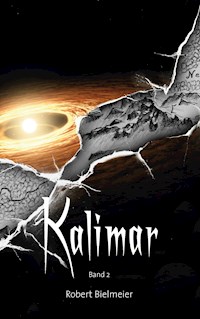
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dem Berg Negroban waren die Gefährten in letzter Sekunde entkommen. Er hatte ihnen nochmals verdeutlicht, dass Kalimar ein Planet voller Gefahren und unbekannter Wesen war. Mephistos Macht war allgegenwärtig, seine Gier tödlich und von Ungeduld getrieben – und so ließ er seinen mächtigsten Vasallen auferstehen: Sangul, den roten Fürsten. Die Mission der Weggefährten wird zur Flucht und die Hoffnung Tassilo zu retten, versickert wie ein Rinnsal im Sand. Bald schon fordert die erbarmungslose Hatz ein erstes Opfer. Ihre Freundschaft und ihr Vertrauen geben ihnen den Funken Hoffnung, der sie nicht verzagen lässt. Ein zerbrechliches Netz, geflochten aus Liebe und Mut, ist alles was ihnen bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Lara & Leo
Den Berg Negroban waren die Gefährten in letzter Sekunde entkommen. Er hatte ihnen nochmals verdeutlicht, dass Kalimar ein Planet voller Gefahren und unbekannter Wesen war.
Mephistos Macht war allgegenwärtig, seine Gier tödlich und von Ungeduld getrieben – und so ließ er seinen mächtigsten Vasallen auferstehen: Sangul, den roten Fürsten.
Die Mission der Weggefährten wird zur Flucht und die Hoffnung Tassilo zu retten, versickert wie ein Rinnsal im Sand. Bald schon fordert die erbarmungslose Hatz ein erstes Opfer. Ihre Freundschaft, ihr Vertrauen zueinander, ist der Funken Hoffnung, der sie nicht verzagen lässt. Ein zerbrechliches Netz, geflochten aus Liebe und Zärtlichkeit, ist alles was ihnen bleibt.
Inhaltsverzeichnis
Dämonenjäger
Baumsänger
List
Brainswick
Frida
Drachensteig
Neues Land
Kabaros
Erde
Epilog
Wichtige Personen:
1. DÄMONENJÄGER
Wir sind, was uns bestimmt ist!
So schnell sie konnten liefen sie den Abhang hinab. Ihre Hoffnung, vor der Reiterschar den Wald zu erreichen, trieb sie voran. Doch wieder war es die mangehafte Kondition von Cruz, die ihre Flucht deutlich verlangsamte.
„Komm schon! Nur noch bis zum Wald. Wir müssen uns dort verstecken, bevor sie den Hügel erreicht haben“, feuerte Tschaisn ihn an und zog Cruz am Oberarm mit sich. Nervös blickte Tschaisn sich um. Endlich schien das Glück auf ihrer Seite zu sein. Noch keiner von den unbekannten Reitern hatte die Hügelkuppe erreicht.
Ohne Vorwarnung blieb Solei stehen. Scipio, der direkt hinter ihr gelaufen war, konnte ihr nur mit Mühe ausweichen. Mit starrem Blick fixierte Solei den Waldrand.
„Dort lauert etwas. Ich kann es spüren“, flüsterte sie.
„Die Bosporans?“, mutmaßte Seraphine. Sie zückte ihren Stock und ließ ihren Blick über die Baumgrenze gleiten.
Solei nickte. „Ich kann keinen von ihnen sehen, aber ich weiß, dass sie sich dort verstecken.“ Sie griff in ihre Tasche und holte die Schleuder hervor.
Scipio sah sie als Erster. „Seht, dort“, rief er und zeigte auf sechs Gestalten, die im Abstand von fünfzig Metern aus dem Unterholz traten. Dieses Mal waren die Bosporans bewaffnet, jeder von ihnen trug einen silbrig glänzenden Krummsäbel. Drei kurze Schnalzlaute waren zu hören. Sofort wechselten die Bosporans in einen federnden Laufschritt.
„Was jetzt?“, fragte Seraphine und blickte Tschaisn unsicher an.
„Wir brauchen Schusswaffen!“, stellte Cruz nüchtern fest. „Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Eine gute alte 45er Magnum und ich würde den Typen ihre hässlichen schwarzen Schädel wegblasen.“
„Lass stecken und zaubere lieber ein Maschinengewehr oder eine Flak aus deiner Trickkiste“, bemerkte Scipio und wies mit der Hand den Hügel hinauf. Mehr als zwanzig Reiter hatten sich auf dem Bergkamm formiert.
„Alter, die Jungs sind nicht zum Kuchenbacken hier“, rief Tschaisn und ein kalter Schauer lief ihm den Rücken hinunter. Auf dem Hügel stand eine Streitmacht, die Tolkiens Orks standgehalten hätte. Groß gewachsene, vom Wind und Wetter abgehärtete Männer, die meisten von ihnen mit asiatischen Einschlag. Lange schwarze Haare zierten ihre Köpfe, manche zu Zöpfen geflochten, andere frei im Wind wehend. Ihre drahtigen, muskulösen Oberkörper glänzten in der Sonne. Ein ungeduldiges Wiehern hallte über die Steppe. Die sehnigen Pferde der Krieger tänzelten nervös und ließen sich nur mit Mühe zurückhalten. So stellte Tschaisn sich Dschingis Khans Mongolen vor. Mochten sich die Männer äußerlich gleichen, trugen sie doch die unterschiedlichsten Waffen. Bogen, Streitäxte, Lanzen, Krummsäbel, Kurzschwerter, Armbrüste oder Hellebarden. Zusätzlich besaß fast jeder von ihnen ein kleines Schild mit Eisendorn. Tschaisn fiel auf, dass die Krummsäbel der Krieger denen der Bosporans glichen. „Verdammt, die Bosporans“, rief Tschaisn und wirbelte herum. Die sechs Dämonen befanden sich nur noch fünfzig Meter von ihnen entfernt. Sie waren stehen geblieben und starrten zu der zahlenmäßig überlegenen Kriegerschar hinauf.
„Interessante Konstellation“, befand Cruz und blickte zwischen ihren Verfolgern hin und her. „Jetzt fehlt nur noch Graulim, dann haben wir all unsere Feinde glücklich vereint.“
Keiner lachte.
„Ich bin für Flucht“, befand Scipio. „Finde keinen von denen sehr einladend.“
„Wartet“, rief Solei, „da tut sich etwas.“
Tschaisn nickte, „Wenn sich zwei streiten …“
Tatsächlich hatten sich einige der Reiter in ihren Sätteln aufgerichtet und zeigten aufgeregt auf die sechs Bosporans. Manch einer hob sein Schild und trommelte mit seinem Schwert dagegen. Der Anführer, ein Riese mit hüftlangem Haar, hob seine Streitaxt in die Höhe und stieß einen schrillen Schrei aus. Seine Krieger taten es ihm gleich und gaben ihren Pferden die Sporen. Im donnernden Galopp rasten sie den Abhang hinab – direkt auf Tschaisn und seine Weggefährten zu.
„Wir müssen aus der Schusslinie“, schrie Tschaisn, „mir nach!“ So schnell sie konnten rannten sie davon. Die Bosporans reagierten sofort. Mit großen Sätzen jagten sie ihnen hinterher. Auch die Mongolenreiter änderten ihre Richtung. Von oben betrachtet verhielt es sich wie ein Dreieck, dessen Spitze Tschaisn und seine Gefährten bildeten. Von unten rasten ihnen die Bosporans entgegen, von oben die säbelschwingenden Horde der Mongolenreiter. Schon nach wenigen Metern war klar, dass die Bosporans sie einholen würden, bevor die Reiterschar einschreiten konnte.
„Vorsicht Cruz!“, schrie Tschaisn. Der schnellste Dämon war nur noch fünf Meter hinter Cruz. Tschaisn wirbelte herum, um Cruz beizustehen, doch Solei war bereits stehen geblieben und hatte sich umdreht. Ihre Schleuder blitzte auf. Ein dumpfer Laut und der Bosporan überschlug sich mehrmals. Direkt vor Cruz, der wie versteinert zugesehen hatte, blieb er liegen. Tschaisn war mit drei schnellen Sätzen bei ihm und zertrümmerte ihr mit einem gezielten Faustschlag die Kehle.
„Vorsicht!“, schrie Seraphine, doch es war zu spät. Aus dem Augenwinkel nahm Tschaisn einen Schatten wahr. Bevor er reagieren konnte, traf ihn der Fuß eines Bosporans. Die Wucht des Schlages schleuderte ihn mehrere Meter durch die Luft. Er wusste sofort, dass die Kreatur ihm mehrere Rippen gebrochen hatte. Brutal schlug er auf den Boden auf. Wieder knackte es und ein stechender Schmerz schoss durch seine Brust. Nach Atem ringend blieb er im Gras liegen. Sekunden später stand der Bosporan breitbeinig über ihm. Seine Augen funkelten rot und mitleidslos. Dann beugte er sich nach hinten, wie eine Schlange, bevor sie zubeißt. Im nächsten Moment schnellte sein Kopf nach vorne und aus seinem Mund schoss ein glühender Feuerstrahl. Tschaisn konnte sich gerade noch wegdrehen und so traf ihn der siedend heiße Atem des Dämons nur an der Schulter. Der wolfsähnliche Fuß des Bosporans schnellte nach vorne und presste Tschaisn flach auf den Boden. Das war’s, dachte er erschöpft, als er den Krummsäbel im Sonnenlicht aufblitzen sah. In diesem Moment flog ein Schatten über ihn hinweg und der Dämon wurde nach hinten geschleudert. Lautlos, mit der Wut der Verzweiflung, hatte sich Seraphine auf die Kreatur gestürzt. Ihr geliebter Stock wirbelte wie eine entfesselte Furie durch die Luft. Der Bosporan, der mit dem Krummsäbel anscheinend nicht besonders gut umgehen konnte, warf ihn weg und wehrte Seraphines Schläge geschickt mit seinen kräftigen Unterarmen ab. Inzwischen hatte der nächste Dämon sie erreicht, packte Seraphine von hinten und schleuderte sie zu Boden. Katzengleich rollte sie sich ab. Scipio und Solei tauchten neben ihr auf. Tschaisn lag bewegungslos am Boden und blickte sie mit glasigen Augen an. Cruz stand wie gelähmt hinter ihnen, unfähig sich zu bewegen. Seraphine stieß einen Schrei aus und rannte mit erhobenem Stock auf die Dämonen zu; Scipio und Solei folgten ihr. Es war ein ungleicher Kampf, bei dem es nur darum ging, die Kreaturen von Tschaisn fernzuhalten. Während Seraphine mit zwei Dämonen auf Leben und Tod kämpfte, hatte Scipio es irgendwie geschafft, einen von den Bosporans mit einem Würgegriff am Boden zu halten. Ein anderer hatte Solei gepackt und sie sich unter den Arm geklemmt. Er streckte eine Hand nach oben und wollte gerade die Beschwörung sprechen, als Solei mit beiden Händen sein Gesicht packte und ihn zwang, sie anzusehen. Unwirsch riss er seinen Kopf weg, doch dann zögerte er einen Moment. Seine Augen, die bereits wieder himmelwärts gerichtet waren, kehrten nochmals zu Solei zurück. Mitten in seiner Beschwörung hielt er inne. Sein Gesicht erstarrte und verwirrt blickte er sie an. Vorsichtig strich Solei mit den Fingern über sein Kinn, ganz zart, fast ohne ihn zu berühren. Der Bosporan starrte sie mit großen Augen an und ein Seufzer entrang sich seiner Kehle. Sein Griff lockerte sich und Solei glitt zu Boden.
In diesem Moment ertönte ein schriller, markerschütternder Schrei und etwas großes Silbernes rotierte durch die Luft. Die schwere Axt war perfekt geworfen. Lautlos enthauptete sie den Bosporan.
„Neiiiinnn“, schrie Solei und sah hilflos mit an, wie der leblose Körper des Dämons zu Boden fiel und sich in einem Lichtblitz auflöste.
Verzweifelt schüttelte sie den Kopf und schluchzte.
Der Anführer der Mongolenreiter sprengte herbei, beugte sich aus seinem Sattel und hob geschickt seine Axt vom Boden auf. Kämpferisch blickte er auf das am Boden kniende Mädchen. Als er sah, dass sie nicht verletzt war, riss er sein Pferd herum, um sich wieder ins Kampfgetümmel zu stürzen. In diesem Augenblick sprang einer der Bosporans mit einem mächtigen Satz auf das Schlachtross des Mongolenfürsten. Seine klauenbesetzte Hand umfasste den Kopf des Mannes und bohrte sich in dessen Schädel. Mit der anderen Hand entwand er ihm die Streitaxt, warf sie zu Boden und trieb dem Pferd seine Wolfsfüße in die Flanken. Wie von einer Tarantel gestochen, galoppierte das panische Tier davon. Noch immer hielt der Dämon den Kopf des Mongolenfürsten umklammert. Seine vor Entsetzen geweiteten Augen starrten auf die krallenbewährte Klaue, die sich langsam in seinen Brustkorb bohrte.
Zufrieden grollte der Dämon, als er den rasenden Herzschlag des Mannes spürte.
Der Mongolenfürst schrie auf und sein Hemd färbte sich blutrot. Der Bosporan brüllte ein abscheuliches Lachen und warf den Kopf nach hinten. Plötzlich verstummte er und ein gurgelndes Röcheln entrang sich seiner Kehle. Wie von einer unsichtbaren Faust getroffen, stürzte der Dämon samt dem Fürsten rittlings vom Pferd. Schwer schlugen sie auf dem Boden auf. Das Schlachtross wieherte panisch und verschwand im Wald. Der Bosporan hatte den Mongolenfürsten losgelassen und lag röchelnd auf dem Rücken. Aus seinem Schlund ragte der Schaft eines roten Pfeils.
Der schwer verletzte Fürst lag stöhnend im Gras und versuchte sich mühsam aufzuraffen. Vergeblich, unfähig, sich zu bewegen, beobachtete er den Dämonen. Dessen Lebensgeister waren noch nicht erloschen. Mühsam richtete er sich auf und krabbelte auf allen vieren auf den Fürsten zu. Unsägliche Geräusche von sich gebend, kam er immer näher. Der Fürst erschauderte. Unter Aufbietung all seiner Kräfte gelang es ihm, sich aufzurichten. Doch ein brutaler Hieb des Bosporans streckte ihn erneut nieder.
„Genug gespielt“, ertönte eine scharfe Stimme. Ein Stiefel wirbelte durch die Luft und traf den Dämon im Gesicht. Der Pfeil brach und der Bosporan wurde auf den Rücken geschleudert. Vor ihm stand ein Mädchen, dessen langes, blondes Haar zu einem kunstvollen Zopf geflochten war. Sie trug eine wildlederne Hose, ein grobes, baumwollenes Hemd und hielt einen fein gearbeiteten Bogen in der Hand. In ihrem Gürtel steckten eine Peitsche und ein langer Dolch. Ihre strahlend blauen Augen blickten abschätzend zwischen den beiden am Boden kauernden Kontrahenten hin und her.
„Seid ihr ein Dämonenjäger?“, fragte sie den schwer atmenden Mongolenfürsten.
Dieser nickte und versuchte sich unter Stöhnen aufzusetzen.
„Dann solltet ihr in Zukunft vorsichtiger sein“, befand die junge Frau.
Mit einer fließenden Handbewegung zog sie ihre Peitsche aus dem Gürtel und ließ sie durch die Luft schwirren. Ein geschickter Hieb und das lederne Ende hatte sich um die Hände des Dämons gewickelt. Hilflos lag er am Boden.
Das blonde Mädchen ging zu der röchelnden Kreatur und strich ihr zärtlich über die Stirn.
„Es wird Zeit für dich zu gehen. Die Freiheit wartet auf dich.“
Die roten Augen des Bosporans blickten sie forschend an, ein Rucken ging durch seinen Kopf und eine kleine blaue Blase entwich seiner Stirn. Nachdenklich betrachtete das Mädchen die Blase, überlegte, ob sie sie zerstören sollte, entschied sich jedoch dafür, sie ungehindert aufsteigen zu lassen. Dann stand sie auf, zog ihren Dolch aus der Scheide und hielt ihm den Mongolenfürsten hin.
„Ich töte nur, wenn ich muss. Dämonenjäger, er gehört euch. Macht es kurz, er hat genug gelitten.“
Ungläubig starrte der Fürst das Mädchen an. „Ihr wollt ihn mir wirklich schenken?“
Sie nickte. „Ich weiß, dass ihr euch reiche Belohnung von jedem getöteten Dämonen versprecht. Doch ich strebe nicht nach dieser Art von Reichtum und jetzt beeilt euch, sonst kommt euch euer Tod zuvor.“
Der Fürst blickte auf sein blutdurchtränktes Hemd und seufzte. Schwerfällig griff er nach dem Dolch und robbte zu dem Dämonen hinüber.
„Denkt daran, er soll schnell die Freiheit erlangen!“, betonte das Mädchen nochmals und wandte sich ab.
Der Mongolenfürst nahm all seine Kraft zusammen und rammte den spitzen Stahl in das Herz der wehrlosen Kreatur. Diese bäumte sich auf und ein langgezogener letzter Atemzug entwich seiner Lunge. Ein Lichtstrahl und der Bosporan war entschwunden.
Als das Mädchen sah, dass der Bosporan von ihnen gegangen war, pfiff sie eine kurze melodische Melodie und aus dem Wald trottete ein prächtiger Rappe.
„Steht auf“, forderte sie den Fürsten auf und reichte ihm die Hand. Mit letzter Kraft und der Hilfe des Mädchens schaffte er es auf den Rücken des Pferdes.
„Bescheuerte Rennerei“, hechelte Cruz und ließ sich ins Gras neben Tschaisn fallen. „Da nützt mir mein ganzes Superwissen nichts, wenn ihr mich zu Tode hetzt.“
„Cruz, bitte“, flehte Seraphine, die hinter Tschaisn kniete und seinen Kopf in ihren Schoß gebettet hatte, „hilf ihm, bevor es zu spät ist.“
Cruz schaute Seraphine wütend an, dann blickte er auf Tschaisn hinunter. Einen Augenblick rang er mit sich, dann wandte er sich an Seraphine: „Ich tue es nicht für dich, du schuldest mir also gar nichts.“
„Ich …“, erwiderte Seraphine.
„Halt den Mund“, unterbrach er Seraphine und legte beide Hände auf Tschaisns Brustkorb.
Dieser schaute ihn aus halb geschlossenen Lidern an. Ein dünnes Lächeln umspielte für einen Moment seine Lippen, dann verlor er das Bewusstsein.
„Umso besser“, befand Cruz und fing sofort mit dem Heilgesang an. Tschaisn stöhnte mehrmals auf, als sich seine Rippen mit leisem Knacken wieder zusammenschoben und zu heilen begannen; seine Ohnmacht bewahrte ihn vor weiteren Schmerzen.
Ein paar der Dämonenjäger kamen näher und beobachteten Cruz aufmerksam. Vereinzelt murmelte einer von ihnen etwas oder nickte anerkennend. Während Cruz sang, strömte blaues Licht aus seinen Händen und umspielte Tschaisns Brust.
Die Reiterschar hatte die Bosporans niedergerungen, jedoch vier Mann verloren. Respektvoll blickten sie auf Seraphine, die noch immer bei Tschaisn kniete und seinen Kopf hielt. Sie hatte gekämpft wie eine Löwin, wäre aber verloren gewesen, wenn nicht einer der beiden Bosporans von ihr abgelassen hätte um seinen beiden Artgenossen gegen die Dämonenjäger beizustehen. Scipio hatte irgendwann den Bosporan nicht mehr im Würgegriff halten können. Kaum hatte sich die Kreatur befreit, stürzten sich sogleich ein paar der Dämonenjäger auf sie. Es war ein ungleicher Kampf. Als nur noch Seraphines Dämon am Leben war, bildeten die Krieger einen Kreis um die beiden und beobachteten schweigend den verbissenen Kampf. Bosporans verfügen über fast unendliche Energie und haben so gut wie kein Schmerzempfinden. Sie verlieren Kämpfe, weil Körperteile nicht mehr funktionieren, nicht weil sie geschwächt sind. Seraphine konnte sich den Dämon vom Hals halten, ihn jedoch tödlich mit dem Bokken zu verletzen, gelang ihr nicht. Als Seraphine bemerkte, dass sie sich den wütenden Angriffen ihres Gegners nicht mehr lange erwehren konnte, bat sie einen verwegen dreinblickenden Dämonenjäger, den Kampf für sie weiterzuführen. Dankbar und ohne zu zögern, griff er den Bosporan an.
„Diese Wunde wirst du so nicht schließen können“, ertönte eine Stimme hinter Cruz, der bereits mehrmals vergeblich versucht hatte, Tschaisns verbrannte Schulter zu heilen. Hinter ihm stand ein junger, ausgezehrter Mann mit leuchtend blauen Haaren. Er war nur mit einer Hose bekleidet, stützte sich auf einen hölzernen Stab und hatte einen speckigen Beutel umhängen. Seine braun gebrannte Brust war von zahlreichen Narben bedeckt.
„Faun“, schrie Solei, sprang auf und fiel ihrem ehemaligen Meister um den Hals.
„Faun, wie gut, dass du hier bist“, wiederholte sie und fuhr ihm mit den Fingern durch sein wunderschönes blaues Haar. Aber das war nicht der alte Faun, wie sie ihn von Noris kannte. Sorgenvoll betrachtete sie sein abgemagertes Gesicht. Seine ehemals leuchtenden Augen lagen müde in dunklen, tiefen Augenhöhlen.
„Solei, Kämpferin des Lichts, auf der Jagd, um zu retten die Nacht“, sagte er leise und drückte ihr einen zarten Kuss auf die Hand. „Ich freue mich, dich wohlauf zu finden. Wie ich sehe, bist du nicht mehr alleine.“
„Du siehst müde aus, Faun. Was ist passiert?“, überging sie besorgt seine Frage.
„Ein guter alter Bekannter wollte mich sehen – ich ihn aber nicht. Aber lass gut sein, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wie erging es dir auf Noris, nachdem ich gegangen bin?“, fragte er, und Solei konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass nichts in Ordnung war. Aber sie kannte Faun gut genug, um zu wissen, dass er alle Fragen diesbezüglich nicht beantworten würde.
„Halt dich fest, Faun, es ist so viel passiert, nachdem du gegangen bist. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe mich mit Lurchi angefreundet.“
Erwartungsvoll schaute sie ihn an, doch Faun schien nicht überrascht zu sein.
„Du hast viel gelernt, meine kleine Sonne. Lurchi hat dir gezeigt, dass das scheinbar Böse immer auch ein gutes Gesicht hat. Merke dir diese Lektion und vergesse sie nie!“
„Weißt du, wie es Lurchi geht?“
Ein dunkler Schatten flog über Fauns gütiges Gesicht. „Ich fürchte, ich habe mich getäuscht. Lurchi ist tot.“
„Was?“, schrie Solei auf. „Du hattest doch gesagt …“
„Pan hat ihn wenige Tage nach deiner Abreise aufgesucht. Der gute alte Lurchi hat sich geweigert, ihm dienlich zu sein. Die Erinnerung an dich war ihm mehr wert als sein Leben.“
„Wer ist Pan?“, schluchzte Solei und merkte, wie es ihr den Hals zuschnürte.
„Pan ist der gehörnte Mann, der, den ihr Teufel nennt.“
„Dann ist er jetzt endgültig gestorben?“, schluchzte Solei und ein paar Tränen stiegen in ihr hoch.
Liebevoll legte Faun seine Hände auf Soleis Wangen. „Weine nicht, Solei. Lurchi war sehr, sehr alt und es war an der Zeit, dass er in das allumfassende Sein zurückkehrt. Sei versichert, dass er jetzt glücklich ist und eine unschätzbare Erfahrung zum universalen Bewusstsein beigetragen hat. Er ist so viele Tode gestorben, jetzt darf er endlich sein.“
„Wer ist das?“, fragte Scipio skeptisch, der plötzlich neben Solei stand.
„Ein guter Freund, Scip. Ein wirklich guter Freund.“
Mit einem gutmütigen Lächeln verneigte sich Faun. „Namaste. Sei gegrüßt.“
„Namaste irgendwas. Vermute, ihr habt im letzten Leben miteinander rumgemacht?“
Faun lachte laut auf. „Ja, das kann man so sagen.“
„Seht“, schrie plötzlich einer der Dämonenjäger und wies mit seinem Speer nach Norden. Aus dem Wald war ein Rappen getreten, der von einer schlanken Frau an den Zügeln geführt wurde. Sie trug einen Bogen und auf dem Pferd kauerte ein Mann, der sich nur mit Mühe im Sattel halten konnte. Die Krieger stellten sich im Halbkreis auf und hielten ihre Waffen bereit. Als die Fremde nur noch hundert Meter von ihnen entfernt war, richtete sich der Mann im Sattel auf und winkte kraftlos.
„Das ist Brachnar“, rief einer der Männer, und sofort rannten mehrere los, um ihrem Anführer beizustehen.
„Die Brandwunde überlässt du mir“, befahl Faun an Cruz gewandt. „Hier ist Magie im Spiel. Sobald ich Brachnar versorgt habe, komme ich zurück“, sprach er und lief davon.
Im Nu waren die ersten Krieger bei Brachnar angekommen und hoben ihn behutsam aus dem Sattel. Faun beugte sich über den Mongolenfürsten und fing sogleich mit der Behandlung an. Seine Hände wanderten über die Brust des Fürsten und eine liebliche Melodie war zu hören. Brachnar stöhnte.
Das blonde Mädchen stand einen Moment neben Faun und beobachtete ihn, dann wandte sie sich ab, nahm ihren Rappen am Zügel und hielt direkt auf Solei und ihre Gefährten zu.
„Wer ist das?“, fragte Seraphine und blickte der jungen Frau neugierig entgegen.
„Ihr Anführer“, meinte Scipio. „Ich habe gesehen, wie ihn einer der Bosporans angegriffen hat. War nicht gesund, was der mit ihm angestellt hat. Vermute, das Mädchen hat ihn gerettet.“ „Ich meine das Mädchen“, wiederholte Seraphine. „Wer ist sie?“
Aufrecht und mit stolzem Blick schritt das blonde Mädchen, ihr Pferd am Zügel führend, an den wartenden Dämonenjägern vorbei. Neugierige Blicke musterten sie. Einige Rufe erklangen. Als einer der Männer vortrat, um ihr den Weg zu versperren, starrte er unvermittelt in die Pfeilspitze ihres Bogens. Schneller als man blinzeln konnte, hatte sie ihren Bogen gezückt. Sofort erhob sich ein wütendes Gemurmel. Unbeeindruckt stand die junge Frau mit gespanntem Bogen vor dem Krieger, der sie aufhalten wollte; die Spitze ihres Pfeils nur wenige Zentimeter von seiner Stirn entfernt.
Die Situation wäre wohl eskaliert, hätte der Dämonenfürst nicht einen weithin hörbaren Befehl geschrien. Er hatte sich aufgerichtet, während Faun sein Gesicht verarztete.
Seine Männer wichen zurück und gaben den Weg frei. Mit einer kaum sichtbaren Bewegung verschwanden Pfeil und Bogen hinter dem Rücken der Blonden. Ruhig ging sie weiter, direkt auf Solei und ihre Freunde zu.
--
Neiiinnn, das Erwachen mir zerstört den zarten Traum des Glücks. Eile zurück ins Reich der Träume, will ihn festhalten, nur einen Augenblick. Vergebens, fort ist er. Zerflossen wie Wasser zwischen den Fingern.
Warum? Warum nur Gedanken, fort mit euch. Ewige Finsternis aus Leid und Grauen; bevor ihr kamt, mir ein Lichtschein ist erschienen. Eine Stunde seliger Schlaf pro Tag ist mir vergönnt. Könnt ich nur schlafen jahrelang. Schwarz wie die Nacht, traumlos, ich bin’s gewohnt. Doch heute mir ein Traum erschien. Welch für ein Gefühl ich empfand. Neu, noch nie empfundenes Verlangen. Nicht ich war das Wollen, es lag außerhalb. Verwirrt, verwirrend, was geschieht mit mir? Solei, du warst bei mir. Kann’s sein? Zartes Geschöpf, dein Herz mich füllt, mich nährt. Angst, Angst in mir, sie zu verlieren. Schon oft ich dachte an Erlösung. Zartes Weib, du ewig bist mir ein Verlangen. Doch immer wenn ich nach der Frauen Seelen griff, war die Labsal mir wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Gäbe es auch nur einen Augenblick des Glücks für mich, nähme ich jedes Leid in Kauf. Sehne mich danach, endlich einmal satt zu sein, doch mein Hunger hört nie auf.
Und jetzt? Im dunklen, schwarzen Schlaf besuchte mich ihre Seele. Noch nie mir dieses widerfuhr. Durch ihre Augen ich die Welt gesehen. Welch Glück, als ich ihre Freunde sah – ein Herz plötzlich in mir schlug.
Ich könnte heulen ob des Pochens in meiner Brust. Ein Schlag wie Erfüllung, zwei Schläge Sehnsucht in mir weckt, drei Schläge ein Leben ohne Hass, ohne Gier – ohne Verlangen.
Der Hunger hört nie auf. Was ich gefühlt – allein des Worts Bedeutung mich schreckt – was ich gefühlt, galt nicht mir! Es galt den anderen. Den anderen? Der Blick nach draußen, vielleicht der Schlüssel ist? War’s Liebe – diese ewig Verlockende, ich nie durfte sie spüren – die mich verzauberte. Solei, Mädchen jung und rein – deine Seele soll meine sein. Ich muss sie finden, jetzt sofort!!
Mit donnerndem Schritt er aus dem Saale schreitet, das Fundament erschauert. Alles Leben sich versteckt.
„Orfus“, die Hand ins Feuerbecken tauchend, er verlangt nach dem Knecht. Brüllt im Geiste und zählt die Sekunden.
Mit einem Schlag der Gerufene vor ihm steht. Tief das Haupt sich gegen den Boden neigt.
Verlangen sei gebändigt, er sich ermahnt, was ist mit Orfus?
Ich sehe Schuld.
„Sprich“, er gefährlich flüstert.
Eine Gedankenblase er ihm reicht. Der Fürst sie nimmt und den Finger in sie bohrt.
Momente des Grauens für Orfus, der geknickt vor dem Fürsten kauert und wartet.
„Alle tot! Sechs Diener verloren und nichts gewonnen. Wo war er selbst als es geschah?“
„Meister, Negrobran ist groß. An beiden Ausgängen haben wir gewacht. Doch war es nötig, uns aufzuteilen. Ich war am falschen Ort und erwarte meine Strafe.“
„Sie wird dich ereilen“, er brüllt und schon den Stab erhoben hat. Doch was ist das? Er greift sich an die herzlose Brust und blickt umher, als ob er jemand suchen würde. Außer Orfus ist niemand im Raum.
„Argghh“, er fletscht, die Welt sich verkehrt. Ein Gefühl ward noch in seiner Brust. Verloren, doch verändernd.
„Nun gut, Orfus “, stöhnt er voll Bedauern. „Du kannst nicht überall sein. Hole die andern drei herbei!“
Orfus ungläubig zu seinem Meister starrt. Keine Strafe? Schnell er handelt wie befohlen.
Drei Donner erklingen. So stehen sie zu viert vor ihm, die Blicke gesenkt.
Der Meister seinen Stab erhebt und mächtige Worte spricht.
„Ignis tenebrae – erwache und gehorche mir – Ignis, lodere hell. Kämpfe für meinen Seelenfrieden.“
Ein Spalt sich auftut und verschlingt Orfus. Ein Schreien, lichter Quell, erklingt. Die Minuten verrinnen, dumpfes Grollen ertönt, Schaudern gefriert. Mit einem Mal ein Wesen aus der Tiefe kriecht. Ein Bosporan wie all die anderen vor ihnen steht – nur die Farbe seiner Haut hat sich verändert und ein langer schwarzer Umhang ihn bedeckt. Glühend rot sein Widerschein, die Halle blutig färbt.
„Sangul, führe aus, was ich dir befohlen. Das Mädchen muss ich haben. Suche und bringe sie mir, jetzt hast du die Macht. Diese drei Bosporans dir zu Diensten sind.“
Das mächtige Wesen sich kurz orientiert, kalt sein Blick mit glühenden Pupillen. Ein Donner, gewaltiger als alles zuvor, und der Meister bleibt allein zurück.
--
Inzwischen war Tschaisn wieder zu sich gekommen. Bis auf seine Schulter, die höllisch brannte, fühlte er sich gut. Vorsichtig betastete er seinen Brustkorb. Keine Schmerzen. Dankbar wandte er sich an Cruz: „Was würden wir ohne dich machen, Alter. Das mit dem Heilen hast du echt drauf. Wie
funktioniert das eigentlich?“
„Quantenphysik. Alles lässt sich auf die kleinste Einheit reduzieren. Wer heilen will, muss nach der Ursache suchen, sie erkennen und beheben. Das ist das Dilemma der Schulmedizin, sie bekämpft in den meisten Fällen nur die Wirkung und schert sich einen feuchten Kehricht um die Ursache. Hast du Knieschmerzen, bekommst du Schmerzmittel und/oder Hyaluron gespritzt, eine ursachenorientierte Betrachtungsweise mit entsprechender Therapie findet selten statt. Symptombeseitigung ist das Schlagwort – Schmerzmittel, Spritze oder Operation das Mittel der Wahl. Allerdings ist diese Vorgehensweise dem Wirtschaftsprinzip von Angebot und Nachfrage geschuldet. Wer will denn heute noch lange warten, bis er wieder gesund ist? Wobei gesund hier die falsche Nomenklatur ist – es müsste wohl eher Beschwerden-Management heißen. Pille eingeworfen, Spritze gesetzt, Beschwerden verschwunden – Ursache bleibt!“
„Cruz“, monierte Linus, „komm zum Punkt!“
„Hey Scipio, wenn der Kuchen spricht, hat der Krümel zu schweigen.“
„Leck mich!“
„Alles zu seiner Zeit, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Scip, jetzt ist Bildung angesagt. Also, wo war ich stehen geblieben – ach ja, Ursachenheilung. Jedes Atom hat eine Eigenfrequenz, jede Zelle einen Grundtakt, in dem sie schwingt. Wird dieser gestört oder verändert, erkranken wir. Einwirkungen von außen, wie zum Beispiel ein Messerstich, unterbrechen den harmonischen Energiefluss in unserem Körper. Heilung bedeutet, dass die Harmonie wiederhergestellt wird. Die getrennten Zellen einer Hautpartie verbinden sich wieder, weil die Trägerfrequenz der sie umgebenden Hautpartikel sie langsam anpasst. Es geht also darum, diese Symbiose zu beschleunigen. Medizin kann manchmal heilen, weil die Wirkstoffe des Präparates in einer ähnlichen Frequenz wie der Urtakt des kranken Organs oder Gewebes schwingen. Heilgesang bedeutet Behandlung auf feinstofflicher Ebene. Die Kunst ist, verschiedene Obertöne zu überlagern und die dem erkrankten oder verletzten Organ entsprechende Frequenz anzuschlagen. Doch ist es beileibe nicht damit getan, einen Oberton zu senden. Unser Körper ist wesentlich komplexer und besteht aus ungefähr zehn hoch siebenundzwanzig Atomen. Jedes Atom hat seine eigene Schwingung. Gott sei Dank müssen wir nicht die Atome justieren, sondern nur die Zellen, und deren Anzahl ist weit geringer. Ihr könnt euch das wie folgt vorstellen: Wenn der Vorstand von BMW beschließt, dass in Zukunft alle neuen Modelle mit Vierradantrieb gebaut werden, muss er diese Anweisung nicht bis in die kleinste Fertigungseinheit transportieren. Es reicht, wenn er es ein paar Direktoren mitteilt, die werden eigenständig dafür sorgen, dass die Information weitergegeben wird. Genauso verhält es sich mit den Zellen.“
„What a cheese you are talking!”, fuhr Scipio dazwischen.
„Gibt es unterschiedliche gute Heiler?“, wollte Solei wissen, die an Faun dachte und wie er die von Lurchi verursachten Wunden geschlossen hatte.
„Der Meistergrad eines Gesangheilers ist seiner Fähigkeit geschuldet, wie viele Obertöne er überlagernd singen und wie fein er ihn organspezifisch steuern kann.“
„Wie viele Töne kannst du überlagern?“, wollte Seraphine wissen.
„Zwölf, was ungefähr der Heilkraft der Bezirksliga entspricht. Die Blauelfen spielen in der Weltauswahl und die besten von ihnen sind in der Lage, um die fünfzig Obertöne zu überlagern.“
„Dann bist du ja nicht mal Mittelmaß!“, stellte Scipio mit einem schadenfrohen Grinsen fest.
„Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge, wie Thomas Mann zu sagen pflegte. Lieber Scipio, ich werde mich an deine Bemerkung erinnern, wenn einer der Bosporans dir den Arsch aufgesäbelt hat und du mich anwinselst, dass ich dir helfen soll.“
Das saß. Scipio lag eine passende Antwort auf der Zunge, aber um Cruz nicht an seine Androhung zu binden, zog er es vor zu schweigen.
„Wer ist das?“, meldete sich Solei und erlöste Scipio von seinem Bestreben, eine unverfängliche Antwort zu finden.
„Lara Croft besucht uns“, erwiderte Seraphine und erhob sich.
Ein paar Meter vor ihnen blieb das blonde Mädchen stehen. Ihr Rappe tänzelte unruhig. Mit einem strengen Blick betrachtete sie jeden einzelnen von ihnen. Bei Tschaisn und Seraphine verweilte er am längsten. Unvermittelt stand Solei auf und ging auf das Mädchen zu. Sofort war Scipio neben ihr.
„Sei vorsichtig!“
„Ist schon gut“, beruhigte ihn Solei und schob Scipio beiseite.
„Mögen mich meine Augen täuschen, mein Herz tut es sicherlich nicht“, flüsterte sie und umarmte die Kriegerin. Sofort verschwand deren ernster Gesichtsausdruck und freudig drückte sie Solei an sich. Die anderen blickten sich verwundert an.
„Schon wieder Besuch aus Noris?“, rief Scipio. „Bei dir war ja echt was geboten. Ich hatte nur blöde Karnickel.“
Solei löste sich aus der Umarmung und wandte sich freudestrahlend an Cruz.
„Darf ich vorstellen – deine große Schwester ist zurückgekehrt.“
Schweigend erhob sich Cruz und näherte sich ungläubig seiner Schwester.
„Bist du’s wirklich?“, zweifelte er und versuchte in ihren Augen die Antwort zu finden.
Seine Schwester riss die Augen auf und strahlte ihn lachend an. „Klar Superhirn, ich kann euch die Sache hier doch nicht alleine abräumen lassen.“
„Oh Mann, du bist es wirklich, Ya… äh, sorry. Muss mich erst an Justice gewöhnen“, antwortete Cruz verlegen und fiel seiner Schwester um den Hals. Irritiert erwiderte Justice die Umarmung.
„Hey Brüderlein, was sind denn das für ungewohnte Gefühlsausbrüche. Was habt ihr mit Cruz gemacht?“
Anstatt zu antworten, überschüttete Cruz sie mit Fragen. Justice wiegelte alle ab und wandte sich Tschaisn zu. Dem war nicht gerade wohl in seiner Haut. Er wusste, dass dieses Mädchen einst Yara war, und mochte sich auch ihr Äußeres dramatisch verändert haben, ihre Gefühle für ihn waren vermutlich noch die gleichen. Seraphine stand scheinbar gleichgültig neben ihm, er spürte jedoch, dass sie alles genau beobachtete.
„Hey Tschaisn“, sagte Justice und sie wäre keine Frau gewesen, hätte sie nicht sofort bemerkt, dass sich zwischen den beiden was angebahnt hatte.
„Justice“, erwiderte Tschaisn und umarmte sie vorsichtig. „Ich glaube, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt.“
„Findest du, ich habe das Gefühl, dass ich etwas zu spät gekommen bin“, erwiderte sie mit einem Seitenblick auf Seraphine.
Genervt seufzte Tschaisn. Das Letzte, was sie jetzt brauchen konnten, war ein Beziehungsdrama. Darauf hatte er weder Lust noch war es zielführend. Er wollte die Sache klarstellen, bevor es Ärger gab.
„Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten?“, fragte er und blickte sehr ernst.
„Lass stecken, Tschaisn“, erwiderte Justice und zwang sich ein Lächeln auf. „Was immer da zwischen dir und Seraphine läuft, geht mich nichts an. Ich bin hier, um Tassilo rauszuholen und euch nach Kabaros zu führen; dafür wurde ich ausgebildet.“
Ungläubig erwiderte Tschaisn ihren Blick.
„Ich meine es ernst“, kam ihm Justice zuvor. „Das hier ist keine Dating-Tour, um ein großes Mädchen zu werden und den Eisberg unserer Schule zum Schmelzen zu bringen. Sag mir lieber, was mit deiner Schulter passiert ist. Hat dich ein Bosporan erwischt?“
Justice’ Direktheit überraschte Tschaisn, auch wenn er noch seine Zweifel hatte, beschloss er, ihr zu glauben. Sie hatte sich definitiv verändert, sie alle hatten sich verändert.
„Du bist gut informiert. Eines dieser Viecher hat meine Schulter gegrillt. Was weißt du über sie?“
„Vor allem, dass sie keine Viecher sind. Unterschätze sie niemals!“
„Nun, es war nicht besonders intelligent, uns anzugreifen, wo sie doch die Dämonenjäger, ihre Erzfeinde, gesehen haben.“
„Vielleicht war es unvernünftig, vielleicht auch kühl kalkuliert. Bedenke, kein Tier tut Unvernünftiges, denn dazu gehört Verstand. Lerne sie zu verstehen. Bosporans sind hochintelligent, sie kommunizieren über Schnalzlaute, damit sie keiner verstehen kann. Wogegen sie selbt fast jede Sprache des Universums verstehen; deshalb gib acht, was du in ihrer Nähe von dir gibst.“
„Warum haben sie uns angegriffen und ihr Leben riskiert?“
Justice’ Blick wurde ernst. „Intelligenz in Fesseln ist schlimmer als einfältig, aber frei zu sein. Ein Bosporan denkt nicht darüber nach, welche Konsequenz sein Handeln für ihn bedeutet. Er hat ein Ziel, und auf dieses bewegt er sich mit einer brutalen Effizienz zu. Sein Handeln lässt keinen Spielraum für Versagen. Entweder Erfolg – oder sterben, was übrigens nicht das Schlechteste ist, was diesen Kreaturen widerfahren kann.“
Nachdenklich hob Tschaisn den Kopf. Er dachte daran, wie sie von den Bosporans am Fuße des Berges Negrobran angegriffen wurden. Justice’ Worte erklärten, warum einer der Dämonen über die von Cruz geschaffene Glaswand geklettert war und sich alleine auf sie gestürzt hatte.
„Was hat es mit der blauen Blase auf sich?“, wollte Solei wissen.
„Ich vermute, dass es sich hierbei um ein codiertes Informationsübertragungssystem handelt“, resümierte Cruz.
„Hallo Cruz, wie ich höre, hast du dir dein pseudointellektuelles Geschwafel immer noch nicht abgewöhnt“, bemerkte Justice trocken. „Aber du hast wie so oft recht. Sie speichern in dieser Blase sämtliche aufgenommenen Informationen in Bild und Ton, einschließlich ihrer Überlegungen, die das weitere Vorgehen betreffen. Jedem anderen Bosporan reicht weniger als eine Sekunde, damit er sämtliche Informationen exakt in der Form vorliegen hat wie der Schöpfer der Wissensblase.“
„Woher weißt du das alles?“, fragte Solei.
Justice zögerte einen Moment. „Das war Dads Idee.“
Erstaunt blickten sie alle an.
„Was?“, empörte sich Cruz, doch bevor er fortfahren konnte unterbrach ihn Seraphine.
„Das heißt – wie bitte –, Superhirn.“
Cruz überging Seraphines Bemerkung. „Was für eine Idee?“
„Kurz bevor wir nach Kalimar aufgebrochen sind, hat er mich beiseitegenommen und mich gebeten, zuvor noch eine andere Welt aufzusuchen. Als wir alle zurück waren, wurde ihm klar, dass wir zu wenig Wissen über Kalimar und seine Geschöpfe angesammelt hatten. Während wir durch den Nachmittag gechillt sind, hat er ein weiteres Training für mich vorbereitet. Ich hatte fast zwei Jahre Zeit, mich über Kalimar schlauzumachen.“
„Zwei Jahre“, staunte Seraphine, „aber das würde ja bedeuten, dass es noch eine dritte Zeitebene gibt.“
Justice nickte. „Es gibt unendlich viele Zeitebenen. Vergesst einfach die Größe Zeit, sie ist vollkommen irrelevant. Wir müssen eine andere Bewusstseinsebene erklimmen, um das Universum zu verstehen.“
„Zwei Jahre Theorie stelle ich mir etwas eintönig vor“, befand Tschaisn und blickte auf die Peitsche und das Messer in Justice Gürtel.
„Gut beobachtet. Darf ich vorstellen – Kampinski“, rief Justice und zog mit einer blitzschnellen Bewegung die Peitsche aus ihrem Gürtel. Geschickt ließ sie sie durch die Luft schwirren und bevor Cruz reagieren konnte, hatte sich das Ende der Peitsche um seine Beine gewickelt. Ein kurzer Ruck und er lag flach wie eine Flunder auf dem Boden.
„Hey“, schrie er auf, „lass den Scheiß.“
„Entschuldige Bruderherz, aber das hast du dir in den letzten sechzehn Jahren absolut verdient.“
„Bitte streiche das Wörtchen absolut aus deinem Wortschatz“, lachte Solei. „Darauf sind wir alle etwas allergisch.“
Fragend blicke Justice sie an. Die nächsten Minuten erzählten sie Justice, was bisher vorgefallen war. Gerade als sie bei den Dämonenjäger angelangt waren, stießen Brachnar und Faun zu ihrer Runde.
Der fast zwei Meter große Mongolenfürst schien wieder bei Kräften zu sein. Sein schweres Leinenhemd war blutgetränkt und fünf wulstige, frische Narben zogen sich über die rechte Seite seines Schädels. Zusammen mit einem grausamen Schmiss, der sich vom linken Ohr bis zu seinem Kinn zog, machte er einen mehr als furchterregenden Eindruck.
„Brachnar ist mein Name, wie darf ich euch nennen, Kriegerin?“, wandte er sich an Justice.
„Justice, denn das ist mein Bestreben.“
„Auf Kalimar?“, fragte Brachnar skeptisch. „Ein denkbar ungünstiger Planet für dieses Ansinnen.“
Justice zuckte nur mit den Schultern und blickte dem Fürsten stolz entgegen. Dieser schwieg ein paar Sekunden, bevor er weitersprach: „Ihr habt nicht nur meine Seele gerettet, sondern mir auch ein selbstloses Geschenk gemacht. Wenn ich etwas für Euch tun kann, so lasst es mich wissen.“
„Mich verlangt nach nichts, Brachnar. Doch wenn Ihr für meine Gefährten etwas zum Essen abzweigen könntet, wäre ich Euch sehr verbunden.“
Brachnar nickte unmerklich. „Wer Bosporans tötet, zählt ohnedies zu unseren Freunden. Es ehrt dich, dass du nichts für dich selbst begehrst. So will ich dir mein Wort geben, wann immer du unsere Hilfe benötigst, ist es mir eine Ehre, meine Schuld zu tilgen.“
„Ihr schuldet mir nichts, doch achte ich Euren Wunsch. Mir würde es nicht anders ergehen. Vielleicht ergibt sich schneller als wir denken die Notwendigkeit, Seite an Seite zu kämpfen.“ Zufrieden nickte der Mongolenfürst und mit einem Blick auf Tschaisn und die anderen fügte er hinzu: „Seid dankbar, sie an eurer Seite zu wissen. Junge Frauen, die zu kämpfen verstehen, sind selten wie ein reines Herz. Wenn ich noch jünger wäre, würde ich um ihre Liebe kämpfen.“
Er verneigte sich vor Justice, nickte den anderen zu und stapfte davon.
Kaum war Brachnar zu den Seinen zurückgekehrt, brachte man ihnen etwas zu essen und frisches Wasser.
Sie entzündeten ein Feuer und brieten etwas Fleisch. Während alle hungrig darauf warteten, dass das Essen fertig wurde, sah sich Faun Tschaisns Brandwunde an. Teile des Stoffes hatten sich ins Fleisch gebrannt. Die Wunde sah nicht gut aus. Sie reichte von der Schulter hinab bis zum Schulterblatt.
„Es wird dauern, bis sie geheilt ist und wie bei allen magischen Wunden wirst du Narben behalten“, erklärte Faun. Er griff nach seinem Beutel und holte eine kleine Dose mit einer bläulichen Salbe hervor. Vorsichtig trug er die gelartige Masse auf die von Blasen übersäte Haut auf. Es zischte als die Heilsalbe einzog. Nach wenigen Sekunden war sie vollständig verschwunden. Tschaisns Gesichtszüge entspannten sich. Die Salbe hatte eine kühlende Wirkung, und das erste Mal seit der Bosporan ihn gebrandmarkt hatte, verspürte er keine Schmerzen mehr. Tschaisn wollte sich gerade wieder ein Hemd anziehen, als Faun ihn aufforderte, ruhig sitzen zu bleiben und zu warten. Verwundert blickte er Faun an, dann zuckte Tschaisn zusammen; ein pulsierender Schmerz breitete sich in seiner Schulter aus. Sogleich hob Faun beide Hände und murmelte beschwörend auf die Wunde ein. Unter der verkrusteten Haut bewegte sich etwas. Wie wenn in einem See ein unterirdischer Vulkan ausbricht, wellte sich die Oberfläche der Wunde. Blendend blaues Licht senkte sich von Fauns Händen auf die gärende Hautoberfläche. Tschaisn erschauerte und wandte sich zähneknirschend ab. Was immer sich da unter der verkrusteten Wundfläche abspielte, sich sammelte und herauszubrechen drohte, wollte er nicht sehen. Die verkohlte Haut spannte sich und strebte in einer stumpfen Erhöhung auf Fauns Hände zu. Mit einem Mal brach die Wunde auf und eine feurige Kugel, umwoben von blauen Äderchen, schoss heraus. Geschickt fing Faun sie auf und hielt sie mit spitzen Fingern fest. Aus seinem Mund schossen peitschende Laute und innerhalb von Sekunden erstarrte die Feuerkugel zu Glas. Schnell ließ er die Kugel in seiner Tasche verschwinden. Erleichtert wandte er sich der jetzt stark blutenden Wunde zu. Ein paar melodisch klingende Heilverse und etliche Schmerzensschreie später war die Wunde so gut wie verheilt. Eine dünne, blasse Haut spannte sich über das noch vor kurzem verbrannte Fleisch. Mit einem Seufzer lehnte Faun sich zurück. „Das Schlimmste wäre überstanden. Jedoch achte auf die Heilung, sie ist noch nicht beendet. Nur langsam lässt sich des Teufels Fluch vertreiben. Noch ein paar Wochen wirst du Schmerzen spüren, doch werden sie erträglich sein.“
Tschaisn nickte dankbar und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Was war das für eine Kugel, die ihr in eure Tasche gesteckt habt?“, erkundete sich Cruz neugierig.
„Das ist Teufelsfeuer. Mächtige Magie und ebenso gefährlich, wie wenn sie aus dem Schlund eines Bosporans kommt.“
„Was macht ihr damit?“, hakte Cruz nach, doch Faun starrte schweigend in das lodernde Lagerfeuer und blieb eine Antwort schuldig.
„Lass ihn“, erwiderte Solei an Fauns Stelle, „er braucht jetzt etwas Ruhe.“
„Fett Fleisch ist das, was ich jetzt brauche“, befand Scipio und biss herzhaft in eine knusprig, braun gebratene Rehkeule.
„Du hast einfach keinen Stil, Scipio, egal wie lange man dich mit Verhaltensregeln bombardiert. Aber heute kann ich dich ausnahmsweise verstehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sich um ein freilaufendes, glückliches Bioreh handelt und lass es mir auch FETT schmecken“, bekundete Seraphine und schnappte Scipio die Rehkeule weg.
„Warum hast du dich äußerlich so sehr verändert?“, fragte Solei, die sich mit Justice an einen kleinen Bachlauf zurückgezogen hatte. Das Feuer im Lager war fast schon niedergebrannt und sandte nur einen spärlichen Lichtschein zu ihnen herüber. Bis auf Cruz, der noch etwas ausprobieren wollte, schliefen bereits alle. Solei hatte Scipio versprechen müssen, sich nur innerhalb der von Brachnar angeordneten Wachposten aufzuhalten. Dass Justice bei ihr war, beruhigte ihn soweit, dass er die beiden alleine ließ.
„Ich war selbst überrascht, als ich mein Spiegelbild in einem See gesehen habe“, antwortete Justice. „Meine Mutter hatte mich vorgewarnt. Unser Äußeres ist ein Spiegel unserer Seele, was in fremden Welten noch mehr zum Tragen kommt als auf der Erde. Unsere Geburtsenergie ist dort präsenter. Die beiden letzten Jahre haben mich sehr verändert. Zu wissen, dass ihr ohne ausreichende Informationen über Kalimar und seine Bewohner unterwegs seid, hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Meine Zeit im Trainingscamp war dagegen ein Kinderspiel gewesen. Diese zwei Jahre haben nicht nur meine Fertigkeiten mit dem Bogen und Kampinski verbessert, sondern auch meine Einstellung zum Leben verändert. Ich sehe jetzt viele Dinge anders. Was früher wichtig war, ist es jetzt nicht mehr.“
„Und Tschaisn?“
Justice verzog den Mund. „Ich werde damit klarkommen – auch wenn es nicht einfach ist.“
„Ist nicht leicht“, seufzte Solei. „Die Liebe ist eine Herzenssache, da hat der Kopf wenig zu melden. Ihr ist egal, in welcher Welt unser Körper sich befindet. Mir geht es ähnlich mit Faun.“
Überrascht warf Justice ihr einen Blick zu. „Wirklich? Du weißt hoffentlich, dass Faun ein Blauelf ist?“
„Ein Blauelf?“
„Ja.“
„Was bedeutet das?“
„Oh Solei, Unwissenheit schützt vor Liebeskummer nicht. Ein Blauelf ist ein uraltes Geschöpf, schon immer wandelten sie von Planet zu Planet. Sie sind Weltenheiler und tun nur Gutes. Stell dir einen Engel vor, der durch das Universum fliegt und überall hilft, wo er gebraucht wird. Niemals würde er sich binden, niemals würde er verweilen. Sie müssen immer weiterziehen, sobald einer Aufgabe gedient ist. Du musst wissen, dass es nur einhundertelf Blauelfen gibt. Die Chance, einen zu treffen, ist ungefähr so groß, wie bei Germany’s next Topmodel zu gewinnen.“
Solei seufzte. „Irgendwie fühlte ich schon immer, dass er mich nicht lieben würde.“
„Mit Sicherheit liebt er dich.“
„Du weißt, was ich meine.“
Justice stupste Solei neckisch am Knie. „Liebe kann auch erfüllend sein, wenn sie einseitig ist.“
„Ich weiß, aber schöner ist’s, wenn es beide trifft“, erwiderte Solei. „Wusstest du, dass Seraphine von einer Blauelfin ausgebildet wurde?“
Justice nickte. „Ja, Vilin, sie hat auch mich in den letzten beiden Jahren unterrichtet.“
„Wirklich, ich denke, sie sind so selten.“
„Sind sie auch. Doch ich glaube, wir alle unterschätzen die Wichtigkeit dieser Mission. Vilin hat Andeutungen gemacht, dass ein neues Zeitalter bevorsteht.“
„Du meinst den Mayakalender. 2012, das Jahr, wo alles endet.“ „So einfach kann man das nicht sagen“, widersprach Justice. „Der Mayakalender endet und eine Zeitenwende tritt in Kraft.
Wir werden einen Wandel erfahren, das alte Bewusstsein hat ausgedient. Materielle Dinge verlieren an Bedeutung und schaffen Raum für die seelische Entwicklung. Die Menschen werden sich zusehends auf ihr Inneres besinnen und Abstand nehmen von der Erfüllung im Außen. Das einzelne Individuum wird erkennen, dass wir alle eins und direkt voneinander abhängig sind.“
„Und das soll alles bis zum 21.12.2012 geschehen?“, fragte Solei skeptisch. „Scheint mir irgendwie unglaubwürdig.“
„Der ganze Prozess läuft schon seit der Jahrtausendwende. Das Neue ist schon lange da, das Alte macht nur viel Lärm beim Sterben – wie immer. Überleg doch mal, was die Erwachsenen immer labern. Wir Jugendlichen funktionieren nicht mehr so, wie sie es getan haben. Wir halten keine Regeln ein und möchten immer mehr mitbestimmen. Wir wollen nicht mehr geführt werden. Nicht nur deutsche Kinder brauchen keinen Führer mehr. Die Jugend der Welt will keine Eltern und Vorgesetzten, die ihnen sagen was sie wie zu tun haben. Wir werden unseren Herzen folgen oder widersprechen.“
„Oder uns abwenden“, ergänzte Solei. „Da ist was dran. Mit Druck erreichst du bei mir gar nichts. Bei meinen Eltern hat das früher noch funktioniert.“
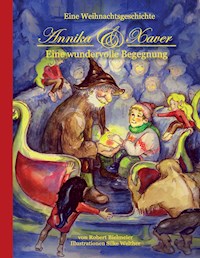













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














