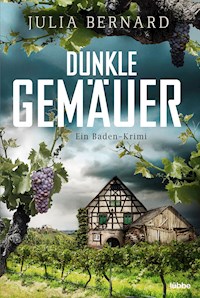9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Griesbaum & Marbach ermitteln
- Sprache: Deutsch
Als Henry Marbach, Schwabe und Privatdetektiv, einem Winzer im Auftrag der attraktiven Louise Münz hinterherspioniert, ahnt er noch nicht, dass ihn seine Nachforschungen zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall werden lassen. Wenn er seine Unschuld beweisen will, muss er mit der Privatermittlerin Suzanne Griesbaum zusammenarbeiten, aber die tickt so ganz anders als er und ist außerdem - Badenerin. Doch Marbach braucht alle Hilfe, die er kriegen kann, denn er ist in etwas viel Größeres hineingeraten, und bald schon ist nicht nur er in Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber die AutorinTitelImpressumKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Über die Autorin
Julia Bernard ist ein Pseudonym der Autorin Julia Hofelich. Die Juristin und gebürtige Schwäbin hat lange in der Ortenau gelebt und sich währenddessen in die Region verliebt.
Auch hat die Autorin in einem Offenburger den Mann fürs Leben gefunden. Kein Wunder also, dass ihre Krimireihe im wundervollen Baden spielt.
J U L I A B E R N A R D
KALTELÜGEN
Ein Baden-Krimi
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ilse Wagner, München
Umschlaggestaltung und -motiv: © www.buerosued.de
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0358-1
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Die alte Scheune stand am Rand eines Sonnenblumenfelds etwas außerhalb von Zunsweier. Sie war schon lange nicht mehr in Betrieb. Die schwarzen Balken des offenen Dachstuhls wiesen starke Verfallserscheinungen auf, ein von Wind und Wetter angenagtes Skelett, das sich in den dämmrigen Himmel reckte. Ein großes gelbes Schild mit der Aufschrift Einsturzgefahr! warnte Besucher davor, die Scheune zu betreten. Privatermittlerin Suzanne Griesbaum schloss davon unbeeindruckt das angerostete Vorhängeschloss am Tor auf und entfernte die Absperrkette. Ihre Jeans klebte kalt und nass an ihrem Bein, weil sie beim Überqueren der Wiese ein Schlammloch übersehen hatte. Sie betrat die Scheune, schloss die Tür hinter sich und ging die knarrenden Stiegen in der Mitte des Raumes hoch. Einige Stufen waren durchgefault, alles war baufällig. Dennoch. Suzanne war schon einmal hier gewesen, und die Scheune war einfach der ideale Beobachtungsposten. Wenn es heute Morgen zum Verkauf der gestohlenen Antiquitäten kam, wie der anonyme Tippgeber behauptet hatte, dann würde sie von hier aus ein paar gute Fotos schießen können. Wenn es dazu kam. Wieder stiegen leichte Zweifel in ihr auf. Es war schon seltsam, dass dieser Laubis, der nach außen hin so viel Wert auf sein Saubermann-Image legte, plötzlich ein Hehler sein sollte. Auf der anderen Seite war der rechtsradikale, frauenfeindliche Gemeinderat ein Widerling, und sie traute ihm einiges zu. Wie auch immer. Sie würde herausfinden, was hier los war, und ihrem Auftraggeber, einem Journalisten, davon berichten.
Auf der oberen Ebene der Scheune lagen noch einige modrige Heuballen, und Suzanne stellte ihren Rucksack darauf ab. Sie setzte eine Schirmkappe auf ihre schulterlangen blonden Haare und hängte sich die Kamera mit dem starken Teleobjektiv um den Hals. Vorsichtig, Schritt für Schritt, tastete sie sich entlang der tragenden Balken, um nicht durch die Bretter zu brechen und auf den Betonboden des Untergeschosses zu stürzen. Einunddreißig war eindeutig zu jung, um wie ein Spiegelei zu enden. Die morschen Dielen unter ihren Füßen schwankten gefährlich. Schließlich erreichte sie die dem Dorf zugewandte Seite der Scheune. Durch eine Lücke in der Bretterwand sah sie hinaus. Das Sonnenblumenfeld und die Streuobstwiesen lagen friedlich und menschenverlassen in der Morgendämmerung. Auch in Laubis’ Haus, einer Villa mit riesigen Fensterfronten am Ortsrand von Zunsweier, regte sich noch nichts. Suzanne ließ ihren Blick über die wundervolle Landschaft schweifen. Der Himmel leuchtete rot-orange. Kleine Nebelschwaden schwebten über einer Wiese, Wildkaninchen hoppelten auf einem Acker umher, und ein Storch schritt majestätisch über einen Feldweg. Vögel zwitscherten. Die Sonne ging strahlend auf, und Millionen Wassertröpfchen auf Gräsern und Blättern glitzerten wie Diamanten. Suzanne war für einen Moment geblendet und machte einen unbedachten Schritt nach hinten. Mit einem Knall brach der Boden unter ihr ein, und sie konnte sich gerade noch an einem Balken festhalten und zur Seite ausweichen, sonst wäre sie in die Tiefe gestürzt. Zitternd blieb sie eine Weile regungslos stehen, bis sich ihr Atem wieder beruhigt hatte. Neben ihr war nun ein großes Loch, durch das man ins Untergeschoss sehen konnte. Wie sollte sie das dem Eigentümer erklären? Sie schüttelte den Kopf und stellte ihr Teleobjektiv auf Laubis’ Haus scharf. Hoffentlich würde sich ihr Einsatz wenigstens lohnen! Durch die Fensterfront sah sie, dass der dicke Gemeinderat sich gerade in Unterhose bekleidet aus dem Bett schälte, Richtung Bad ging und die Tür schloss. Es dauerte nicht lange, bis er das Bad wieder verließ, sich im Schlafzimmer Anzug und Krawatte anzog, die Treppen hinunterging und in der Küche verschwand. Suzanne biss sich auf die Lippen. Die Küche konnte sie von ihrem Beobachtungsposten aus nicht richtig sehen, hoffentlich würde der Deal nicht dort stattfinden. Wenige Minuten später bog ein klappriger Jeep in Laubis’ Straße ein und hielt ein paar Meter hinter dessen Haus am Sonnenblumenfeld. Sie richtete das Teleobjektiv auf das Auto. Die Fahrertür ging auf, und ein sehniger Typ mit einem großen, golfbagähnlichen Rucksack und einer dunklen Sonnenbrille stieg aus. Er trug alte Turnschuhe, eine zerlöcherte Jeans und einen Schlagring. Er sah nicht gerade aus wie der millionenschwere Kunstsammler und Immobilienhai aus Baden-Baden, der Laubis anscheinend das Diebesgut abkaufen wollte. War der Deal etwa bereits gelaufen, und die hatten jetzt nur jemanden zum Abholen der Stücke geschickt? Sie schoss einige Fotos, auch vom Nummernschild des Autos. Der sehnige Typ warf die Fahrertür zu und lehnte sich seltsamerweise erst einmal dagegen. Sein Blick schien die Gegend abzusuchen und schließlich an der Scheune haften zu bleiben. Es wirkte fast, als starre er genau auf die Stelle, an der sie saß. Ihr Magen zog sich zusammen. Sie musste sich täuschen, der Typ konnte sie unmöglich sehen, sie befand sich gut verborgen hinter Brettern, und er hatte nicht mal ein Fernglas. Und es war ihr auch niemand gefolgt oder wusste, dass sie hier war, nicht mal der Inhaber der Scheune, dessen Schlüssel sie ohne sein Wissen »ausgeliehen« hatte. Der Mann stieß sich nun vom Auto ab und schlenderte am Rand des Feldes entlang. Direkt auf die Scheune zu. Was hoffentlich ein Zufall war, es gab sicherlich eine Menge Leute, die ihren Morgenspaziergang an diesem wundervollen Sonnenblumenfeld machten. Bestimmt auch Typen mit Schlagringen. Ihr Magen krampfte sich stärker zusammen. Es war bekannt, dass Laubis nicht sonderlich zimperlich mit Gegnern umging. Was, wenn er mitbekommen hatte, dass sie ihn beschattete? Während sie mit der rechten Hand den Fotoapparat umklammert hielt und den Typen mit dem Rucksack beobachtete, tastete sie mit der linken Hand in der hinteren Tasche ihrer Hose nach ihrem Handy … Mist, da konnte sie lange tasten, das Handy lag mal wieder in der Mittelkonsole ihres Autos. Sie ließ die Kamera sinken und sah sich im Raum nach einer Waffe um. Nur Bretter und Steine. Und man konnte es drehen und wenden, wie man wollte: Sie war nicht gerade eine Kampfsportmaschine, auch wenn sie fast den gelben Gürtel in Judo hatte. Sie setzte lieber ihren Verstand als Waffe ein, aber das konnte ein ganz schön stumpfes Schwert sein, wenn man auf einem einsamen Dachboden von einem Typen mit einem Schlagring angegriffen wurde. Der Mann hatte die Scheune mittlerweile erreicht und ging über die Wiese auf das Scheunentor zu, das sie von ihrer Position aus nicht sehen konnte. Leise durchquerte Suzanne so schnell es ging den Dachboden. Hinter einem Bretterstapel blieb sie stehen und lugte auf der anderen Seite des Dachs hinaus. Gott sei Dank, der Typ blieb nicht stehen. Er ging geradewegs auf ein kleines Waldstück zu. Suzanne atmete auf. Also doch nur ein Spaziergänger. Was sonst. Dass sie etwas anderes gedacht hatte, lag sicherlich daran, dass sie in letzter Zeit ein wenig angespannt war. Zu viel Arbeit. Sie balancierte auf ihren Beobachtungsposten zurück. Laubis saß nun im Wohnzimmer am Fenster, er hatte sich zurückgelehnt und las eine Zeitschrift, die er auf seinem dicken Bauch abstützte. Es war schon ein starkes Stück, dass er neulich bei einer Kundgebung gegen Ausländerfeindlichkeit, bei der sie eine Rede gehalten hatte, über ihre Figur gelästert hatte. Sie hatte das genau gehört. Sie war vielleicht nicht mager, aber verglichen mit dem Mann hatte sie Modelmaße. Und wie er sie bei der nachfolgenden Diskussion ständig »Susanne« genannt hatte, obwohl man ihren Namen, wie sie ihm mehrmals erklärt hatte, »Süsann« aussprach. »›Süsann‹ klingt mir nicht deutsch genug«, hatte er gesagt. Sie schaubte, lehnte sich vorsichtig an einen Balken und wartete. Die Minuten zogen sich quälend langsam dahin. Obwohl es immer noch recht früh war, wurde es in der Augustsonne, die durch den offenen Dachstuhl fiel, allmählich brütend heiß auf ihrem Beobachtungsposten, den sie mit mehreren Hornissen und verschiedenen anderen Krabbeltieren teilen musste. Leider nirgends eine Spur des dubiosen Kunstsammlers. Sie sah auf ihre Uhr. Eine Weile konnte sie noch warten, aber spätestens um elf Uhr musste sie im Büro bei einer Besprechung mit einer Klientin sein, die Hilfe in einer hässlichen Scheidungssache benötigte. Jetzt hatte der Noch-Ehemann sogar den gemeinsamen Hund vergiftet! Überhaupt hatte Suzanne noch einiges zu erledigen, bevor sie am Abend nach Stuttgart auf das Death-Metal-Festival fahren konnte, auf das sie sich seit Wochen freute. Wenigstens die letzten beiden Tage des Feinstaubfestivals wollte sie miterleben. In ihrem Bauch begann es vor Freude zu kribbeln. Das würde großartig werden! Und diesmal würde sie sich bestimmt trauen, den Sänger von Dieselskandal anzusprechen! Diesmal bestimmt! Sie würde ihn noch vor dem ersten Konzert … Ein seltsames Geräusch, ein Sirren und dann ein lautes Rascheln und ein dumpfer Aufschlag, als sei etwas Schweres von weit oben auf den Boden gefallen, riss sie aus ihren Gedanken. Was zum Henker war das? Nun sagte eine männliche Stimme, deren Besitzer direkt vor der Scheune stehen musste: »Jesses nai!«, und: »Sauber liggd de Babbe im Sarg.« Sie spähte hinunter. Durch eine Ritze zwischen zwei Brettern sah sie den Kopf und einen Arm des Schlagring-Typen. Er hielt einen riesigen Ast hoch. Keine Ahnung, was er damit vorhatte. Ausgerechnet in diesem Moment kam eine Frau die Straße entlang und ging zügig auf Laubis’ Haus zu. Suzanne zwang sich, ruhig zu atmen. Sicher stellte der Schlagringtyp keine Gefahr dar, sondern war nur ein bisschen verrückt. Sie nahm die Kamera hoch und warf einen Blick durch das Teleobjektiv zu Laubis’ Haus hinüber. Die Frau betrat den Vorgarten, sie war blond, ziemlich hübsch und trug ein kurzes weißes Kleid. Sie hatte eine große Handtasche dabei und sah schon eher aus wie eine Kunstsammlerin aus Baden-Baden. Suzanne tastete mit dem Finger zum Auslöser. In diesem Moment brach etwas mit Getöse durch die morsche Wand der Scheune, sauste an ihrem Kopf vorbei und blieb keinen Meter von ihr entfernt in einem Balken stecken. Sie schrie auf, ihr Herzschlag setzte für eine Sekunde aus. Das Ding sah aus wie ein Pfeil aus einer Armbrust. Panisch duckte sie sich und brüllte: »Hören Sie auf mit Schießen! Hier ist jemand drin! Aufhören!« Ein weiterer Pfeil verfehlte sie um ein paar Meter, und vor Schreck taumelte sie rückwärts und knallte brutal gegen einen der Stützbalken. Ein stechender Schmerz in ihrem Rücken, sie japste nach Luft, spürte, wie der Balken sich bewegte. Ruckartig drehte sie sich um. Wie in Zeitlupe knickte der morsche Stützbalken, den sie gerammt hatte, mit lautem Krachen ab. Im Dachstuhl knarrte es bedrohlich. Es regnete Holzstücke. Sie zwang sich, langsam und gebückt Schritt für Schritt zurück zur Treppe zu gehen. Nicht rennen, sonst brach der Boden. Staub rieselte auf sie herab, eine Gaube zersplitterte. Nicht rennen. Auf jeden Schritt achten. Ein grauenvolles Ächzen lief durch das alte Gebälk, ein Todesseufzer. Ein weiterer Stützbalken bog sich nun beängstigend. Die Scheune stürzte ein. Sie musste hier raus. Sofort. Mit zitternden Knien erreichte sie die Treppe. Klemmte sich beinahe in einer Ritze den Fuß ein, bekam ihn nach kurzer Zeit verzweifelten Ringens wieder frei. Am hinteren Ende der Scheune, dort, wo sie gesessen hatte, fiel ein Dachsparren krachend auf die Dielen und brach hindurch. Staub und Splitter wirbelten auf. Suzanne bezwang die Treppe und rannte auf die Tür zu. Blieb ruckartig stehen. Sie konnte da nicht raus. Da draußen war jemand mit einer Armbrust. Der Schlagringtyp. Er wollte sie töten. Hinter ihr krachte ein weiteres Stück Holz durch die Decke auf den Boden, ein riesiger Stein landete direkt neben ihr. Sie hatte keine Wahl. Sie riss die Tür auf und rannte ins Freie.
Kapitel 2
Die junge Frau hatte ein kleines Mädchen an der Hand, das noch kaum laufen konnte, und eine große Tasche über der Schulter. Sie ging mit langsamen, wippenden Schritten auf das Regal mit der Babynahrung zu. Blieb stehen und schaute sich um. Dann packte sie blitzschnell zwei Obstgläschen und steckte sie in ihre Tasche. Sie wollte gerade einen Müsliriegel einpacken, als Privatdetektiv Henry Marbach ihr von hinten die Hand auf die Schulter legte. Die Frau zuckte so zusammen, dass ihr fast der Müsliriegel auf den Boden fiel. Mit zitternden Händen legte sie ihn zurück ins Regal. »Bitte«, flüsterte sie nur.
»Kommen Sie mal mit«, sagte Henry.
Gemeinsam gingen sie in das karge Büro hinter der Herrenumkleidekabine. Die Frau weinte leise, als sie auf dem Plastikstuhl Platz nahm und ihre Tasche öffnete. Windeln, Babyshampoo, zwei Gläschen mit Obstbrei, ein Kinder-T-Shirt. Das kleine Mädchen schaute mit hungrigem Blick auf das Essen.
Das Prozedere war immer das Gleiche. Diebesgut sichern, Vorfall dokumentieren, Polizei anrufen, Anzeige erstatten. Seit zehn Wochen patrouillierte Henry nun schon wie ein Westernsheriff durch die Abteilungen eines Kaufhauses in der Stuttgarter Königstraße und stellte Großväter, die eine Packung Toast klauten, und Mädchen in der Pubertät, bei denen das Taschengeld nicht für den teuren Lippenstift ausgereicht hatte. Es war der scheußlichste Nebenjob, den er je gemacht hatte, und wenn seine finanzielle Situation nicht derart angespannt gewesen wäre, hätte er ihn schon lange hingeschmissen. Aber in seine kleine Detektei im Stuttgarter Westen hatte sich seit Monaten kein Klient verirrt. Und nicht genug damit, dass er pleite war: Es kostete ihn zudem eine ganze Stange Geld, das niemanden merken zu lassen.
»Ich muss die Polizei anrufen«, sagte er.
Die Frau sah ihn mit verweinten, leeren Augen an. »Die Kleine hatte Hunger. Ich habe kein Geld mehr. Was hätten Sie denn gemacht?«
Wahrscheinlich das Gleiche wie Sie, dachte er. Er verspürte tiefes Mitleid mit ihr. Aber er hatte keine Wahl, er war letzte Woche schon abgemahnt worden, weil sein Kollege Josh mitbekommen hatte, dass er einen Haargummidieb einfach so hatte laufen lassen. Abgesehen davon bekamen sie eine Art Provision für jeden gestellten Dieb. Er warf einen Blick in den Flur hinaus. Niemand da. »Da es das erste Mal ist, dass ich Sie erwische, werde ich aber noch ein Auge zudrücken«, sagte er schnell. Er legte das Diebesgut auf den Tisch. Eines der Obstgläschen in der Tasche übersah er, schloss die Tasche wieder und gab sie der Frau zurück. »Verschwinden Sie, aber zügig«, sagte er und tätschelte dem Mädchen den Kopf.
Die Frau stand auf, lächelte und verschwand. Henry lächelte auch, aber sein Lächeln erlosch, als wenig später die Tür aufging und Josh und der Abteilungsleiter hereinkamen. »Wusste ich es doch«, grinste Josh schmierig, und Henry musste anerkennen, dass Josh gar kein so mieser Detektiv war, wie er gedacht hatte.
»Wir haben alles auf Film. Sie sind gefeuert«, schnaubte der Abteilungsleiter in Henrys Richtung, und das erste Mal seit Wochen fühlte sich Henry richtig gut. Bis er zu Hause das Schreiben seines Vermieters im Briefkasten fand. Wenn er seine Miete nicht binnen sieben Tagen bezahlte, würde er seine Wohnung und sein damit verbundenes Büro verlieren.
Er warf das Schreiben auf den Stapel mit unbezahlten Rechnungen und machte sich in seiner Designerküche erst einmal einen Cappuccino. Er hatte es bisher immer geschafft, das nötige Geld aufzutreiben. Für alles. Er würde es auch diesmal schaffen. Er wusste nur noch nicht genau, wie.
Um besser nachdenken zu können, ging er ein paar Stunden ins Fitnessstudio und aß ein Pastramisandwich im angesagten Café Tatti. Danach machte er sich schweren Herzens auf den Weg ins Pfandleihhaus, um seine alte Rolex einmal mehr zu versetzen, und ertrug stoisch die prolligen und herablassenden Sprüche, die der Inhaber Maik zum Besten gab, als er ihm das Geld auszahlte. Viel zu wenig Geld, aber da ließ Maik nicht mit sich handeln. Als Henry über den Innenhof zurück zur Straße ging, vorbei an den mit grünen Graffitiköpfen und Beschriftungen beschmierten Mauern, fühlte er sich, als sei er mit eiskaltem Wasser übergossen worden.
Wieder in der Detektei, rief er seinen besten Freund Achim an, einen Anwalt, und fragte ihn nach Arbeit. Er unterstützte Achim häufiger, zum Beispiel hatte er erst vor ein paar Monaten eine totgeglaubte Prozessgegnerin auf Hiddensee gefunden. Achim hatte tatsächlich auch diesmal einen Job für ihn, leider etwas ganz anderes als Recherche. Henry schluckte, aber die Erinnerung an den Stapel mit unbezahlten Rechnungen überzeugte ihn, und er sagte zu.
Am nächsten Morgen bereute er das bitterlich. Flugzeuge starteten dröhnend vom nahegelegenen Stuttgarter Flughafen, ihre gigantischen Metallkörper flogen wie urzeitliche Drachen über das Festivalgelände. Die Sonne brannte, E-Gitarren kreischten, und das Schlagzeug bollerte wie ein wild gewordener Presslufthammer. Der Sänger von Dieselskandal hatte lange Haare und ein Spinnennetztattoo auf der Stirn, und er brüllte seine Lieder ins Mikrofon, als ginge es um sein Leben. In den Texten kam viel Blood vor, viel Fear und viele Bitches. Weiter hinten, noch näher an der Autobahn, stimmten sich die Mitglieder einer weiteren Death-Metal-Band auf ihren ersten Gig ein. Die Lautsprecher bebten. Wahrscheinlich würde Henry nach diesem Vormittag auf dem »Feinstäuble«, wie das Feinstaubfestival von den Fans liebevoll genannt wurde, nie wieder seine volle Hörfähigkeit zurückerlangen, aber von irgendetwas musste er seine Miete bezahlen. Zudem schuldete er Achim, der neben seiner Anwaltstätigkeit auch der Bandmanager von Dieselskandal war, ebenfalls ein paar größere Scheine. Auch wenn Achim das sicherlich großzügig »vergessen« hatte, würde Henry ihm nie etwas schuldig bleiben. Das Zurückzahlen dauerte manchmal nur etwas länger, aber er würde heute damit anfangen, indem er nur seinen halben Lohn für den Tag verlangen würde.
Henry krempelte die Ärmel seines hellblauen Hemdes nach oben und wuchtete das giftgrüne Schild mit der Aufschrift »Basst wie’d Fauschd uffs Aug’: Mauldäschla ond Tequila« von der Ladefläche des Transporters. Er hievte es auf die Schulter und ging zu Achims Maultaschenstand, den sie in den letzten Stunden aufgebaut hatten, zurück. Das Schild war verdammt schwer, und es dauerte über zehn Minuten, bis Henry und Achim es in der Halterung befestigt hatten. Direkt nebenan performte Dieselskandal brüllend und hämmernd über Shotguns und noch mehr Bitches. Für eine winzige Sekunde dachte Henry mit leichtem Bedauern an seinen Job bei der Kripo zurück, den er vor seiner Tätigkeit als selbständiger Privatermittler gehabt hatte. Und sogar seine Zeit als Ladendetektiv vermisste er fast. Dann wischte er mit einer entschlossenen Bewegung seine schmutzigen Hände an einem Tuch ab. Er war nicht der Typ, der der Vergangenheit nachtrauerte. Erfolgreiche Menschen blickten in die Zukunft. Und da Henry seine Zukunft für die nächsten Stunden klar erkennen konnte, nahm er sich ein Bier aus Achims Tiefkühltasche und trank es mit wenigen Zügen leer. Dann betrat er den Stand, warf den Grill an und verkaufte Maultaschen und Tequila, während der Sänger mit dem Spinnennetztattoo über die Bühne robbte und in Düsenjägerlautstärke etwas grölte, das sich anhörte wie ein Rudel Wölfe auf Koks.
Gerade noch rechtzeitig, bevor die abendlichen Bandauftritte begannen, gingen die Maultaschen aus, und Henry konnte heimfahren. Die Sonne stand bereits tief, aber es war immer noch siedend heiß, als er endlich einen fast legalen Parkplatz in der Nähe des Schwabtunnels gefunden hatte und aus seinem schwarzen Porsche stieg. Mit einem zufriedenen Lächeln strich er über die glänzende Tür und schloss sie vorsichtig. Das Auto gefiel ihm immer noch genauso gut wie vor fünf Jahren, als er es gekauft hatte. Es war wie er selbst. Schnittig, elegant und, obgleich schon etwas in die Jahre gekommen, immer noch top in Form. Leider war es auch noch nicht abbezahlt, aber wie hatte schon seine Oma gesagt: »S’isch, wie’s isch.« Manche Dinge hatte man nicht in der Hand. Andere schon. Er brauchte zum Beispiel dringend ein Hemd ohne Grillfettspritzer, eine kalte Dusche und einen noch kälteren Proteindrink. Im Anschluss würde er seinen Oberkörper noch ein wenig mit der neuen Langhantel perfektionieren. Als er in Gedanken an diese Verheißungen schwungvoll um die Ecke in seine Straße ging, stieß er beinahe mit einer blonden Frau zusammen. Sie lehnte an der Mauer direkt vor seinem Büro. War sie etwa eine neue Klientin? Möglicherweise sogar mal eine zahlungskräftige? Auf jeden Fall sah sie toll aus. Etwa Mitte zwanzig, groß, schlank, mit grünen Augen und langen Haaren. Ihr schwarzes Kleid war so kurz und eng, dass es Henry für eine Sekunde den Atem raubte. Er lächelte und suchte nach einem coolen Spruch. Blöderweise fiel ihm nur »Hi« ein. Das sagte er dann auch.
Die Art, wie sie ihn anschaute und die Augenbrauen hochzog, war ein Schlag in die Magengrube. Offensichtlich hielt sie ihn für einen dahergelaufenen alten Sack, der sie anbaggern wollte.
»Möchten Sie zu mir?«, machte er einen zweiten Anlauf und zeigte auf sein Schild, auf dem vergilbt Marbach Privatermittlungen – diskret, günstig, erfolgreich zu lesen war.
Die grünen Augen der Frau weiteten sich. Sie sagte immer noch nichts.
Komm schon, diskret und günstig stimmt immerhin, dachte Henry. Und als die Frau weiter schwieg: Dann halt nicht, du hast die einmalige Chance auf einen Topermittler gehabt! Und er ging vielleicht langsam auf die fünfzig zu, aber das gab ihr keinen Grund, so herablassend zu schauen. Die Jüngelchen in ihrem Alter steckte er noch locker in die Tasche! Er pumpte seinen Bizeps unauffällig ein wenig auf und schlenderte cool aus der Hüfte heraus an der Frau vorbei. In seinem linken Ohr summte ein schriller Ton, den er vermutlich Dieselskandal verdankte. Himmel, wie er Death Metal hasste. Und Black Metal und Thrash Metal und Melodic Death und was es sonst noch so gab. Warum managte Achim nicht mal klassische Pianisten? Henry pfriemelte den Schlüssel aus seiner Jeans. Und es war ungerecht, dass dieser herumgrölende Sängerhänfling im Gegensatz zu ihm beruflich so einen Erfolg hatte und sich außerdem nach dem Konzert wahrscheinlich vor weiblichen Fans nicht retten konnte, denen er im Séparée was von seiner Shotgun vorsang. Henry musste wider Willen grinsen. Er war bloß neidisch, weil er, der Ermittler mit dem gereiften Astralkörper, seit Monaten keinen Auftrag mehr bekommen hatte und zudem die Nacht allein mit einem Pfeifen im Ohr und einer Langhantel verbringen musste. Er schüttelte den Kopf und schloss die Tür auf.
»Sind Sie wirklich der Detektiv?« Die Kleine hatte eine rauchige, tiefe Stimme mit einem kaum hörbaren badischen Einschlag. Henry drehte sich um. Vielleicht würde das hier ja doch noch ein Auftrag werden. Er sah in grüne Augen, die die Fettspritzer auf seinem Hemd musterten.
»Ich war undercover investigativ unterwegs«, behauptete er im Brustton der Überzeugung. »Es geht nichts über ein dreckiges Hemd als Tarnung. Da wird man unsichtbar.«
Sie glaubte ihm kein Wort, das sah er genau. »Einen Detektiv hätte ich mir anders vorgestellt«, bemerkte sie.
»Wie denn?«, fragte Henry. »Wie Justus Jonas in Die drei Fragezeichen?« Er lehnte sich möglichst lässig an den Türrahmen und zog ein zerknautschtes Päckchen Zigaretten aus seiner Hosentasche. Keine Ahnung, warum er die jeden Tag einsteckte. Eigentlich rauchte er seit Monaten nicht mehr.
»Weiß nicht«, sagte sie. »Anders halt.«
»Daran sehen Sie, wie fantastisch meine Tarnung ist.«
»Da haben Sie vielleicht recht.« Sie drehte einige ihrer langen Haare um ihren Zeigefinger. Ihre Hände zitterten ein wenig. Hinter dem perfekten Make-up wirkte sie auf einmal zerbrechlich und verzweifelt, und er hatte plötzlich Mitleid mit ihr. Außerdem merkte er, wie erschöpft er von dem langen Tag war.
»Wollen Sie mit reinkommen? Zufällig habe ich heute Abend noch einen Termin frei.« Er stieß die Eingangstür weit auf. Auf der Fußmatte vor seiner Wohnungstür lag ein gelber Umschlag, der verdächtig nach Mahnbescheid aussah.
»Weiß nicht«, murmelte sie. In ihren Augen schimmerten jetzt Tränen. Und etwas anderes. Angst.
Er hielt ihr die Kippen hin, und sie nahm sich mit einer zögerlichen Bewegung eine heraus. Ihre Fingernägel waren dunkelrosa lackiert. Er gab ihr Feuer. Sie saugte den Rauch gierig ein. Er ignorierte die schreiende Stimme der Vernunft in seinem Inneren und zündete sich ebenfalls eine an.
»Ich habe gehört, dass Sie gut sein sollen in Ihrem Job«, sagte sie nach einer Weile.
Er zuckte die Schultern, als sei er völlig unbeeindruckt. »Darf ich fragen, wer mich empfohlen hat?«
»Das … das tut nichts zur Sache.«
An der Art, wie sie zögerte, erkannte er, dass es einer derjenigen ehemaligen Klienten sein musste, die ihre Rechnung noch nicht beglichen hatten und es daher vorzogen, nicht bei ihm in Erinnerung gerufen zu werden.
Sie trat ihre Kippe aus und kam einen Schritt auf ihn zu, stand ihm nun direkt gegenüber. Sie roch gut, nach Erdbeershampoo und ein wenig nach Rauch. »Wenn ich Ihnen was erzähle, müssen Sie darüber schweigen, oder?« Sie sprach leise. In ihrer Stimme schwang ein panischer Unterton mit. »Die Sache ist … heikel.«
»Selbstverständlich«, sagte Henry.
Sie legte ihre warme Hand auf seinen nackten Unterarm und jagte Stromstöße durch seinen Körper. »Die Sache könnte gefährlich werden. Auch … auch für Sie.«
Die Sache wird für mich jetzt schon gefährlich, dachte er. Aber sie war eine mögliche Auftraggeberin, und er würde sich jetzt verdammt noch mal zusammenreißen. »Ich schlage vor, wir gehen erst mal rein, und Sie erzählen mir alles«, sagte er und zog mit leisem Bedauern seinen Arm unter ihrer Hand weg. »Ich habe täglich mit bedrohlichen Kriminellen und brisanten Fällen zu tun. So schnell bringt mich nichts aus dem Konzept.«
Sie nickte, und dabei fielen ihre langen Haare ein wenig zur Seite. Für eine Sekunde konnte er zwei dünne, blutunterlaufene Abschürfungen an ihrem Hals erkennen. Als habe sich ein dünnes Seil in die Haut gegraben. Dann bewegte sie den Kopf, und die Haare verdeckten die Stelle wieder.
Beim Hineingehen hob Henry schnell den verdächtigen Umschlag vom Boden auf und hielt ihn so gegen sein Hemd, dass der Absender nicht zu sehen war. Danach sperrte er die Wohnungstür auf. Seinem aufgeräumten, breiten Flur mit dem hellen Parkett und den stilvollen Leuchten sah man weder an, dass Henry seit Jahren pleite war, noch, dass er in zwei der angrenzenden Zimmer auch wohnte. Alles war geschäftsmäßig, geschmackvoll und teuer, von den Schwarzweißfotos bis hin zum Designerspiegel und dem Wartesessel neben dem Garderobenständer. Die erste Tür links im Flur führte in Henrys Büro. Auch hier standen schwarze Ledersessel und ein Schreibtisch mit einer Granitplatte. Die Platte war vielleicht der Grund, warum er schon wieder einen Mahnbescheid bekommen hatte. Aber wenn man in Stuttgart jemand sein wollte, dann musste man einen auf dicke Hose machen, das hatte er schnell gelernt, nachdem er von Kleinengstingen hergezogen war. Wenn man irgendwann die richtig großen Klienten und damit Erfolg haben wollte, kam es vor allem darauf an, dass alle glaubten, man sei bereits erfolgreich. Das fing bei der Kleidung, dem Auto und dem Büro an. Auf der einen Seite war ihm seit Langem klar, dass diese Rechnung bei ihm aus irgendwelchen Gründen nicht aufging, auf der anderen Seite wusste er, dass er es nicht verkraften würde, wenn man ihn in der Öffentlichkeit als Verlierer ansah. Denn er arbeitete verdammt hart und war kein Verlierer. Egal, wie oft sein Vater, ein Profiboxer, versucht hatte, ihm das einzureden, wenn Henry nach einem Kampf mit blutiger Nase vor ihm gestanden hatte.
Henry bat seine potenzielle neue Auftraggeberin, sie hieß Louise Münz, in einem der Klientensessel Platz zu nehmen, und ging in die Küche, wo er den Mahnbescheid auf den Haufen mit Rechnungen legte und einen Milchkaffee zubereitete. Er brachte der jungen Frau den Kaffee, behauptete, er habe noch ein wichtiges geschäftliches Telefonat zu tätigen, und ging duschen. Als er zurückkam, in einer trendigen Jeans und einem Hemd, das seinen muskulösen Oberkörper gut zur Geltung brachte, die kurzen schwarz-grau melierten Haare strubbelig in Form gebracht, war der Kaffee leer und seine Kippen auch. Louise Münz saß angespannt im Sessel. Ihr Kleid war ein wenig hochgerutscht und gab den Blick auf wundervolle Oberschenkel frei. Henry schaute sicherheitshalber woanders hin. »Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
Es dauerte eine Weile, bis sie sprach. Erneut sah er Tränen in ihren Augen. »Er … er hat versucht, mich zu erwürgen«, stieß sie schließlich hervor. »Hier, sehen Sie.« Sie legte ihre Haare in den Nacken und zeigte ihm die blutunterlaufenen Abschürfungen. »Mit meiner eigenen Kette.«
»Wer?«, fragte Henry.
Sie zögerte lange, als sei sie noch nicht sicher, ob sie ihm trauen könne. Aber dann stieß sie plötzlich »Joseph Sandhaas« hervor. »Er ist Winzer in Durbach, und letzten Herbst habe ich … Also, ich wollte einmal bei einer Weinlese helfen, weil ich das cool fand. Wissen Sie, ich bin in Baden geboren und aufgewachsen, hatte aber bis dahin noch nie bei einer Weinlese mitgemacht.« Sie lächelte kopfschüttelnd. »Jedenfalls haben wir uns da kennengelernt. Er ist der Besitzer des Weinguts. Vor ein paar Wochen war ich beim Einkaufen in Bad Cannstatt, wo ich wohne, und da bin ich ihm zufällig wiederbegegnet. Ich dachte jedenfalls, dass es Zufall war. Wir waren miteinander essen. Ich hatte gerade eine ziemlich heftige Trennung hinter mir, und er steckt mitten in einer Scheidung, wir hatten uns einiges zu erzählen. Er hatte etwas Väterliches an sich.« Mit einem verächtlichen Schnauben stieß sie die Luft aus. »Ich meine, er ist ungefähr dreißig Jahre älter als ich, oder sogar vierzig, und ich dachte nie … Ich bin so bescheuert. Ich hätte erkennen müssen, dass mit dem Typen was nicht stimmt. Eine Woche später habe ich ihn erneut ›zufällig‹ getroffen, an der U-Bahn-Haltestelle Wilhelmsplatz. Er hat behauptet, er habe einen Großkunden für seinen Wein in Bad Cannstatt. Von da an ist er mir beinahe täglich über den Weg gelaufen, und es hört nicht auf. Ständig parkt sein alter Daimler bei mir in der Straße. Vor drei Tagen das letzte Mal. Man erkennt ihn sofort, das Auto ist rot, hat aber silberne Kotflügel. Er hat mir erzählt, ich sei seine Traumfrau. Ich habe irgendwann gedacht, dass er nervig ist und dumm. Aber nicht, dass er gefährlich ist. Er hat mir eher ein bisschen leidgetan. Er ist alt und offensichtlich einsam.« Sie stöhnte. »Ich bin so blöd. Ich dachte, ich muss nur mal in Ruhe mit ihm reden, damit er aufhört. Jedenfalls bin ich vorgestern zu ihm nach Durbach gefahren und … Er hat mir ein Glas Wein angeboten. Zuerst haben wir uns unterhalten, im Garten, denn ich bin selbstverständlich nicht in sein Haus gegangen, und ich dachte, er würde verstehen, was ich ihm sagen will. Aber plötzlich ist er ausgerastet. Ich wollte gehen, nur …« Sie verstummte. Eine Träne rann über ihre Wange.
Henry wartete eine Weile. Als seine Klientin nicht weitersprach, fragte er behutsam: »Und dann? Hat er …?«
Sie sah auf den Boden. »Er hat mich in einen Gartenschuppen gestoßen, sich in den Türrahmen gestellt und mich nicht mehr rausgelassen. Wir haben geredet, er hat seltsames Zeug gebrabbelt, irgendwann hat er versucht, mich zu küssen und …« Sie weinte jetzt. »Als ich mich gewehrt habe, hat er meine Kette gepackt. Hat sie um meinen Hals zugezogen, fester und fester. Ich dachte, ich werde sterben. Wenn meine Kette nicht gerissen wäre …« Sie berührte die Stelle am Hals. »Kurz danach hat er mich losgelassen. Es war, als ob er wieder zu sich kommt. Er hat so getan, als sei nichts gewesen. Am Ende ist es mir gelungen, ihn zu überzeugen, mich gehen zu lassen. Seither wohne ich bei einer Freundin und traue mich kaum noch auf die Straße.«
»Waren Sie nach dem Angriff beim Arzt? Es ist wichtig, dass die Spuren …«
»Nein«, unterbrach sie ihn. »Und ich war auch nicht bei der Polizei. Die werden doch über mich lachen und bestimmt sagen, dass ich selbst schuld bin, wenn ich zu so einem Typen auch noch hinfahre und mit ihm Wein trinke.«
»Das denke ich nicht. Sie sollten unbedingt zur Polizei. Dieser Sandhaas scheint gefährlich zu sein.«
Sie knetete ihre Hände. »Es geht nicht.« Erneut zögerte sie, wischte sich ein paarmal über die Augen. »Es gibt … Es gibt da ein Problem. Deshalb bin ich ja hier.« Mit einer hilflosen Geste fuhr sie sich über den Mund. »Vor ein paar Jahren … Jetzt werden Sie mir bestimmt auch nicht mehr glauben.«
»Versuchen Sie es doch mal«, ermunterte Henry sie. Eine Weile waren nur das Brummen und Hupen von Autos und die klackernden Schritte der Fußgänger vor dem Büro zu hören. Im Raum war es mittlerweile heiß geworden, weil eines der Fenster wegen des Zigarettenrauchs offen stand und die Sommerhitze unerbittlich hereindrang. Henry schaltete den Säulenventilator ein, der neben seinem Aktenschrank stand. Es dauerte sehr lange, bis seine Klientin sprach. »Es gab da einen Lehrer bei mir an der Schule und er … Er hat mir immer wieder zu verstehen gegeben, dass ich zu dumm für Physik bin. Hat mich an die Tafel gerufen und mich vor allen fertiggemacht. Na ja, er war ein Sadist, und ich konnte ihn nicht leiden, und deshalb habe ich eines Tages rumerzählt, er hätte mir mehrmals an die Brust gefasst. Ich war siebzehn damals und habe wirklich nicht beabsichtigt, dass die Geschichte so hohe Wellen schlägt. Dass die Polizei ins Spiel kommt. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr zurück, und ich bin bei meiner Aussage geblieben, obwohl sie falsch war. Ich bin absolut nicht stolz darauf. Der Lehrer wurde beurlaubt, aber dann … Zum Glück kam alles raus, bevor noch größerer Schaden angerichtet wurde. Ich habe eine Jugendstrafe bekommen. Jetzt wird mir niemand mehr glauben, wenn ich ›schon wieder‹ einen ›unbescholtenen‹ Mann beschuldige, mich gestalkt und angegriffen zu haben. Sandhaas weiß von der Sache in der Schule. Er hat mir gedroht, wenn ich mit der Polizei über ihn rede, wird er meinen alten Lehrer ausfindig machen, und dann werden die beiden mich gemeinsam vor Gericht fertigmachen.« Sie schluckte. »Daher brauche ich handfeste Beweise gegen Sandhaas. Denn ich habe nichts. Absolut nichts. Dass ich nicht beim Arzt war, war ziemlich blöd von mir, nur … Ich war vollkommen durcheinander. Ich hatte Angst. Und er hat mich ja nicht vergewaltigt, daher dachte ich nicht, dass man Spuren … Meinen Sie, dass man bei Sandhaas im Schuppen noch etwas finden könnte?« Sie drehte eine Haarsträhne um ihren Zeigefinger. Bevor Henry einwenden konnte, dass er nicht einfach in einem fremden Schuppen nach Spuren suchen konnte, fuhr Louise Münz fort: »Vielleicht macht dieses Schwein so was ja auch nicht zum ersten Mal. Vielleicht hat er schon mal eine andere Frau angegriffen, eine, die nicht so eine Vorgeschichte hat wie ich. Vielleicht hat er sogar eine Vorstrafe.« Sie schluckte schwer. »Denn der ist nie im Leben so unbescholten, wie er tut. Wenn Sie das für mich herausfinden könnten … Außerdem … wenn Sie ihn auf frischer Tat in Bad Cannstatt ertappen würden und ich bombenfest nachweisen könnte, dass er mich verfolgt, dann bestünde jedenfalls die Chance, dass die Polizei mich ernst nimmt.«
Henry nickte. Wenn stimmte, was seine Klientin ihm da erzählte, und er glaubte ihr, war sie in einer ziemlich misslichen Lage. Auch wenn sie als Jugendliche den Lehrer zu Unrecht beschuldigt hatte, musste sie sich trotzdem gegen den Übergriff von diesem Sandhaas wehren können. Und das würde tatsächlich schwierig werden, ohne konkrete Beweise und bei der Vorgeschichte.
»Wenn ich ihn jetzt anzeige, ohne etwas in der Hand, und es gelingt mir nicht, ihn in den Knast zu bringen, bringt er mich um«, fuhr Louise Münz leise und panisch fort. »Sie hätten ihn sehen sollen, als er auf mich losgegangen ist. Er ist vollkommen verrückt, der Typ.« Sie schaute ihn mit ihren tiefgrünen Augen an. »Wären … wären Sie denn überhaupt bereit, den Fall zu übernehmen?«
Henry dachte kurz nach, dann nickte er. Typen wie dieser Sandhaas machten ihn stinkwütend! »Es wird allerdings nicht ganz billig werden, wenn ich öfters nach Durbach fahren muss. Vielleicht sollten Sie einen Detektiv vor Ort engagieren?«
Louise Münz schüttelte den Kopf. »Geld ist kein Problem«, sagte sie. »Wirklich nicht. Ich habe vor einiger Zeit geerbt. Und ich hätte gerne jemanden von außerhalb. Sandhaas ist da unten sehr bekannt. Sagen Sie mir, was es kostet, wenn Sie sich da ein Hotelzimmer nehmen und für ein paar Tage nur für mich tätig sind.« Sie legte einen dicken Stapel Hunderteuroscheine auf den Tisch.
Henry nannte eine Zahl, und sie schob ihm die Scheine zu. Er wusste nicht, ob es die Tatsache war, dass sie den geforderten Vorschuss von zweitausend Euro bar und anstandslos bezahlte, oder die Art, wie sie ihn dabei anschaute, aber er hatte für eine Sekunde das Gefühl, dass irgendetwas an der Sache nicht stimmte. Aber als sie ihn wenig später mit Tränen in den Augen anlächelte und er die Dankbarkeit und Erleichterung in ihrem Gesicht sah, sagte er sich, dass der Tag am Grill ihm wohl das Hirn vernebelt haben musste. Sie war eine Frau, der man Schlimmes angetan hatte und die seine Hilfe benötigte. Was zum Henker konnte schon passieren, wenn er ein paar Tage aufs Land fuhr und einen Winzer beobachtete? Und danach einen Teil seiner Schulden los war?
Kapitel 3
Einige Tage später lehnte Henry an einer Hauswand am Offenburger Marktplatz und beobachtete Joseph Sandhaas aus gebührendem Abstand. Sandhaas saß an einem Tisch vor einer kleinen Kneipe, er war ein hagerer Mann Ende fünfzig, der Arbeitshosen mit Grasflecken und ein schwarzes T-Shirt trug. Er hatte gerade den zweiten Kaffee geordert, er trank ihn immer schwarz. Gleich würde er sich, wie jeden Abend, bestimmt einen Flammkuchen und einen Weißwein bestellen. Henry wurde wieder stinksauer, als er sich vorstellte, wie dieser widerliche Kerl, der hier seelenruhig aß und trank, Louise verfolgt, angegriffen und fast mit ihrer eigenen Halskette erdrosselt hatte. Ein bisschen wütend war er auch auf sich selbst. Seit gut einer Woche war er nun an dem Winzer dran. Hervorragend bezahlt, aber bisher leider ohne vorzeigbares Ergebnis. Sandhaas war in den letzten Tagen nicht nach Stuttgart gefahren, weder mit seinem roten Daimler mit den silbernen Kotflügeln, der im Moment offenbar ständig in der Garage stand, noch mit dem Lieferwagen des Weinguts. Er hatte auch keinerlei Vorstrafen, das hatte Henry gründlich geprüft, und es gab nicht den geringsten Hinweis darauf, dass er vor Louise Münz andere Frauen gestalkt oder angegriffen hatte. Sein dunkelstes Geheimnis schien zu sein, dass er bei Nacht manchmal nackt im Gifizsee schwimmen ging. Das Einzige, das Henry total merkwürdig gefunden hatte, war die Sache mit dem Gedenkstein. Sandhaas war am Donnerstagabend in den Wald gefahren, zu einem Gedenkstein gegen Hexenverbrennung. Und er hatte vor dem Stein drei Hunderteuroscheine verbrannt. Offensichtlich hatte der Typ einen an der Waffel. Aber das war noch kein Beweis dafür, dass er auf Louise Münz losgegangen war.
Henry hatte sich in der letzten Woche intensiv in Durbach umgehört, obwohl ihm die Landluft mit ihren brummenden Traktorengeräuschen Schauder des Grauens über den Rücken jagte, weil sie ihn an die erzwungenen sonntäglichen Boxwettkämpfe seiner Kindheit erinnerte, an Schläge in den Magen auf mit Heu gefüllten Boxplätzen und an zähe Jägerschnitzel. Er hatte bei seinen Recherchen mehr über den Weinbau erfahren, als ihm lieb war, aber nichts Relevantes über Sandhaas’ Privatleben. Er wusste nun zwar, dass der Winzer von seinen Kollegen als kleinlicher »Korindekagger« bezeichnet wurde und in einer schmutzigen Scheidungsgeschichte steckte, aber das brachte Henry verdammt nochmal keinen Schritt weiter im Fall seiner Klientin, zumal Louise das bereits gewusst hatte. Selbst das Gespräch mit der Noch-Ehefrau Conny Sandhaas unter dem Vorwand, er sei ein Hotelier aus Stuttgart und suche einen guten Weinhändler, war kurz und fruchtlos gewesen. Sie hatte ausschließlich über Wein geredet und das Gespräch sofort abgebrochen, als Henry versucht hatte, mehr über Joseph Sandhaas als Mensch zu erfahren. Die Eheleute, das wusste Henry von seinen Recherchen, die im Moment noch im selben Haus wohnten, lieferten sich seit Monaten einen erbitterten Scheidungskrieg, der wohl bereits zwei Fensterscheiben, eine Porzellanpuppensammlung, mehrere Rebstöcke und das Leben des Wachhundes gefordert hatte. Henry hatte am Vortag selbst beobachtet, wie Conny Sandhaas ihrem Noch-Ehemann mit den Worten, das Weingut gehöre ihr allein und sie bringe ihn um, wenn er das nicht akzeptiere, eine Dosis Haarspray ins Gesicht gesprüht hatte, sodass der Winzer taumelnd und mit tränenden Augen das Weite hatte suchen müssen. Das friedliche badische Landleben. Da lobte Henry sich doch die gesitteten Großstädter-Scheidungen in Stuttgart, bei denen Ehepartner und Großkanzleianwälte mit Pokerface Streitschlichtung schon im Vorfeld betrieben, indem sie das ganze Vermögen auf Offshorekonten verschwinden ließen, und es daher überhaupt nicht zu einem offenen Streit darüber kommen konnte, weil man offiziell pleite war. Er schüttelte den Kopf. Einmal hatte er immerhin gedacht, er habe endlich eine heiße Spur: Eine ältere Dame, die sich als gute Bekannte der Ehefrau Conny Sandhaas entpuppt hatte, hatte Henry auf seine Nachfrage flüsternd erzählt, der Joseph sei ein »gemeiner Frauenheld«. Henry hatte die Dame sofort auf ein »Lewwerkäs im Weggle« und einen Kaffee eingeladen, weil er gehofft hatte, die freundliche Bekannte der Ehefrau könnte ihm endlich einige schmutzige Details aus Sandhaas’ Leben liefern, vielleicht wusste sie ja sogar etwas über Stalking oder Vergewaltigung? Aber es hatte sich herausgestellt, dass die Vermutungen der Dame über den Winzer im Wesentlichen darauf beruht hatten, dass Joseph Sandhaas sich die Haare zu stark gelte, eine stilistische Sünde, sicher, die ihn jedoch noch nicht zum Kriminellen machte. Die Frau hatte gar nicht mehr aufgehört zu reden, hatte ausgeführt, Sandhaas sei »ein Querulant« und habe in den letzten Jahren alles torpediert, was Conny getan habe, sogar den lukrativen Verkauf eines Weinbergs an ein Hotel. Da seien ganz plötzlich geschützte Tierarten zwischen den Reben aufgetaucht, und das sei ja immer das Ende aller Bemühungen. Eine Bekannte von ihr habe das vor einem Jahr auch miterleben müssen, sie habe Badische Quellschnecken im Pool gehabt und nicht mehr baden dürfen, bis die Schnecken umgesiedelt worden seien. Bis Henry sich hatte loseisen können, hatte er so viel über Badische Quellschnecken und den Badischen Riesenregenwurm erfahren, dass er wahrscheinlich die nächsten Jahre Albträume davon haben würde. Allein die Vorstellung, wie ein Igel so einen riesigen Wurm keuchend hinunterwürgte … Er erschauderte, lehnte sich bequemer an die Wand und richtete den Blick wieder auf Sandhaas. Der war nun bei seinem Flammkuchen angelangt, und der Geruch nach kross gebratenem Speck und Zwiebeln, der bis zu ihm herüberwehte, ließ Henry das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sein Magen knurrte. Er würde noch ein paar Minuten warten, und seine Beschattung dann unterbrechen. Auch ein Detektiv musste essen. Heute Abend würde bei Sandhaas bestimmt nichts mehr passieren, so wie auch an den letzten Abenden nicht. Vielleicht würde er, Henry, in dieses Schoellmanns gehen, das sah angesagt aus, und man hatte sicherlich einen schönen Blick über Offenburg, während man sich beim Essen mit irgendwelchen badischen Gebräuen ins Nirwana lötete. Oder er konnte seine bisherigen Recherche-Misserfolge mit ein paar Bierchen im Brandeck-Biergarten betäuben, da war er am ersten Abend schon gewesen, und das Schnitzel mit Pommes hatte ihm fantastisch geschmeckt. Wenn er Lust hatte, konnte er danach ja nochmal hier am Marktplatz vorbeischlendern. Joseph Sandhaas war bestimmt noch eine Weile dort. Er trank seinen Wein unfassbar langsam, auch das hatte Henry in den letzten Tagen erfahren dürfen. »Wow«, grummelte er. Sandhaas war also ein riesenregenwurmschützender »Korindekagger« mit zu viel Gel im Haar, der langsam Wein trank, nackt im Gifiz schwamm, in Scheidung lebte und Geldscheine an einem Hexengedenkstein verbrannte. Das würde seiner Klientin, wenn sie Sandhaas bei der Polizei anzeigte, bestimmt weiterhelfen. Henry verschränkte die Arme vor der Brust. All seine Beobachtungen brachten ihn keinen Schritt weiter. Vielleicht sollte er die Beschattung abbrechen und nach Stuttgart zurückfahren? Er ballte die Hände zu Fäusten. Nein, so schnell gab ein Henry Marbach nicht auf! Er war nur hungrig, da bekam er manchmal schlechte Laune. Er konnte es nicht bringen, mit leeren Händen vor Louise zu stehen, die so sehr auf ihn zählte! In den letzten Tagen hatte sie ihn mehrfach angerufen und ihn angefleht, unbedingt weiter Beweise zu suchen. Bei diesen Gesprächen, die immer freundschaftlicher geworden waren, hatte sich herausgestellt, dass er und diese wundervolle Frau einige Gemeinsamkeiten hatten. Auch sie ging zum Beispiel ins Fitnessstudio. Irgendwann hatte sie ihm gestanden, dass sie muskulöse Kampfsportler mochte und dass sie ihn recht gutaussehend fand. Sie waren mittlerweile sogar per Du. Er interpretierte da selbstverständlich nichts hinein, aber es war doch schön, dass jemand die Mühe auffiel, die er in seinen Körper investierte. Er musste plötzlich lächeln. Natürlich war sie viele Jahre jünger als er, und natürlich würde er niemals mit einer Klientin etwas anfangen und ihre Notlage ausnutzen. Aber vielleicht würde er sie ja nach dem Abschluss des Falls mal ganz ohne Hintergedanken zum Essen einladen? Erneut knurrte Henrys Magen, laut und vernehmlich. Während er noch mit sich rang, ob er seine Pflichten vernachlässigte, wenn er jetzt sofort ins Brandeck ging, oder ob er sich nicht lieber nur eine Kleinigkeit beim Bäcker holen sollte, stürmte ein Mann an Sandhaas’ Tisch. Er war klein und dick und wirkte schmierig, wie ein Makler oder Versicherungsvertreter. Und er keuchte. An der Art, wie die beiden Männer sich begrüßten, mit angespannter Miene und ohne den geringsten Körperkontakt, erkannte Henry, dass sie sich überhaupt nicht ausstehen konnten. Dennoch setzte sich der Dicke zu Sandhaas an den Tisch, beugte sich zu ihm hinüber und redete so leise auf ihn ein, dass Henry nichts verstand. Sandhaas schlug mit der Faust auf seine Stuhllehne und sagte laut und aggressiv: »Doch, wir müssen uns sehr wohl unterhalten!« So schnell es unauffällig ging, näherte sich Henry dem Restaurant und schlenderte langsam daran vorbei, scheinbar in seine WhatsApp-Nachrichten vertieft. Versuchte, aus all den lauten Gesprächsfetzen das Gespräch zwischen Sandhaas und dem Schmierigen herauszufiltern: »… kommen wir halt zu spät.« »En scheene Gruß dahaim!«, »Lass mich einfach in Ruhe …« »Mach emol!« »Saulegger.« »Bass uff, Siglinde, daine Schäuffele.« »… dass mer vom Rad nunnerhagelt.« »Une très belle femme …« »… uffm Weinfeschd.« »Dem René seine Leiche war grausam zugerichtet!« Henry stoppte abrupt. Das war eindeutig Sandhaas’ Stimme gewesen. Dann ging er ein paar Schritte weiter, sodass er nicht mehr direkt neben Sandhaas’ Tisch stand, um die zwei nicht misstrauisch zu machen, trotzdem aber noch alles gut überblicken und hören konnte.
»Traurig, dass der René tot ist. Aber er war schon immer merkwürdig, und so ist es wahrscheinlich besser«, sagte Sandhaas’ Gesprächspartner gerade mit sichtlich schlecht geheucheltem Mitgefühl. »Für alle Beteiligten. War bestimmt eine furchtbare Sauerei. Nicht mal sterben konnte der anständig.«
Sandhaas beugte sich zu dem dicklichen Mann hin und senkte die Stimme: »Dem René sein Tod war kein Selbstmord, wenn die das rausfinden …« Der Rest des Satzes ging im schallenden Gelächter einer großen französischen Reisegruppe unter, neben deren Tisch Henry stand. Henry machte ein paar Schritte zurück zu Sandhaas’ Tisch.
»… nur ein Unfall! Die Bullen haben den Fall abgeschlossen«, sagte der Dickliche halblaut. »Der René war ein Säufer. Es war abzusehen, dass er mal so enden wird. Er war zu bis obenhin und hat sich einfach den falschen Schlafplatz ausgesucht. Vielleicht konnte er auch seine Visage im Spiegel nicht mehr ertragen und hat sich absichtlich vor den ICE geworfen, was weiß ich? Wie oft sollen wir das noch diskutieren? Ein elendes Jahr ist das jetzt her. Ich …«
Erneut ertönte lautes Gelächter, das gar nicht mehr enden wollte und immer wieder neu entflammte. Egal, wo Henry sich hinstellte, es waren nur winzige Fetzen des Gesprächs zwischen dem Winzer und seinem Gesprächspartner zu verstehen. »… finde ich das schon auffällig …« »… Fragen zu stellen!« Für eine Sekunde fuhr es Henry eiskalt in den Bauch, weil er sich überlegte, ob Sandhaas seine Beschattung bemerkt haben könnte, aber dann sagte der Dickliche etwas, das sich wie »es gibt keine Geister« anhörte. Wieder schwoll der Geräuschpegel an. Als das Lachen und Schnattern ein wenig abgeflaut war, sagte Sandhaas’ Gesprächspartner: »Nein, du hast Dreck am Stecken! Ich habe nie etwas …«
»Ach, wirklich? Willst du mich verarschen?«, unterbrach ihn Sandhaas mit sich überschlagender Stimme, bevor die Reisegruppe in grölendes Lachen ausbrach. Henry sah, wie Sandhaas mehrfach mit der flachen Hand auf den Tisch schlug. »… des Totengräbers«, sagte der Winzer schließlich wieder deutlich vernehmbar, als die Franzosen sich endlich ausgegrölt hatten. Seine Stimme klang panisch.
Der Dickliche stand schwerfällig auf. »Bullshit! Die hat keine Ahnung, die blufft nur!«, zischte er. »Du bist vollkommen durchgeknallt! Muss stressig sein im Moment für dich. Ich meine, ich kenne deine Conny ja nicht gut, aber man hört, dass sie dir gewaltig Feuer unter dem Arsch macht. Du wirst bald wieder so bettelarm sein wie damals. Kein Wunder, dass dir deine Scheidung so zusetzt und du total verwirrt bist!«
Sandhaas lachte bitter auf. »Meine Scheidung sollte dir auch zusetzen, mein lieber Daniel. Dir ganz besonders«, sagte er. »Du weißt ja, was danach passieren wird.«
Was sein Gesprächspartner antwortete, verstand Henry nicht, weil sich die Reisegruppe lautstark zuprostete. Aber das Gesicht des Dicklichen sah plötzlich fahl aus, fast grünlich. Als habe ihm das, was auch immer nach Sandhaas’ Scheidung passieren würde, gewaltig auf den Magen geschlagen. Henry sah nur noch, wie der Dickliche aufstand und zügig über den Marktplatz in Richtung Hauptstraße ging.
Kapitel 4
Da Henry vermutete, dass Sandhaas wie sonst auch nach dem Abendessen einfach nach Hause fahren würde, entschied er sich, dem dicklichen Daniel zu folgen. Er musste unbedingt herausfinden, worum es bei dem Gespräch gegangen war! Welchen Dreck Sandhaas am Stecken hatte! War der Selbstmord dieses René, der anscheinend kein Selbstmord war, etwa ein Gewaltverbrechen? Hatte Sandhaas damit irgendetwas zu tun? Wenn er das nachweisen konnte, würde das Louise wirklich weiterhelfen! Und er konnte vielleicht sogar noch einen Todesfall aufklären. Jetzt brauchte er nur noch eine gute Gelegenheit, um diesen Daniel anzusprechen. Der konnte den Winzer offenbar nicht leiden, eine gute Voraussetzung, um ihm alles zu entlocken, was er über Sandhaas wusste. Wenn man es geschickt anstellte. Wie genau, das musste Henry sich noch überlegen, aber ihm würde etwas einfallen. Der Mann ging zügig erst die Hauptstraße entlang, dann bog er neben der Buchhandlung Roth in eine Gasse ein und lief durch die Klosterstraße. Das Gespräch mit Sandhaas hatte ihn offensichtlich aufgeregt. Er keuchte, und große Schweißflecken hatten sich auf seinem hellblauen Hemd gebildet. Einmal blieb er kurz stehen und las etwas auf seinem Handy. Es war noch recht früh am Abend und ziemlich heiß. Die Stadt war voller Menschen, die zwischen den bunten Häusern über das Kopfsteinpflaster schlenderten. Es roch süß nach irgendeiner Blüte und an einer Ecke so verlockend nach Crêpes, dass es Henry fast schwindlig wurde. Sein Magen knurrte wütend. Trotzdem folgte er dem Mann weiter, der nun einen Hut aufgesetzt und tief ins Gesicht gezogen hatte, den Blick starr auf den Boden gerichtet, als wolle er nicht, dass ihn jemand erkannte. Er ging zügig, rannte fast. Henry blieb so weit entfernt wie möglich und verbarg sich immer wieder in Hauseingängen, jederzeit bereit, sich wenigstens das Nummernschild zu notieren, sollte der Typ irgendwo ein Auto geparkt haben und damit wegfahren. Schließlich erreichte Daniel das Ende der Fußgängerzone und folgte weiter der Hauptstraße, die nun zu einer viel befahrenen Straße wurde. Autos rauschten an ihnen vorbei. Eine Weile ging der Dickliche einfach geradeaus. Dann, ohne Vorwarnung, lief er über die Straße, und unter Hupen und dem Gequietsche von Bremsen hetzte er auf der anderen Straßenseite zwischen Häusern durch und außer Sicht. Henry, der für eine Sekunde von Pizzageruch abgelenkt worden war, der aus dem Fenster eines Restaurants drang, und einen winzigen Blick auf die Speisekarte riskiert hatte, um zu sehen, ob es Pizza Calzone gab, konnte nicht schnell genug reagieren. Auto folgte auf Auto, und bis er die Straße überquert hatte, war der Mann verschwunden. Henry fluchte und durchstreifte ziellos noch ein paar Straßen. Nichts. Das hatte er ja wirklich geschickt angestellt. Himmel, er wurde alt. Wegen einer verdammten Calzone hatte er ein Zielobjekt verloren! In Baden bezeichnete man so jemanden vermutlich als »Dranfunsel«.
So schnell er konnte, ging Henry zurück zum Marktplatz. Wahrscheinlich hätte dieser Daniel sowieso nicht mit ihm geredet. Trotzdem hätte er zumindest herausfinden können, wer der Typ war! Henry spürte, wie sein Gesicht vor Ärger und Scham heiß wurde. Ein K. o., bevor der Kampf richtig angefangen hatte, so was durfte einem Profiboxer schlicht und ergreifend nicht passieren!
Am Marktplatz angekommen musste er feststellen, dass Sandhaas nicht mehr an seinem Tisch saß. Hoffentlich fuhr er gerade nur nach Hause und nicht nach Stuttgart, um Louise zu stalken! Verdammt, wie konnte man an einem einzigen Tag so viele Anfängerfehler machen? Henry rannte zu seinem Porsche, der wie immer im Parkhaus Marktplatz stand, und brauste nach Durbach, während sein Magen grässlich knurrte. Er kämpfte mit dem Gelüst, eine zu rauchen. Schweißgebadet kam er bei Sandhaas’ Anwesen an. Mit heruntergelassenen Scheiben fuhr er langsam an dem Haus vorbei, das in einem großen, naturnahen Garten unterhalb eines Weinbergs lag. Durch die weit geöffnete Balkontüre konnte er bis ins Auto Sandhaas’ Stimme hören, die schrie: »Wenn du mir nicht sofort die Fernbedienung wiedergibst, zerhacke ich deinen Heilkräutergarten!« Henry atmete auf. Das hörte sich nach einem gemütlichen Fernsehabend der Noch-Eheleute Sandhaas an und nicht nach Stalking in Stuttgart. Wenigstens das. Er konnte wohl Feierabend machen.
Zuerst aß er in einem nahegelegenen Gasthaus ein riesiges Pilzomelett mit einem knackigen Salat und gönnte sich ausnahmsweise noch einen Nachtisch, einen Pfannkuchen mit Zimt und Zucker und einem Apfelmus, so säuerlich-fruchtig, wie er noch nie eins gekostet hatte. Trotzdem war er auch auf dem Heimweg immer noch sauer auf sich wegen seiner Ermittlungspannen. Vielleicht würde er morgen mal mit Joseph Sandhaas direkt sprechen? Würde ihn mit den Vorwürfen konfrontieren, die Louise erhoben hatte, und ihn dann gleich noch nach diesem toten René fragen? Aber das musste er mit Louise absprechen, denn sie wollte ja eigentlich nicht, dass Sandhaas von der Beschattung erfuhr.
Als Henry wieder in seinem Hotelzimmer war, dachte er bei weit aufgerissenen Fenstern noch eine Weile über das Gespräch zwischen Sandhaas und dem Dicklichen nach, vor allem darüber, wer dieser tote René gewesen sein könnte. Er googelte den Namen René mit der Jahreszahl vom Vorjahr, Unfall, ICE