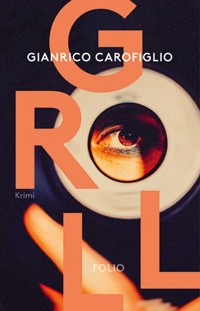9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Sommer 1992 ist ein extrem kalter Sommer in Süditalien. Und es ist der Sommer der brutalen Mafia-Anschläge auf die Staatsanwälte Falcone und Borsellino. In Bari wütet derweil ein regelrechter Krieg zwischen verschiedenen Mafia-Gangs. Als der Sohn des Clanführers Grimaldi entführt und kurz darauf tot aufgefunden wird, übernimmt Maresciallo Fenoglio die Ermittlungen. Der Verdacht fällt schnell auf Grimaldis Gegenspieler Lopez, der Fenoglio daraufhin Informationen anbietet, um seine Familie zu schützen. Doch ist Lopez wirklich für den Tod des Jungen verantwortlich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Sommer 1992: In Bari und Umgebung herrschen unruhige Zeiten. Zwischen verschiedenen Mafia-Gangs ist ein regelrechter Krieg entbrannt. Und als der kleine Sohn des Clanführers Grimaldi entführt wird, versteht Maresciallo Pietro Fenoglio, dass ein Punkt erreicht ist, an dem es kein Zurück mehr gibt. Doch dann beschließt Grimaldis Gegenspieler Lopez, der den Krieg ausgelöst hat und der von allen der Entführung verdächtigt wird, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. So erfährt Fenoglio einiges über die Strukturen der apulischen Mafia und über Lopez’ bisherige Verbrechen. Aber ist er auch wirklich der Mörder des inzwischen tot aufgefundenen Jungen?
Weitere Informationen zu Gianrico Carofiglio sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Gianrico Carofiglio
Kalter Sommer
Roman
Aus dem Italienischen von Verena v. Koskull
Die italienische Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel »L’estate fredda« bei Einaudi.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2018
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Gianrico Carofiglio
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Christina Neiske
AG · Herstellung: Han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-21918-5V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
ERSTER AKT
Tage des Feuers
1
Mit der frisch gekauften Zeitung in der Jackentasche betrat Fenoglio das Caffè Bohème und setzte sich an den Tisch am großen Fenster. Er mochte das Lokal, denn der Wirt war ein großer Musikliebhaber und legte jeden Tag ein buntes Potpourri berühmter Romanzen und Orchesterstücke auf. An diesem Morgen erklang das Zwischenspiel der Cavalleria rusticana, und Fenoglio fragte sich, ob das angesichts dessen, was sich in der Stadt abspielte, ein Zufall war.
Der Barmann bereitete ihm seinen üblichen extrastarken Cappuccino und brachte ihn mit einem mit Creme und Kirschmarmelade gefüllten Bocconotto an seinen Tisch.
Alles war wie immer. Die Musik spielte dezent, aber für den, der sie hören wollte, gut vernehmbar. Die Stammgäste kamen und gingen. Er aß sein Frühstücksgebäck, nippte am Cappuccino und blätterte durch die Zeitung. Im Nachrichtenteil ging es vor allem um den Mafiakrieg, der in den nördlichen Stadtvierteln ausgebrochen war, und um die unerfreuliche Tatsache, dass weder die Polizei noch die Carabinieri oder die Staatsanwaltschaft wussten, was los war.
Er las einen Artikel, in dem der Chefredakteur eine Fülle kluger Ratschläge vom Stapel ließ, um den Ermittlern zu erklären, wie mit der Sache zu verfahren sei. Die aufwühlende Lektüre zog ihn so sehr in den Bann, dass er den jungen Mann mit der Spritze erst bemerkte, als dieser bereits brüllend vor der Kassiererin stand.
»Her mit der Kohle, Fotze!«
Wie versteinert stand die Frau da. Der Junge reckte ihr die Spritze ins Gesicht. Er habe Aids, blaffte er heiser in nahezu unverständlichem Dialekt. Sie solle alles rausrücken, was in der Kasse sei, brüllte er noch einmal. Mit angstgeweiteten Augen zog sie wie in Zeitlupe die Schublade auf und fingerte das Geld heraus.
Gerade wollte sie dem Räuber das Geld geben, da schlossen sich Fenoglios Finger um dessen Handgelenk. Der Kerl versuchte herumzuwirbeln, doch mit einer geradezu anmutigen Halbdrehung bog Fenoglio ihm den Arm auf den Rücken, packte ihn mit der anderen Hand bei den Haaren und riss ihm den Kopf nach hinten.
»Lass die Spritze los.«
Mit ersticktem Grunzen versuchte sich der Junge aus Fenoglios Griff zu winden. Fenoglio packte härter zu und riss seinen Kopf noch weiter nach hinten. »Ich bin Carabiniere.« Mit einem trockenen Klacken fiel die Spritze zu Boden.
Die Kassiererin brach in Tränen aus. Die anderen Gäste fingen wieder an sich zu rühren, erst zaghaft, dann in Normalgeschwindigkeit, als hätte man sie von einem Bann befreit.
»Nicola, ruf die 112«, sagte Fenoglio zum Barmann, da die Kassiererin nicht in der Verfassung schien, ein Telefon zu bedienen.
»Hinknien«, sagte er dann zu dem Jungen. Es klang so freundlich, dass man fast damit rechnete, dass er noch ein »bitte« hinzufügen würde. Nachdem der Junge auf die Knie gegangen war, ließ Fenoglio seine Haare los und lockerte den Griff, als wäre es eine reine Formsache ihn festzuhalten.
»Jetzt leg dich mit dem Gesicht auf den Boden und verschränk die Hände hinter dem Kopf.«
»Keine Handschellen!«, flehte der Junge.
»Rede keinen Quatsch und leg dich hin. Ich habe keine Lust, so stehen zu bleiben, bis der Wagen kommt.«
Der Junge stöhnte resigniert, bevor er sich mit fast kindlicher Ergebenheit auf den Boden legte, den Kopf zur Seite drehte und die Hände im Nacken faltete.
Draußen hatte sich eine kleine Menschentraube gebildet. Einige Gäste waren hinausgegangen und berichteten, was passiert war. Die Leute wirkten aufgekratzt, als hätte der Kampf gegen die wachsende Kriminalität nun endlich begonnen. Irgendjemand schrie. Zwei junge Kerle betraten die Bar und steuerten auf den Räuber zu.
»Wo wollt ihr denn hin?«, fragte Fenoglio.
»Überlassen Sie den uns«, sagte der Nervösere der beiden, ein pickliger, schmächtiger Kerl mit Brille.
»Aber gern. Was habt ihr mit ihm vor?«
»Wir treiben’s ihm aus«, sagte der andere und machte einen Schritt nach vorn.
»Wart ihr schon mal bei uns auf der Wache?«, fragte Fenoglio mit einem verbindlichen Lächeln.
Der Junge wusste nicht, was er sagen sollte. »Nein, wieso?«
»Weil ich dafür sorgen werde, dass ihr den ganzen Tag und womöglich noch die ganze Nacht dort verbringen werdet, wenn ihr nicht augenblicklich Leine zieht.«
Die beiden sahen sich an. Der Picklige grunzte überheblich, der andere hob die Schultern und zog eine verächtliche Fresse, dann verließen sie die Bar. Die kleine Menschentraube löste sich auf.
Ein paar Minuten später trafen die Streifenwagen ein, zwei Carabinieri-Wachtmeister und ein Brigadiere in Uniform betraten die Bar und grüßten Fenoglio mit einer Mischung aus Ehrerbietung und verhohlenem Argwohn. Sie legten dem Jungen Handschellen an und zerrten ihn unsanft auf die Füße.
»Ich fahre mit euch mit«, sagte Fenoglio, nachdem er seinen Cappuccino und den Bocconotto gegen den Widerstand des Barmanns bei der Kassiererin bezahlt hatte.
2
»Ich hab dich schon mal irgendwo gesehen«, sagte Fenoglio und drehte sich zu dem frisch Festgenommenen auf dem Rücksitz um.
»Abends, wenn’s Vorstellungen gab, war ich immer beim Teatro Petruzzelli. Hab da den Parkwächter gemacht. Bestimmt haben Sie mich dort gesehen.«
Aber natürlich. Bis vor ein paar Monaten hatte er als illegaler Parkwächter am Petruzzelli gearbeitet. Dann hatte der Brand das Theater zerstört, und er hatte seinen Job verloren. Genau so drückte er sich aus: »Ich habe meinen Job verloren«, als wäre sein Arbeitgeber pleitegegangen oder hätte ihn rausgeschmissen. Dann hatte er sich darauf verlegt, Zigaretten zu verhökern und Autoradios zu klauen.
»Aber das bringt kaum was ein. Einbrüche sind nichts für mich, also habe ich gedacht, ich könnte es mit Überfällen mit der Spritze versuchen.«
»Bravo, tolle Idee. Und wie viele Überfälle hast du gemacht?«
»Keinen, Herr Wachtmeister. Das ist ja die Scheiße. Es war das erste Mal, und da laufen Sie mir über den Weg. So ein Pech aber auch.«
»Er ist nicht Wachtmeister, sondern Maresciallo«, korrigierte ihn der Carabiniere am Steuer.
»Entschuldigen Sie, Maresciallo. Ohne Uniform konnte ich das nicht wissen. Es war mein Erster, ich schwöre.«
»Glaube ich nicht«, sagte Fenoglio. Doch das stimmte nicht. Er glaubte dem Jungen, er war ihm sympathisch. Seine Art zu reden hatte etwas Komödiantisches, in einem anderen Leben hätte er Schauspieler oder Kabarettist sein können.
»Ich schwöre. Außerdem bin ich gar nicht drogenabhängig, und Aids habe ich auch nicht. Alles Schwachsinn. Ich scheiße mir schon in die Hosen, wenn ich nur eine Spritze sehe. Wenn Schwachsinn labern ein Verbrechen wäre, müsste ich ›lebenslänglich‹ kriegen. Ich bin halt ’n Loser. Legen Sie im Bericht ein gutes Wort für mich ein; schreiben Sie, dass ich mich gut betragen habe.«
»Das hast du tatsächlich.«
»Stellen Sie sich vor, die Spritze ist nagelneu, ich hab nur ein bisschen Jodtinktur drangemacht, damit es aussieht wie Blut.«
»Du redest ganz schön viel, oder?«
»Entschuldigen Sie, Maresciallo. Ich hab halt Muffe, ich war noch nie im Knast.«
Am liebsten hätte Fenoglio ihn laufen lassen. Am liebsten hätte er dem Carabiniere am Steuer gesagt: Halt an und gib mir die Handschellenschlüssel. Dann hätte er den Jungen losgemacht – er wusste noch immer nicht, wie er hieß – und ihn aus dem Auto geschmissen. Leute zu verhaften war ihm schon immer zuwider gewesen, und allein der Gedanke an Gefängnis verschaffte ihm Beklemmungen. Als Maresciallo der Carabinieri behielt man so etwas allerdings besser für sich. Natürlich gab es Ausnahmen – bei gewissen Straftaten und gewissen Leuten hatte er mit einer Festnahme kein Problem, etwa bei dem Typen, den sie vor ein paar Monaten geschnappt hatten: Monatelang hatte er seine neunjährige Enkelin vergewaltigt – die Tochter seiner Tochter.
Er hatte seine Leute nur mühsam davon abhalten können, ihm einen kleinen Vorgeschmack von Gerechtigkeit zu geben und ihn windelweich zu prügeln. Manchmal waren Vorschriften wirklich hinderlich.
Natürlich konnte er den Jungen nicht laufen lassen, damit hätte er gleich gegen mehrere Gesetze verstoßen. Aber in letzter Zeit kamen ihm derlei abwegige Gedanken immer öfter. Er machte eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er eine Fliege verscheuchen.
»Wie heißt du?«
»Albanese Francesco.«
»Und du sagst, du warst noch nie im Bau?«
»Noch nie, ich schwöre.«
»Du warst also clever genug, dich nicht schnappen zu lassen.«
Der Junge grinste. »Ich hab ja nix Schlimmes gemacht. Wie gesagt, Kippen verticken, Autos knacken, Ersatzteile verscherbeln.«
»Und ein bisschen Gras verkaufst du auch, oder?«
»Na gut, ein paar Krümel, was ist schon dabei? Ihr verhaftet mich doch jetzt nicht auch für das, was ich euch obendrauf verrate?«
Ohne zu antworten, schaute der Maresciallo nach vorn auf die Straße.
Sie erreichten die Dienststelle des mobilen Einsatzkommandos. Hastig schrieb Fenoglio das Verhaftungsprotokoll und trug einem der beiden Einsatzbeamten auf, die Papiere für die Staatsanwaltschaft und das Gefängnis fertig zu machen und den Staatsanwalt zu informieren. Dann wandte er sich dem Jungen zu.
»Ich gehe jetzt. Du wirst noch heute Vormittag dem Richter vorgeführt. Wenn du mit deinem Anwalt redest, sag ihm, du willst einen Vergleich. Dann kriegst du Bewährung und musst nicht in den Knast.«
Der Junge sah ihn an wie ein Hund, dem sein Herrchen gerade einen Dorn aus der Pfote gezogen hat.
»Danke, Maresciallo. Wenn Sie irgendetwas brauchen, ich bin immer in Madonnella und beim Petruzzelli unterwegs, Sie finden mich in der Bar del Marinaio. Stets zu Diensten.«
Die neuerliche Erwähnung des Teatro Petruzzelli machte Fenoglio schlechte Laune. Vor ein paar Monaten hatte jemand das Theater in Brand gesetzt, und er kam einfach nicht darüber hinweg. Wie konnte man bloß im Entferntesten auf so etwas Abscheuliches kommen? Ein Theater niederbrennen! Und dann die geradezu unerträgliche Ironie – niemand wusste, ob es ein Zufall gewesen war oder ob die Brandstifter dem Ganzen ein makabres i-Tüpfelchen hatten aufsetzen wollen –, es ausgerechnet nach einer Vorstellung der Norma abzufackeln, die mit einem Scheiterhaufen endet.
Das Petruzzelli war einer der Gründe gewesen, weshalb Fenoglio so gern in Bari lebte.
Das riesige Theater mit zweitausend Sitzplätzen lag fußläufig von der Kaserne. Wenn es ein Konzert oder eine Oper gab, war Fenoglio oft bis abends im Büro geblieben und von dort geradewegs in den stuckverzierten dritten Rang hinaufgestiegen. Wenn er dort saß, glaubte er fast an Wiedergeburt. Er lauschte der Musik so intensiv – besonders der einiger Barockkomponisten, vor allem Händel –, dass ihm war, als wäre er in einem früheren Leben deutscher Provinzkapellmeister gewesen.
Und jetzt, da das Theater nicht mehr stand? Niemand wusste, ob es wieder aufgebaut würde und ob die Verantwortlichen je geschnappt, vor Gericht gestellt und verurteilt würden. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Verfahren wegen mutwilliger Brandstiftung gegen Unbekannt eröffnet. Eine schöne Art zu sagen, dass sie nicht den blassesten Schimmer hatten, was passiert war. Fenoglio hätte sich liebend gern um den Fall gekümmert, aber der war anderen übertragen worden, ohne dass er etwas dagegen hatte tun können.
»In Ordnung, Albanese. Mach keine Dummheiten. Zumindest nicht zu viele«, sagte er, versetzte ihm einen Klaps auf die Schulter und machte sich auf den Weg in sein Büro.
Vor der Tür wartete ein junger Carabiniere.
»Capitano Valente will mit Ihnen reden. Sie sollen zu ihm kommen.«
Capitano Valente war der neue Leiter der Einsatzabteilung. Fenoglio war noch nicht dahintergekommen, ob ihm der Kerl angenehm war oder nicht. Vielleicht beides. Er war anders als sämtliche Carabinieri-Offiziere, mit denen er in den letzten zwanzig Jahren zu tun gehabt hatte.
Valente war erst vor ein paar Tagen zu ihnen gekommen, während der Verbrecherkrieg, dessen tieferen Sinn noch niemand begriffen hatte, in vollem Gange war. Er kam vom Oberkommando in Rom, und keiner wusste, weshalb er nach Bari versetzt worden war.
»Kommen Sie herein, Maresciallo Fenoglio«, sagte Valente, als Fenoglio in der Tür auftauchte.
Das war eine weitere Eigenheit, die Fenoglio ratlos machte: Capitano Valente siezte alle und stellte dem Nachnamen stets den Dienstgrad voran. Die ungeschriebene Umgangsregel für Offiziere besagt, dass man Vorgesetzte siezt und Untergebene duzt und sie beim Nachnamen, wenn nicht gar beim Vornamen nennt. Gleichrangige duzen sich natürlich. Zwischen Unteroffizieren und unteren Dienstgraden ist die Sache weniger eindeutig, aber dass der Leiter einer Einsatzabteilung sämtliche Mitarbeiter siezt, ist äußerst ungewöhnlich.
Wieso tat er das? Wollte er Distanz wahren? War er besonders förmlich? Oder besonders schüchtern?
»Guten Tag, Signor Capitano.«
»Setzen Sie sich«, sagte Valente und deutete auf einen Stuhl. Die Mischung aus Förmlichkeit und Freundlichkeit war schwer einzuordnen. Dazu die Einrichtung des Büros: keine Wimpel, keine Abzeichen, keine Militärkalender. Nichts deutete darauf hin, dass dies das Büro eines Capitanos der Carabinieri war. Es gab einen Fernseher, eine passable Stereoanlage, ein kleines Sofa und mehrere Sessel, dazu einen kleinen Kühlschrank und ein paar expressionistische Bilder, die entfernt an Egon Schiele erinnerten. In der Luft lag ein leiser Duft, der höchstwahrscheinlich von einem Holzstäbchen-Diffusor stammte. Ein nicht gerade militärischer Gegenstand.
»Ich will schon seit zwei Tagen mit Ihnen reden. Wie es aussieht, bin ich in einem denkbar schlechten Moment nach Bari gekommen.«
»Das kann man wohl sagen, Signor Capitano. Und nach dem Unfall des Oberkommissars haben Sie noch nicht einmal Verstärkung.«
Der Oberkommissar hatte sich beim Fußballspielen das Bein gebrochen und würde für drei Monate ausfallen. Plötzlich stand die Einsatzgruppe mit einem neuen Capitano da, der keine Ahnung von der Stadt und ihrer Kriminalgeografie hatte, und musste mitten in einem Mafiakrieg ohne ihren zweiten Chef auskommen.
»Erklären Sie mir, was in der Stadt vor sich geht?«, bat Valente.
3
»Das Ganze hat am 12. April begonnen, mit dem Mord an Gaetano D’Agostino, genannt der Kurze. Er wurde während eines Besuches bei seiner Mutter im Viertel Libertà erschossen. Er wohnte in Enziteto – ein ziemlich übles Pflaster, um es gelinde auszudrücken – und gehörte zum Clan von Nicola Grimaldi, genannt der Blonde oder Dreizylinder.«
»Wieso Dreizylinder?«
»Grimaldi leidet an einem Herzfehler, einer Herzrhythmusstörung. Ich weiß nicht, wie der exakte medizinische Terminus lautet. Jedenfalls spielt der Spitzname darauf an, dass sein Herz auf drei Zylindern läuft statt auf vier. Allerdings würde niemand wagen, ihn in seiner Gegenwart so zu nennen.«
»Der Name passt ihm nicht.«
»So ist es.«
»Sie sagten, D’Agostino war ein Mann von Grimaldi. Also wurde er von einem gegnerischen Clan umgebracht?«
»Leider ist die Sache nicht so einfach. Die Ermittlungen in diesem Mordfall werden vom mobilen Einsatzkommando geleitet; sie waren als Erste am Tatort, auch wenn wir ebenfalls eine Akte haben. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass uns keine Fehden zwischen Grimaldi und anderen kriminellen Banden in der Stadt und Umgebung bekannt sind. Wenn es welche gäbe, hätte es auch auf der anderen Seite Opfer gegeben. Tote Bandenmitglieder in den Vierteln San Paolo, Bitonto oder Giovinazzo zum Beispiel. Aber Fehlanzeige, sämtliche Opfer gehörten zu Dreizylinder, im Rest der Stadt herrscht Ruhe.«
»Das heißt?«
»Man muss wohl von einem internen Konflikt ausgehen. Seit dem 23. April ist Capocchiani Michele, einer von Grimaldis Stellvertretern, genannt ›u Puerc‹, das Schwein, spurlos verschwunden. Er ist vorbestraft und brandgefährlich. Seine Frau hat ihn als vermisst gemeldet, und ein paar Tage später haben wir sein ausgebranntes Auto gefunden, allerdings ohne Leiche. Am 29. April erfolgte der Mord an Gennaro Carbone, genannt der Queue …«
»Der Queue?«
»Offenbar war Carbone ein begnadeter Billardspieler. Er wurde vor der Spielhalle umgebracht, die er für Grimaldi in Santo Spirito führte. Es war ein besonders brutaler Mord mit automatischen Waffen. Die Killer hatten ein Maschinengewehr und eine 44er Magnum – selbst verformt sind die Geschosse unverkennbar. Ein Passant wurde von einem Querschläger aus dem Maschinengewehr verletzt. Vor ein paar Tagen, am 9. Mai, ist ein ähnlicher Anschlag auf einen gewissen Andriani verübt worden, sein Vorname fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls war auch er einer von Grimaldis Leuten. Er hat wie durch ein Wunder überlebt. Ein weiterer vertraulicher Hinweis, dem wir nachgegangen sind, betrifft das Verschwinden von Simone Losurdo, genannt die Mücke. Niemand hat ihn als vermisst gemeldet, doch er stand unter Sonderbewachung, und seit dem 21. April, also zwei Tage vor der Vermisstenmeldung von Capocchiani, hat er sich nicht mehr im Polizeipräsidium gemeldet.«
»Was sagen die Angehörigen?«
»Losurdos Frau stammt aus einer alten Mafiafamilie. Die machen bei uns nie den Mund auf. Wir haben sie nach dem Verbleib ihres Mannes gefragt, und sie hat geantwortet, er würde ihr nicht erzählen, was er treibt. Er komme und gehe, wie es ihm passt. Aber sie war ziemlich aufgewühlt. Ich glaube, Losurdo ist tot. Das Interessanteste an der ganzen Geschichte ist allerdings das Verschwinden von Vito Lopez, genannt der Metzger.«
»Wieso der Metzger?«
Fenoglio schüttelte lächelnd den Kopf. »Der Spitzname hat nichts mit den Morden zu tun, die er zweifellos begangen hat. Der Vater hatte eine gut gehende Metzgerei. Lopez hätte es nicht nötig gehabt, zum Verbrecher zu werden.«
»Und Sie meinen, sein Verschwinden ist von besonderer Bedeutung?«
»Wie Capocchiani ist Lopez einer von Grimaldis Stellvertretern, möglicherweise der angesehenste und zweifellos der schlauste. Seit einigen Tagen hat man seine Spur verloren. Im Unterschied zu den anderen wissen wir nicht, wann genau er verschwunden ist – wir wissen nur, dass er seit Ende April nicht mehr gesehen wurde. Da auch seine Frau und sein Sohn verschwunden sind, glaube ich nicht, dass Lopez tot ist, sondern dass er mit der Familie abgehauen ist. Das würde auch mit den Informationen unserer V-Leute zusammenpassen, die behaupten, in Grimaldis Gruppe sei es zu einem Zerwürfnis gekommen. Deshalb auch die Morde und die spurlos verschwundenen Personen.«
Der Capitano strich mit der Hand über die Schreibtischplatte, als wollte er die Beschaffenheit des Holzes prüfen. Er zog eine Schublade auf, holte ein silbernes Zigarettenetui hervor und hielt es Fenoglio hin.
»Rauchen Sie, Maresciallo?«
»Nein, danke, Signor Capitano.«
»Stört es Sie, wenn ich eine rauche?«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Wir öffnen trotzdem das Fenster.«
Fenoglio wollte aufstehen, doch der Capitano kam ihm zuvor. Er riss das Fenster auf, kehrte an seinen Platz zurück und zündete sich die Zigarette an.
»Welche Maßnahmen laufen gerade?«
»Wir haben zahlreiche Leute befragt, aber ohne Ergebnis. Wir haben ziemlich viele Telefone angezapft, doch das hat ebenfalls nichts gebracht. Inzwischen benutzen alle diese Typen Handys, und die sind ziemlich schwer abzuhören, wie Sie wissen. Wir sollten eine Abhöraktion bei Grimaldi durchführen, aber in sein Haus zu kommen ist so gut wie unmöglich. Man könnte die Telefongesellschaft um Unterstützung bitten. Die könnten eine Störung für das ganze Wohnhaus simulieren, und wenn der Kundendienst gerufen wird, schicken wir unsere Leute in Technikerkluft, um ein paar Wanzen zu installieren. Wenn Sie einverstanden sind, könnten wir die Staatsanwaltschaft um eine Genehmigung ersuchen.«
Mit erhobenen Händen breitete der Capitano die Arme aus, als wollte er sagen: Klar, selbstverständlich, alles, was nötig ist! Es war eine fast theatralische Geste, der missglückte Versuch, einer Rolle gerecht zu werden.
»Wer ist der zuständige Staatsanwalt?«
»Es gibt verschiedene Zuständigkeiten, absurderweise sind die Ermittlungen aufgeteilt. Der Carbone-Mord, um den wir uns kümmern, wird von Dottoressa D’Angelo geleitet, die meiner Meinung nach die Beste ist, auch wenn die Zusammenarbeit manchmal ein bisschen kniffelig ist. Aus charakterlichen Gründen, meine ich. Aber sie ist immer zur Stelle, weiß genau Bescheid und beschäftigt sich schon eine ganze Weile mit dem Thema. Ich glaube, vorher war sie in Kalabrien.«
Fenoglio hielt inne; der Capitano schien etwas sagen zu wollen. Als ihm klar wurde, dass dem nicht so war, fuhr er fort.
»Wir können sie in den nächsten Tagen aufsuchen, und ich stelle sie Ihnen vor.«
»Klar, aber sicher, das machen wir.« Valente setzte eine interessierte Miene auf und sah aus, als wünschte er sich insgeheim, ganz woanders zu sein.
»Ich kann Ihnen auch eine schriftliche Kurzfassung meiner Schilderungen zukommen lassen«, fügte Fenoglio hinzu.
»Nein, danke, das ist nicht nötig. Ihre Schilderung war sehr klar und ausführlich. Demnächst gehen wir die Dottoressa besuchen und besprechen die Abhöraktion und alles Weitere.«
Bei den letzten Worten stand er auf und deutete ein verhaltenes Lächeln an, als wollte er sich für etwas entschuldigen.
4
Um halb zwei schloss Fenoglio die Akte, die er gerade gelesen hatte, klappte seinen Notizblock zu, zog ein Buch aus seiner kleinen Büro-Bibliothek und ging essen.
Die Trattoria lag am Corso Sonnino, fünf Minuten von der Kaserne entfernt. Sie war vor allem abends gut besucht, und genau das gefiel Fenoglio an ihr: Mittags war meist nur wenig los, und so konnte er sich an seinen Stammplatz setzen, lesen und Musik auf dem Walkman hören und bleiben, so lange er wollte.
Seit Serena vor nunmehr zwei Monaten gegangen war, aß er fast jeden Tag dort. Ich brauche eine Pause, hatte sie gesagt und sich sofort für den banalen Satz entschuldigt. Sie hatten zu vieles für selbstverständlich genommen – was nie eine gute Idee ist –, und irgendwann hatte Serena ihren Groll bemerkt wie einen dunklen Fleck auf der Haut, der gestern anscheinend noch nicht da gewesen war, aber unmöglich über Nacht gekommen sein konnte. Dieser Groll bereitete ihr ein schlechtes Gewissen, und sie schämte sich dafür. Sie hatte versucht, ihn zu rationalisieren und sich einzureden, wie unfair er sei, doch in solchen Fällen hilft die Ratio nicht weiter. Fenoglio hatte sie nicht gefragt, woher dieser Groll stammte, der ihm nicht entgangen war und den er dennoch zu ignorieren versucht hatte. Eine ganz miese Taktik. Er hatte sie nicht danach gefragt, weil er die Gründe ahnte und zugleich Angst davor hatte, sie zu hören. Klar, der Job. Dass er ständig fort war – Tag und Nacht, sonntags, feiertags –, machte das Zusammenleben nicht einfacher. Aber der Job war nicht das Hauptproblem, der Knackpunkt, die Krux.
Das Hauptproblem war gnadenlos einfach, alles andere war Nebensache: Er konnte keine Kinder bekommen, Serena schon. In diesem Punkt waren sich die Ärzte einig. Diese unausgesprochene biologische Option, die mit jedem Jahr schrumpfte und bald nicht mehr da sein würde, war der Samen der Angst, der Funke des Zorns, der Grund für eine Entscheidung, die in ihrer behaupteten Vorläufigkeit bereits zu einer Endgültigkeit zu werden drohte.
Während Serena sprach, hatte Fenoglio das heftige Verlangen überkommen, sie in den Arm zu nehmen, ihr zu sagen, wie sehr er sie liebte, ihr ein Versprechen zu geben, doch er hatte nicht den Mut gehabt; er wusste nicht, was er ihr versprechen sollte, und hatte die passenden Worte nicht gefunden. Er war noch nie gut darin gewesen, seine Gefühle auszudrücken. Es war, als wäre er mit einer quälenden Sprachlosigkeit geschlagen, mit einer emotionalen Beherrschtheit, die sich als Kälte tarnte. Wenn man genau darüber nachdachte, war dies das viel größere Problem, schlimmer noch als die Unmöglichkeit, Kinder zu bekommen. Zudem hatte sie ihm gerade gesagt, man dürfe die Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, was so viel hieß wie: Man darf Emotionen und Gefühle nicht für selbstverständlich nehmen. Man muss sie teilen, benennen, greifbar machen. Man darf die Liebe nicht für selbstverständlich nehmen.
Na schön, hatte er nur geantwortet, dann würde er so bald wie möglich ausziehen. Mit einer Mischung aus kleinlauter Beklommenheit und unbewusster Erleichterung hatte Serena erwidert: Nein, sie sei diejenige, die gehen müsse. Es sei ihr Problem, sie habe es zur Sprache gebracht, und sie müsse es lösen, auch in praktischer Hinsicht. Sie würde in der Wohnung einer Freundin wohnen, die aus beruflichen Gründen nach Rom ziehen würde. Während der Abiturprüfungen im Juli würde sie dann sowieso als Prüfungspräsidentin in Mittelitalien arbeiten. Danach wäre der Sommer vorüber, und die paar Monate seien genau der richtige Zeitraum, um sich über alles klar zu werden und eine Entscheidung zu treffen.
Hast du einen anderen? Kriegst du ein Kind mit einem anderen, und ich drehe durch vor Schmerz?
Dieselben Worte, die ihm an jenem Nachmittag durch den Kopf geschossen waren, drängten sich jetzt, auf dem Höhepunkt dieses Erinnerungsausbruchs am Trattoriatisch, wieder in sein Bewusstsein.
Wie aus dem Nichts war der Kellner neben ihm aufgetaucht: Das Tagesgericht sei Reis-Kartoffel-Auflauf mit Miesmuscheln. Fenoglio fühlte sich wie ertappt, und ohne sich anzuhören, was es sonst noch gab, antwortete er hastig, Reis-Kartoffel-Auflauf mit Miesmuscheln sei wunderbar. Hatte er Selbstgespräche geführt? Hatte der Kellner ihn gehört? Hatte er sich wie ein Geisteskranker auf Freigang aufgeführt?
Fenoglio musste an einen Zwischenfall von vor ein paar Jahren denken. Er war in einer Buchhandlung gewesen, in der nur wenige Kunden waren, und plötzlich fiel ihm eine Frau um die fünfzig auf. Sie war allein und redete leise, aber deutlich vernehmbar vor sich hin.
»Dann bin ich also das Miststück? Nein, du bist das Miststück. Ich sehe deine Taschen durch, weil ich allen Grund dazu habe. Willst du mir nicht erklären, wie die Restaurantquittung da reinkommt? Ich soll gegen unsere Abmachung gegenseitigen Respekts verstoßen haben? Wer hat denn diese Studentin gefickt? Von wegen, du gehst jetzt! Damit machst du es dir zu einfach, nachdem du mir fast zwanzig Jahre meines Lebens geklaut hast! Allesamt für den Arsch. Merkst du gar nicht, was für Gemeinheiten du von dir gibst? Ein Mann hat Bedürfnisse, die eine Frau nicht nachvollziehen kann? Ich soll mich glücklich schätzen, zu Hause zu hocken und auf dich zu warten, während du deine Kolleginnen und Studentinnen vögelst, weil du Bedürfnisse hast? Das ganze Leben, die ganze Liebe, all die Hingabe, alles Streben nach Schönheit! Und was bleibt davon? Urologie! Das ist so widerlich! So widerlich!«
So ging es ein paar Minuten, und das Wort widerlich fiel immer häufiger. Gebannt hatte Fenoglio diesem erschütternden Ausbruch einer verzweifelten Seele gelauscht. Dann war er einen Kaffee trinken gegangen und hatte das Gehörte auf der Suche nach Interpretationen und Alternativen am Bartresen noch einmal Revue passieren lassen. Eine geradezu neurotische Angewohnheit. Vielleicht war der Mann gar kein Miststück. Vielleicht stammte die Quittung von einem Geschäftsessen, und er hatte es nur nicht ertragen, dass man in seiner intimsten Privatsphäre herumschnüffelte, und es für unter seiner Würde empfunden, auf ihre Anschuldigungen zu reagieren. Vielleicht war sie verrückt, immerhin schimpfte sie allein vor sich hin. Wer weiß, wo die Wahrheit lag, wenn es denn eine gab.
Mitten in diesen Überlegungen, die sich zu einer regelrechten Abhandlung auswuchsen, wurde Fenoglio von einem jähen Gedanken durchzuckt: Auch er führte Selbstgespräche, und zwar ziemlich oft. Vielleicht hatte er zu diesem inneren Dialog nicht die Lippen bewegt, aber andere Male schon. Serena wies ihn oft darauf hin: Du redest mit dir selbst. Wirklich? Ja, tust du, du machst sogar Grimassen und gestikulierst.
Genau wie die Frau in der Buchhandlung.
Die Grenze zwischen Wahnsinn und Vernunft erscheint uns klar und nahezu unüberwindlich. Dabei ist sie hauchdünn und durchlässig. Unversehens finden wir uns auf dem Terrain des Wahnsinns wieder und haben keine Ahnung, wie wir dorthin gekommen sind – wissen die Wahnsinnigen, dass sie dort sind?
Fenoglio beschloss, ein paar Seiten zu lesen, doch schon brachte der Kellner den Reis-Kartoffel-Auflauf und das übliche Bier. Das Essen ließ die Dinge wieder beruhigend konkret werden, und als er die Trattoria verließ, war sein Unbehagen so gut wie verflogen.
Es war natürlich nur vorübergehend gewesen. Aber galt das nicht für alles?
5
Als er ins Büro zurückkam, stand wie bei einem Déjà-vu derselbe junge Carabiniere mit der beinahe wortgleichen Nachricht vor seiner Tür: Der Capitano wolle ihn sprechen und bitte ihn, in sein Büro zu kommen.
»Kennen Sie Maresciallo Fornaro?«, fragte Valente.
»Den Dienststellenleiter in Santo Spirito?«
»Genau.«
»Natürlich.«
»Was halten Sie von ihm?«
»Ein guter Mann und ein guter Carabiniere. Ein bisschen alte Schule, aber er hat stets gute Arbeit geleistet.«
»Er hat mich vorhin angerufen und mir eine seltsame Geschichte erzählt.«
»Die da wäre?«
»Ein Vertrauensmann hat ihm berichtet, jemand habe Grimaldis Sohn entführt. Es habe eine Lösegeldforderung für den Jungen gegeben.«
Fenoglio schüttelte ungläubig den Kopf.
»Das ist völlig ausgeschlossen. Wer würde etwas so Irrwitziges tun, bei dem Krieg, der gerade im Gange ist? Ist Fornaro sich sicher?«
»Er meint, die Quelle sei äußerst glaubhaft.«
»Wir sollten nach Santo Spirito fahren und uns die Sache ein bisschen genauer schildern lassen.«
Zehn Minuten später saßen sie im Alfetta des Capitano.
Am Steuer saß Carabiniere Montemurro, neben ihm auf dem für höhere Dienstgrade reservierten Platz der Capitano. Fenoglio saß auf dem Rücksitz.
»Wer könnte so etwas getan haben?«, fragte der Capitano und drehte sich zu Fenoglio um, während sie die Stadt verließen und auf die nördliche Umgehungsstraße auffuhren.
»Ehe wir von einer Entführung ausgehen, würde ich gern mit Fornaro reden, um herauszufinden, wie glaubhaft die Information ist. Denn – ich wiederhole – die Sache erscheint mir höchst unwahrscheinlich. Das Kind von jemandem wie Grimaldi zu entführen wäre reiner Wahnsinn, das würde den totalen Krieg bedeuten.«
Auf dem Stadtring herrschte kaum Verkehr, und zehn Minuten später erreichten sie Santo Spirito. Sie fuhren die von zweistöckigen Jahrhundertwendehäusern gesäumte Strandpromenade entlang und hielten bei dem kleinen Fischerei- und Sporthafen, um einen Kaffee zu trinken. Es war ein sonniger, windiger Nachmittag, große weiße Kumuluswolken zogen über den Himmel, die Luft war frisch und trocken.
Auf dem Weg von der Küste zur Carabinieri-Station wurde der Verkehr plötzlich von drei Autos aufgehalten, die mitten auf der Straße standen. Der vorderste Wagen war ein schwarzer BMW, dessen Fahrer mit einem Typen redete, der am Autofenster stand. Vor dem BMW war die Straße frei.
Montemurro wartete zehn Sekunden, dann drückte er auf die Hupe, ohne dass etwas passierte. Wenn im Stau jemand zu hupen anfängt, tun es ihm die anderen Fahrer normalerweise gleich. Nicht so diesmal. Die Fahrer der anderen beiden Autos schienen jede Menge Zeit zu haben.
Montemurro hupte noch einmal, diesmal länger. Der Typ am Fenster des BMW hörte auf zu reden und ging auf das Auto dahinter zu. Es gab einen kurzen Wortwechsel, und der Fahrer hob entschuldigend die Hände, um zu sagen, dass nicht er gehupt habe.
»Soll ich die Sirene anmachen?«, fragte Montemurro, während der Typ, ein halsloser Glatzkopf um die vierzig, auf sie zukam.
»Nein«, erwiderte Fenoglio. Er öffnete die Wagentür, stieg aus und ging auf den Glatzkopf zu. Seine Handlung löste eine fast rhythmische Abfolge weiterer Reaktionen aus. Der Fahrer des BMW stieg aus; der Capitano und Montemurro stiegen aus dem Alfetta; der Glatzkopf verlangsamte seine Schritte, und seine entschlossene, aggressive Haltung veränderte sich. Der BMW-Fahrer holte ihn hastig ein und schob sich an ihm vorbei. Er trug Anzug und Krawatte, hatte schmale Lippen und eine Brille auf der Nase. Mit nervöser Eilfertigkeit wandte er sich an Fenoglio.
»Guten Tag, Maresciallo, entschuldigen Sie, wir haben Sie nicht erkannt. Wir sind gleich weg.«
»Gleich ist zu spät. Das hätte sofort passieren müssen. Fahrt an der Ecke rechts ran und macht die Straße frei.«
Der Mann sah ihn flehentlich an.
»Können Sie nicht ein Auge zudrücken? Das wäre furchtbar nett, ich stecke gerade in einer schwierigen Situation. Wir haben Sie nicht gesehen.«
»Ich dachte, du wärst auf Zack, Cavallo. Ich muss mich geirrt haben. Sag deinem Freund, er soll die Straße frei machen und im Auto bleiben. Ich will das nicht zweimal sagen müssen.«
Der Glatzkopf schien etwas einwenden zu wollen, doch Cavallo warf ihm einen warnenden Blick zu.
»Wer sind die beiden?«, fragte der Capitano, als die beiden davoneilten.
»Den Halslosen mit der Glatze kenne ich nicht. Der andere heißt Cavallo. Er arbeitet für Grimaldi, aber soweit ich weiß, gehört er nicht zu seinem Clan. Er macht den Verbindungsmann zu Unternehmern und Politikern und betreibt für Grimaldi Geldwäsche durch Wucher. Spitzname: der Buchhalter.«
»Passt zu ihm.«
»Ich glaube, der hat sogar einen Abschluss in Rechnungswesen. Wo wir schon hier sind, können wir ihn gleich fragen, ob er etwas weiß. Cavallo, komm mal her.«
Der Buchhalter kam unterwürfig näher.
»Ich bin wirklich platt. Vor dir hätte ich so etwas Dämliches nicht erwartet. Den Verkehr aufzuhalten, um sich dickezutun.«
»Sie haben recht, Maresciallo, das war dumm von mir. Wir haben etwas Wichtiges besprochen, und ich war abgelenkt. Sie kennen mich, normalerweise passiert mir so was Blödes nicht.«
Fenoglio antwortete nicht und blickte zum BMW hinüber.
»Wer ist der Kerl ohne Hals?«
»Ein guter Junge, leider nicht besonders helle. Er macht das Mädchen für alles in der Villa Bianca.«
»Und wer hat ihm den Job in der Villa Bianca verschafft?«
»Sie wissen ja, Maresciallo, wenn ich jemandem mit meinen Beziehungen behilflich sein kann …«
»Klingt vernünftig. Was ist eigentlich an der Geschichte mit Grimaldis Sohn dran?«
Cavallo schluckte heftig, als müsste er einen allzu großen Bissen hinunterwürgen. »Was … was für eine Geschichte?«
»Ich hatte also recht. Du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Dann fahren wir alle Mann in die Kaserne.«
»Wieso in die Kaserne, Maresciallo?«
»Ich zeige euch wegen Nötigung an, weil ihr mutwillig den Verkehr aufgehalten habt. Auf Nötigung stehen übrigens bis zu vier Jahre Knast, und wir müssen überlegen, ob wir dich nicht gleich festnehmen. Bei deinen Vorstrafen wäre das durchaus angebracht.«
»Maresciallo, Sie machen Witze.«
»Sehe ich aus wie jemand, der Witze macht?«
Mit einer mechanischen Geste rückte sich Cavallo den tadellos sitzenden Krawattenknoten zurecht und holte ein Päckchen Dunhill und ein goldenes Feuerzeug aus der Tasche, das nach einem echten Dupont aussah. Er steckte sich die Zigarette mittig zwischen die Lippen und saugte heftig daran.
»Was ist los, Cavallo?«
Der Buchhalter blickte sich verstohlen um.
»Bringen Sie mich nicht in Schwierigkeiten, Maresciallo. Ich darf kein Wort sagen, das ist ein Befehl.«
»Erklär mir, was los ist. Ich muss es ja nicht an die große Glocke hängen.«
»Maresciallo …« Cavallos Stimme klang wie ein Flehen.
»Seit wann ist der Junge verschwunden?«
Cavallo warf die halb gerauchte Zigarette fort und trat sie mit der Fußspitze aus. Er trug nagelneue Mokassins mit Troddeln.
»Seit vorgestern Morgen. Er war auf dem Weg zur Schule und ist nie dort angekommen.«
»Stimmt es, dass es eine Lösegeldforderung gab?«
Cavallo nickte.
»Und ist es gezahlt worden?«
»Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie versucht haben, das Geld zusammenzukriegen. Und jetzt lassen Sie mich bitte gehen. Wir stehen mitten auf der Straße, die könnten uns sehen. Wenn Grimaldi mitkriegt, dass ich euch das gesagt habe, bricht er mir alle Knochen.«
»Hau ab«, sagte Fenoglio.
Cavallo zögerte kurz, als hätte er nicht recht verstanden. Dann drehte er sich um und hastete davon.
6
»Dann ist es also wahr«, sagte der Capitano, als sie wieder im Auto saßen.
»Wir haben ein gewaltiges Problem. Mal sehen, was Fornaro uns zu sagen hat.«
Fornaro stand vor der Kaserne und erwartete sie. Er sah aus wie ein Carabinieri-Inspektor aus einer Fünfzigerjahre-Komödie: dichter, grau melierter Schnurrbart, runder Trommelbauch unter der stramm sitzenden Uniform, grimmiger, aber gutmütiger Blick. Er zeigte dem Capitano einen militärischen Gruß, drückte Fenoglio die Hand und nickte Montemurro zu.
Ein unangenehmer Geruch erfüllte das Büro, eine Mischung aus verbrauchter Luft, Staub und Essensmief. Als würde dort regelmäßig schlechtes Essen konsumiert, ohne dass die vergitterten Fenster jemals geöffnet wurden.
»Darf ich Ihnen etwas anbieten, Signor Capitano? Einen Kaffee, ein Getränk?«
»Nein, danke, Maresciallo. Wir hatten gerade einen Kaffee. Wollen Sie uns erzählen, was Sie mir am Telefon kurz angedeutet haben?«
»Jawohl. Eine vertrauliche Quelle, die sich in der Vergangenheit als verlässlich erwiesen hat und den Kreisen um Nicola Grimaldi, genannt Nico, der Blonde, nahesteht, hat mir heute Morgen berichtet, dass der jüngste Grimaldi-Sohn von Unbekannten entführt und eine beträchtliche Summe Lösegeld verlangt wurde.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Fornaro hatte geklungen, als hätte er einen Dienstbericht oder eine Mitteilung abgelesen.
»Wann hat sich die Entführung zugetragen?«, fragte Fenoglio.
Fornaro zögerte kurz, als ginge es ihm gegen den Strich, dass nicht der Capitano, sondern ein Gleichgestellter ihn befragte. Als er antwortete, klang er weniger bürokratisch.
»Vorgestern, aber ich habe erst heute mit der Quelle gesprochen.«
»Hat sie gesagt, ob das Lösegeld gezahlt wurde?«
Fornaro schüttelte den Kopf. »Das wusste sie nicht. Ihr war nur bekannt, dass die Entführer ein sehr hohes Lösegeld verlangt haben und dass die Familie dabei war, das Geld aufzutreiben.«
»Sind Sie der Sache nachgegangen?«, fragte der Capitano.
»Jawohl. Unverzüglich nach Erhalt der Informationen haben meine Kollegen und ich uns zu der Schule des Jungen begeben, wo wir von der Schulleiterin erfahren haben, dass das Kind vorgestern nicht in der Schule erschienen ist. Im Laufe desselbigen Vormittags hat sich die Mutter des Minderjährigen zur Schule begeben, um sich seiner Anwesenheit zu versichern, und musste erfahren, dass das Kind nicht in der Klasse aufgetaucht ist.«
»Haben Sie mit den Angehörigen des Jungen gesprochen?«
»Nein, Signor Capitano. Nach einer ersten Überprüfung der vertraulichen Information auf ihre Glaubwürdigkeit hielt ich es für richtig, zunächst Sie in Kenntnis zu setzen, ehe ich weitere ermittlerische Schritte einleite.«
Fenoglio überlegte. Kein Zweifel, die Entführung hatte stattgefunden. Eine vertrauliche Information, die sich mit der Aussage der Schulleiterin deckte, konnte kein Zufall sein. So etwas hatte es noch nicht gegeben – es passte in keines der üblichen Raster.
»Hat deine Quelle eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Gibt es irgendwelche Verdächtigen?«
»Sie hat nichts gesagt. Aber es wird gemunkelt, es hätte etwas mit dem Zerwürfnis zwischen Grimaldi und Vito Lopez zu tun.«
»Und?«
»Wenn es einen Krieg zwischen Grimaldis Leuten und einer Lopez-treuen Rebellengruppe gibt, ist es durchaus möglich, dass Lopez’ Leute den Jungen entführt haben. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.«
Wie unterschiedlich Fornaro sich ausdrückte, je nachdem, ob er sich an ihn oder an den Capitano wandte.
»Glaubst du, deine Quelle kann dir noch mehr Informationen liefern?«
»Ich glaube nicht, in der Gruppe ist er nur ein kleines Licht. Was er mir zuträgt, ist bei denen schon allgemein bekannt, und Grimaldi teilt seine Geheimnisse bestimmt nicht mit ihm.«
Der Capitano holte sein Zigarettenetui hervor, bat um Erlaubnis zu rauchen und zündete sich nachdenklich eine Zigarette an. »Was machen wir jetzt?«
»Wir bestellen die Eltern des Jungen hierher«, schlug Fenoglio vor. »Die sind zwar bestimmt nicht bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, aber irgendetwas müssen sie uns sagen, um das Verschwinden des Jungen zu erklären.«
»Stimmt. Maresciallo Fornaro, schicken Sie einen Wagen los, um Grimaldi und seine Frau zu holen. Wir warten hier.«
Ein eigentümlicher Ausdruck trat auf Fornaros Gesicht. Als wäre er peinlich berührt und wollte etwas einwenden, fände aber nicht die richtigen Worte, um seinem Gegenüber die Sache verständlich zu machen. Als Leiter einer Carabinieri-Station in der Vorstadt kommt es auf das richtige Gleichgewicht an zwischen Ausübung der Amtsgewalt und Besonnenheit gegenüber denjenigen, die zu allem bereit sind. Wenn man in unmittelbarer Nachbarschaft mit gemeingefährlichen Verbrechern lebt, muss man versuchen, miteinander auszukommen und Grenzen akzeptieren, die für einen Außenstehenden schwer nachvollziehbar sind. Die theoretische Befugnis ist eine Sache, doch in der wirklichen Welt gelten andere Regeln. Grimaldi war nicht der Typ, den man zusammen mit seiner Frau wie einen x-beliebigen Handtaschendieb in die Kaserne schleifen konnte. Man musste den richtigen Weg finden. Obwohl Fornaro kein Wort darüber verlor, war es, als hätte er es laut ausgesprochen. Gerade wollte Fenoglio sagen: Ich fahre mit Montemurro hin und hole die beiden ab, vielleicht nehme ich ein paar Carabinieri der Station als Unterstützung mit, damit Grimaldi sieht, mit wem er es zu tun hat und wie ernst die Sache ist, als ein uniformierter Carabinieri-Brigadiere atemlos und mit erregtem Gesicht ins Büro stürzte.
»Verzeihung, aber soeben ist ein Anruf eingegangen. In Enziteto ist eine Schießerei auf offener Straße zwischen zwei Autofahrern im Gange.«
»Wie weit ist das von hier?«, fragte der Capitano unerwartet schnell und entschlossen.
»Fünf Minuten, wenn wir Gas geben«, entgegnete Fornaro.
»Wir schnappen uns die M12 und kugelsichere Westen und fahren sofort hin.«
7
Mit Sirenen, Blaulicht und quietschenden Reifen rasten die beiden Autos los. Fenoglio sah auf die Uhr und lud seine Pistole. Der Capitano hielt die bereits geladene Maschinenpistole in der Hand. Montemurro saß mit der Beretta 92 zwischen den Beinen am Steuer. Niemand sagte ein Wort. Der Wagen der Carabinieri-Station mit Fornaro und zwei Carabinieri an Bord fuhr vor ihnen her und schoss über die Kreuzungen und roten Ampeln. Sie durchquerten Santo Spirito in südlicher Richtung und bogen auf die Landstraße.
Während sie mit hundertfünfzig Sachen die zwei Kilometer bis zur Abfahrt nach Enziteto zurücklegten, musste Fenoglio unwillkürlich an eine ähnliche Situation vor vielen Jahren in Mailand denken. Er hatte mit zwei Kollegen im Auto gesessen, als sie die Meldung eines bewaffneten Überfalls nur wenige hundert Meter entfernt erhielten. Sie waren genau in dem Moment zur Stelle gewesen, als die Räuber mit erhobenen Waffen aus dem Postamt stürmten. Es gab eine heftige Schießerei, und am Ende war einer der beiden Räuber – ein einundzwanzigjähriger Junge – tot und einer der Carabinieri schwer verletzt. Ein paar Wochen später hatten die ballistischen Untersuchungen ergeben, dass die tödlichen Schüsse nicht aus Fenoglios Waffe stammten. Technisch gesehen war er also für den Tod des Jungen nicht verantwortlich, und die Nachricht war eine Erleichterung gewesen. Sie währte jedoch nur kurz. Er hatte sich gefragt, ob es zwischen ihm und dem Kollegen, der den tödlichen Treffer abgefeuert hatte, einen Unterschied gab. Hätte die Sache den gleichen Ausgang genommen, wenn der Carabiniere mit seiner Pistole allein vor Ort gewesen wäre? Dutzende Schüsse – man hatte einunddreißig Hülsen am Boden gefunden – waren fast gleichzeitig auf die Räuber abgegeben worden, ein tödlicher Kugelschwarm, vor dem es so gut wie kein Entrinnen gab. Die Frage war nicht, wer den Treffer abgefeuert hatte. Die Frage war, wer an der Attacke beteiligt gewesen war. Und es tat nichts zur Sache, ob die Carabinieri in der Situation rechtmäßig gehandelt hatten. Auf die Räuber zu schießen war richtig und unvermeidlich und der Tod des Jungen die richtige und unvermeidliche Folge einer konzertierten Aktion gewesen. Fenoglio hatte sich gefragt, wie er auf die Frage antworten würde, ob er schon einmal jemanden erschossen habe.
Er hätte mit Ja geantwortet.
Als sie den Tatort in Enziteto erreichten, war niemand mehr dort. Ehe Fenoglio aus dem Auto stieg, blickte er auf die Uhr: Es waren kaum mehr als fünf Minuten vergangen. In Ernstfällen die Zeit im Blick zu behalten ist entscheidend, damit sich die Erinnerung nicht verzerrt, lückenhaft und ungenau wird.
Sie schalteten die Sirenen und Blaulichter ab. Die Straße war menschenleer, die Fenster verrammelt, als wäre das Viertel unbewohnt. An zwei Punkten in ungefähr zwanzig Metern Abstand war der Boden mit Hülsen übersät. Zwei bewaffnete Gruppen hatten sich mit Gewehren und Pistolen bekämpft, doch falls jemand getroffen worden war, hatte er keine sichtbaren Blutspuren hinterlassen.
Es war unheimlich still, wie ausgestorben. Enziteto war tatsächlich ein gottverlassener Winkel, dachte Fenoglio, keine drei Kilometer von der Küste, den Restaurants, Seebädern und dem Flughafen entfernt. Nimmt man die kleine Abfahrt von der Bundesstraße, findet man sich unversehens in einem düsteren, abstrakten Jenseits wieder.
Abstrakt, das war der richtige Ausdruck.
Wie zahllose andere grässliche Vorstädte war Enziteto ein abstrakter Ort. Fenoglio musste an einen Satz denken, den sein Landsmann, der Maler Casorati, einmal gesagt hatte und der ihm im Kopf geblieben war, weil er eine fundamentale Wahrheit enthielt: »Malerei ist immer abstrakt.«
Wer wohl die 112 gerufen hatte? Nicht eine Menschenseele war zu sehen, nicht ein vorbeifahrendes Auto, kein Kind, das zufällig des Wegs kam, kein Moped, kein Fahrrad.
Ein räudiger Hund trottete langsam über die Straße, als wollte er den Status quo unterstreichen. Dann zerriss Sirenengeheul die Stille. Weitere Streifenwagen der Carabinieri und der Polizei trafen ein und mit ihnen der Chef des mobilen Einsatzkommandos. Die Welt wurde wieder konkreter.
Sie klapperten die Mietskasernen ab auf der Suche nach jemandem, der etwas gesehen hatte. Viele Türen blieben verschlossen, manche Leute öffneten und sagten, sie hätten nichts gesehen, andere bestanden darauf, anonym zu bleiben, und erzählten von einer Schießerei zwischen zwei bis zu den Zähnen mit Pistolen, Gewehren und MGs bewaffneten Fahrzeughaltern.
Ein paar Stunden später rückten sie ab. In der Zwischenzeit war das gesamte Einsatzkommando in den Dienst zurückbeordert worden. Einige wurden in die Krankenhäuser geschickt, andere sollten die Wohnungen sämtlicher in der Gegend ansässiger Vorbestrafter durchkämmen. Drei davon wurden zum Stub-Test in die Kaserne gebracht, um sie auf Schmauchspuren zu untersuchen.
Auch Grimaldi und seine Frau wurden in die Kaserne nach Bari gebracht, um zum Verschwinden ihres Sohnes vernommen zu werden. Der tags darauf für die Staatsanwaltschaft verfasste Bericht, in dem sie der Korruption beschuldigt wurden, beschrieb das Verhör wie folgt: »Die beiden Eheleute bestritten jedwede Probleme, insbesondere die Entführung des Minderjährigen. Auf Nachfrage, wo sich das Kind befinde, sagten sie, es sei bei seinem Onkel und seiner Tante mütterlicherseits, wohnhaft in der Lombardei, um dort ein paar Tage Ferien zu machen. Sie verweigerten die Herausgabe der Telefonnummern besagter Verwandter und konnten keine Erklärung dafür liefern, weshalb das Kind mitten im laufenden Schuljahr zu nämlichen Verwandten gefahren sei. Grimaldi und seine Frau wurden zur Zusammenarbeit mit den Behörden aufgefordert und auf die Bedeutung einer solchen Zusammenarbeit für die Wiederauffindung des Kindes hingewiesen. Jedwede Kooperation wurde jedoch abgelehnt und der Tatbestand abgestritten. Dem folgte feindseliges Schweigen sowie die Weigerung, das Vernehmungsprotokoll zu unterschreiben.«
Am späten Nachmittag wurde außerhalb von San Ferdinando di Puglia, rund siebzig Kilometer nördlich des Schauplatzes der bewaffneten Auseinandersetzung, ein ausgebrannter Peugeot 205 mit deutlich erkennbaren Einschusslöchern gefunden. Der Wagen war in Pescara gestohlen worden, und die Fahndung wurde auf dieses Gebiet ausgeweitet.
Ungefähr zeitgleich drangen drei vermummte Männer in das Haus von Vito Lopez’ Schwägerin ein, schlugen ihren Mann zusammen, der zum kriminellen Milieu keinerlei Verbindung hatte, und zertrümmerten die Einrichtung. Sie wollten wissen, wo Lopez sei. Zum Schluss schossen sie ihm in die Beine, sagten ihm, wenn er von nun an hinken würde, könne er sich bei dem Drecksack von Metzger bedanken, und verschwanden.