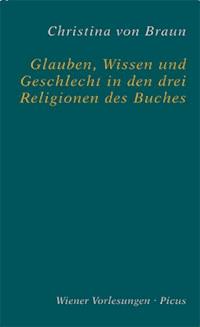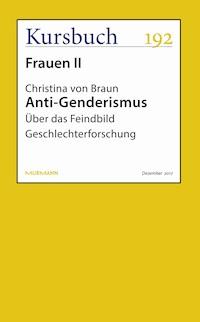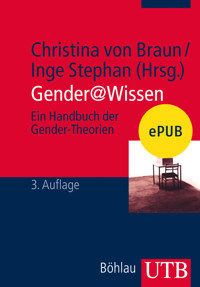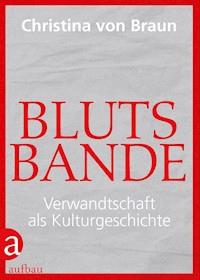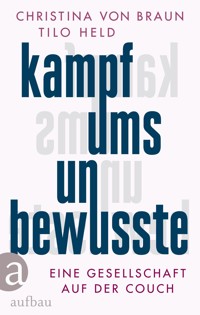
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Unbewusste als Territorium kultureller und politischer Konflikte und wie die Psychoanalyse heute helfen kann, sie zu lösen.
Die Rede vom Unbewussten begann mit dem Niedergang der Religion um 1800. Hundert Jahre später entstand die Psychoanalyse, die von Anfang an nicht nur Therapieform, sondern auch Instrument des Erkenntnisgewinns und der Kulturkritik war. Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun und der Psychoanalytiker Tilo Held beleuchten die Bedeutung des Unbewussten für gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen. Von Antisemitismus und Totalitarismus über sich wandelnde Geschlechterrollen bis hin zu Fake News und Verschwörungserzählungen.
Eine scharfsinnige Darstellung des »Kampfs ums Unbewusste« der letzten zweihundert Jahre bis heute und Vorschläge, wie eine von anderen Disziplinen bereicherte Psychoanalyse zur Überwindung gegenwärtiger Krisen beitragen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 883
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Ein Buch über die wechselnden Theorien zum Unbewussten schreiben, bedeutet, eine Art von Theatergeschichte verfassen – eine Biographie, die um 1800 einsetzte, als das Unbewusste seinen bis heute gültigen Namen erhielt. Die Bühne, auf der dieses Schauspiel, das von Menschen sowohl geschrieben und inszeniert als auch erlitten wird, ist das Leben selbst: das der Individuen wie das der Gemeinschaften. Dabei hält sich der Ablauf dieses Dramas nicht an die saubere Grenze zwischen Politik und Kultur; vielmehr zeigt es uns, wie die Kultur das politische Leben umkrempelt und wie die Politik die Kultur instrumentalisiert, was in den totalitären Staaten besonders evident wird. Das Stück hat ein Open End: Wir wussten nicht (und wissen bis heute nicht), wie es ausgeht, aber wir können rückblickend erkennen, dass immer wieder neue Faktoren den Verlauf änderten: etwa als um 1900 die sich wandelnden Geschlechterrollen alte Traditionen aus den Angeln zu heben begannen oder als die ebenfalls in dieser Zeit aufkommenden Massenmedien die Psyche der Menschen auf neue Gleise schoben und parallel zu beidem eine neue facettenreiche ›Disziplin‹ entstand: die Psychoanalyse.« Aus dem Vorwort
Über die Autoren
Christina von Braun, geboren 1944, ist Kulturtheoretikerin, Autorin und Filmemacherin. Sie war Professorin an der Humboldt-Universität im Fach Kulturwissenschaft und leitete dort bis 2003 den Studiengang Gender Studies. Sie hat zahlreiche Bücher, Aufsätze und Essays veröffentlicht und mehr als 50 Filme zu kulturellen und kulturhistorischen Themen gedreht. 2013 wurde sie mit dem Sigmund-Freud-Kulturpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien bei Aufbau »Blutsbande. Verwandtschaft als Kulturgeschichte«.
Tilo Held, geboren 1938, war seit 1981 Ärztlicher Direktor der Rheinischen Landesklinik in Bonn und damit der erste und lange Zeit einzige Leiter einer psychiatrischen Klinik in Deutschland, der zugleich Psychoanalytiker war. 1990 erhielt er den Hermann-Simon-Preis für Sozialpsychiatrie, 1999 wurde er apl. Professor für Psychiatrie an der Universität Bonn. Im Jahre 2001 wechselte er nach Berlin, wo er die Fliedner Klinik Berlin am Gendarmenmarkt gründete und leitete.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christina von Braun, Tilo Held
Kampf ums Unbewusste
Eine Gesellschaft auf der Couch
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Einleitung
1 Kurze Vorgeschichte einer langen Zeit
Das Unbewusste der Aufklärung
Das Vertrauen und seine Sozialstrukturen
Der Glaube verdrängt das Vertrauen
Kulturtechniken verschaffen dem Glauben Zugang zum Unbewussten
2 Exit Gott – Auftritt das Unbewusste
Das vorfreudianische Unbewusste
Jüdische Traditionen und die Entstehung der »Redekur«
Das Unbewusste in den frühen Lehren der Psychoanalyse
Der Kampf um die psychoanalytische Definition des Unbewussten
Die Spaltung in ein »jüdisches« und ein »arisches« Unbewusstes: Der Fall Jung
3 Die totalitäre Besetzung des Unbewussten
Das Beispiel Russland
Die Psychoanalyse und das Unbewusste im Nationalsozialismus
Der Glaube im Nationalsozialismus: Die Deutsche Glaubensbewegung und Alfred Rosenberg
Die Kulturtechniken des Glaubens in Adolf Hitlers Mein Kampf
Der Glaube und die sekundäre Oralität in Carl Schmitts Utopie eines »totalen Staats«
Anziehungskraft des totalitären Staates auf das Unbewusste
Die Widerstandskräfte des Unbewussten
4 Nach dem Albtraum: Das Unbewusste offenbart seine Vielfalt
Unmittelbare Nachkriegszeit
Die Emigration der Psychoanalyse
Das geteilte Deutschland und die Psychoanalyse: die Entwicklung in der Bundesrepublik
Das geteilte Deutschland und die Psychoanalyse: die Entwicklung in der DDR
Die internationale Entwicklung
5 Das Geschlecht des Unbewussten, das Unbewusste der Geschlechter
Vorbemerkung
Gründe für das Beharrungsvermögen der binären Geschlechterordnung
Die Aufhebung der Geschlechterpolarität in Reproduktion und Sexualität
Die neue sexuelle Vielfalt
Fluide Geschlechtergrenzen reflektieren die fließenden Grenzen zwischen bewusst und unbewusst
Die politische Dimension von Geschlecht und Reproduktion im Unbewussten
6 Die Massenmedien erobern das Unbewusste
Die Gleichzeitigkeit von Psychoanalyse und Massenmedien
Die Entstehung der »Emokratie«
Soziale Medien: Das Beispiel Facebook
Affekt und Technik
Das Unbewusste im Dienst der freiwilligen Diktatur
Die Funktion von Verschwörungserzählungen und der immunisierende Effekt des Analogen
Der Umschlag von Affekt in physische Gewalt
Der heilige Algorithmus
Das widerständige Unbewusste
Zwischenbilanz
7 Die Zukunft der Analytischen Psychotherapie am Beispiel Deutschland
Psychotherapie und Medizin
Rückblick
Was ist? Und was könnte werden? Die Psyche als Transformationsfeld
Die Transformation des Sozialen in das Individualpsychische
Das Inzesttabu
8 Psychoanalyse und Traumaforschung
Persönliche Vorbemerkungen
Der deutsche »Sonderweg«
Child Survivors in der internationalen Traumaforschung
Prä- und posttraumatische Traumafolgen
Weitere Ergebnisse der neueren Traumaforschung
Bedingungen für die Entfaltung des posttraumatischen Wachstums
Die nächste Generation
Was kann die Psychoanalyse aus der Traumforschung lernen?
9 Die Psychoanalyse und ihre Nachbarn
Neurowissenschaft der menschlichen Beziehungen
Gibt es ein »mütterliches Gehirn«?
Was es für das Kind heißt, einen engagierten Vater zu haben
Was es für die psychische und körperliche Gesundheit des Vaters bedeutet, engagierter Vater zu sein
Die Mutter und der engagierte Vater
Fazit
Anhang
Anmerkungen
Einleitung
1 Kurze Vorgeschichte einer langen Zeit
2 Exit Gott – Auftritt das Unbewusste
3 Die totalitäre Besetzung des Unbewussten
4 Nach dem Albtraum: Das Unbewusste offenbart seine Vielfalt
5 Das Geschlecht des Unbewussten, das Unbewusste der Geschlechter
6 Die Massenmedien erobern das Unbewusste
Zwischenbilanz
7 Die Zukunft der Analytischen Psychotherapie am Beispiel Deutschland
8 Psychoanalyse und Traumaforschung
9 Die Psychoanalyse und ihre Nachbarn
Fazit
Bibliographie
Register
Danksagung
Impressum
Einleitung
Dieses Buch ist ein Experiment. Aus zwei Gründen: Erstens begibt man sich mit dem Thema des Unbewussten auf unsicheres Terrain. Das Unbewusste entzieht sich jeder genaueren Definition – eine Eigenschaft, von der wir im Laufe des Schreibens begreifen sollten, dass genau darin auch sein Potenzial und seine Widerstandskraft liegt. Zweitens schreiben wir – Christina von Braun, die Kulturhistorikerin, und Tilo Held, der Psychiater/Psychoanalytiker – nach mehr als 50 Jahren Ehe zum ersten Mal ein Buch zusammen; wir konnten nicht einschätzen, ob das funktioniert oder die Beziehung belastet. (Um es vorwegzunehmen: Es gab Konflikte, aber die Beziehung hat diese überlebt.)
Ein Buch über die wechselnden Theorien zum Unbewussten schreiben, bedeutet, eine Art von Theatergeschichte verfassen – eine Biographie, die um 1800 einsetzt, als das Unbewusste seinen bis heute gültigen Namen erhielt. Die Bühne, auf der dieses Schauspiel, das von Menschen sowohl geschrieben und inszeniert als auch erlitten wird, ist das Leben selbst: das der Individuen wie das der Gemeinschaften. Dabei hält sich der Ablauf dieses Dramas nicht an die saubere Grenze zwischen Politik und Kultur; vielmehr zeigt es uns, wie die Kultur das politische Leben umkrempelt und wie die Politik die Kultur instrumentalisiert, was in den totalitären Staaten besonders evident wird. Das Stück hat ein Open End: Wir wussten nicht (und wissen bis heute nicht), wie es ausgeht, aber wir können rückblickend erkennen, dass immer wieder neue Faktoren den Verlauf änderten: etwa als um 1900 die sich wandelnden Geschlechterrollen alte Traditionen aus den Angeln zu heben begannen oder als die ebenfalls in dieser Zeit aufkommenden Massenmedien die Psyche der Menschen auf neue Gleise schoben und parallel zu beidem eine neue facettenreiche »Disziplin« entstand: die Psychoanalyse.
Heute befinden wir uns erneut in einer Umbruchphase – sie ist geprägt von anderen Krisen: Klimawandel, Kampf um Energieressourcen, Angst vor Krieg, medialer Manipulation und dem wachsenden Anteil autokratischer Regime. In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung heißt es: »Erstmals seit 2004 verzeichnet unser Transformationsindex (BTI) mehr autokratische als demokratische Staaten. Von 137 untersuchten Ländern sind nur noch 67 Demokratien, die Zahl der Autokratien steigt auf 70.«1 Auch in dieser Situation, wo es um das Überleben der freiheitlichen Gesellschaften geht, wächst der Ruf nach einer Befähigung zur Abwehr – weniger durch Waffen als durch psychische und intellektuelle Resilienz. Wir möchten im Folgenden darstellen, dass sich das Unbewusste – aufgrund seiner Flexibilität und seiner Unbeherrschbarkeit – als besonders widerstandsfähig erwies und auch weiterhin erweisen dürfte.
Um sich durchzusetzen, bedarf das Unbewusste allerdings eines Instrumentariums, das in der Welt des Bewusstseins angesiedelt ist. Diese Brücke schlug die Psychoanalyse um 1900, und auch heute könnte sie die richtige Mittlerin sein, was jedoch nur möglich ist, wenn sie über die Formulierungen und Lehrsätze von 1900 hinausgeht. Gefragt sind neue Denkmuster, die auf die aktuellen Gefährdungen antworten, etwa auf die medialen Manipulationen. Diesen durch Aufklärung und mediale Kompetenz zu begegnen ist nicht falsch, aber zu wenig. Es geht nicht um ein Wissen, das sich durch bewusste Bildung erwerben lässt – sondern um ein psychologisches Wissen, das mindestens ebenso viel mit Gefühl wie mit Intellekt zu tun hat. Dass dieses Wissen zum kollektiven Fundus der Gesellschaft wird, ist eines der Anliegen unseres Buches. Die Psychoanalyse ist nicht nur Therapie, sie vermittelt auch eine spezifische Art der Erkenntnis. Sie kann weder die einzelne Biographie noch einen historischen Prozess ungeschehen machen. Aber sie kann dazu beitragen, dass Ereignisse anders gelesen werden.
Dies ist also kein Buch über die Geschichte oder Wirkmacht der Psychoanalyse; es ist ein Buch über ein Feld, das zu ihrer Entstehung beitrug. Als sie – ebenfalls um 1900 – die Bühne betrat, bedurfte es offenbar völlig neuer Einsichten und Methoden, um das veränderte menschliche Verhalten einzuordnen und gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Wir befinden uns in einer historisch ähnlichen Umbruchsituation wie die Gesellschaft um 1900. Und auch heute gibt es einen hohen Bedarf an Einsicht und Einordnung, den die Psychoanalyse leisten könnte, allerdings eine »erneuerte« Psychoanalyse. Sie hatte eine wichtige Funktion in ihrer Entstehungszeit, doch auf vielen Gebieten – darunter Geschlechterverhältnisse und Massenmedien – werden die Lehren von damals den aktuellen Notwendigkeiten nicht mehr gerecht.
Das Buch besteht aus zwei Teilen: einer geschrieben von Christina von Braun, der andere von Tilo Held. Im ersten Teil wird die Geschichte des Unbewussten bis in die Jetztzeit nachgezeichnet: Sie beginnt, wo deutsche Philosophen und Schriftsteller den Begriff »das Unbewusste« in die Welt setzten. Nach einer kurzen Vorgeschichte, in der einige Leitgedanken des Buches umrissen werden, etwa der Antagonismus zwischen Vertrauen und Glauben, beschreibt Kapitel 2, in welcher Weise das Unbewusste an die Leerstelle rückte, die »Gott« nach der Entmachtung der Kirche im Denken vieler Menschen hinterließ. Die Verlagerung vom Transzendenten zum Unbewussten vollzog sich zunächst in Deutschland und dort genauer in den protestantischen Gebieten, wo der »nach innen genommene« Gott die Gestalt nicht nur des »Gewissens«, sondern auch des »Gemüts« annahm. Von Gewissen und Gemüt bis zum Unbewussten war es nicht weit.
Um 1900 kommt es zu einer Wende: Nun intervenierten jüdische Denktraditionen – auch sie weltlich ausgerichtet – in den Entwicklungsprozess des »Unbewussten«. Es kam zu der von Freud und anderen »kulturellen« Juden entwickelten Psychoanalyse. Sie verlieh der Diskussion um das Unbewusste eine neue Dimension, indem sie unterstrich, dass die Psyche ihre eigene, von Physis, sozialem Umfeld und kulturellen Mustern bestimmte Dynamik hat und dass sie nicht zwingend mit Gott, geschweige denn einem spezifischen Gott, identisch ist.
Im 3. Kapitel wird beschrieben, wie die nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen totalitären Staaten sich des psychischen Gebiets zu bemächtigen versuchten und welche Instrumentarien sie entwickelten, um über dieses Terrain Herrschaft auszuüben. Es wird aber auch schon gezeigt, dass das Unbewusste über eine eigene Widerstandsfähigkeit verfügt, die sich jeder Form von »Besetzung« entzieht. Kapitel 4 geht auf die Entwicklung nach 1945 ein und skizziert die breite Ausdifferenzierung der kulturellen und politischen Dimensionen sowohl des Unbewussten als auch der Psychoanalyse, bevor im 5. und 6. Kapitel noch einmal zurückgegriffen wird auf die Zeit um 1900, wo – parallel zur Entstehung der Psychoanalyse – zwei große Umbrüche ihren Anfang nahmen, die auf die Geschichte des Unbewussten einen mächtigen Einfluss ausüben sollten: Der eine betraf die Geschlechterordnung, der andere die modernen Massenmedien. In beiden Fällen zeigt sich, wie notwendig es geworden ist, dass die Psychoanalyse – ob als Therapie, als Methode der Erkenntnis oder als Kulturkritik – Antworten auf aktuelle Fragestellungen und Krisen gibt.
Der zweite Teil des Buchs, für den Tilo Held verantwortlich zeichnet, beginnt im 7. Kapitel mit einer Darstellung der Psychoanalyse als staatlich finanzierter Heilmethode (weltweit nur in Deutschland) und dem Verhältnis der Psychoanalyse zu anderen Heilmethoden, besonders zur Medizin. Das 8. Kapitel zeigt am Beispiel der Traumaforschung, wie wichtig der kulturelle Kontext für die Therapie ist und welchen Gewinn die Psychoanalyse aus der sozialwissenschaftlichen Forschung und den neueren Erkenntnissen der Anthropologie ziehen könnte. Das 9. und letzte Kapitel thematisiert, welche Bereicherung die Psychotherapie erfahren könnte, wenn sie sich den neueren Erkenntnissen der Evolutionsforschung und Neurobiologie öffnete: Diese berühren viele der Gebiete, mit denen die Psychoanalyse tagtäglich zu tun hat, bestätigen auch einige der Spekulationen aus der Frühzeit der Psychoanalyse (als die Naturwissenschaften noch auf das Fach herabblickten) – und vor allem zeichnen sie Freiheitsgrade für die individuelle Entwicklung auf, die allen bisherigen Vorstellungen widersprechen.
Wenn im Folgenden vom Unbewussten die Rede ist, so ist damit nicht die lange Geschichte gemeint, die der Einführung des Begriffs vorausging: etwa die Wahrsagungen der Antike, magische Heilungen im Tempel, die Idee der Besessenheit durch den Teufel oder suggestive Heilmethoden wie der Mesmerismus. Diese Vor-Geschichten wurden vom Schweizer Psychiater, Psychoanalytiker und Medizinhistoriker Henri Frédéric Ellenberger großartig beschrieben.2 Seine Darstellung endet mit der Einführung der Psychoanalyse um 1900. Der Fokus unseres Buchs liegt auf der Zeit von 1800 bis heute: In dieser Zeit wurde das Unbewusste benannt und auf unterschiedliche Weisen theoretisiert. Zugleich gab es immer wieder Versuche, das terrain vague der Psyche zu besetzen, wobei diese Bemühungen auf beträchtlichen Widerstand stießen. Wir sind keineswegs die ersten, die sich mit dem Gebiet des modernen Unbewussten beschäftigen.3 Doch der Fokus unserer Forschung ist spezifisch; in ihrem Zentrum stehen zwei Fragen. Erstens: Wie und warum wurde das Unbewusste zum Territorium kultureller und politischer Konflikte? Zweitens: Wie kann die Psychoanalyse als Wissenschaft vom Unbewussten durch ihre Methodik und Theorie den neuen Anforderungen gerecht werden?
1Kurze Vorgeschichte einer langen Zeit
Das Unbewusste der Aufklärung
Der Begriff des Unbewussten tauchte zum ersten Mal im späten 18. Jahrhundert auf. Für das Zeitalter der Aufklärung stand er für das von Wissen und Rationalität Ausgeschlossene. Auch vorher existierte das Unbewusste, aber es wurde anders eingeordnet: etwa als Ungläubigkeit, der Scholastik und spätere Theologien ihre durchdachten Lehren gegenüberstellten. Als die »Lumières« – so die Selbstbenennung der französischen Aufklärer – mit dem Anspruch antraten, diese Lehrgebäude zu zertrümmern,1 musste ein neuer Begriff gefunden werden für das, was außerhalb stand. Gestiftet wurde er im deutschen Kulturraum: Hier attestierten Theologen wie Friedrich D. E. Schleiermacher, der in Berlin eine Pfarrei leitete, dass die Religion »Anschauung und Gefühl« sei und über eine eigene »Provinz im Gemüthe« verfüge,2 während Philosophen und Dichter den psychologisierenden Begriff des »Unbewussten« entwickelten und mit religiösen Charakteristika versahen, die einige Ähnlichkeit mit alttestamentlichen Gottesnamen hatten: Allwissender, Mächtiger, Allsehender, Eifersüchtiger, großer Erschaffer, Heiligster, Hirte, Hörer des Gebets, Retter, Erlöser, Schöpfer, souveräner Herr, Vater. Der Schriftsteller Karl Philipp Moritz (1756–1793) verwendete mehr als ein Jahrhundert vor Freud die Begriffe »Unbewusstes« und »Es«. In dem von ihm herausgegebenen Magazin zur Erfahrungsseelenkunde bezeichnete er damit das, »was sowohl in unsrem Körper als in den innersten Tiefen unsrer Seele vorgehet, und wovon wir uns nur dunkle Begriffe machen können«. Dieses »Es« liege »außer der Sphäre unsrer Begriffe«, unsere Sprache habe dafür keinen Namen.3 Der Fährte, die Schleiermacher und Moritz legten, folgten viele weitere Autoren, und die Suche nach dem richtigen Wort für diese innere Macht blieb ein durchgängiger Topos aller Reflexionen des 19. Jahrhunderts über das Unbewusste.
Die Rationalität der »Lumières« und das irrationale Unbewusste haben mehr gemein, als die Gegenüberstellung der Zeit vermuten lässt. Zunächst die Schwierigkeit der Selbstdefinition. Beide lassen sich nur durch ihre Negation beschreiben: durch das, was sie nicht sind – vergleichbar der Reinheit, die sich nie positiv begründen lässt, nur in Abgrenzung gegen die »Unreinheiten«, die jede Kultur zu diesem Zweck erfindet.4 Auch Kants Definition von der Aufklärung als »Austritt des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« hilft nicht viel weiter. Sie ist sowohl selbstherrlich, weil sie durch den Begriff des Selbstverschuldens unterstellt, dass der Mensch immer schon auf seine Unmündigkeit hätte verzichten können, als auch unhistorisch, als habe es keinen geschichtlichen Kontext für die Genese der Aufklärung, inklusive Kants eigener Einsichten, gegeben. Vor allem übersieht sie, dass die »Lumières« ihr Gegenstück, das Unbewusste, zwingend im Gepäck hatten. Goethe begriff das. In Faust II verspottete er die Brüder Humboldt, die einerseits als Heroen der deutschen Aufklärung galten und sich andererseits im Gespräch mit den Toten übten und in Schloss Tegel die Tische rücken ließen. In der Walpurgisnacht heißt es über die alten »Geister«: »Ihr seid noch immer da! nein, das ist unerhört. / Verschwindet doch! Wir haben ja aufgeklärt! – / Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. / Wir sind so klug, und dennoch spukt’s in Tegel.« Weil sich Bewusstsein und Unbewusstes nur durch ihre Gegensätzlichkeit definieren ließen, waren sie unzertrennlich.
Der Rückgriff des aufgeklärten Zeitalters auf die Bilderwelt der christlichen Religion macht deutlich, wie sehr sie dessen Traditionen verhaftet blieb. Im Neuen Testament heißt es: »Jesus spricht: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf dass, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.«5 Dieselbe Licht- und Helligkeitsmetaphorik charakterisiert auch die »Lumières«, analog verhielt es sich mit dem Gegenpol. Hatte die Kirche die Sünde den dunklen Mächten der Unterwelt zugeordnet, so umfasste das Dunkel nun alles, was die Menschheit (noch) nicht erforscht hatte oder erklären konnte. Die Kirche verortete die Finsternis bei den Ungläubigen; die Aufklärung bei den Unwissenden. In einem trafen sich aber beide: Das Christentum verlangte von seinen Anhängern an Begebenheiten zu glauben, die mit der sichtbaren Evidenz nicht vereinbar waren: an die Menschwerdung Gottes, an die Auferstehung Christi, die unbefleckte Empfängnis und die Jungfrauengeburt. Auch in den areligiösen »Lumières« überbrückte, wie wir noch sehen werden, der »Glaube« den Abgrund zwischen Bewusstsein und Unbewusstem.
Dass dieser Glaube ein Spezifikum des Christentums war, zeigt der Vergleich mit der jüdischen Religion und dem Islam. Beide verkündeten den Glauben an einen unsichtbaren Gott, hielten sich jedoch für die diesseitige Wahrheit an das empirisch Erfassbare. Das erleichterte den Umgang mit wissenschaftlichen Neuerungen und erklärt, dass die arabische Medizin, Mathematik und Astronomie des Mittelalters viel weiter fortgeschritten war als die des Christentums, das zu dieser Zeit nur Wissen gelten ließ, das mit dem Glauben vereinbar war. Die Christen, so Michel de Montaigne (1533–1592) in seinem unnachahmlichen Spott, »finden allezeit eine Gelegenheit zu glauben, wenn sie etwas Unglaubliches antreffen. Eine Sache ist um so viel vernünftiger, je mehr sie der menschlichen Vernunft widerspricht. Käme sie mit der Vernunft überein: so würde sie kein Wunder mehr seyn.«6
Das Vertrauen und seine Sozialstrukturen
Die Charakteristika des Glaubens zeigen sich besonders deutlich am Vergleich mit dem Vertrauen. Der amerikanische Sozialpsychologe Timothy Levine führte umfangreiche empirische Forschungen zur Frage des Vertrauens durch. So sollten Studierende aus der gefilmten Selbstdarstellung eines Menschen schließen, ob dieser lügt oder nicht. Die wenigsten lagen richtig. Die Aufrichtigkeit eines Menschen, so Levine, werde zumeist von seinem Verhalten abgeleitet: Um Vertrauen zu erwecken, genüge oft Selbstbewusstsein, ein freundlicher, offener Blick.7 In einer auf seinen Forschungen basierenden Untersuchung – es ging um insgesamt 500.000 Fälle – wurden Entscheidungen von Untersuchungsrichtern zur Freilassung eines Angeklagten auf Kaution mit denen eines Computers verglichen. Computer und Richter verfügten über dieselben Informationen: Umstände des Vergehens, Vorgeschichte des Angeklagten, Strafregister etc. Der einzige Unterschied: Die Richter sahen den Angeklagten vor sich, das schreibt das Gesetz vor, sie hörten ihn reden, machten sich ihren eigenen Eindruck von diesem Menschen. Es zeigte sich, dass der Rechner das Rückfallrisiko der Straffälligen höher und um 25 Prozent genauer eingeschätzt hatte.8 Fazit: Der Mensch eignet sich nicht als Lügendetektor.
Levine erklärt unsere Unfähigkeit, »Lügner zu identifizieren« nicht etwa mit fehlender Menschenkenntnis, sondern damit, dass wir schon aus Selbstschutz davon ausgehen, dass uns die anderen die Wahrheit sagen. Die Tendenz, anderen zu vertrauen, sei »eine adaptive Folge der menschlichen Evolution; sie ermöglicht effiziente Kommunikation und soziale Koordination« und erlaubt »dem Menschen, sozial zu funktionieren«. Da die meisten Täuschungen »von wenigen produktiven Lügnern begangen werden, entspricht der Vertrauensvorschuss in Wirklichkeit gar keiner Voreingenommenheit. Meistens liegen wir mit dem passiven Vertrauen richtig. Allerdings macht es uns auch anfällig für gelegentliche Täuschungen.« Für das Überleben der Art stelle dies allerdings eine geringere Gefahr dar als der Verlust des Vertrauens.9
Auf die Relevanz dieses angeborenen Vertrauenssystems für die moderne Gesellschaft und die Psychoanalyse geht das 9. Kapitel ein. Hier sollen zunächst die historischen Auswirkungen solcher Vertrauenssysteme dargestellt werden. Das zur menschlichen Natur gewordene Vertrauen fand seine Entsprechung in vielen prähistorischen und frühzeitlichen Gesellschaften, von denen uns Anthropologen und Archäologen berichten, darunter David Graeber und David Wengrow in ihrer Monumentalstudie The Dawn of Everything. A New History of Humanity.10 Dieses Buch, in dem sich ein Gutteil der bisherigen Forschung zum Thema versammelt findet, liefert keine eindimensionale Darstellung der menschlichen Entwicklungsgeschichte, sondern beschreibt eine Vielzahl unterschiedlicher sozialer Dynamiken. Damit widerlegen die Verfasser einige stereotype Vorstellungen der bisherigen anthropologischen Forschung und verweisen zugleich auf die vielen unterschiedlichen Wege, die die Erbschaft der Evolution einschlagen konnte. So wurde etwa das Vorurteil widerlegt, dass jede größere Ansammlung von Menschen zwingend nach einer zentralisierten Sozialstruktur verlange. Graeber und Wengrow verweisen auf große Siedlungen aus der Steinzeit, die sich im Gebiet der heutigen Ukraine und Moldawiens befanden und bis zu 10.000 Menschen umfassten. Diese Gemeinschaften – das zeigen Grabungen, die keinen zentralen Palast oder Tempel zutage förderten – lebten ohne soziale Hierarchie und kamen ohne Oberpriester oder Herrscher aus. Da die Behausungen mehr oder weniger die gleiche Größe aufwiesen, ist davon auszugehen, dass auch das Eigentum relativ gleich verteilt war.11 Die Menschen lebten von Tierzucht, kleiner Landwirtschaft, Sammeln und Jagen, und sie hinterließen kaum einen ökologischen Fußabdruck, obgleich sich ihr Fortbestand über eineinhalbtausend Jahre erstreckte. Auch fand man keine Spuren von Kriegsführung.
Wie das Zusammenleben in diesen kreisförmig angelegten Siedlungen funktioniert haben könnte, stellen Wengrow und Graeber durch den Vergleich mit einer baskischen Kultur dar, die bis in die jüngste Zeit existierte und deren Dorfarchitektur auf einer ähnlichen Form basierte. Äußerlich hatten diese Gemeinschaften zwar die Merkmale der sie umgebenden christlichen Kultur angenommen: Im Zentrum der Gemeinschaft stand eine Kirche. Doch ihre Sozialstruktur entsprach nicht der hierarchischen Ordnung anderer christlicher Dörfer. Wegen der Ringform des Dorfes hatte jedes Haus einen Nachbarn zur Rechten und zur Linken, keines stand in der Mitte, keines an erster oder an letzter Stelle. Die Konstruktion garantierte die »saisonale Rotation der wesentlichen Aufgaben und Pflichten«, die auch rituell eingeübt wurden. »Jeden Sonntag segnet ein Haushalt zwei Brote in der örtlichen Kirche, isst eines davon und schenkt dann das andere seinem ›ersten Nachbarn‹ (dem Haus zu seiner Rechten).«12 In der darauffolgenden Woche übernahm der nächste Haushalt, bis alle Familien zum Zuge gekommen und der volle Zyklus erreicht war. Die Brote wurden als »Samen« bezeichnet, sie standen für das Leben. Bei der Fürsorge für die Toten und für Reisende verlief die Weitergabe der Aufgaben in umgekehrter Richtung. Auch bei größeren Pflichten, für deren Erledigung es mehrerer Hände bedurfte, wurde nach einem ähnlichen System verfahren: Hier taten sich zehn Haushalte zusammen. Der Kreis symbolisierte und strukturierte die sozialen und ökonomischen Pflichten; er repräsentierte »komplizierte Systeme gegenseitiger Hilfe«, die auch ohne »zentrale Kontrolle oder Verwaltung« auskamen.13
Eine solche Zirkulation von Gaben und Pflichten entspricht dem, was der französische Anthropologe Marcel Mauss in seinem Buch Die Gabe beschrieben hat: Systeme der Reziprozität und des Tausches, die weltweit und in vielen unterschiedlichen Frühkulturen existierten und von denen sich Relikte bis in die modernen Gesellschaften finden. Das Prinzip der zirkulierenden oder »zeremoniellen Gabe« besagt, dass jede erhaltene Gabe durch eine andere erwidert oder weitergegeben werden muss. Geschieht das nicht, so kommt dies einer Kriegserklärung gleich. Durch diesen Mechanismus konstituiert sich ein unsichtbares soziales Band, das der Konfliktvermeidung dient und jede einzelne Person der Gemeinschaft einschließt. Das System basiert auf dem Vertrauen, das immer in zwei Richtungen funktioniert: Ein Mensch schenkt Vertrauen und ist Empfänger von Vertrauen, was wiederum zum Selbstvertrauen beiträgt. Im Prinzip der Reziprozität liegt die Stärke von Vertrauenssystemen wie dem Gabentausch, in dem, so Mauss, die Gabe für den Schenkenden selbst steht, »und zwar darum, weil man sich selbst – sich und seine Besitztümer – den anderen ›schuldet‹«.14 Der Gabentausch existierte in Gesellschaften mit oraler Kommunikation, und es war die Grundlage, so der Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan, von vielen sozialen Netzen wie Sippe, Clan oder Familie, wo die gesprochene, das heißt, mit dem Leib verbundene, Sprache als Teil des Organismus galt.15 Weil die gesprochene Sprache jeden einzelnen erfasste, wurde das System des Gabentauschs zu einem Teil des Gefühlssystems jedes einzelnen Körpers: Es wurde also nicht als Zwangssystem wahrgenommen. Die zeremonielle Gabe wurde so zu einem Teil des kollektiven und individuellen Unbewussten.
Über die Gemeinschaften, die nach diesen Prinzipien funktionierten, wissen die Anthropologen und Archäologen heute immer mehr: Sie lernen die Zeichen zu interpretieren, die sich aus der Bauweise steinzeitlicher Siedlungen, Gräberfunden, Nahrungsresten oder genetischen Analysen ergeben. Oft handelt es sich um Relikte, die auf einige tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung zurückzudatieren sind, doch einige Grundsätze ihrer ungeschriebenen Gesellschaftsregeln werden allmählich lesbar – vermutlich deshalb, weil sich unsere Augen dafür zu öffnen beginnen. Diese Strukturen passten sich also dem angeborenen Vertrauensvorschuss an, sie verliehen den Vorgaben der Evolutionsbiologie ein angemessenes soziales Gerüst.
Wie und warum wurden diese Systeme ausgehebelt? Warum gab es immer mehr hierarchische und immer weniger egalitäre Gesellschaften? Wie sich der Wandel vollzog, hing von den jeweiligen kulturellen Umständen oder geo-historischen Gegebenheiten ab. Offenbar ist aber, dass hierarchische Gesellschaften auf egalitäre folgten – so gut wie nie geschah dies in gegengesetzter Richtung. Daraus lässt sich schließen, dass sie die Gemeinschaften der zirkulierenden Gaben verdrängten. Sehr oft, fast immer, war das Oberhaupt der hierarchischen Gesellschaften männlich, oft wurde seine Herrschaft durch Kontrolle oder Gewalt gesichert, die auch vor Ausbeutung und Leibeigenschaft nicht Halt machte. Wie die Sozialsysteme der zirkulierenden Gaben existierten auch diese hierarchischen Gesellschaften weltweit: in Mesopotamien, in Nord- und Südamerika, im alten Ägypten ebenso wie in China und anderen Regionen. Einige von ihnen hielten sich lange – im alten Ägypten mehrere tausend Jahre –, bis andere Gesellschaftsstrukturen an ihre Stelle rückten. In diesen hatten oft erbliche Eliten oder Aristokratien das Sagen. Dazu gehörte auch das antike Griechenland, das sich zwar als »demokratisch« verstand, weil es keinen König gab, dessen Ökonomie aber auf Sklaverei und Leibeigenschaft beruhte.
Daneben entwickelte sich, vor allem rund ums Mittelmeer, noch ein dritter Typus von Gemeinschaft, deren Beginn sich ziemlich genau auf die Einführung neuer, vor allem phonetischer Schriftsysteme datieren lässt.16 Unter diesen war besonders einschneidend das Alphabet, ein Schriftsystem, das wegen seiner wenigen Zeichen leicht zu erlernen war und das deshalb – im Gegensatz zu allen bis dahin existierenden Schriftsystemen – breiteren Bevölkerungsschichten den Zugang zu Bildung und Wissen und damit auch zur Herrschaft über das kulturelle Gedächtnis der Gemeinschaft bot. Hierarchische Strukturen hatten es hier schwerer. Die Kulturen, die aus diesen neuen alphabetischen Systemen hervorgingen, verkündeten die Gleichheit aller Menschen: Deuteronomium, das 5. Buch Mose, ist »der erste, vollständig ausformulierte Nations- und Gesellschaftsvertrag der Welt, der die Männer, Frauen und Kinder, die Reichen und die Armen einer ganzen Gemeinschaft einbezieht«.17 Neue »Sozialgesetze« sahen etwa die Freilassung von Sklaven nach sieben Jahren vor. Allerdings bangten diese Gemeinschaften wegen der Gleichstellung und des wachsenden Umfangs um den sozialen Zusammenhalt; so schufen sie sich geschriebene Regelwerke, die an die Stelle der ungeschriebenen Gabensysteme traten. Die jüdische Gemeinschaft, die erste »textual community« der Welt,18 bildete sich nicht lange nach der Entstehung des semitischen Alphabets, der Mutter aller Alphabete. In der Heiligen Schrift, die sich diese Gemeinschaft gab, wurden 613 Zeremonialgesetze formuliert, die alle Bereiche des Lebens – von Ernährung, über Sexualverhalten bis zu Bestattung und Reinheitsvorschriften – erfassten und für einen Gemeinschaftskörper sorgten, der jeden einzelnen Körper einschloss und Bindungen schuf, die sogar die spätere Zerstreuung überdauerten. Der angeborene Vertrauensvorschuss der Evolutionsbiologie fand also auch in einer schriftbasierten Kultur ein neues soziales Regelwerk.
Die Heiligen Schriften der drei monotheistischen Religionen sind allesamt in alphabetischen Schriftsystemen verfasst. Das semitische Alphabet schuf die Voraussetzungen für die Entstehung des Monotheismus. Indem es Laute in visuelle Zeichen umwandelte, die auf Pergament oder Stein verewigt werden konnten, entriss dieses Schriftsystem dem Körper die Sprache. Das galt nicht für vorangegangene Schriftsysteme, die keine Beziehung zur gesprochenen Sprache hatten.19 Der Abstraktionsschub, den das Alphabet als körperferne, der gesprochenen Sprache aber zugleich eng verbundenes Zeichensystem implizierte, vollzog sich parallel zur Herausbildung der jüdischen Gemeinschaft. Mit der Ausbreitung des semitischen Alphabets wurden die ersten Grundlagentexte der jüdischen Religion formuliert. In ihrem Mittelpunkt stand ein abstrakter Gott: ein Gott, der nicht zu sehen war, der sich einzig in den Zeichen der Schrift offenbarte und die Welt aus dem Wort erschuf. Dieser Gott konnte auch als »das Gesetz« gedacht werden – als ein Regelwerk, das die Gemeinschaft in einer ähnlichen Weise vor innerem Zwist schützte, wie es die alte Gabengemeinschaft vermochte. In den religiösen Systemen (etwa dem babylonischen), die der Entstehung des Judentums vorausgingen, repräsentierten die Herrscher eine transzendente Macht. Ihre Autorität beruhte auf der Verbindung zum Jenseits. Dagegen waren die Könige Israels Menschen (weshalb die Hebräische Bibel ihren irdischen Missetaten auch viel Platz einräumt). Der Bezug der Gemeinschaft zur Transzendenz beruhte auf der von einem Gott verliehenen Heiligen Schrift. Sie bewirkte den Zusammenhalt des Volks Israel.
Auch die griechische Kultur basierte auf einem Alphabet. Es entstand zweihundert Jahre nach dem semitischen und hatte ebenfalls einen bedeutenden Abstraktionsschub zur Folge. In dessen Mittelpunkt befand sich jedoch kein allmächtiger Gott, sondern der Glaube an Logos, Theorie und an ein geschriebenes, irdisch verfasstes Rechtssystem, das später im römischen ius, Basis des modernen Rechtsstaats, seine deutlichste Ausformulierung finden wird. Wieso verlief der Weg so anders? Das griechische Alphabet unterschied sich in einem entscheidenden Punkt vom semitischen: Es erfasste alle Laute der mündlichen Sprache, während das semitische Alphabet nur aus Konsonanten bestand. Texte, in denen die Vokale nicht ausgeschrieben werden, sind nur lesbar für die, die auch die gesprochene Sprache beherrschen. Erst aus dem Zusammenhang lässt sich erschließen, welche Vokale einzufüllen sind; ob die Buchstaben »rs« Reis, Rose oder Riese bedeuten. Das Konsonantenalphabet hatte zur Folge, dass sich die Oralität in den jüdischen Traditionen parallel zur Schrift erhielt: Der Text wird bis heute in der Synagoge laut verlesen, und die Heilige Schrift wird im mündlichen Gespräch zwischen Lehrer und Schüler von Generation zu Generation immer wieder neu ausgelegt. Die Bewahrung der mündlichen Tradition machte die jüdische Kultur leichter kompatibel mit den flexiblen Traditionen des angeborenen Vertrauensvorschusses. In der griechischen Kultur dagegen sollte das »volle Alphabet« dafür sorgen, dass die Schrift die Oralität zunächst verdrängte und dann nach ihren Regeln gestaltete.20 In diesem Fall kam es also zu einer Vorherrschaft der Schrift.
Das jüdische Regelwerk blieb ein Sonderfall: Erstens war es zugeschnitten auf einen spezifischen Kulturraum, ließ sich also nicht ohne Weiteres auf andere Traditionen übertragen – etwa die des ostasiatischen Raums. Zweitens basierte es auf einer Gemeinschaft von überschaubarer Größe, was in der Diaspora durch das matrilineare Prinzip verstärkt wurde.21 Die jüdische Religion gilt zwar als »Weltreligion«, historisch stieß sie sich aber immer wieder an solchen Einschränkungen, die letztlich verhinderten, dass sich das Vertrauensprinzip, auf dem sie basierte und das sie weitergab, auf andere Schriftkulturen übertragen ließ. So mag es sich erklären, dass das Christentum, das mit dem Judentum um die Nachfolge auf den Thron Davids konkurrierte, Vertrauen durch Glauben zu ersetzen versuchte. Der Glaube war besser vereinbar mit der Dominanz der Schrift.
Der Glaube verdrängt das Vertrauen
Die Geschichte des Christentums begann etwa tausend Jahre nach der des Judentums, zeitgleich mit der Zerstörung des Zweiten Tempels und dem Beginn der jüdischen Diaspora.
Als größte Sünde des Christentums gilt der Glaubenszweifel. Seit dem 4. Jahrhundert ist das Glaubensbekenntnis Bestandteil des Gottesdienstes. Während sich das Schma Jisrael (Höre, Israel) der jüdischen Religion an die gesamte Gemeinschaft richtet und von dieser verlangt, sich nach den Regeln des Einen Gottes zu richten, stellt das Credo (Ich glaube) der Kirche den individuellen Glauben in den Mittelpunkt. Im Protestantismus wurde der Einzelne sogar für seinen Glauben verantwortlich gemacht. Luther verlangte von den Gläubigen, ein direktes Verhältnis zu Gott aufzubauen, auf die Mittlerrolle der Geistlichen zu verzichten. Er übersetzte die Heilige Schrift ins Deutsche, damit sie jedes Mitglied der Gemeinschaft selbst lesen konnte und nicht zwingend auf die Interpretation der Institution Kirche angewiesen war. In den protestantischen Gebieten wuchsen die Alphabetisierungsraten rascher als in den katholischen, und diese Lesefähigkeit schloss auch die Frauen ein: Die ersten Mädchenschulen entstanden im protestantischen Raum. Zugleich beinhaltete das reformierte Glaubensbekenntnis zunehmend dogmatische Aspekte; sie dienten der Abgrenzung gegen die katholische Kirche, hatten aber auch zur Folge, dass Rom seinerseits strenger formulierte, was sich im Trienter Glaubensbekenntnis von 1564 niederschlug.
Die Zentrierung aufs Ich hatte den »nach Innen« genommenen Gott des Protestantismus zur Folge: Es entwickelte sich einerseits das Gewissen, andererseits begann jener »beschwerliche Weg« ins Innere des Menschen, wo Schleiermacher die Religion vermutete.22 Beides, die verdrängten, abgespaltenen oder vergessenen Teile des Gewissens wie auch diese neue »aufgeklärte« Art, Religion zu denken, fanden in der Theoretisierung des Unbewussten einen Niederschlag: Ihm wurden jene Bereiche zugewiesen, die der Glaube nicht ganz zu beherrschen vermochte. Die Genese macht verständlich, warum die ersten Theoretiker des Unbewussten so gut wie alle aus protestantischen Häusern kamen: In der reformierten Kirche war der Säkularisierungsprozess weiter fortgeschritten als im Katholizismus. Für die Protestanten war es schwierig geworden, am Transzendenzgedanken festzuhalten; gleichzeitig bot dieser »innere Gott« die Möglichkeit, sowohl vom Glauben abzufallen als auch ihm treu zu bleiben. Mit dem Unbewussten erlebte das Göttliche eine Wiederauferstehung im Ich. Das Bewusstsein trat die Erbschaft des Glaubens an, während das Vertrauen dem Unbewussten überlassen blieb. Die naheliegende Frage, warum sich dann um 1900 ein Jude, Sigmund Freud, und mit ihm viele andere säkularisierte Juden dem Unbewussten so intensiv zuwandten, ist eine Frage, die uns im nächsten Kapitel beschäftigen wird.
Der Glaube ist eine prekäre Angelegenheit: Er ist exklusiv, es gibt nur die eine Wahrheit, alles andere fällt unter »Lüge«. Das Vertrauen dagegen duldet die andere Wahrheit neben der eigenen. Umso entschlossener, ja, rücksichtsloser muss der Glaube die eigene Position durchsetzen. Vertrauen wird geschenkt; der Glaube dagegen wird erwogen, dekretiert, auch erzwungen. Es gibt Glaubensfanatiker, wogegen der Begriff »Vertrauensfanatiker« keinen Sinn ergibt. Vertrauen kann enttäuscht, auch verraten werden. Dem Glauben kann dies nicht geschehen, denn er ist nicht zu widerlegen, über Glaubensinhalte lässt sich nicht diskutieren. Der Glaube muss nicht religiös sein – wir werden sehen, wie viele weltliche Gestalten er annehmen kann –, er bezieht sich oft auf eine Ideologie oder eine Institution wie »die Partei«. Seine Vertreter sichern sich im Allgemeinen durch die Berufung auf eine höhere Instanz ab: Gott, Nation, Vorsehung, ein politisches Programm. Der Glaube ist eine Grundhaltung. Manchmal findet er in der Gemeinschaft Verstärkung, doch im Verhältnis zwischen zwei Menschen oder einer Familie kommt der Glaube nur dann ins Spiel, wenn die Außenwelt dominiert. Vertrauensverhältnisse dagegen können sowohl zwischen zwei Menschen als auch in einer Familie gelten; sie lassen sich auch auf eine größere Gruppe übertragen, wenn deren Sozialstruktur das angeborene Vertrauen unterstützt. Der entscheidende Unterschied: Der Glaube fordert die Bereitschaft, ja den Willen, an etwas zu glauben. Das angeborene Vertrauen dagegen kann und muss auf den Willen verzichten. Vertrauen »wächst«, kann nicht »gewollt« werden, während der Glaube wenig Raum lässt für das, was »von selbst« geschieht. Weil er dem Bewusstsein nähersteht – er hat seinen Ursprung immer in einem Text, einer Lehre oder einem Bekenntnis –, eignet der Glaube sich besser für hierarchische Strukturen und Gewalt als das Vertrauen. Autokraten setzen nie auf Vertrauen, immer nur auf den Glauben.
Dass auch der Glaube evolutionsinhärent sein kann, legt ein Gespräch nahe, das ich 1989 mit dem jüdischen Philosophen und Naturwissenschaftler Yeshayahu Leibowitz für einen Film über die Geschichte des Antisemitismus führte. Auf meine Frage, ob das, was in der Shoah geschehen ist, vorauszusehen war, antwortete er: »Vor sechzig Jahren konnte ja niemand die Phänomene, die wir nachher aus dem Dritten Reich gekannt haben, überhaupt im Traum denken. Das hat auch kein Historiker und kein Soziologe vorausgesehen. Ich: Gibt es nachträglich etwas, das wir erkennen können? Eine Gesetzmäßigkeit, die dahin geführt hat? Leibowitz: Da treffen Sie einen Punkt. Es gibt offenbar in der Geschichte keine Gesetzmäßigkeit. Das ist der tiefe Gegensatz zwischen der Geschichte der Menschheit und der Natur. In der Natur können wir Gesetzmäßigkeiten finden. In der Menschheitsgeschichte finden wir keine Gesetzmäßigkeit. Und das ist verständlich, denn in der Natur gibt es weder Bewusstsein noch Willen, da gibt es nur Notwendigkeiten. Aber Menschen haben ein Bewusstsein und haben Willen. Ich: Das heißt, Geschichte ist deshalb unberechenbar, weil der Mensch nicht Natur ist. Leibowitz: Ja ganz richtig. Aber die Negation genügt nicht. Wir müssen hinzufügen, er ist nicht Natur, sondern er hat Bewusstsein und Willen. Und das gibt es in der Natur nicht. Ich: Und eben dies Bewusstsein führt dazu, dass er unberechenbar ist? Leibowitz: Absolut unberechenbar.«23
Sowohl Glaube als auch Vertrauen sind dem Menschen inhärent, repräsentieren jedoch unterschiedliche, oft unvereinbare Anteile der menschlichen Psyche. Im Zentrum des Kampfs ums Unbewusste steht der Kontrast zwischen diesen beiden Polen. Das Kapitel Genesis der hebräischen Bibel erscheint wie eine einprägsame Reflexion über diese Opposition, die die Evolution uns bescherte: Das Paradies repräsentiert das Urvertrauen, der Apfel vom Baum der Erkenntnis dagegen den Glauben. Wir werden sehen, dass hinter allen religiösen, politischen oder sozialen Konflikten, von denen noch die Rede sein wird, immer wieder der Schatten des Gegensatzes von Glauben und Vertrauen hervortritt. Der Antagonismus sorgte für eine Dynamik, die für die Geschichte des Unbewussten und seine Theoretisierung entscheidend war, weshalb er – ohne dass wir dies vorher geplant hätten – zu einem Leitfaden dieses Buchs wurde.
Das Verhältnis von Glauben und Vertrauen ist nicht nur geprägt von ihrer Gegensätzlichkeit, sondern auch von einem Prozess der Annäherung und Überlagerung. Er zeigt sich deutlich in der französischen Sprache, die für den Glauben zwei Begriffe hat: croyance und foi. Ersteres ist der bewusste Glaube, der ursprünglich vom Willen gesteuert ist, bevor er zum Bekenntnis oder zur Gewohnheit wird. Das zweite ist eine schon kaum mehr bewusste Art des Glaubens, deren Etymologie auch mit dem Begriff der confiance (Vertrauen) zusammenhängt: Er leitet sich ab von lateinisch fides, Vertrauen, Glauben, Treue. Der Unterschied zwischen croyance und foi lässt sich etwa so erfassen: Des croyances peuvent être décrites, la foi ne peut être que vécue. Die croyances können beschrieben, die foi kann nur gelebt werden. Der »gelebte Glaube« nähert sich also der Bedeutung von confiance im Sinne von Vertrauen an – und bleibt dennoch ein Glaube, den man hat, mit dem man sich wie mit einer schusssicheren Weste umgeben kann, oder gar anderen aufzwingt. Die Überlagerung von Glauben und Vertrauen, von der die französische Sprache Zeugnis ablegt, scheint vor allem ein Phänomen der christlichen Gesellschaft zu sein. Sie erklärt zugleich, warum es manchmal schwierig ist zu entscheiden, ob ein Phänomen ins Zuständigkeitsgebiet des Glaubens oder des Vertrauens fällt.
»Unter den Vorschriften des mosaischen Gesetzes«, so schrieb Moses Mendelssohn, »lautet kein einziges: du sollst glauben oder nicht glauben; sondern alle heißen: Du sollst tun oder nicht tun! Dem Glauben wird nicht befohlen, denn der nimmt keine anderen Befehle an, als die im Weg der Überzeugung zu ihm kommen.«24 Die Tradition des rabbinischen Judentums konnte auf den Glauben verzichten, weil es Handlungsanweisungen gab. Um Jude zu sein, genügte es, sich an ein Regelwerk zu halten. Das war schwierig genug, befreite aber die Mitglieder von der noch schwierigeren Glaubenspflicht. Stattdessen vermittelten jüdische Lehren die Fähigkeit, mit dem Zweifel umzugehen, Widersprüche zu ertragen – eine Gewohnheit, die dann auch vom kulturellen oder areligiösen Judentum weitergeführt wurde und etwa in der Figur des »Intellektuellen« ihren Niederschlag fand.25 Es versteht sich, dass die Unterscheidung zwischen Judentum und Christentum nicht im Gegensatzpaar Vertrauen und Glauben aufgeht. Doch das Beispiel ist aufschlussreich, um die Entwicklungen des Unbewussten im totalitären Staat zu verstehen.
Kulturtechniken verschaffen dem Glauben Zugang zum Unbewussten
Der Wille ist ebenso riskant wie der Glaube selbst. Im christlichen Kulturraum entstanden – vielleicht aus diesem Grund – Kulturtechniken, die den Willen kontrollieren und befördern halfen. Wurden sie bei ihrer Einführung zunächst als willkürlicher Eingriff wahrgenommen, so sollten sie allmählich verinnerlicht und zu einem Teil der menschlichen »Natur« werden. Als Beispiele seien hier drei Kulturtechniken aufgeführt: erstens Schrift/Buchdruck und eng damit verbunden das Geld, zweitens die Räderwerkuhr und drittens die technischen Sehgeräte. Alle drei erwiesen sich als kollaborative Willens- und Glaubenshilfen. Sie trugen dazu bei, dass der Glaube zur »Natur« des Menschen, zu einer eigenen »Provinz im Gemüthe« werden konnte.
Die christliche Theologie war die größte Schriftproduzentin des mittelalterlichen Abendlandes. Verfasst wurden nicht nur theologische Lehren, sondern auch juristische Codices, denn die Kirche verwaltete neben dem Glauben auch irdische Besitztümer und das archivalische Gedächtnis, das die Basis von Schriftgemeinschaften bildet. Gegen Ende des Mittelalters waren viele Klöster zu besseren Kopieranstalten geworden. Der Buchdruck mit seinen beweglichen Lettern wurde im christlichen Kulturraum erfunden, der mit der Erbschaft des griechischen Alphabets auch die Schriftdominanz übernommen hatte.
Auch das Geld, selbst ein Schriftsystem, diente als Glaubenshilfe. Die Kirche hatte zunächst vom »Geldteufel« gesprochen, aber schon unter Konstantin dem Großen im vierten Jahrhundert verschaffte das Leiden Christi dem Geld Glaubwürdigkeit: Das Credo in der Kirche wurde zur Basis des Kredits und des Glaubens ans Geld. Das Kreuz wurde auf Münzen geprägt, und die Hostie nahm die Form einer Münze an.26 Im 13. Jahrhundert, als sich die Geldwirtschaft zum ersten Mal seit der Antike wieder etablierte, verkündete die Kirche die Transsubstantiationslehre, die eine dem Geld analoge Idee implizierte: das Fleisch gewordene Zeichen. Faktoren wie diese machten die christliche Religion nicht nur geldkompatibel, sondern schufen auch die Voraussetzungen für eine Verbreitung der Geldwirtschaft im christlichen Kulturraum; sie bahnten den Weg für die Entstehung von Kapitalismus und freier Marktwirtschaft.27 Zwar läuteten sowohl der Buchdruck (der zu einer breiteren Bildung führte) als auch die Geldwirtschaft (die den Aufstieg neuer sozialer Klassen einleitete) den Prozess der Aufklärung ein. Doch als dies geschah, hatte der Übergang von einer Gesellschaft, die an heilige Texte glaubte, zu einer Gesellschaft, in der sich Schrift und Geld jedem einzelnen Körper eingeprägt hatten, schon längst stattgefunden. Der Glaube hatte einen ersten Sieg über das Vertrauen errungen.
Die Räderwerkuhr wiederum vollbrachte den Transfer von Techniken der Frömmigkeit zu denen der Industrialisierung. Auch die mechanische Uhr entsprach einem Bedürfnis christlicher Klöster. Das französische Wort horloge leitet sich von hora lego (Gebetsstunde) ab. Die Cluniazensische Reform im 10. und 11. Jahrhundert schuf eine feste Gliederung der Zeit durch sieben Gebetsstunden. Da das Gebet auch in der Nacht verrichtet wurde, kamen Sonnenuhren nicht infrage. Wasseruhren froren bei den winterlichen Temperaturen des Nordens ein. Der Zeitmesser, der den Anforderungen der Mönche und Nonnen entsprach, wurde um 1300 erfunden: in Gestalt der mechanischen Uhr. Sie sicherte den Tagesablauf im Kloster, der von der Idee eines synchronen Lebens bestimmt war: Man aß, betete, arbeitete zusammen, lebte in Gemeinschaftsräumen. Die Räderwerkuhr garantierte den festen Zeitrhythmus und schuf zugleich soziale Homogenität.
Bald begannen die Uhren, auch das Wirtschaftsleben außerhalb der Klostermauern zu regulieren. In den Städten ertönten Glocken für den Arbeitsbeginn, für Mahlzeiten, das Ende der Arbeit, das Schließen der Stadttore, Marktzeiten, Sitzungen des Stadtrates, Sperrstunde usw.28 Die Räderwerkuhr schuf die entscheidende Voraussetzung für den allmählichen Prozess der Mechanisierung und Industrialisierung, der seit dem Spätmittelalter über die Textilindustrie und bald auch über andere Wirtschaftssektoren bestimmte. Der Industrialisierungsprozess ist ohne die Räderwerkuhr nicht vorstellbar, und Lewis Mumford hat deshalb zu Recht behauptet, dass die Schlüsseltechnik des Industriezeitalters nicht die Dampfmaschine, sondern die Uhr war.29 Sie synchronisierte die Gemeinschaft – und das (mit dem Vertrauen eng verbundene) Zeitgefühl wurde durch eine verinnerlichte Zeit ersetzt, die den vierundzwanzig gleich langen Stunden der Räderwerkuhr entsprach.
Bei der dritten Kulturtechnik verband sich der Glaube mit dem Sinn des Sehens. Sowohl die jüdische Religion als auch der Islam gehen von einem verborgenen Gott aus, der nicht abgebildet werden darf – er bleibt mithin verschleiert. Moses wie Mohammed verhüllen ihr Haupt, bevor sie das Wort Gottes empfangen. Der Raum Gottes ist das Dunkel, das Wissen und Denken nicht durchdringen können. Er ist der sakrale Bereich, in dem Unzugängliches vermutet und das »Un‑Bewusste« verwahrt wird. Das Christentum folgte einer anderen Logik. Das griechische Wort apokalypsis, das dem Johannesevangelium, dem Buch der Offenbarung den Namen lieh, heißt wörtlich aus dem Griechischen übersetzt »Entschleierung« und ist zusammengesetzt aus kalypta, was »schleierartiger Umhang« bedeutet, und dem Präfix apo (weg, entfernt). Auch der lateinische Begriff revelatio versteht die Offenbarung als einen symbolischen Akt der Entschleierung (von velum, Schleier, Vorhang). Dahinter steht der Gedanke, dass der Gläubige das Geheimnis Gottes, die Wahrheit, unverhüllt sehen und begreifen kann. Im Gegensatz zu den beiden anderen monotheistischen Religionen ist das Christentum eine Religion der Enthüllung. In ihrem Zentrum steht ein Gott, der in seinem Sohn sichtbare Gestalt angenommen hat.30
Dieser christliche Topos der revelatio – als Zugang zur Wahrheit und zum Geheimnis – sollte bestimmend werden für die Wissenschaft des christlichen Kulturraums: Auf der Suche nach der wissenschaftlichen »Wahrheit« entwickelte das Abendland eine Fülle von Sehtechniken und Sehgeräten, die neue Paradigmen setzten und Ent-Deckungen ermöglichten. Die christliche Welt übernahm zu Beginn der Neuzeit viele Erkenntnisse aus dem arabischen Raum, wo das Wissen in der Medizin und auf technisch-naturwissenschaftlichen Gebieten weiter fortgeschritten war. Doch im Bereich des Sehens erfand das christliche Europa ganz Eigenes: Zentralperspektive, Fernrohr, Mikroskop, Camera obscura und später Fotografie und Film. Diese Techniken veränderten das Sehen und verwandelten die transzendente Wahrheit, an die es zu glauben galt, in die Vorstellung eines mit den Augen zu erfassenden Wissens. Inzwischen gibt es viele Formen von Wissen, die sich dem Auge entziehen – neurologische Vorgänge zum Beispiel. Für sie wurden bildgebende Verfahren entwickelt, mit denen ein Topos aus den Evangelien eine neue Wendung erfährt. Jesus sagt zum ungläubigen Thomas: »Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.«31 Die bildgebenden Methoden helfen denen unter uns, die nur an das glauben wollen, was sie auch sehen können.
Diese Kulturtechniken schufen einen Raum, in dem sich der Glaube im Unbewussten ansiedeln konnte. Sie wurden ergänzt durch die Idee einer »Mathematisierbarkeit« der Welt. Für den französischen Soziologen und Psychoanalytiker Cornelius Castoriadis ist der große Wissensschub der Neuzeit nicht einer technischen Errungenschaft wie dem Buchdruck zu verdanken; vielmehr sei ihm eine Imagination von Welt vorausgegangen, »derzufolge alles Seiende ›rational‹ (und insbesondere mathematisierbar) ist, nach der der Raum des möglichen Wissens von Rechts wegen vollständig ausgeschöpft werden kann und wonach das Ziel des Wissens in der Beherrschung und Aneignung der Natur liegt.«32 Die Mathematisierbarkeit der Welt bildete eine Fortführung der Scholastik, die auf einem »logischen Ordnungssystem« beruhte und die »Erklärung des Glaubens durch die Vernunft« verfolgte. Ihre Logik, so Erwin Panofsky, fand in der Architektur der Gotik ihren Ausdruck.33 »Es verwundert kaum, daß eine Denkweise, die es für nötig hielt, den Glauben durch einen Appell an die Vernunft und die Vernunft durch einen Appell an die Vorstellungskraft ›klarer‹ zu machen, sich auch verpflichtet fühlte, die Vorstellungskraft wiederum durch einen Appell an die Sinne ›klarer‹ zu machen.«34 Castoriadis’ »mathematisierbare Welt« der Renaissance ging also eine Glaubenskultur des Christentums voraus, die schon mit Erfolg die Ratio in ihr religiöses System integriert hatte.
Nun könnte man aus dieser Darstellung schließen, dass das Unbewusste als ein Phänomen des christlichen Kulturraums zu betrachten ist. Ganz zu leugnen ist dies nicht, denn bei der Geschichte des Unbewussten, womit nicht die »Sache« selbst, sondern ihre Definition gemeint ist, wie auch bei der Entstehung der Psychoanalyse bewegen wir uns im christlichen Kulturraum – auch da, wo Juden maßgeblich beteiligt waren. Der Säkularisierungsprozess, innerhalb dessen sich das Aufkommen des Diskurses über das Unbewusste historisch vollzog, wurde hier angestoßen. Der christliche Kulturraum implizierte, wie das Beispiel der Sehtechniken zeigt, nicht zwingend den Verzicht auf christliche Lehren, sondern manchmal auch deren Verlagerung auf eine weltliche Ebene.35 Nahmen andere religiöse Traditionen – Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, um nur diese zu nennen – weltliche Form an, wenn also aus Religion Kultur wurde, so geschah dies häufig unter dem Einfluss der christlichen Mehrheitsgesellschaft, etwa beim diasporischen Judentum36 oder im Falle des Islam unter dem Einfluss des Kolonialismus.37 Der Säkularisierungsprozess war der erste von vielen Umbrüchen, die die weitere Entwicklung der Moderne begleiten sollten. Mit jedem Umbruch nahmen die Konflikte um das Unbewusste neue Gestalt an.
Mit den digitalen Medien des 20. und 21. Jahrhunderts fanden die verschiedenen Kulturtechniken – Schrift, Geld, Zeitvermessung, Bild und Mathematisierbarkeit – zueinander und schufen die Basis für die spezifische Gesellschaftsformation, die wir von Internet und sozialen Medien kennen. Mit den digitalen Techniken erreichte die »Mathematisierbarkeit der Welt« einen neuen Höhepunkt, indem sich nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere Psyche einem »Vermessungswahn« unterwarfen.38
Angesichts dieser Glaubensaufrüstung haben das angeborene Vertrauen und die ihm angepassten Sozialstrukturen heute einen schwierigeren Stand. Bisher konnte der Glaube das Vertrauen nicht zerstören, doch der Konflikt zwischen den beiden Dynamiken im Umgang mit dem Unbewussten spitzt sich zu – schon deshalb, weil der Glaube dem Vertrauen mitunter täuschend ähnlich sieht und Sozialstrukturen hervorgebracht hat, etwa die quasi-oralen Kommunikationsformen des Internets, die von denen des Vertrauens schwer zu unterscheiden sind. In der Vergangenheit bewirkten Kulturtechniken, dass Glaubensinhalte, etwa die hierarchische Geschlechterordnung, mit der »Natur« identifiziert wurden. Heute scheint es eher darauf anzukommen, dass wir lernen, zwischen Glaubens- und Vertrauensverhältnissen zu differenzieren.
Retrospektiv lässt sich die Frage stellen, ob das Interesse am Unbewussten, das sich seit 1800 herausbildete und um 1900 mit der Psychoanalyse ein eigenes Lehrgebäude errichtete, nicht auch als Versuch zu sehen ist, das Überleben des angeborenen Vertrauens zu sichern. Das entspräche der bemerkenswerten Flexibilität des Unbewussten, für das jede Epoche neue Definitionen und Erklärungsmuster bereithält. Mit dem Unbewussten erweist sich die Psyche – das zeigen neuere psychologische und neurobiologische Forschungen – als ein Feld permanenter Transformationen: vom Bewussten zum Unbewussten, vom Organischen/Chemischen ins Soziale. Und umgekehrt: Auf die Interaktion von Biologie und Psyche wird das 9. Kapitel ausführlicher eingehen. Hier sei nur festgehalten, dass diese Flexibilität des Unbewussten dem Glauben immer wieder die Verfügungsgewalt über das liquide Territorium der »Seele« entzieht. Einst kämpfte die Kirche um jede Seele; heute wollen weltliche Institutionen, Ökonomie und politische Bewegungen die Psyche erobern. Im »Kampf ums Unbewusste« spiegeln sich also sowohl die innerpsychischen Konflikte zwischen Glauben und Vertrauen als auch die Auseinandersetzungen zwischen den religiösen, politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Kräften wider. Die Psyche wurde zum eigentlichen Ziel moderner Eroberungspolitik – ob im Wahlkampf, beim Konsum oder in militärischen Auseinandersetzungen.
2Exit Gott – Auftritt das Unbewusste
Das vorfreudianische Unbewusste
Der Rückgang des Bestimmungsrechts der Kirche über das Denken und Fühlen wurde in ganz Europa als eine große Befreiung erlebt. Frankreich, wo mit der Monarchie auch die Kirche entmachtet wurde, vollzog diesen Schritt früher und radikaler als Deutschland – dort hatte man es allerdings mit der katholischen Kirche zu tun, während der Protestantismus schon als eine Art von Voraufklärung wirkte. Umso grundsätzlicher waren die Einschnitte in Frankreich, als sie schließlich kamen. 1748 hatte der Arzt Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) in seinem Pamphlet L’homme-machine ein unverhohlen atheistisches und mechanistisches Welt- und Menschenbild entworfen. Er musste das Land verlassen und fand Zuflucht im liberalen Holland, bevor ihn Friedrich II. von Preußen an seinen Hof holte und in Sanssouci als Leibarzt und Vorleser einstellte. Andere, nicht minder radikale Aufklärer folgten ihm und läuteten den Bruch mit dem katholischen Ancien Régime ein, auch in Wissenschaft und Medizin.
Fragen von Bewusstsein spielten sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eine Rolle. Descartes hatte verkündet, dass das Ich, das er mit der Seele gleichsetzte und damit der Transzendenz überließ, nicht erkennbar sei. Er sah dieses Ich jedoch als Konstrukteur und Organisator der Wirklichkeit. Kant gab der Empirie mehr Gewicht, wies sie aber auch in ihre Grenzen. Das Denken kanalisiere und deformiere die Realität nach Mustern, die mit a priori erworbenem Wissen oder kulturellen Modellen zusammenhingen. So unterschiedlich diese Positionen auch waren – beide vereinte, dass sie den Menschen, das denkende Wesen, und mithin auch seine Psyche, seine Gefühle und individuelle Wahrnehmungsart ins Zentrum stellten. Die Reaktionen auf solche Positionierungen unterschieden sich: In Frankreich erklärte der Mathematiker, Philosoph und Religionskritiker Auguste Comte (1798–1857), Mitbegründer der Soziologie und des Positivismus, dass es keinen Sinn habe, in das Seelenleben des Ich einzudringen. Es entziehe sich der Erkenntnis. Er hielt an den verifizierbaren Realitäten fest. Sein Einfluss auf die französische Wissenschaft des 19. Jahrhunderts führte zu einer deutlichen Orientierung an biologischen und physikalischen Fakten, während zur gleichen Zeit in Deutschland das Interesse an der »Seele« oder dem Innenleben des Menschen wuchs. Das galt vor allem für Philosophie und Literatur, später auch für die Medizin. Diese kulturellen Unterschiede mögen erklären, warum Konzepte des Unbewussten in Deutschland sehr viel früher diskutiert wurden als anderswo in Europa und weshalb die Psychoanalyse in diesem Kulturraum entstand.
Im Deutschland wurde das Vakuum, das der Glaube an Gott und an eine zur Transzendenz befähigte Seele hinterließ, schon ab dem späten 18. Jahrhundert mit dem Konzept des Unbewussten gefüllt. Das heißt, Gott wurde auf die Erde und ins Ich verlagert. Allerdings blieben die Attribute sehr ähnlich: »allmächtig«, »unberechenbar«, »allwissend«, »souverän« usw., und auch manche Begriffe blieben die gleichen. Aus der religiösen wurde die menschliche Seele, die Psyche. Diese Verlagerung vollzog sich parallel zur Rezeption der französischen Aufklärung und war vor allem dem Protestantismus geschuldet. Das romantische Unbewusste transportierte Aufklärung und deren Gegenbewegung in einem. Es ließ Raum für das Unsagbare und Unkontrollierbare, das »Geheimnis« einer Allmacht, die bis dahin im Transzendenten verortet worden war, wies dieser aber einen Platz zu, der »wissenschaftlich« erfasst werden konnte. Indem Gott in das Unbewusste umbenannt wurde, entstand ein anderes Verhältnis zu dieser Allmacht. Sie ließ sich vermessen, erschien beherrschbar, kanalisierbar. Diese Sichtweise wurde zur treibenden Kraft von Naturbeherrschungsphantasien. Zugleich wurde ein Verlust spürbar: Es entstand das Bedürfnis nach dem unergründlichen Geheimnis, für das Gott gestanden hatte. Beide Seiten schlugen sich nieder in den Bildern vom Unbewussten
In Deutschland kam es, anders als in Frankreich, zu einer Verschränkung von Naturphilosophie und Dichtung, was dazu führte, dass die medizinische Forschung der Vorherrschaft von Philosophie und Literatur unterworfen wurde; so wie sie einst dem theologischen Primat unterstanden hatte. Im Gegenzug grenzten sich Naturwissenschaften und Medizin von den geisteswissenschaftlichen Perspektiven ab. Erst mit Hermann von Helmholtz (1821–1894), Arzt, Physiologe und Physiker, der sich für die Interaktion zwischen Physis und Psyche interessierte und dem ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten Begriff der »Humanwissenschaften« Raum geben wollte, trat wieder das bewusste Ich in den Fokus. Das hatte zur Folge, dass die Psyche des Wissenden zum Forschungsgegenstand wurde. In den 1870ern bekannte sich auch Emil Du Bois-Reymond (1818–1896), der als Wegbereiter der experimentellen Elektrophysiologie und Mitbegründer des Faches Physiologie als strenger Naturwissenschaftler galt, zu den Grenzen der naturwissenschaftlichen Forschung. 1872 räumte er in einem Vortrag ein, dass die Frage des Bewusstseins jenseits der Kompetenz der Wissenschaften liege.1
Im Gegensatz zu den Naturwissenschaftlern waren die deutschen Philosophen und Schriftsteller keineswegs zurückhaltend in ihrem Umgang mit dem Bereich der Psyche. Sie erklärten das Unbewusste zu einer terra incognita und damit zu einem Gebiet, das seiner Erforschung harrte. So schrieb Jean Paul in Selina. Oder über die Unsterblichkeit der Seele, ein Werk, das er 1823 begann, aber nicht vollenden konnte: »Wir machen aber von dem Länderreichtum des Ich viel zu kleine und enge Messungen, wenn wir das ungeheure Reich des Unbewußten, dieses wahre innere Afrika, auslassen.« Jean Paul stellte dieses »Reich« der von der Erde abgewandten Seite des Monds gegenüber, während die sichtbare Seite für das Bewusstsein stehe.2 Jean Pauls Vergleich war ein Weckruf zur Kartographierung des dunklen Kontinents der Psyche. Zugleich mag auch eine Rolle gespielt haben, dass Deutschland, anders als England und Frankreich, zu dieser Zeit über keine Kolonien verfügte. Es könnte sich also um einen Kompensationsdiskurs handeln. Die reale oder phantasierte Ich-Erweiterung und seine kartographische Erfassung boten die Möglichkeit, den Blick auf »innere Kolonien« zu richten.
Man wird einwenden, dass es im 19. Jahrhundert auch in Frankreich ein reges Interesse an psychischen Vorgängen gab. Das ist richtig, doch war dieses eher vom Rationalismus eines Descartes oder Auguste Comtes Positivismus geprägt. Mit dem Unbewussten im Sinne einer Erforschung der Seele oder der Selbstreflexion hatte die französische nouvelle psychologie nichts im Sinn. Das schränkte die Bereitschaft ein, sich auf Experimente einzulassen, die auch nur entfernt mit den Geisteswissenschaften zu tun haben könnten. Der berühmte Neurologe Jean-Martin Charcot (1825–1893) zum Beispiel, der im späten 19. Jahrhundert die Hysterie zu seinem Fachgebiet erkoren hatte und dessen Vorlesungen an der Salpêtrière viele Pariser Intellektuelle – zu ihnen gehörte 1885 auch Sigmund Freud – anzogen, war überzeugt, mit den hysterischen Anfällen ein medizinisch »berechenbares«, also verifizierbares Phänomen vor sich zu haben, was sich schon bald als eine große Täuschung erweisen sollte.3 Die Erforschung psychischer Vorgänge im Sinne einer Selbstreflexion, wie sie Freud später zu neuen Erkenntnissen führte, war in Charcots Denkmustern nicht vorgesehen.
Betrachtet man die vorfreudianischen Theorien zum Unbewussten im deutschsprachigen Raum, so schälen sich drei Typen heraus: Der eine bestand aus dem, was man als »post-christliche« Betrachtung bezeichnen könnte; der zweite wandte sich der oben beschriebenen Richtung der Kartographie zu, die die Eroberung des »inneren Kontinents« zum Ziel hatte; und bei der dritten – und auch chronologisch spätesten – Variante zeichnete sich der Typus eines Unbewussten ab, das über das Ich herrscht und später auch von Freud beschrieben wurde.
Auffallend ist, dass fast alle deutschen Theoretiker, die sich mit dem Unbewussten beschäftigten, aus protestantischen Familien stammten oder sogar in Pfarrhäusern aufgewachsen waren, manchmal auch als Theologen begonnen hatten. Das evangelische Pfarrhaus war berühmt als Produktionsstätte von Bildung und Wissenschaft, aber offenbar eignete es sich auch als Raum des Übergangs von einem religiösen zu einem säkularen Bild der »Seele«. Wie bereits beschrieben, wurde der Übergang von Gott zum Unbewussten auch von evangelischen Theologen wie Friedrich Schleiermacher geebnet, dessen Buch Über die Religion von 1799 auf große Begeisterung unter seinen Zeitgenossen stieß. Die von ihm vorgeschlagene »sanfte« oder allmähliche Transition von Religion zur »Wissenschaft von der Seele« wäre im katholischen Frankreich kaum denkbar gewesen. Die »evangelische« Tendenz dieser Diskurse um das Unbewusste blieb ausschließlich dem deutschen Sprachraum vorbehalten, wo auch die Reformation ihren Ausgangspunkt hatte.
Zu den deutschen Theoretikern, die die Aufklärung begrüßten, aber zugleich noch im Bann kirchlicher Lehren standen, gehörte der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854). In seinem transzendentalen Idealismus von 1800 ist vom »absoluten« oder dem »ewigen Unbewußten« die Rede.4 Es ist, wie Ludger Lütkehaus es ausdrückt, ein metaphysisches Unbewusstes, das »zum Statthalter des noch nicht toten, aber schon sterbenden Gottes, zum Garantie-Schein der gefährdeten Unsterblichkeit der Seele« berufen ist.5 Deshalb erscheint es auch in der Metaphorik des Lichts, die christlicher Religion und Aufklärung gemeinsam ist, als »die ewige Sonne im Reich der Geister«. Auch die Kritik an Wissenschaft und Vernunft verband Schellings Konzept mit der Religion. Zugleich haftete seinem Unbewussten jene Synchronisierung mit der Außenwelt an, die Kulturtechniken des Glaubens wie Geld und Uhr dem Menschen in den vorangegangenen Jahrhunderten antrainiert hatten. Er schreibt: »Der Erfolg meiner Handlungen ist also nicht von mir, sondern vom Willen aller übrigen abhängig, und ich vermag nichts zu jenem Zwecke, wenn nicht alle denselben Zweck wollen.« Als Mittler zwischen der Vorstellung einer göttlichen und einer weltlichen Bestimmung des Menschen diente Schelling der Glaube an die Geschichte, den auch andere Denker dieser Epoche, etwa Hegel und Fichte, vertraten: »Wenn nun aber jenes Absolute der eigentliche Grund der Harmonie […] nicht nur des Individuums, sondern der ganzen Gattung ist, so werden wir die Spur dieser ewigen und unveränderlichen Identität am ehesten in der Gesetzmäßigkeit finden, welche als das Gewebe einer unbekannten Hand durch das freie Spiel der Willkür in der Geschichte sich hindurchzieht.«6
Die Formulierung von der »unbekannten Hand« erinnert an Adam Smiths »unsichtbare Hand« von 1776.7