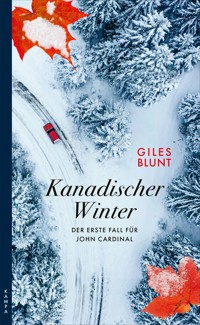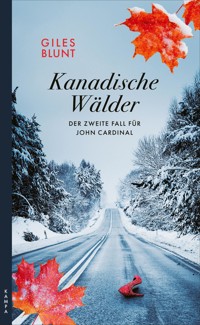Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für John Cardinal
- Sprache: Deutsch
Indian Summer in Algonquin Bay. Das rot-goldene Farbenmeer vor dem tiefblauen Himmel entschädigt für den sengenden Sommer, den eisigen Winter und den von Ungeziefer geplagten Frühling. Doch John Cardinal erwartet in diesem Herbst der schwärzeste Tag seines Lebens. Seine Frau ist tot. Cardinals Kollegen von der Polizei sind überzeugt, dass Catherine sich das Leben genommen hat, litt sie doch seit Jahren unter psychischen Problemen und hinterließ einen handgeschriebenen Abschiedsbrief. Der vom Dienst suspendierte Detective glaubt nicht an diese Theorie, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und stößt schon bald auf Ungereimtheiten: Ein Forensiker entdeckt einen fremden Fingerabdruck auf dem Brief, und der Witwer erhält anonyme Beileidskarten, die Catherines Tod verhöhnen. Doch damit nicht genug: Cardinals Kollegin Lise Delmore ermittelt in einem Kinderpornographie-Fall, der zu dem Psychiater Dr. Bell führt, bei dem auch seine Frau in Behandlung war, und eine Welle von Suiziden erschüttert die sonst so idyllische Küstenstadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giles Blunt
Kanadische Nächte
Der vierte Fall für John Cardinal
Kriminalroman
Aus dem kanadischen Englisch von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann
Kampa
Für Janna
1
Auf der Madonna Road kann einfach nichts Schlimmespassieren. Die Straße, die sich am Westufer eines kleinen Sees außerhalb von Algonquin Bay, Ontario, entlangwindet, ist der ideale, von Kiefernduft erfüllte Zufluchtsort für wohlhabende Familien mit kleinen Kindern, Yuppies mit einem Faible für Kanus und Kajaks ebenso wie für ein Völkchen von listigen Streifenhörnchen, die mit den großen Hunden der Anwohner Fangen spielen. Ein Ort, ruhig, schattig, abgelegen – scheinbar wie geschaffen, um sich vor Kummer und Leid in Sicherheit zu wähnen.
Detective John Cardinal und seine Frau Catherine wohnten im kleinsten Haus auf der Madonna Road, aber selbst diese bescheidene Bleibe konnten sie sich nur leisten, weil das Haus auf der seeabgewandten Straßenseite lag und sie nicht einmal ein Zipfelchen Ufergrundstück besaßen. Die Wochenenden verbrachte Cardinal größtenteils im Keller, inmitten von Gerüchen nach Sägemehl, Farbe und Holzwachs. Bei der Arbeit mit Holz fühlte er sich kreativ und Herr der Lage, was auf dem Revier nur selten vorkam.
Aber auch wenn er nicht mit Tischlerarbeiten beschäftigt war, genoss er die Stunden in seinem kleinen Haus und die Ruhe des Sees. Es war Herbst, Anfang Oktober, die ruhigste Zeit des Jahres. Die Motorboote und die Jetskis waren an Land gebracht, und die Schneemobile knatterten noch nicht über Eis und Schnee.
Der Herbst in Algonquin Bay ist wie eine Entschädigung für die anderen drei Jahreszeiten. Ein Farbenmeer aus Rottönen, Ocker und Gold wogt über die Hügel, der Himmel strahlt so tiefblau, dass man den brütend heißen Sommer, den Frühling mit seinen Mückenplagen und den gnadenlos kalten Winter beinahe vergessen kann. Der Trout Lake lag übernatürlich still da, wie schwarzer Onyx umgeben von Glut. Obwohl Cardinal in Algonquin Bay aufgewachsen war (und das alles als selbstverständlich hingenommen hatte) und jetzt seit zwölf Jahren wieder hier lebte, war er jedes Jahr von Neuem überrascht über die herbstliche Pracht. Um diese Jahreszeit verbrachte er jede freie Minute zu Hause. An jenem Abend hatte er die viertelstündige Fahrt auf sich genommen, um eine halbe Stunde mit Catherine beim Abendessen zu verbringen, bevor er wieder aufs Revier zurückmusste.
Catherine steckte sich eine Tablette in den Mund, spülte sie mit einem Schluck Wasser hinunter und verschloss das Tablettenröhrchen wieder.
»Es ist noch mehr Auflauf da, wenn du möchtest«, sagte sie.
»Nein, ich hab genug. Das war hervorragend«, sagte Cardinal, während er versuchte, die letzten Erbsen auf seinem Teller aufzuspießen.
»Es gibt heute keinen Nachtisch, es sei denn, du hast Lust auf Kekse.«
»Ich hab immer Lust auf Kekse. Die Frage ist nur, ob ich irgendwann von einem Gabelstapler hier rausgewuchtet werden möchte.«
Catherine brachte ihren Teller und ihr Glas in die Küche.
»Wann gehst du los?«, rief Cardinal ihr nach.
»Jetzt gleich. Es ist dunkel, der Mond scheint. Ideale Bedingungen.«
Cardinal schaute nach draußen. Der Vollmond, eine orangefarbene Scheibe tief über dem See, wurde vom Fensterkreuz gevierteilt.
»Willst du den Mond fotografieren? Sag bloß, du hast vor, ins Kalendergeschäft einzusteigen.«
Aber Catherine war bereits im Keller verschwunden, und er hörte, wie sie in ihrer Dunkelkammer herumkramte. Cardinal verstaute die Essensreste im Kühlschrank und räumte das Geschirr in die Spülmaschine.
Catherine kam aus dem Keller, verschloss ihre Kameratasche, stellte sie neben der Tür ab und zog sich ihre Jacke über, eine goldbraune mit dunkelbraunem Lederbesatz an Ärmeln und Kragen. Sie zog einen Schal vom Kleiderhaken, wickelte ihn sich einmal, zweimal um den Hals, nahm ihn wieder ab.
»Nein«, murmelte sie vor sich hin. »Der wird mir nur lästig.«
»Wie lange wirst du unterwegs sein?«, fragte Cardinal, doch seine Frau hörte ihn nicht. Sie waren nun schon seit fast dreißig Jahren verheiratet, und immer noch gab sie ihm Rätsel auf. Manchmal, wenn sie loszog, um zu fotografieren, war sie aufgekratzt und gesprächig und beschrieb ihm ihr Vorhaben in allen Einzelheiten, bis ihm der Kopf schwirrte vor lauter Fachbegriffen wie Brennweite und Öffnungsverhältnis. Manchmal erfuhr er erst etwas über ihr Projekt, wenn sie Tage oder Wochen später aus der Dunkelkammer kam, die Abzüge umklammernd wie eine Safaritrophäe. Diesmal war sie verschlossen.
»Wann wirst du ungefähr zurück sein?«, fragte Cardinal.
Catherine schlang sich einen kurzen, karierten Schal um den Hals und stopfte die Enden in ihre Jacke. »Ist es wichtig? Ich dachte, du müsstest wieder zur Arbeit.«
»Muss ich auch. Ich bin nur neugierig.«
»Also, ich werde lange vor dir wieder zu Hause sein.« Sie zog ihre Haare aus dem Schal heraus und schüttelte den Kopf. Cardinal roch den Duft ihres Shampoos, etwas, das entfernt an Mandeln erinnerte. Catherine setzte sich auf die Bank neben der Haustür und öffnete ihre Kameratasche. »Der Splitfield-Filter. Ich wusste doch, dass ich was vergessen hatte.«
Sie verschwand kurz im Keller, kam mit dem Filter zurück, steckte ihn in die Kameratasche. Cardinal hatte keine Ahnung, was ein Splitfield-Filter sein könnte.
»Gehst du wieder ans Government Dock?« Im Frühjahr, als das Eis aufbrach, hatte Catherine eine Fotoserie am Ufer des Lake Nipissing geschossen. Riesige weiße Eisblöcke, die sich übereinander schoben wie tektonische Platten.
»Die Serie ist doch längst fertig«, sagte Catherine stirnrunzelnd. Sie befestigte ein kleines, zusammenklappbares Stativ an ihrer Kameratasche. »Wieso stellst du mir so viele Fragen?«
»Manche Leute machen Fotos, andere stellen Fragen.«
»Ich wünschte, du würdest mich nicht so löchern. Du weißt doch, dass ich nicht gern im Voraus über meine Projekte rede.«
»Manchmal schon.«
»Diesmal nicht.« Sie stand auf und hängte sich die schwere Tasche über die Schulter.
»Was für eine herrliche Nacht«, sagte Cardinal, als sie vor dem Haus standen. Er betrachtete die Sterne, die im hellen Mondschein schwach zu erkennen waren. Die Luft duftete nach Kiefern und Laub. Auch Catherine liebte den Herbst ganz besonders, aber im Moment war sie mit anderen Dingen beschäftigt. Sie stieg in ihren Wagen, einen braunen PT Cruiser, den sie sich vor einigen Jahren gebraucht gekauft hatte, ließ den Motor an und fuhr los.
Cardinal folgte ihr in seinem Camry über die dunkle, gewundene Straße in Richtung Stadt. Kurz vor der Ampel am Highway 11 betätigte Catherine den Blinker und ordnete sich links ein, während Cardinal geradeaus über die Kreuzung und dann die Sumner Street hinunter zum Revier fuhr.
Catherine war also unterwegs zum östlichen Stadtrand, und Cardinal fragte sich flüchtig, wohin sie wollte. Aber er war immer froh, wenn sie sich in ihre Arbeit stürzte, und außerdem nahm sie regelmäßig ihre Medikamente. Es war jetzt ein Jahr her, seit man sie aus der Psychiatrie entlassen hatte. Letztes Mal war sie schon fast zwei Jahre draußen gewesen, dann hatte sie einen manischen Schub gehabt und musste wieder für drei Monate in die Klinik. Aber solange sie ihre Medikamente nahm, machte Cardinal sich keine allzu großen Sorgen.
Es war ein Dienstagabend, und in der Verbrecherwelt herrschte einigermaßen Ruhe. Cardinal verbrachte mehrere Stunden damit, liegen gebliebenen Papierkram zu erledigen. Erst kürzlich waren wie jedes Jahr sämtliche Teppichböden gereinigt worden, und es roch im ganzen Gebäude nach Putzmitteln und feuchtem Teppich.
Der einzige Kollege, der außer Cardinal Spätschicht schob, war Ian McLeod, und selbst McLeod, tagsüber das Großmaul des Reviers, war zu dieser späten Stunde vergleichsweise still und ernst.
Cardinal war gerade dabei, eine Akte, die er endlich geschlossen hatte, mit einem Gummiband zu verschnüren, als McLeods gerötetes Gesicht über der Trennwand zwischen ihren Schreibtischen erschien.
»Hey, Cardinal. Ich wollte Sie nur kurz warnen. Es geht um unseren Bürgermeister.«
»Was will er denn?«
»Er war gestern Abend hier, als Sie schon Feierabend hatten. Wollte seine Frau vermisst melden. Das Problem ist nur, dass sie gar nicht verschwunden ist. Jeder in der Stadt weiß, wo sie steckt, außer dem verdammten Bürgermeister.«
»Hat sie immer noch eine Affäre mit Reg Wilcox?«
»Ja. Sie wurde sogar gestern Abend in seiner Begleitung gesehen. Szelagy hat am Motel Birches Posten bezogen, um die Porcini-Brüder im Auge zu behalten. Die sind seit einem halben Jahr wieder auf freiem Fuß und scheinen sich einzubilden, sie könnten wieder ins Geschäft einsteigen. Jedenfalls, als Szelagy gerade hier anruft, um Bericht zu erstatten, sieht er plötzlich die Gattin des Bürgermeisters zusammen mit dem hochgeschätzten Chef der Stadtreinigung aus Zimmer 12 kommen. Also, wenn Sie mich fragen, ich konnte den Typen noch nie ausstehen – möchte wissen, was die Weiber an ihm finden.«
»Er sieht doch gut aus.«
»Ich bitte Sie, Cardinal, der Typ sieht aus wie ein Dressman von Sears.« Um Cardinal eine Kostprobe zu geben, posierte McLeod im Dreiviertelprofil und setzte ein breites Grinsen auf.
»Manche Leute finden das durchaus sehenswert«, sagte Cardinal. »Wenn auch nicht an Ihnen.«
»Na ja, manche Leute können mich mal. Jedenfalls, ich habe Seiner Durchlaucht gestern Abend gesagt, hören Sie, Ihre Frau ist nicht verschwunden. Sie ist erwachsen. Sie wurde in der Stadt gesehen. Wenn sie nicht nach Hause kommt, dann ist das ihre freie Entscheidung und ihr gutes Recht.«
»Und was hat er dazu gesagt?«
»›Wer hat sie gesehen? Wo? Wann?‹ Das Übliche. Ich hab ihm erklärt, ich wäre nicht befugt, ihm darüber Auskunft zu erteilen. Ich hab ihm gesagt, sie sei in der Nähe von Worth und Macintosh gesehen worden, und wir könnten im Moment keine Vermisstenanzeige aufnehmen. Jetzt gerade ist sie wieder mit Wilcox im Birches. Ich hab Feckworth gesagt, er soll herkommen, Sie würden sich liebend gern mit ihm unterhalten.«
»Was zum Teufel haben Sie sich denn dabei gedacht?«
»Von Ihnen nimmt er es leichter auf. Ich stehe nicht gerade auf gutem Fuß mit ihm.«
»Sie stehen doch mit niemandem auf gutem Fuß.«
»Also, das find ich jetzt wirklich kränkend.«
Während Cardinal auf den Bürgermeister wartete, machte er die Spesenabrechnung für den vergangenen Monat und beschriftete das Deckblatt für eine Akte. Immer wieder musste er dabei an Catherine denken. Sie hatte sich gut gehalten seit ihrer Entlassung vor einem Jahr, und inzwischen unterrichtete sie sogar wieder am örtlichen College. Aber beim Abendessen hatte sie abwesend gewirkt, auf eine Weise ungehalten, die womöglich darauf schließen ließ, dass sie in Gedanken nicht nur mit ihrem Fotoprojekt beschäftigt gewesen war. Catherine war Ende vierzig und kam allmählich in die Wechseljahre, die starke Stimmungsschwankungen bei ihr auslösten, sodass ihr ständig neue Medikamente verschrieben werden mussten. Wenn sie ein wenig zerstreut wirkte, nun, dafür gab es reichlich Erklärungen. Andererseits, wie gut kennt man einen Menschen, den man liebt? Man brauchte sich ja nur anzusehen, wie es dem Bürgermeister erging.
Als Seine Durchlaucht der Bürgermeister Lance Feckworth eintraf, führte Cardinal ihn in eins der Vernehmungszimmer, damit sie sich ungestört unterhalten konnten.
»Ich will das aufgeklärt haben«, sagte der Bürgermeister. »Ich verlange, dass offizielle Ermittlungen aufgenommen werden.« Feckworth, ein fülliger, kleiner Mann mit einer Vorliebe für Fliegen, hockte nervös auf der Kante des Plastikstuhls, auf dem gewöhnlich der Verdächtige saß. »Ich weiß, dass ich als Bürgermeister nicht mehr Rechte habe als jeder andere Wähler, aber auch nicht weniger. Was ist, wenn sie einen Unfall hatte?«
Feckworth war als Bürgermeister keine große Leuchte. Seit er im Amt war, schien der Stadtrat jedes Problem endlos zu diskutieren, um schließlich zu dem Ergebnis zu gelangen, dass man nichts unternehmen konnte. Aber er war ein leutseliger Mensch, der immer einen Witz auf Lager hatte und anderen gern auf die Schulter klopfte. Es war erschütternd, sein sorgengequältes Gesicht zu sehen, als wäre ein Gebäude, an dessen Anblick man sich über die Jahre gewöhnt hatte, plötzlich mit einer abstoßenden Farbe angestrichen worden.
So schonend wie möglich brachte Cardinal ihm bei, dass Mrs. Feckworth am vergangenen Abend in der Stadt gesehen worden war und dass es in der ganzen Woche keine Meldung über einen schweren Unfall gegeben hatte.
»Verdammt noch mal, jeder Polizist erzählt mir, sie sei in der Stadt gesehen worden, aber keiner will mir sagen, wo und von wem. Was soll das? Wie würden Sie sich fühlen, wenn es um Ihre Frau ginge? Sie würden die Wahrheit wissen wollen, stimmt’s?«
»Ja, stimmt.«
»Dann schlage ich vor, dass Sie mich darüber aufklären, was los ist, Detective. Wenn nicht, werde ich mich direkt an Chief Kendall wenden, und ich werde weder an Ihnen noch an diesem Vollidioten McLeod ein gutes Haar lassen, darauf können Sie Gift nehmen.«
Und so saß Cardinal eine Stunde später zusammen mit dem Bürgermeister von Algonquin Bay in seinem Auto auf dem Parkplatz des Birches. Auch wenn der Name etwas anderes vermuten ließ, stand nicht eine einzige Birke in der Nähe des Motels. Es lag mitten in der Innenstadt auf der MacIntosh Street, wo weit und breit überhaupt kein Baum zu sehen war. Und es hieß nicht einmal mehr Birches, seit die Sunset-Inns-Kette es vor über zwei Jahren übernommen hatte, aber alle in der Stadt nannten es immer noch so.
Cardinal hatte etwa zehn Schritte von Zimmer 12 entfernt geparkt. Szelagy saß auf der anderen Seite des Parkplatzes in seinem Wagen, doch die beiden Männer nahmen keine Notiz voneinander. Cardinal öffnete sein Fenster einen Spalt breit, um zu verhindern, dass die Scheiben beschlugen. Selbst hier, mitten in der Stadt, lag der Geruch nach Herbstlaub in der Luft und der vertraute Duft nach Kaminfeuer.
»Wollen Sie wirklich behaupten, sie ist da drin?«, fragte der Bürgermeister. »Meine Frau – in diesem Zimmer?«
Er muss es doch wissen, dachte Cardinal. Wie ist es möglich, dass seine Frau tagelang fortbleibt und sich in Motels einmietet, ohne dass er davon weiß?
»Das glaub ich einfach nicht«, sagte Feckworth. »Nicht in so einer billigen Absteige.« Doch er klang schon weniger überzeugt, so als hätte der Anblick der Zimmertür ihn in seinem Glauben erschüttert. »Cynthia ist absolut loyal«, sagte er. »Ein Charakterzug, auf den sie stolz ist.«
In Wirklichkeit hüpfte Cynthia Feckworth mindestens seit vier Jahren von einem Bett in Algonquin Bay ins nächste, und der Bürgermeister war der Einzige, der nichts davon wusste. Und woher nehme ich das Recht, ihm die Augen zu öffnen?, dachte Cardinal. Wieso maße ich mir an, diesen Mann aus seiner seligen Ahnungslosigkeit zu reißen?
»Es kann nicht sein, dass sie mit einem anderen schläft. Das wäre … wenn sie mit einem anderen Mann … dann ist Schluss. Darauf können Sie sich verlassen. O Gott, wenn es wirklich stimmt, dass sie …« Feckworth verbarg stöhnend das Gesicht in den Händen.
Wie aufs Stichwort ging die Tür von Nummer 12 auf, und ein Mann trat heraus. Er war durchgestylt, als wäre er einem Katalog für Herrenmode entsprungen.
»Das ist ja Reg Wilcox«, sagte der Bürgermeister. »Stadtreinigung. Was macht der denn hier?«
Entspannt und zufrieden schlenderte Wilcox zu seinem Ford Explorer. Dann setzte er rückwärts aus der Parklücke und fuhr davon.
»Tja, jedenfalls war Cynthia nicht in dem Zimmer. Das ist ja schon etwas«, bemerkte Feckworth. »Vielleicht sollte ich einfach nach Hause fahren und hoffen, dass sich alles zum Guten wendet.«
Die Tür von Nummer 12 öffnete sich erneut, und eine attraktive Frau sah sich kurz um, bevor sie heraustrat und die Tür hinter sich zuzog.
Sie knöpfte ihren Mantel gegen die kühle Nachtluft zu und überquerte den Parkplatz.
Der Bürgermeister sprang aus dem Wagen und stellte sich ihr in den Weg. Cardinal kurbelte sein Fenster hoch, er hatte keine Lust, sich das anzuhören. In dem Augenblick klingelte sein Handy.
»Cardinal, warum zum Teufel gehen Sie nicht an Ihr Funkgerät?«
»Ich sitze in meinem Privatfahrzeug, Sergeant Flower. Aber es lohnt sich nicht, es Ihnen zu erklären.«
»Also gut, hören Sie zu. Ein Anrufer hat hinter dem Gateway-Wohnblock eine Leiche gefunden. Kennen Sie das neue Gebäude?«
»Das Gateway? An der Umgehungsstraße? Ich wusste gar nicht, dass es schon fertig ist. Sind Sie sicher, dass es sich nicht um einen Betrunkenen handelt, der seinen Rausch ausschläft?«
»Ganz sicher. Die Kollegen aus dem Streifenwagen am Tatort haben es soeben bestätigt.«
»Okay. Ich bin ganz in der Nähe.«
Der Bürgermeister und seine Frau stritten sich.
Cynthia Feckworth stand mit vor der Brust verschränkten Armen da, den Kopf gesenkt. Ihr Mann hatte die Arme ausgebreitet, die typische Haltung des flehenden Gatten. In der Tür des Motelbüros stand ein Angestellter und beobachtete die Szene.
Der Bürgermeister bekam nicht einmal mit, dass Cardinal wegfuhr.
Der Gateway-Turm stand am östlichen Stadtrand, eins der wenigen Hochhäuser in einem Gebiet, wo Einkaufszentren wie Pilze aus dem Boden schossen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befand sich ebenfalls ein kleines Einkaufszentrum mit einer Reinigung, einem Supermarkt und einem großen Computerreparaturladen namens CompuClinic, der von der Main Street hierhergezogen war. Die Geschäfte waren bereits seit einiger Zeit geöffnet, aber viele der Wohnungen in dem Turm waren noch unbewohnt. Eine kreuzungsfreie Straße wurde angelegt, um die Verkehrsanbindung des aufstrebenden Viertels zu verbessern – wenn man es denn als solches bezeichnen konnte. Cardinal musste im Slalom durch eine Ansammlung von orangefarbenen Kegeln fahren und dann noch einen Umweg vorbei am neuen Schnellrestaurant von Tim Hortons und dem Baumarkt in Kauf nehmen, um zu dem Gebäude zu gelangen.
Er passierte neu errichtete Reihenhäuser, von denen die meisten noch unbewohnt waren. Nur in einigen brannte Licht. Vor dem letzten Haus stand ein PT Cruiser, und einen Augenblick lang dachte Cardinal, es sei Catherines Auto. Ein- oder zweimal im Jahr hatte er solche Anwandlungen: die plötzliche Angst, dass Catherine etwas zugestoßen sein könnte – dass sie einen manischen Schub erlitten und sich in Gefahr gebracht hatte oder dass sie von Depressionen überwältigt und suizidgefährdet war –, und dann die Erleichterung, wenn sich herausstellte, dass seine Sorge unbegründet gewesen war.
Er bog in die Einfahrt zum Gateway und parkte unter einem Schild mit der Aufschrift: Anwohnerparkplatz – Besucherparkplätze am Straßenrand.
Ein uniformierter Polizist stand vor dem mit Absperrband gesicherten Tatort.
»Hallo, Detective«, sagte der Polizist, als Cardinal auf ihn zukam. Er sah aus, als wäre er etwa achtzehn Jahre alt, und Cardinal konnte sich beim besten Willen nicht an seinen Namen erinnern. »Da hinten liegt eine Tote. Sieht aus, als wäre sie ziemlich tief gestürzt. Ich dachte mir, am besten sperre ich hier großräumig ab, bis wir mehr wissen.«
Cardinal schaute an dem Mann vorbei zu der Stelle hinter dem Gebäude. Alles, was er sehen konnte, waren ein Müllcontainer und ein paar Autos.
»Haben Sie irgendwas angefasst?«
»Äh, ja. Ich hab bei der Toten den Puls gefühlt, aber da war nichts mehr zu spüren. Und ich hab ihre Taschen nach einem Personalausweis durchsucht, aber keinen gefunden. Wahrscheinlich eine Bewohnerin, die vom Balkon gesprungen ist.«
Cardinal sah sich um. Normalerweise fanden sich an solchen Orten Schaulustige ein. »Keine Zeugen? Niemand, der was gehört hat?«
»Das Gebäude steht mehr oder weniger leer, glaub ich, bis auf die Geschäfte im Erdgeschoss. Als ich kam, war niemand mehr da.«
»Okay. Geben Sie mir Ihre Taschenlampe.«
Der junge Mann reichte Cardinal die Lampe und öffnete die Absperrung, um ihn durchzulassen.
Cardinal bewegte sich langsam, um keine Spuren zu verwischen, für den Fall, dass die Vermutung des jungen Polizisten, die Frau sei von einem Balkon gesprungen, sich als falsch erweisen sollte. Er ging an dem Müllcontainer vorbei, der bis oben hin vollgestopft war mit alten Computerteilen. An einer Seite hing eine Tastatur an ihrem Kabel herunter, und ein paar Platinen schienen auf dem Boden explodiert zu sein.
Die Leiche lag bäuchlings direkt hinter dem Müllcontainer, und sie trug eine hellbraune Jacke mit dunkelbraunen Lederbesätzen an Ärmeln und Kragen.
Genau wie Catherines Jacke, dachte Cardinal.
»Ich konnte an keinem der Balkone da oben ein offenes Fenster oder eine offene Tür entdecken«, sagte der junge Polizist. »Wahrscheinlich kann der Hausmeister uns sagen, wer sie ist.«
»Ihr Ausweis liegt im Auto«, sagte Cardinal.
Der junge Polizist sah sich um. Neben dem Gebäude standen zwei Autos.
»Das kapier ich nicht«, sagte er. »Woher wissen Sie, welches ihr Auto ist?«
Aber Cardinal hörte ihn überhaupt nicht. Verblüfft sah der junge Mann, wie Sergeant John Cardinal – der Star des CID-Teams, ein altgedienter Ermittler, der die kompliziertesten Kriminalfälle der Stadt gelöst hatte, ein alter Haudegen, legendär für seine Sorgfalt bei der Untersuchung eines Tatorts – mitten in der Blutlache auf die Knie sank und die Tote in die Arme nahm.
2
Normalerweise wäre Lise Delorme stocksauer gewesen,wenn man sie an ihrem freien Tag an einen Tatort beordert hätte – und dass es dauernd passierte, machte es nicht weniger ärgerlich. Sie saß in einem indischen Restaurant mit ihrem neuen Freund, einem sehr gut aussehenden Anwalt, der nur ein oder zwei Jahre jünger war als sie. Sie hatten sich kennengelernt, als er erfolglos einen Gewohnheitsverbrecher verteidigte, den Delorme wegen Erpressung festgenommen hatte. Es war ihre dritte Verabredung, und obwohl es Delorme eigentlich widerstrebte, mit einem Anwalt ins Bett zu gehen, hatte sie vorgehabt, ihn nach dem Essen auf einen Drink zu sich einzuladen. Shane Cosgrove hieß er.
Es hätte die Sache reizvoller gemacht, wenn Shane ein besserer Anwalt gewesen wäre. Delorme war der Meinung, sein Mandant hätte eigentlich freigesprochen werden müssen angesichts des dünnen Beweismaterials, das sie gegen ihn in der Hand gehabt hatte. Aber Shane sah wirklich gut aus, er war unterhaltsam und dazu Junggeselle, und solche Männer waren in einem Kaff wie Algonquin Bay nicht leicht zu finden.
Als sie an den Tisch zurückkehrte, war sie so bleich, dass Shane sie fragte, ob sie sich hinlegen müsse. Detective Sergeant Chouinard hatte ihr soeben mitgeteilt, dass man eine Leiche gefunden habe, dass es sich bei der Toten um John Cardinals Frau handele und Cardinal selbst sich am Tatort befinde. Ein Streifenpolizist hatte Chouinard zu Hause angerufen, der wiederum Delorme benachrichtigt hatte.
»Holen Sie ihn da weg, Lise«, hatte er gesagt. »Was auch immer jetzt in ihm vorgehen mag, Cardinal ist seit dreißig Jahren Polizist. Er weiß ebenso gut wie Sie und ich, dass er, bis feststeht, dass es sich nicht um Mord handelt, der Verdächtige Nummer eins ist.«
»Hören Sie«, sagte Delorme, »Sie wissen genau, dass Cardinal seiner Frau immer zur Seite gestanden hat trotz …«
»Trotz einer Menge Scheiß. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass er womöglich endlich die Schnauze voll hatte. Es ist durchaus denkbar, dass irgendein kleiner Tropfen das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht hat. Also setzen Sie gefälligst Ihren Arsch in Bewegung, fahren Sie zum Tatort und gehen Sie vom Schlimmsten aus. Solange nichts anderes erwiesen ist, haben wir es mit einem Mord zu tun.«
Und so war Delorme nicht wütend, als sie durch die Stadt fuhr, sondern traurig und bekümmert. Zwar war sie Cardinals Frau einige Male begegnet, aber sie hatte sie nie wirklich kennengelernt. Natürlich wusste sie, was alle im Department wussten: dass Catherine alle paar Jahre einen manischen Schub erlitt und in die Psychiatrie eingewiesen werden musste. Und jedes Mal, wenn Delorme Catherine Cardinal erlebt hatte, hatte sie sich gefragt, wie das möglich war.
Denn Catherine Cardinal gehörte zu den wenigen Frauen, die, zumindest, wenn es ihr gut ging, die Bezeichnung »strahlende Schönheit« verdienten. Die Worte »manisch« und »depressiv« – ganz zu schweigen von »schizophren« oder »psychotisch« – beschworen Bilder von nervlich zerrütteten, wenn nicht gar halb wahnsinnigen Menschen herauf. Aber Catherine hatte Sanftmütigkeit, Intelligenz und Klugheit ausgestrahlt.
Delorme, die bereits länger als ihr lieb war, als Single lebte, langweilte sich meist in Gesellschaft von Ehepaaren. Bei Verheirateten vermisste sie im Allgemeinen das gewisse Etwas derjenigen, die immer noch auf der Jagd waren. Außerdem nervten sie einen mit der Überzeugung, dass Alleinstehenden etwas fehlte. Das Schlimmste jedoch war, dass viele Ehepartner einander anscheinend nicht einmal leiden konnten und derart grob miteinander umgingen, wie sie es einem Fremden gegenüber niemals wagen würden. Aber zwischen Cardinal und seiner Frau, die schon Gott weiß wie lange miteinander verheiratet waren, schien eine tiefe Verbundenheit zu bestehen. Cardinal sprach fast jeden Tag von seiner Frau, es sei denn, sie befand sich in der Klinik, und auch dann hatte Delorme nie das Gefühl gehabt, dass er aus Scham schwieg, sondern aus Loyalität. Ständig erzählte er Delorme von Catherines neuesten Fotos, wie sie einem ehemaligen Studenten zu einem Job verholfen hatte, dass sie einen Preis gewonnen hatte oder von irgendwelchen witzigen Bemerkungen, die sie gemacht hatte.
Dennoch hatte Catherine, so erinnerte sich Delorme, etwas Dominantes, ja beinahe etwas Herrisches, selbst wenn man von ihrer psychischen Krankheit wusste. Womöglich war es sogar eine Auswirkung dieser Krankheit, die Aura eines Menschen, der in die Tiefen des Wahnsinns hinabgestiegen und zurückgekehrt war, um davon zu berichten. Nur diesmal war sie nicht zurückgekommen.
Und vielleicht war es sogar besser so für Cardinal, dachte Delorme. Vielleicht war es nicht das Schlechteste für ihn, von dieser Last befreit zu sein. Delorme hatte erlebt, wie sehr es Cardinal jedes Mal mitgenommen hatte, wenn seine Frau wieder in die Psychiatrie eingewiesen worden war, und mehrmals hatte sie zu ihrer eigenen Verwunderung festgestellt, dass sie wütend auf die Frau war, die Cardinal das Leben zur Qual machte.
Lise Delorme, fluchte sie innerlich, als sie vor dem Absperrband hielt, manchmal bist du wirklich ein komplettes, erbarmungsloses Miststück.
Falls Chouinard gehofft hatte, durch die sofortige Herbeizitierung Delormes verhindern zu können, dass der Hauptverdächtige den Tatort vermasselte, hatte er sich getäuscht. Als Delorme aus ihrem Wagen stieg, sah sie, wie Cardinal, dessen Lederjacke völlig mit Blut besudelt war, seine Frau in den Armen hielt.
Ein junger Polizist – Sanderson – hielt am Absperrband Wache.
»Waren Sie als Erster am Tatort?«, fragte ihn Delorme.
»Jemand aus dem Gebäude hat mich angerufen. Anonym. Er sagte, es sehe so aus, als liege hinter dem Haus eine Tote. Ich bin sofort hergekommen, habe festgestellt, dass die Frau tot war, und das Revier benachrichtigt. Die haben die Spurensicherung verständigt, und dann ist Cardinal hier aufgekreuzt. Ich hatte doch keine Ahnung, dass es seine Frau ist.« Er wirkte gequält. »Sie hatte keine Papiere bei sich. Wie hätte ich das wissen sollen?«
»Ist schon gut«, sagte Delorme. »Sie haben das Richtige getan.«
»Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ihn von der Toten ferngehalten. Aber er hat es auch erst gesehen, als er direkt vor ihr stand. Werde ich jetzt Ärger bekommen, Ma’am?«
»Beruhigen Sie sich, Sanderson, Sie kriegen schon keinen Ärger. Die Leute von der Spurensicherung und der Gerichtsmediziner werden gleich hier sein.«
Delorme ging zu Cardinal hinüber. So übel, wie seine Frau zugerichtet war, musste sie von sehr hoch oben gestürzt sein. Cardinal hatte sie auf den Rücken gedreht und hielt sie in den Armen, als schliefe sie. Sein Gesicht war mit Blut und Tränen überströmt.
Delorme hockte sich neben ihn. Vorsichtig befühlte sie zuerst Catherines Handgelenk, dann ihren Hals und stellte zweierlei fest: Es war kein Puls zu spüren, und der Körper war noch warm, wobei die Extremitäten schon stark abgekühlt waren.
In der Nähe der Toten lag eine Kameratasche, deren Inhalt auf dem Asphalt verstreut war.
»John«, sagte Delorme leise.
Als er nicht reagierte, fuhr sie sanft fort: »John, hör zu. Ich werde dir das nur einmal sagen. Das hier bricht mir das Herz, okay? Am liebsten würde ich mich in eine Ecke verkriechen und weinen und erst wieder rauskommen, wenn mir einer sagt, dass das alles nicht wahr ist. Hörst du mich? Du hast mein tiefstes Mitgefühl. Aber wir wissen beide, was wir zu tun haben.«
Cardinal nickte. »Ich wusste nicht, dass … Bis ich sie gesehen habe.«
»Ja, ich weiß«, sagte Delorme. »Aber du musst sie jetzt loslassen.«
Cardinal weinte, und sie ließ ihn. Arsenault und Collingwood, die Kollegen von der Spurensicherung, kamen auf sie zu. Delorme gab ihnen ein Zeichen, sie sollten einen Augenblick warten.
»John. Würdest du sie bitte hinlegen? Du musst sie wieder genauso hinlegen, wie du sie gefunden hast. Die Spurensicherung ist da. Der Gerichtsmediziner wird gleich eintreffen. Egal, wie das passiert ist, wir müssen die Ermittlungen vorschriftsmäßig durchführen.«
Cardinal schob Catherine von seinen Knien und drehte sie mit sinnloser Zärtlichkeit um. Ihre linke Hand legte er über ihren Kopf. »Die Hand hat so gelegen«, sagte er. »Diese hier«, sagte er, während er den anderen Arm am Handgelenk fasste, »lag an ihrer Seite. Ihre Arme sind gebrochen, Lise.«
»Ich weiß.« Delorme hätte ihn am liebsten berührt, ihn getröstet, zwang sich jedoch zu professioneller Selbstbeherrschung. »Komm mit mir, John. Lassen wir Arsenault und Collingwood ihre Arbeit tun, okay?«
Cardinal stand schwankend auf. Inzwischen waren noch weitere uniformierte Polizisten am Tatort eingetroffen, und aus dem Augenwinkel sah Delorme, dass einige Leute sie von den Balkonen aus beobachteten, während sie Cardinal am Absperrband vorbei zu ihrem Wagen geleitete. Unter ihren Füßen knirschten Computerteile. Sie öffnete die Beifahrertür, und er stieg ein. Dann setzte sie sich auf den Fahrersitz und schlug die Tür zu.
»Wo warst du, als du den Anruf erhalten hast?«, fragte Delorme.
An Cardinals Gesicht war nicht zu erkennen, ob er irgendetwas mitbekam.
Sah er den Krankenwagen, der mit zuckendem Blaulicht vor dem Absperrband hielt? Den Gerichtsmediziner, der mit seiner Tasche zu der Toten hinüberging? Arsenault und Collingwood in ihren weißen Papieroveralls? McLeod, der mit gesenktem Kopf vor dem Tatort auf und ab ging? Sie konnte es nicht einschätzen.
»John, ich weiß, dass es dir schwerfällt, jetzt Fragen zu beantworten …« Das sagten sie immer. Hoffentlich begriff er, dass sie das tun musste, dass sie an die Wunde rühren musste, in der noch das Messer steckte.
Als er schließlich sprach, war seine Stimme überraschend klar, er klang nur sehr erschöpft. »Ich war im Motel Birches, in meinem Wagen, mit dem Bürgermeister.«
»Bürgermeister Feckworth? Wieso?«
»Er hatte seine Frau als vermisst gemeldet und verlangt, dass wir Ermittlungen einleiteten. Er hat gedroht, er würde sich an die Presse wenden, an den Chief. Irgendjemand musste ihm reinen Wein einschenken.«
»Wie lange warst du mit ihm zusammen?«
»Insgesamt vielleicht zweieinhalb Stunden. Er ist aufs Revier gekommen. McLeod kann das alles bestätigen. Szelagy auch.«
»Überwacht Szelagy das Motel immer noch wegen der Porcini-Brüder?«
Cardinal nickte. »Kann sein, dass er noch dort ist. Aber er wird sein Funkgerät ausgeschaltet haben. Das würdest du auch machen, wenn du die Porcini-Brüder überwachen müsstest.«
»Weißt du, was Catherine hier in dem Gebäude wollte?«
»Sie ist losgegangen, um Fotos zu machen. Ich weiß nicht, ob sie hier jemanden gekannt hat. Aber ich nehme es an, sonst wäre sie ja nicht reingekommen.«
Delorme konnte beinahe hören, wie Cardinals Polizistengehirn sich wieder einschaltete.
»Wir müssen das Dach überprüfen«, sagte er. »Wenn sie nicht von dort gestürzt ist, müssen wir die oberen Etagen durchsuchen. Dich meine ich. Du musst das tun. Ich darf nicht an den Ermittlungen beteiligt sein.«
»Warte einen Augenblick hier«, sagte Delorme.
Sie stieg aus dem Wagen und ging zu McLeod, der neben dem Müllcontainer stand.
»Sehen Sie sich bloß an, was hier für ein Schrott rumliegt«, sagte er. »Man sollte meinen, hier hätte jemand einen Computer in die Luft gejagt.«
»Da drin ist ein Computerladen, CompuClinic«, sagte Delorme. »Hören Sie, haben Sie Cardinal heute Abend gesehen?«
»Ja, er war bis gegen halb acht auf dem Revier. Ungefähr um viertel nach sieben ist der Bürgermeister gekommen, und dann sind sie zusammen losgefahren. Wahrscheinlich zum Motel Birches, wo die holde Bürgermeistersgattin mit der Stadtreinigung rumvögelt. Soll ich den Bürgermeister anrufen?«
»Haben Sie seine Nummer?«
»Was für eine Frage. Der Typ geht mir schon seit einer Woche auf den Senkel.« McLeod hatte sein Handy bereits aus der Tasche genommen und wählte eine Nummer von einer Liste auf dem leuchtenden Display aus.
Delorme ging zu den Spurensicherern hinüber. Auf Knien sammelten sie kleine Gegenstände ein, die sie in Plastiktüten verstauten. Der Mond stand jetzt höher und war nicht mehr orangefarben, sondern tauchte die Szene in ein silbriges Licht. In der kühlen Brise lag der Geruch nach altem Laub. Warum passieren die schlimmsten Dinge in den schönsten Nächten?, fragte sich Delorme.
»Haben Sie Plastikbeutel über ihre Hände gezogen?«, fragte sie Arsenault.
Er schaute zu ihr hoch. »Klar. Solange wir ein Verbrechen nicht ausschließen können.«
Collingwood, der Jüngere der beiden von der Spurensicherung, leerte gerade die Kameratasche, die etwa einen Meter neben der Toten lag. Er war jung, blond und so wortkarg, dass es beinahe feindselig wirkte.
»Kamera«, sagte er und hielt eine Nikon hoch. Die Linse war zerbrochen.
»Sie war Fotografin«, sagte Delorme. »Cardinal sagt, sie ist heute Abend losgegangen, um Fotos zu machen. Was noch?«
»Ersatzfilme. Batterien. Linsen. Filter. Linsenputztuch.«
»Mit anderen Worten, was man in einer solchen Tasche erwartet.«
Er antwortete nicht. Bei Collingwood war es manchmal, als würde man gegen eine Wand reden.
»In ihrer Jackentasche haben wir Autoschlüssel gefunden«, sagte Arsenault und reichte sie Delorme.
»Ich seh mal im Wagen nach«, sagte sie.
Der Gerichtsmediziner, der über die Tote gebeugt gewesen war, stand auf und schlug sich Staub von seinem Mantel. Es war Dr. Claybourne, der mit Anfang dreißig schon eine Halbglatze hatte. Delorme hatte schon bei mehreren Fällen mit ihm zusammengearbeitet. Einmal hatte er sie zum Abendessen eingeladen, doch sie hatte abgelehnt mit der Begründung, sie hätte bereits einen Freund, was damals gar nicht stimmte. Manche Männer waren Delorme zu nett, zu harmlos, zu langweilig. In ihrer Gesellschaft fühlte man sich allein, ohne allein zu sein.
»Was meinen Sie?«, fragte Delorme.
Dr. Claybourne hatte einen roten Haarkranz und blasse, fast durchscheinende Haut. Delorme war aufgefallen, dass er leicht errötete, was sie allerdings auf seinen hellen Teint zurückführte.
»Tja, sie ist zweifellos von sehr hoch oben gestürzt. Und nach dem Blutverlust zu urteilen, muss sie noch gelebt haben, als sie gefallen ist.«
»Todeszeitpunkt?«
»Im Moment habe ich nur zwei Anhaltspunkte, die Körpertemperatur und die Tatsache, dass die Totenstarre noch nicht eingesetzt hat. Ich würde sagen, sie ist seit etwa zwei Stunden tot.«
Delorme warf einen Blick auf ihre Uhr. »Dann muss sie etwa um halb neun gestorben sein. Was ergeben Ihre Berechnungen?«
»Oh, das muss ich Ihren forensischen Experten überlassen. Sie liegt knapp zwei Meter vom Gebäude entfernt. Die Balkone ragen anderthalb Meter weit aus. Sie könnte von einem Balkon oder aus einem Fenster gestürzt sein.«
»Aus welcher Höhe?«
»Schwer zu sagen. So etwa vom zehnten Stock, würde ich schätzen.«
»Dann fangen wir wohl am besten mit dem Dach an.«
»Okay. Bisher habe ich noch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden.«
»Ich fürchte, Sie werden auch keine finden. Ich kenne die Tote. Sind Sie über ihre Krankheit im Bilde?«
»Nein.«
»Rufen Sie in der Psychiatrie an. Sie wurde in den vergangenen acht Jahren mindestens viermal dort eingewiesen. Das letzte Mal vor etwa einem Jahr, da hat sie drei Monate in der Klinik verbracht. Und wenn Sie den Anruf gemacht haben, können wir mal aufs Dach gehen.«
McLeod winkte sie zu sich. Sie ließ Claybourne stehen, der sein Handy bereits in der Hand hatte.
»Der gute Mr. Feckworth war nicht gerade begeistert über meinen Anruf. Ich konnte seine Alte im Hintergrund keifen hören. Natürlich hab ich mein ganzes diplomatisches Können ins Spiel gebracht.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Seine Durchlaucht sagt, Cardinal war bis halb zehn mit ihm auf dem Motelparkplatz. Szelagy sagt dasselbe.«
»Sie haben von Szelagy gehört?«
»Ja, er überlässt die Porcinis heute Abend sich selbst. Er ist unterwegs hierher.«
Delorme ging zu ihrem Wagen. Cardinal saß noch immer auf dem Beifahrersitz und sah aus, als hätte er ein paar Kugeln in den Bauch gekriegt. Delorme führte ihn zum Krankenwagen.
Die Notärztin war eine hart wirkende Frau mit kurzen blonden Haaren. Ihre Dienstkleidung saß ziemlich knapp.
»Der Ehemann des Opfers«, sagte Delorme. »Kümmern Sie sich um ihn, ja?« Sie wandte sich an Cardinal. »John, ich gehe jetzt aufs Dach. Bleib hier und begib dich in die Obhut dieser Leute. Ich bin in zehn Minuten wieder zurück.«
Cardinal setzte sich auf die Rampe des Krankenwagens. Wieder unterdrückte Delorme den Impuls, ihn in die Arme zu nehmen. Es bedrückte sie, dass ihr Freund schreckliche Qualen litt und sie ganz Polizistin sein musste.
McLeod und Dr. Claybourne fuhren mit ihr im Aufzug in den obersten Stock. Von dort aus stiegen sie über eine Treppe bis zu einer Tür mit der Aufschrift Dachterrasse. Die Tür wurde mithilfe eines Ziegelsteins offen gehalten. McLeod schaltete die Außenbeleuchtung ein.
Das Dach war mit einem Holzboden versehen, und es gab Picknicktische mit einem Loch in der Mitte für Sonnenschirme. Die Sonnenschirme waren weggeräumt worden, denn der Herbstwind war inzwischen zu kalt, als dass man länger als ein paar Minuten draußen sitzen konnte.
»Sie könnte sehr gut hier raufgekommen sein, um Fotos zu machen«, sagte Delorme, als sie sich umsah. Im Norden wand sich eine beleuchtete Straße den Hügel hinauf in Richtung Flughafen. Östlich davon erhob sich der dunkle Steilhang, und im Süden waren die Lichter der Stadt, die große Kathedrale und der Funkturm der Post zu sehen. Der Mond trat gerade hinter den Glockentürmen der französischen Kirche hervor.
McLeod zeigte auf eine schlichte hüfthohe Betonmauer, die das Dach umgab. »Sieht nicht so aus, als könnte man da aus Versehen drüberfallen. Vielleicht hat sie sich weit vorgebeugt, um ein Foto zu machen. Vielleicht sollten wir uns mal ansehen, was wir auf dem Film in ihrer Kamera finden.«
»Die Kamera war in der Tasche, ich nehme also nicht an, dass sie gerade beim Fotografieren war, als sie gestürzt ist.«
»Nachsehen kann trotzdem nichts schaden.«
Delorme zeigte in die Richtung, wo der Mond stand. »Da ist sie runtergefallen.«
»Am besten, Sie sehen sich die Stelle zuerst an«, sagte Dr. Claybourne. »Wenn Sie fertig sind, werfe ich auch einen Blick darauf.«
Vorsichtig gingen Delorme und McLeod zum Dachrand. McLeod sagte leise: »Ich glaub, der Doc ist in Sie verknallt.«
»Also wirklich, McLeod.«
»Haben Sie nicht gesehen, wie er rot angelaufen ist?«
»McLeod …«
Den Blick auf den Holzboden geheftet, näherte Delorme sich der Mauer. Der Mond und die Terrassenlampen boten gute Beleuchtung. Vor der Mauer blieb sie stehen, schaute nach unten, ging langsam ein paar Schritte nach links, dann nach rechts.
»Ich kann keinerlei Anzeichen für einen Kampf entdecken«, sagte sie. »Eigentlich überhaupt keine Spuren.«
»Da ist was.« McLeod hatte einen Zettel entdeckt, der unter einem Pflanzkübel klemmte, und bückte sich, um ihn aufzuheben. Er reichte ihn Delorme. Es war ein zehn mal fünfzehn Zentimeter großes liniertes Blatt, das von einem Spiralblock abgerissen worden war.
Das Blatt enthielt einige Sätze, mit Kugelschreiber in einer sauberen, energischen Handschrift geschrieben.
Lieber John,
wenn du das liest, werde ich dich auf eine Weise verletzt haben, die unverzeihlich ist. Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie leid es mir tut. Du sollst wissen, dass ich dich immer geliebt habe – ganz besonders in diesem Augenblick –, und wenn ich einen anderen Ausweg gefunden hätte …
Catherine
3
Als Delorme wieder nach unten kam, betrat Szelagy geradedie Eingangshalle in Begleitung einer in Tränen aufgelösten, ganz in Schwarz gekleideten Frau.
»Sergeant Delorme«, sagte Szelagy, »das ist Eleanor Cathcart. Sie wohnt hier im Haus im neunten Stock, und sie kennt Catherine.«
»Ich kann es einfach nicht fassen«, sagte die Frau. Sie nahm ihren Hut ab und schob sich mit theatralischer Geste eine schwarze Haarsträhne aus der Stirn. Alles an ihr wirkte übertrieben: Sie hatte dunkle Augenbrauen, trug dunklen Lippenstift, und ihre Haut war so weiß wie Porzellan, obwohl an ihr nichts auch nur entfernt Zerbrechliches war. Die Art, wie sie bestimmte Wörter aussprach, ließ darauf schließen, dass sie sich Paris sehr verbunden fühlte. »Ich lasse sie ins Haus, und sie springt vom Dach? Das ist doch einfach macabre.«
»Woher kennen Sie Catherine Cardinal?«, fragte Delorme.
»Ich unterrichte am College. Theaterwissenschaften. Catherine unterrichtet dort Fotografie. Mon Dieu, ich kann es nicht fassen. Ich habe sie erst vor ein paar Stunden ins Gebäude gelassen.«
»Warum haben Sie sie hereingelassen?«
»Ach, ich hatte ihr immer so vorgeschwärmt von der schönen Aussicht aus meinem kleinen pied-à-terre. Sie hat mich gefragt, ob sie mal herkommen und fotografieren könnte. Das hier ist schließlich das einzige hohe Gebäude auf dieser Seite der Stadt. Sie hat schon seit Monaten davon gesprochen, aber wir sind erst kürzlich dazu gekommen, ein rendezvous auszumachen.«
»Waren Sie in Ihrer Wohnung verabredet?«
»Nein, sie wollte nur aufs Dach. Da oben gibt es eine Dachterrasse. Ich habe sie nach oben begleitet und ihr gezeigt, wie man die Tür offen halten kann – sie fällt nämlich sonst zu, und dann ist man ausgesperrt, wie ich aus eigener bitterer Erfahrung weiß. Ich habe mich nicht lange da oben aufgehalten. Sie war bei der Arbeit und wollte ungestört sein. Die Kunst verlangt ein großes Maß an Einsamkeit.«
»Sie sind sich also ziemlich sicher, dass sie allein war.«
»Ja, sie war allein.«
»Wo wollten Sie eigentlich hin?«
»Zu einer Theaterprobe im Capital Centre. Wir proben gerade Das Puppenheim, und nächste Woche ist Premiere. Glauben Sie mir, einige in der Truppe sind längst noch nicht so weit. Unser Torvald liest seinen Text immer noch ab.«
»Wirkte Catherine in irgendeiner Weise aufgewühlt?«
»Überhaupt nicht. Na ja, Moment. Nein, sie war sehr konzentriert, sie konnte es kaum erwarten, aufs Dach zu gelangen, aber ich habe das als Begeisterung für ihre Arbeit interpretiert. Andererseits ist Catherine nicht immer leicht zu durchschauen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie bekommt regelmäßig solche Depressionen, dass sie in die Klinik muss, und davon hab ich auch nie etwas bemerkt. Aber wie die meisten Künstler neige ich dazu, sehr mit mir selbst beschäftigt zu sein.«
»Es würde Sie also letztlich nicht wundern, wenn sie Selbstmord begangen hätte?«
»Nun, es ist ein Schock. Ich meine, mon Dieu. Glauben Sie etwa, ich würde ihr einfach die Schlüssel zur Dachterrasse in die Hand drücken und sagen ›Tschüs, meine Liebe, angenehmen Selbstmord, ich bin mal eben zur Probe‹? Ich bitte Sie.«
Die Frau warf den Kopf in den Nacken und betrachtete die Decke. Dann schaute sie Delorme aus ihren dunklen Augen an. »Sehen Sie es so«, sagte sie. »Ich stehe hier wie vom Donner gerührt, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass ich Catherine Cardinal von allen Leuten, die ich kenne – und ich kenne eine Menge Leute –, am ehesten einen Selbstmord zutrauen würde. In eine geschlossene Anstalt kommt man schließlich nicht wegen einer kleinen Enttäuschung oder einer Anwandlung von Weltschmerz, und Lithium bekommt man nicht wegen PMS verschrieben. Außerdem – haben Sie schon mal ihre Arbeiten gesehen?«
»Einige«, sagte Delorme. Sie erinnerte sich an eine Ausstellung in der Bibliothek vor ein paar Jahren: ein Foto von einem weinenden Kind auf den Stufen der Kathedrale, eine leere Parkbank, ein einzelner roter Regenschirm in einer verregneten Landschaft. Fotos, die Sehnsucht ausdrückten, Bilder, die Einsamkeit darstellten. Wie Catherine selbst. Schön, aber traurig.
»Plädoyer beendet«, sagte Ms. Cathcart.
Gerade in dem Moment, als Delormes innerer Richter die Frau wegen unverzeihlichen Mangels an Mitgefühl verurteilte, brach Ms. Cathcart in Tränen aus – und das waren keine Bühnentränen, sondern unkontrolliertes Schluchzen aus echtem, nicht geprobtem Schmerz.
Delorme begab sich zusammen mit Dr. Claybourne zum Krankenwagen, wo Cardinal immer noch auf der Rampe saß. Er sprach sie an, noch bevor sie ihn erreichten, die Stimme belegt und verhalten.
»Gibt es einen Abschiedsbrief?«
Claybourne hielt ihm den Brief hin, damit er ihn lesen konnte. »Können Sie uns sagen, ob das die Handschrift Ihrer Frau ist?«
Cardinal nickte. »Das ist ihre Schrift«, sagte er und wandte sich ab.
Delorme begleitete Claybourne zu seinem Wagen.
»Also, Sie können es bezeugen«, sagte der Gerichtsmediziner. »Er hat die Handschrift als die seiner Frau identifiziert.«
»Ja«, sagte Delorme. »Ich kann’s bezeugen.«
»Wir müssen selbstverständlich trotzdem eine Autopsie durchführen, aber meiner Meinung nach war es Selbstmord. Wir haben keine Anzeichen für einen Kampf gefunden, wir haben einen Abschiedsbrief, und wir wissen, dass sie depressiv war.«
»Haben Sie mit der Klinik telefoniert?«
»Ich habe ihren Psychiater zu Hause erreicht. Er war natürlich bestürzt – es ist immer schlimm, einen Patienten zu verlieren –, aber er war nicht überrascht.«
»Also gut. Danke, Doktor. Wir werden das Gebäude noch überprüfen, für alle Fälle. Lassen Sie es mich wissen, falls wir noch etwas für Sie tun können.«
»Mach ich«, sagte Claybourne und stieg in seinen Wagen. »Deprimierend, nicht? Selbstmord?«
»Gelinde gesagt«, erwiderte Delorme. Das war der dritte innerhalb weniger Monate, mit dem sie zu tun hatte.
Sie sah sich nach Cardinal um, der sich nicht mehr beim Krankenwagen befand, und entdeckte ihn am Steuer seines Wagens. Er machte nicht den Eindruck, als wollte er losfahren.
Delorme setzte sich auf den Beifahrersitz. »Sie werden eine Autopsie durchführen, aber der Gerichtsmediziner wird Selbstmord als Todesursache feststellen«, sagte sie.
»Soll das Gebäude gar nicht überprüft werden?«
»Doch, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass wir etwas finden werden.«
Cardinal ließ den Kopf hängen. Delorme konnte sich nicht vorstellen, was in ihm vorging. Als er schließlich etwas sagte, war es nicht das, was sie erwartet hatte.
»Ich sitze hier und überlege, wie ich ihr Auto nach Hause schaffen soll. Wahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Lösung, aber im Moment kommt es mir vor wie ein unlösbares Problem.«
»Ich fahre es zu dir«, sagte Delorme. »Wenn wir hier fertig sind. Kann ich irgendjemanden für dich anrufen? Jemanden, der kommen und bei dir bleiben kann? Du solltest jetzt nicht allein sein.«
»Ich rufe Kelly an. Sobald ich zu Hause bin.«
»Aber Kelly ist doch in New York, oder? Hast du denn niemanden hier in der Nähe?«
Cardinal ließ den Motor an. »Ich komme schon zurecht«, sagte er.
Aber er klang ganz und gar nicht danach.
4
Tun die Schuhe nicht weh?«
Kelly Cardinal saß am Esstisch und griff nach einem gerahmten Foto ihrer Mutter, um es in Noppenfolie einzuwickeln. Sie wollte es während der Trauerfeier neben den Sarg stellen.
Cardinal setzte sich auf den Stuhl ihr gegenüber. Es waren mehrere Tage vergangen, aber er fühlte sich immer noch wie benommen, unfähig, seine Umwelt wahrzunehmen. Die Worte seiner Tochter hatten sich in seinem Kopf nicht zu etwas zusammengefügt, das er entziffern konnte. Er musste sie bitten, ihre Frage zu wiederholen.
»Die Schuhe, die du anhast«, sagte sie. »Die sehen nagelneu aus. Drücken die nicht?«
»Ein bisschen. Ich hab sie erst einmal getragen – zur Beerdigung meines Vaters.«
»Das war vor zwei Jahren.«
»Ah, ich liebe dieses Bild.«
Cardinal nahm das Foto von Catherine, das sie bei der Arbeit zeigte. Sie trug einen gelben Anorak, ihre Haare waren vom Wind zerzaust und vom Regen nass, und sie war mit zwei Kameras bepackt – eine um den Hals, die andere über der Schulter. Sie wirkte völlig entgeistert. Cardinal erinnerte sich, wie er diesen Schnappschuss mit dem kleinen Knipsapparat aufgenommen hatte, dem einzigen Fotoapparat, mit dem er je umzugehen gelernt hatte. Catherine war tatsächlich entgeistert gewesen, erstens, weil sie sich bei der Arbeit gestört fühlte, und zweitens, weil sie wusste, was der Regen mit ihren Haaren machte, und sie so nicht fotografiert werden wollte. Bei trockenem Wetter fiel ihr Haar in weichen Wellen auf ihre Schultern, während es bei Regen ganz wild und kraus wurde, was ihre Eitelkeit kränkte. Aber Cardinal liebte ihre Haare, wenn sie so wild waren.
»Obwohl sie Fotografin war, konnte sie es nicht ausstehen, fotografiert zu werden«, sagte er.
»Vielleicht sollten wir das Bild nicht nehmen. Sie wirkt ein bisschen ungehalten darauf.«
»Doch, doch. Bitte. Es zeigt Catherine bei dem, was sie am liebsten getan hat.«
Anfangs hatte Cardinal sich gegen die Idee gesträubt, ein Foto aufzustellen; es schien ihm nicht würdevoll genug, ganz abgesehen davon, dass der Anblick von Catherines Gesicht ihm das Herz zerriss.
Aber Catherine hatte in Fotos gedacht. Wenn man ein Zimmer betrat, in dem sie arbeitete, hatte sie einen, ehe man sich versah, bereits fotografiert. Es war, als wäre die Kamera ein Puffermechanismus, der im Lauf der Zeit einzig zu dem Zweck entwickelt worden war, scheue, zerbrechliche Menschen wie sie zu schützen. Andererseits war Catherine in Bezug auf Fotos vollkommen unprätentiös, sie konnte ebenso begeistert sein über einen gelungenen Schnappschuss von einer Straßenszene wie über eine Fotoserie, an der sie monatelang gearbeitet hatte.
Kelly steckte das eingewickelte Bild in ihre Tasche. »Zieh dir ein Paar andere Schuhe an. Du willst doch nicht die ganze Zeit in Schuhen rumstehen, die dir gar nicht passen.«
»Die passen«, sagte Cardinal. »Ich hab sie bloß noch nicht eingelaufen.«
»Nun mach schon, Dad.«
Cardinal ging ins Schlafzimmer und öffnete den Wandschrank. Vergeblich bemühte er sich, nicht auf die Seite zu sehen, wo Catherines Sachen untergebracht waren. Sie hatte hauptsächlich Jeans und T-Shirts oder Pullover getragen. Sie hatte zu der Sorte Frauen gehört, die, obwohl sie auf die fünfzig zugingen, immer noch gut aussahen in Jeans und T-Shirt. Aber dort hingen auch ein paar elegante schwarze Kleider, einige seidene Blusen und ein oder zwei Jäckchen, alles in den Grau- und Schwarztönen, die sie bevorzugt hatte. »Meine Gouvernantenfarben«, hatte sie sie genannt.
Cardinal nahm die schwarzen Schuhe aus dem Schrank, die er täglich trug, und machte sich daran, sie zu polieren. Es klingelte an der Tür, dann hörte er, wie Kelly sich bei einer Nachbarin bedankte, die gekommen war, um ihr Beileid auszudrücken und ihnen etwas zu essen zu bringen.
Als Kelly ins Zimmer kam, war Cardinal peinlich berührt, als ihm bewusst wurde, dass er mit der Schuhbürste in der Hand vor dem Wandschrank kniete, reglos wie einer der Toten von Pompeji.
»Wir müssen gleich fahren«, sagte Kelly. »Dann haben wir noch eine Stunde für uns, bevor die anderen Leute kommen.«
»Mhmm.«
»Die Schuhe, Dad. Die Schuhe.«
»Okay.«
Kelly setzte sich auf das Bett hinter ihm. Während er seine Schuhe bürstete, konnte er ihr Spiegelbild in der Schranktür sehen. Alle sagten, sie hätte seine Augen. Aber sie hatte Catherines Lippen, mit kleinen Fältchen an den Mundwinkeln, die sich vertieften, wenn sie lächelte. Und sie hätte auch Catherines Haare, wenn sie sie wachsen ließe und nicht so einen strengen Kurzhaarschnitt trüge mit einer einzelnen aufgehellten Strähne. Sie war ungeduldiger als ihre Mutter, hatte höhere Ansprüche an andere Menschen, die sie folglich ständig enttäuschten, aber vielleicht lag das einfach daran, dass sie noch so jung war. Sie konnte auch extrem streng mit sich sein, was nicht selten dazu führte, dass sie aus Verzweiflung über sich selbst in Tränen ausbrach, und bis vor nicht allzu langer Zeit war sie auch sehr kritisch mit ihrem Vater gewesen. Aber als Catherine das letzte Mal in die Klinik eingewiesen wurde, war sie gnädiger geworden, und seitdem kamen sie ziemlich gut miteinander aus.
»Es ist ja schon schlimm genug für mich«, sagte Kelly, »aber ich kann einfach nicht verstehen, wie Mom dir das antun konnte. Wo du all die Jahre immer zu ihr gestanden hast, obwohl sie so verrückt war.«
»Sie war viel mehr als das, Kelly.«
»Das weiß ich, aber was hast du nicht alles durchgemacht! Du musstest dich dauernd um mich kümmern, als ich noch klein war – du hast mich praktisch allein großgezogen. Und was du dir alles von ihr hast gefallen lassen! Ich weiß noch, wie du einmal, als wir noch in Toronto wohnten, diesen total komplizierten Schrank gebaut hast mit all den Schubladen und kleinen Türen. Ich glaube, du hast ungefähr ein Jahr lang daran gearbeitet, und dann kommst du eines Tages nach Hause, und sie hat ihn kurz und klein geschlagen, weil sie Brennholz brauchte! Sie hat irgendwas gefaselt von Feuer und kreativer Zerstörung, was überhaupt keinen Sinn ergab, und sie hat diesen Schrank kaputt gemacht, den du so liebevoll gebaut hattest. Wie kann man jemandem so was bloß verzeihen?«
Cardinal schwieg eine Weile. Schließlich schaute er seine Tochter an. »Catherine hat nie etwas getan, was ich ihr nicht verziehen habe.«
»Das hat etwas damit zu tun, wer du bist, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, wer sie war. Wie ist es möglich, dass sie nicht begriffen hat, was sie für ein Glück hatte? Wie konnte sie das alles einfach wegwerfen?«
Kelly hatte angefangen zu weinen. Cardinal legte ihr einen Arm um die Schultern, und sie lehnte sich an ihn und weinte heiße Tränen in sein Hemd, so wie ihre Mutter es so oft getan hatte.
»Sie hat gelitten«, sagte Cardinal. »Sie hat auf schreckliche Weise gelitten, und niemand konnte ihr helfen. Das darfst du nicht vergessen. Auch wenn sie manchmal sehr anstrengend war, ist sie diejenige, die am meisten gelitten hat. Niemand fand ihre Krankheit so schrecklich wie sie selbst. Und wenn du glaubst, sie sei nicht dankbar dafür gewesen, dass sie geliebt wurde, dann irrst du dich, Kelly. Du glaubst gar nicht, wie oft sie gesagt hat: ›Was hab ich für ein Glück.‹ Wenn wir zum Beispiel einfach nur beim Abendessen saßen oder bei irgendeiner anderen unbedeutenden Gelegenheit, nahm sie meine Hand und sagte: ›Was hab ich für ein Glück.‹ Und über dich hat sie das auch gesagt. Sie war sehr unglücklich darüber, dass sie so viel von der Zeit verpasst hat, in der du aufgewachsen bist. Sie hat alles getan, um gegen die Krankheit anzukämpfen, aber am Ende hat die Krankheit sie besiegt, das ist alles. Ich kenne die Statistiken, Kelly. Sie sind erschreckend. Es hat deine Mutter unglaublich viel Mut – und Loyalität – gekostet, um überhaupt so lange durchzuhalten.«
»O Gott«, sagte Kelly. Ihre Nase war so verstopft, dass sie klang, als wäre sie erkältet. »Ich wünschte, ich hätte nur halb so viel Mitgefühl wie du. Jetzt hab ich dir auch noch dein Hemd versaut.«
»Ich wollte sowieso ein anderes anziehen.«
Er reichte ihr eine Schachtel Kleenex, und sie riss eine ganze Handvoll Papiertaschentücher heraus.
»Ich muss mir das Gesicht waschen«, sagte sie. »Ich seh ja aus wie Medea.«
Cardinal wusste nicht, wer Medea war. Ebenso wenig wusste er, ob das, was er seiner Tochter erzählt hatte, nicht großer Unsinn war. Was weiß ich denn schon?, dachte er. Ich hab überhaupt nichts geahnt. Ich bin noch schlimmer als der Bürgermeister. Fast dreißig Jahre verheiratet, und ich bekomme nicht mal mit, dass die Frau, die ich liebe, sich umbringen will.
Diese Frage hatte Cardinal am Tag zuvor dazu bewogen, in die Stadt zu fahren und sich mit Catherines Psychiater zu unterhalten.
Er hatte während Catherines letztem Klinikaufenthalt mehrmals kurz mit Frederick Bell gesprochen. Es waren nur kurze Begegnungen gewesen, bei denen er lediglich den Eindruck gewonnen hatte, dass der Mann intelligent und kompetent war. Aber Catherine war ganz begeistert von ihm gewesen, weil Bell im Gegensatz zu den meisten Psychiatern nicht nur Medikamente verschrieb, sondern viel mit Gesprächstherapie arbeitete. Außerdem hatte er sich auf manische Depression spezialisiert und Bücher über das Thema geschrieben.
Er betrieb seine Praxis in seinem eigenen Haus, einem Ungetüm von einem Altbau in der Randall Street gleich hinter der Kathedrale. Zu den ehemaligen Eigentümern gehörten ein Parlamentsabgeordneter und ein Mann, der es später zu einem Medienzar gebracht hatte. Mit seinen Türmchen und Zinnen, ganz zu schweigen von dem gepflegten Garten und dem schmiedeeisernen Zaun, fiel es in der Gegend völlig aus dem Rahmen.
An der Tür wurde Cardinal von Mrs. Bell begrüßt, einer freundlichen Frau von Mitte fünfzig, die gerade das Haus verließ. Als Cardinal sich vorstellte, sagte sie: »Oh, Detective Cardinal. Mein herzliches Beileid.«
»Danke.«
»Sie sind doch nicht etwa dienstlich hier, oder?«
»Nein, nein. Meine Frau war eine Patientin Ihres Mannes, und …«
»Ach ja, selbstverständlich. Da werden Sie sicher Fragen haben.«
Während sie ihren Mann holte, sah Cardinal sich um. Poliertes Eichenparkett, Holzvertäfelungen, Deckenstuck – und das war nur das Wartezimmer. Als Cardinal sich gerade auf einen Stuhl setzen wollte, ging die Tür auf, und Dr. Bell trat ein, größer, als Cardinal ihn in Erinnerung hatte, über eins achtzig, mit einem buschigen braunen Vollbart, der am Kinn zu ergrauen begann, und einem angenehmen englischen Akzent, der weder hochgestochen noch gewöhnlich klang.
Er nahm Cardinals Hand in seine beiden Hände. »Detective Cardinal, ich möchte Ihnen noch einmal sagen, wie leid mir das mit Catherine tut. Sie haben mein tiefes Mitgefühl. Kommen Sie, treten Sie ein.«
Hätte in dem Sprechzimmer nicht ein riesiger Schreibtisch gestanden und ein Fernseher gefehlt, hätte es auch ein Wohnzimmer sein können. Bücherregale, bis zur Decke mit medizinischen und psychologischen Fachbüchern, Zeitschriften und Aktenordnern vollgestopft, zogen sich über alle vier Wände hin. Breite Ledersessel, abgenutzt und keineswegs zueinander passend, waren so angeordnet, dass man sich bequem unterhalten konnte. Und natürlich gab es eine Couch – ein bequemes, ganz normales Sofa, nicht so ein strenges, geometrisches Möbelstück, wie man es aus Filmen kannte, in denen Psychiater vorkamen.
Auf Bells Einladung hin setzte Cardinal sich auf das Sofa.
»Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee? Tee?«
»Nein, danke. Und danke, dass Sie mich so kurzfristig empfangen.«
»Keine Ursache. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann«, entgegnete Dr. Bell. Er zog seine Cordhose an den Knien hoch und nahm in einem der Sessel Platz. In seinem irischen Wollpullover wirkte er überhaupt nicht wie ein Arzt. Eher wie ein Professor, dachte Cardinal, oder wie ein Geiger.
»Ich vermute, Sie fragen sich, wie es möglich ist, dass Sie nichts geahnt haben«, sagte Bell, als hätte er Cardinals Gedanken gelesen.
»Ja«, sagte Cardinal. »Da vermuten Sie richtig.«
»Sie sind nicht der Einzige. Ich bin ihr Psychiater, der Mann, mit dessen Hilfe Catherine seit einem Jahr ihr Innenleben erforscht hat, und ich habe es auch nicht kommen sehen.«
Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und schüttelte seinen Wuschelkopf. Cardinal fühlte sich an einen Airedale erinnert. Nach einer Weile sagte Bell leise: »Selbstverständlich hätte ich sie in die Klinik eingewiesen, wenn ich es geahnt hätte.«
»Aber ist das nicht ungewöhnlich?«, fragte Cardinal. »Dass eine Patientin Sie regelmäßig aufsucht, aber nichts davon erwähnt, dass sie vorhat … Warum sollte jemand zu einem Therapeuten gehen, dem er sich nicht anvertrauen kann oder will?«
»Sie hat sich mir anvertraut. Selbstmordgedanken waren Catherine nicht fremd. Nicht dass Sie mich falsch verstehen: Sie hat nie etwas davon erwähnt, dass sie konkret vorhatte, sich das Leben zu nehmen. Aber wir haben natürlich darüber gesprochen, was der Gedanke an Suizid für sie bedeutete. Einerseits erschreckte sie die Vorstellung, andererseits erschien sie ihr sehr anziehend – wie Sie sicherlich wissen.«
Cardinal nickte. »Es gehörte zu den ersten Dingen, die sie mir über sich selbst erzählt hat, bevor wir verheiratet waren.«
»Offenheit war eine von Catherines großen Stärken«, sagte Bell. »Sie hat oft gesagt, eher würde sie sterben, als noch einmal eine manisch-depressive Phase durchzumachen – und nicht nur, um sich selbst davor zu verschonen, möchte ich hinzufügen. Wie die meisten Menschen, die an Depressionen leiden, quälte es sie, dass die Krankheit den Menschen, die sie liebte, das Leben so schwer machte. Es würde mich wundern, wenn sie Ihnen das über die Jahre nicht auch gesagt hätte.«
»Sie hat es oft gesagt«, erwiderte Cardinal und spürte, wie etwas in ihm zusammenbrach. Plötzlich verschwamm alles vor seinen Augen. Der Arzt reichte ihm eine Schachtel Kleenex.
Bell ließ einen Augenblick verstreichen, dann lehnte er sich stirnrunzelnd vor. »Sie hätten es nicht verhindern können. Bitte, lassen Sie mich Ihnen das versichern. Menschen, die fest entschlossen sind, sich das Leben zu nehmen, sorgen in der Regel dafür, dass niemand ihre Absichten errät.«
»Ich weiß. Sie hat nicht angefangen, Dinge zu verschenken, die ihr am Herzen lagen, oder irgendetwas dergleichen.«
»Nein. Keinerlei klassische Anzeichen. Und in ihrer Krankenakte steht auch nichts von einem früheren Versuch, obwohl sie viel über Suizid nachgedacht hat. Aber wir wissen, dass sie über Jahrzehnte gegen ihre manische Depression angekämpft hat. Die Statistiken sind eindeutig: Bei manisch-depressiven Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich das Leben nehmen, am höchsten, und zwar ohne Ausnahme. Bei keiner anderen Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit höher. Gott, ich rede, als wüsste ich, wovon ich rede, aber ich weiß es nicht.« Dr. Bell hob hilflos die Arme. »Wenn so etwas passiert, kommt man sich ziemlich inkompetent vor.«
»Ich bin sicher, dass es nicht Ihre Schuld ist«, sagte Cardinal. Er wusste eigentlich gar nicht mehr, was er überhaupt bei dem Arzt wollte. War er hergekommen, um sich anzuhören, wie dieser bärtige Engländer sich über Statistiken und Wahrscheinlichkeiten ausließ? Ganz ohne jeden Zweifel bin ich derjenige, der jeden Tag mit ihr zusammen war, dachte er. Ich bin derjenige, der sie am längsten kannte. Ich bin derjenige, der nicht aufgepasst hat. Zu dumm, zu egoistisch, zu blind.
»Es ist verführerisch, nicht wahr? Man ist in Versuchung, sich selbst die Schuld zu geben«, sagte Bell, als hätte er einmal mehr Cardinals Gedanken gelesen.
»In meinem Fall ist es eine traurige Tatsache«, erwiderte Cardinal, dem die Verbitterung in seiner eigenen Stimme nicht entging.
»Aber mir geht es genauso«, sagte Bell. »Das sind die Kollateralschäden des Suizids. Jeder, der einem Menschen nahestand, der sich das Leben genommen hat, wirft sich vor, nicht genug getan zu haben, nicht einfühlsam genug gewesen zu sein, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben, um es zu verhindern. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Gefühle eine korrekte Einschätzung der Realität darstellen.«
Dr. Bell sagte noch andere Dinge, die Cardinal nicht mitbekam. Später fragte er sich, ob er die ganze Zeit geweint hatte. Sein Kopf war wie ein ausgebranntes Haus. Eine leere Hülle. Woher sollte er wissen, was um ihn herum geschah?
Als Cardinal sich verabschiedete, sagte Bell: »Catherine hatte großes Glück, mit Ihnen verheiratet zu sein. Und sie wusste das.«
Die Worte des Arztes hätten beinahe dazu geführt, dass er erneut in Tränen ausbrach. Mit letzter Kraft gelang es ihm, sich zusammenzureißen, wie ein Patient, der eben noch auf dem OP-Tisch gelegen hat und verzweifelt seine beiden zusammengenähten Hälften festhält. Irgendwie schaffte er es durchs Wartezimmer und hinaus in die goldene Oktobersonne.
5
D