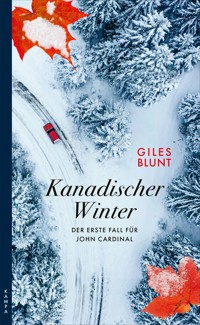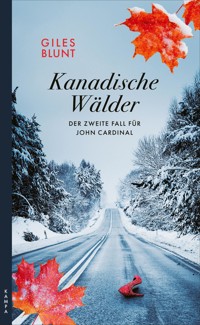6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Cardinal
- Sprache: Deutsch
Ein packender und harter Thriller vom preisgekrönten Bestsellerautor Giles Blunt Algonquin Bay, Kanada: In einer kalten Nacht wird Detective John Cardinal zu einem Mordfall gerufen. Auf dem Parkplatz eines Motels liegt eine Männerleiche mit einem Stiefelabdruck an der Kehle – offenbar ein Mord aus Eifersucht. Die Geliebte des Mordopfers ist verschwunden. Kurz darauf wird, angekettet in einem verlassenen Hotel im Wald, die Frau eines Politikers aus Ottawa erfroren aufgefunden. Seine Ermittlungen führen Cardinal tief in die Arktis, auf die Spur eines jahrzehntealten ungesühnten Verbrechens bei einer Polarexpedition … "Ewiges Eis", ausgezeichnet als bester kanadischer Kriminalroman, ist der sechste Band der John Cardinal-Reihe: "Eine der handwerklich besten, großartig geschriebenen, fesselndsten Krimiserien überhaupt." Lindwood Barclay
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Giles Blunt
EWIGES EIS
Thriller
Aus dem Englischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Algonquin Bay, Kanada: In einer kalten Nacht wird Detective John Cardinal zu einem Mordfall gerufen. Auf dem Parkplatz eines Motels liegt eine Männerleiche mit einem Stiefelabdruck an der Kehle – offenbar ein Mord aus Eifersucht. Die Geliebte des Mordopfers ist verschwunden. Kurz darauf wird, angekettet in einem verlassenen Hotel im Wald, die Frau eines Politikers aus Ottawa erfroren aufgefunden. Seine Ermittlungen führen Cardinal tief in die Arktis, auf die Spur eines jahrzehntealten ungesühnten Verbrechens bei einer Polarexpedition …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Aus dem blauen Notizheft
1. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
2. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
3. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
4. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
5. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
6. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
7. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
8. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
9. Kapitel
10. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
11. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
12. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
13. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
14. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
15. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
16. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
17. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
18. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
19. Kapitel
Aus dem blauen Notizheft
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Danksagung
Für Janna
Well I lived with a child of snow
When I was a soldier
And I fought every man for her
Until the nights grew colder
Leonard Cohen
Aus dem blauen Notizheft
Wir hörten das Flugzeug, bevor es zu sehen war. Der Sturm, der drei Tage und Nächte um uns herum geheult hatte, war endlich vorbei, und eine dichte Wolkendecke lag über der Stille.
Hunter war den ganzen Morgen draußen gewesen, um den Schnee von der Startbahn zu räumen, wenn man den Streifen Eis, der sich vom Labor bis zum letzten Leuchtfeuer erstreckte, als solche bezeichnen wollte, diese blassblaue Verbindung der Driftstation Arcosaur mit dem Rest der Welt.
Wyndham und ich waren aus dem Labor gekommen, um das Flugzeug landen zu sehen. Die Twin Otter, die alle zwei Wochen eintraf, stellte unsere einzige Versorgungsquelle dar, und wir freuten uns immer auf sie wie Kinder auf den Weihnachtsmann.
Zu dem Zeitpunkt lauteten unsere Koordinaten 82°28’N 55°20’W. Wir waren mehr als neunzig geographische Meilen von unserer ursprünglichen Position in der Lincolnsee abgekommen und trieben steuerlos auf dem Beaufortwirbel. Zwei Wochen zuvor hatten wir die Canadian Forces Station Alert passiert. Wir fragten bei den Militärs an, ob die Otter ihre Landebahn benutzen dürfte, um nicht nach Resolute ausweichen zu müssen, bekamen jedoch ein knappes Nein zur Antwort. Vanderbyl war tagelang stinkwütend gewesen.
Kurt Vanderbyl, unser leitender Wissenschaftler, war gerade dabei, sich um eine Anordnung hüfthoher Radiometer und Sensoren zu kümmern. Er war der Älteste von uns, ein asketischer silberhaariger Niederländer, der sich gebückt zwischen den Instrumenten bewegte wie ein Priester beim Austeilen der Kommunion. Sein Assistent Ray Deville wich schon den ganzen Vormittag nicht von seiner Seite, ein wandelndes Klemmbrett mit Sonnenbrille und blauer Daunenjacke. Beim Geräusch des sich nähernden Flugzeugs drehten sich beide um und legten zum Schutz gegen das trotz der Wolken grelle Licht die Hände über die Augen.
Als das Flugzeug schließlich in Sicht kam, war es schon überraschend nah. Ein Neuling in der Arktis hätte vielleicht gedacht, der Pilot würde über die Landebahn hinausschießen und durch das Labor pflügen. Ich war selbst ein erfahrener Pilot, doch die Burschen, die in die Arktis flogen, waren Teufelskerle, deren Können mich immer wieder beeindruckte. Die Otter setzte auf den Kufen auf, schoss auf uns zu und kam nicht einmal fünfzig Meter vor uns zum Stehen. Der Pilot kletterte aus dem Cockpit und winkte.
Wyndham legte sich ein Geschirr um die Brust, ich hakte ihn am Schlitten ein, und wir machten uns auf den Weg zum Flugzeug. Ein Passagier stieg aus.
Wer zum Teufel ist das denn?, fragte ich.
Rebecca Fenn – Kurts Frau.
Seine Frau? Ich dachte, die hätten sich getrennt.
Haben sie auch. Aber sie hat hier ihr eigenes Projekt. Rein beruflicher Aufenthalt – behauptet Kurt zumindest.
Das kann ja heiter werden.
Weiß nicht. Er hätte sicher nicht zugestimmt, wenn er befürchten müsste, dass die Arbeit der anderen beeinträchtigt würde.
Vanderbyl war als Erster beim Flugzeug. Er nahm Rebecca den Koffer ab, doch sie umarmten sich nicht und wechselten auch kein Wort.
Rebecca kennst du ja, sagte er zu Wyndham, als wir näher kamen.
Ja, klar. Hallo, Rebecca.
Hallo, Gordon. Schön, dich wiederzusehen.
Gordon zog einen Handschuh aus, um ihr die Hand zu schütteln. Vanderbyl wandte sich mir zu.
Und das ist Karson Durie, Gletscherexperte, auch bekannt als Kit.
Ah ja – ich habe schon viel von Ihnen gehört.
Wir gaben uns die Hand. Ihre war schlank und noch warm vom Flugzeug drinnen.
Sie streifte sich die Handschuhe über und ließ, die Hände in die Hüften gestemmt, den Blick über die Umgebung schweifen. Wow.
Ich hoffe, das ist ein positives Wow, sagte Vanderbyl, während Wyndham und ich begannen, die Vorräte auf den Schlitten zu laden.
Weiß ich noch nicht, erwiderte sie. Sie hatte eine tiefe, samtene Stimme und einen Tonfall, der von absolutem Selbstvertrauen zeugte. Ich habe kürzlich etwas über die Reaktion von Leuten gelesen, die zum ersten Mal eine Eisinsel betreten haben, sagte sie. Irgendwelche amerikanischen Militärs, angeführt von einem General. Seine ersten Worte lauteten: »Hier kann niemand überleben. Wir müssen hier weg, solange es noch möglich ist.«
Wir alten Hasen kennen das Zitat, sagte Wyndham und wuchtete eine Kiste mit der Aufschrift PATAK’S CURRYPASTE auf den Schlitten. Genau das sagt einem der gesunde Menschenverstand ja eigentlich auch. Ein Rat, auf den hier allerdings keiner hört – aber sonst kriegt man hier nichts auf die Beine gestellt.
Wow, sagte sie noch einmal. Dieser Ort ist …
Ich zeige dir dein Labor, sagte Vanderbyl.
Die beiden stapften in Richtung Lager davon. An der Art, wie sie nebeneinanderher gingen, hätte selbst ein zufälliger Beobachter bemerkt, dass sie Mann und Frau waren.
Es ist unklug, sie hierherzuholen, sagte ich zu Wyndham.
Warum? Alle sind total beschäftigt. Sie hat ihr eigenes Forschungsprojekt, und Kurt hat weiß Gott alle Hände voll zu tun.
Ich will hier einfach keinen Sturm und Drang.
Dazu wird es nicht kommen. Rebecca ist eine gute Wissenschaftlerin. Hübsches Mädchen, findest du nicht? Äh, ich meine natürlich hübsche Frau.
Was ich finde, spielt keine Rolle.
1
Ein heftiger Wind fegte über den Lake Nipissing – so laut, dass er John Cardinal weckte und aus dem Bett trieb, ehe sein Wecker um sechs Uhr klingelte. Die Sonne ließ sich noch nicht blicken, aber ein fetter Mond beschien den zugefrorenen See und die Bäume am Ufer, die sich im Sturm bogen. Wie immer um diese Jahreszeit war die Oberfläche des Sees übersät mit den Hütten der Eisangler. Zweige jagten über den Rasen hinter dem Haus, der Deckel einer Mülltonne kam in Sicht und krachte gegen einen Baum. Er rollte wie eine Münze weiter durch den Garten und dann aus dem Blickfeld.
»Nicht zu fassen«, sagte Cardinal. Er schaltete das Licht in der Küche aus, um besser sehen zu können. Er war in Algonquin Bay geboren und aufgewachsen und hatte bis auf ein Dutzend Jahre, die er in Toronto verbracht hatte, immer hier gelebt.
»The Bay«, wie der Ort von den Einheimischen kurz und bündig genannt wurde, lag zwar nur dreihundertvierzig Kilometer von Toronto entfernt – also ziemlich weit weg von der Arktis –, doch die Winter hier oben waren richtig hart. Cardinal hatte schon eine Menge ungewöhnlicher Wetterphänomene erlebt, aber so etwas hatte er noch nie gesehen. Die Anglerhütten – nicht alle zwar, aber doch eine ganze Reihe – wanderten, vom gnadenlosen Sturm aus ihrer Verankerung gerissen, über den See.
Sein Telefon klingelte. Es war Chouinard, der ihm erklärte, er brauche nicht erst aufs Revier zu kommen, sondern solle sich direkt zu einem Tatort am Highway 17 auf den Weg machen. Als Cardinal im Wagen saß, hatte sich der Sturm schon hinter die Hügel verzogen.
Das Motel lag auf einer kleinen Anhöhe und wurde fast vollständig von einem Wäldchen verdeckt, wäre da nicht die grelle Leuchtreklame gewesen. Cardinal parkte seinen Wagen direkt hinter dem BMW des Gerichtsmediziners und schaltete den Motor ab. Er zog die Handbremse und warf Lise Delorme einen Blick zu, die sich schon anschickte auszusteigen.
Der Morgen dämmerte, klar und windstill. Die Januarsonne ließ sich noch nicht blicken. Sie gingen an den anderen Autos vorbei – den Streifenwagen, den Zivilfahrzeugen, dem Van der Spurensicherung – hinauf zum Motel.
Delorme deutete auf die Leuchtreklame. »Würdest du in einer Absteige übernachten, die sich Motel 17 nennt? Was hat sich der Typ bloß dabei gedacht?«
»Wem das Motel 6 gefallen hat, dem wird das Motel 17 noch besser gefallen«, erwiderte Cardinal. »Eine einfache Rechnung.«
Eine Polizistin in Uniform, die vor dem Absperrband postiert war, winkte sie durch.
Auf dem Parkplatz standen einige Personen dicht beieinander, zwei weitere knieten auf dem Boden. Die Anordnung der Gruppe erinnerte Cardinal an eine Weihnachtskrippe. Detective Constable Vernon Loach stand auf. »Genau der richtige Tag für so was, oder?«
»Minus achtundzwanzig Grad, soweit ich zuletzt gehört habe«, sagte Cardinal.
»Haben Sie die wandernden Anglerhütten gesehen?«
»Ja. Es gibt für alles ein erstes Mal.«
»Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Eine Invasion von Dixi-Klos. Ich leite hier übrigens die Ermittlungen, nur damit Sie Bescheid wissen.«
»Wie bitte?«, sagte Delorme. »Ich höre wohl nicht recht, Constable?«
»Klären Sie das mit Chouinard.«
Delorme zog ihr Handy heraus und entfernte sich ein Stück. Sie kam mit versteinerter Miene zurück.
Loach wandte sich an den Gerichtsmediziner. »Würden Sie die Spätankömmlinge wohl auf den neuesten Stand bringen, Doc?«
Dr. Barnhouse trug eine Pilotenmütze mit Pelzbesatz, mit der er wie eine Comicfigur aussah. Er war ein übelgelaunter Schotte, dessen Stimmung sich auf demselben Tiefpunkt befand wie die Temperatur. »Wie wär’s, wenn Sie eine Matinee-Vorstellung einplanen würden, Sergeant Loach.«
»Detective Constable«, korrigierte Delorme ihn, »nicht Sergeant.«
»Lassen Sie uns einfach zur Sache kommen«, sagte Loach.
»Wären wir dann soweit? Waren alle auf dem Klo? Sind alle Bleistifte gespitzt?«
»Sie könnten längst fertig sein.«
Cardinal bemühte sich, Loach, der erst kürzlich aus Toronto zu ihnen gestoßen war, unvoreingenommen zu begegnen. Das einzig Auffällige an ihm war momentan, dass es ihm völlig gleichgültig zu sein schien, ob jemand ihn mochte oder nicht. Eine Einstellung, die vielleicht nützlich war, wenn man es mit Drogendelikten in Toronto zu tun hatte. Doch in einer Mordkommission – egal wo, aber vor allem in einer Kleinstadt im Norden – könnte sich dies als belastend erweisen.
»Gut genährter männlicher Weißer«, verkündete Barnhouse, »Anfang vierzig, hat schätzungsweise acht Stunden draußen gelegen, vielleicht auch zehn. Die extreme Kälte macht selbst eine grobe Schätzung des Todeszeitpunkts unmöglich.
Nach erster Sichtung der Totenflecken kann man davon ausgehen, dass der Mann hier gestorben ist, und zwar in dieser Stellung. Die Todesursache ist höchstwahrscheinlich Ersticken. Keine Würgemale, keine Finger– oder Daumenabdrücke, aber das Zungenbein ist zertrümmert; außerdem weisen die Augen petechiale Blutungen auf. Der Mörder hat wahrscheinlich auf dem Hals seines Opfers gestanden. Einige Spuren deuten darauf hin.«
»Reizend«, bemerkte Cardinal.
»Gehen wir rein«, sagte Loach. »Wir haben eines der Zimmer requiriert. Sehen Sie sich unterwegs die beiden Fahrzeuge an.«
Sie ließen Barnhouse zurück, der seine Formulare ausfüllte; zu dritt betraten sie dann das Zimmer neben dem Motelbüro.
»Hat die Spurensicherung Fotos von seinem Hals gemacht?«, fragte Cardinal. »Vielleicht finden wir eine Übereinstimmung mit einem bestimmten Schuh.«
»Gute Idee«, sagte Loach, aber Cardinal war sich nicht sicher, ob dies sarkastisch gemeint war oder nicht. Er erkundigte sich nach den beiden Autos vor dem Eingang.
»Richtig. Zücken Sie Ihre Stifte, es gibt jede Menge Namen. Der schwarze Nissan gehört einer Frau hier aus dem Ort, Laura Lacroix – sie ist weder hier noch zu Hause. Ehefrau eines gewissen Keith Rettig, der in Ihrer hübschen Stadt wohnt – äh, in unserer hübschen Stadt. Die Eheleute leben getrennt. Das Opfer heißt Mark Trent, Verwaltungsangestellter im Krankenhaus und Eigentümer des grünen Audi, der vor Zimmer sieben parkt. Die Beweismittel in besagtem Zimmer lassen darauf schließen, dass die beiden eine Affäre hatten. Und der Geschäftsführer des Motels bestätigt, Trent wie auch die beiden Fahrzeuge schon mehrfach gesehen zu haben, die Frau jedoch noch nie. Die beiden waren wohl äußerst diskret. Laut Lehrbuch ist der Ex unser Hauptverdächtiger. Wie es halt oft so läuft: Er kriegt raus, dass seine Frau fremdgeht, flippt aus, und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als diesem armen Idioten auf dem Hals herumzutrampeln.«
»War das Opfer auch verheiratet?«, fragte Delorme.
»Ja, und zwar mit Melinda Trent, ebenso wie ihr Gatte in der Krankenhausverwaltung beschäftigt. Da wir ja heutzutage Gleichberechtigung großschreiben, gilt Mrs. Trent ebenfalls als Hauptverdächtige. Sie hat heute Morgen eine Vermisstenanzeige aufgegeben, ist allerdings bisher noch nicht informiert worden. Das werde ich« – Loach zog den Ärmel seines Parkas hoch und sah auf die Uhr – »jedoch umgehend erledigen.«
Draußen brachte der Fahrer eines Abschleppwagens, in Abgaswolken gehüllt, Befestigungen an den Rädern des Audi an.
»Ms. Lacroix ist also derzeit nicht auffindbar, aber ihr Auto steht hier. Irgendwelche Spuren eines dritten Fahrzeugs?«
»Nein. Kein Schnee in der Auffahrt, keine Spuren. Apropos: Was ist das hier überhaupt für ein verrücktes Wetter? In Toronto haben wir mehr Schnee als hier. Ich bin ja eigentlich nur zum Skilaufen hergekommen, wie Sie wissen.«
»Fahren Sie zehn Kilometer rauf in den Norden, da liegt Schnee ohne Ende.«
»Wie gesagt, verrückt. Wo war ich stehengeblieben? Der Geschäftsführer. Wohnt im Haus hinter dem Motel. Behauptet, er hätte im Bett gelegen und nichts gehört. Keine anderen Gäste oder sonstige Zeugen, soweit wir wissen. Die vorläufige Theorie – besser gesagt, meine Theorie – lautet: Unsere beiden Liebenden beenden ihr Stelldichein. Laura Lacroix geht als Erste, verdrückt sich möglichst unauffällig – ihr Mantel ist weg; Mr. Trent ist in Hemdsärmeln herausgekommen. Wir haben neben der Leiche ein filigranes Armband gefunden. Ich schätze, sie hatte es vergessen, und er ist hinter ihr hergelaufen, um es ihr zu geben.«
»Sie sind wohl von der schnellen Truppe«, bemerkte Cardinal.
»Gut, was? Sieht so aus, als hätte jemand der Frau aufgelauert, als sie in ihren Wagen steigen wollte. Andererseits, in welchem Wagen ist sie dann weggefahren und warum? Trent kommt raus mit dem Armband, der Täter will keinen Zeugen und bringt ihn um.«
»Wenn es der wütende Ehemann war«, sagte Delorme, »stand Trent wahrscheinlich sowieso als Nächster auf seiner Liste. Vielleicht sogar an erster Stelle.«
»Gut möglich.«
»Sie sprechen mit Trents Frau«, sagte Cardinal. »Sollen wir uns Mr. Rettig vornehmen?«
»Ja. Und wenn er kein wasserdichtes Alibi hat, bringen Sie ihn aufs Revier, dann nehmen wir ihn in die Mangel. Denn wenn es nicht der wütende Ehemann war, dann könnte sich diese Geschichte hier als ausgewachsenes Rätsel entpuppen. Und ich kann Rätsel nicht leiden.«
Sie standen eine Weile schweigend da, während Cardinal in die Nacht blickte. Loach sah Delorme an und meinte: »Detective Cardinal wirkt so nachdenklich. Mir scheint, er wird von einem Gedanken heimgesucht.«
»Nein, nichts Konkretes«, sagte Cardinal. »Nur dass nichts von alldem – eine Affäre, ein Eifersuchtsdrama, die Tatsache, dass die Frau verschwunden ist – bedeutet, dass sie tatsächlich getötet wurde. Möglicherweise hat sie einen Killer angeheuert, und ihr Verschwinden dient als Täuschungsmanöver. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie von einem Dritten entführt wurde, aus welchem Grund auch immer …«
»Genau«, sagte Loach. »Bei einer Ermittlung wie dieser sind schmutzige Gedanken der beste Freund eines Cops.«
Keith Rettig wohnte in einem weißen Bungalow in einer kleinen Straße etwas abseits vom Lakeshore Drive. Er war erheblich älter, als Cardinal erwartet hatte, mindestens Anfang sechzig. Er öffnete die Tür in Sweatshirt und Jeans, von oben bis unten mit Farbe bekleckert.
Cardinal stellte sich und Delorme vor und fragte, ob sie eintreten dürften.
»Lieber nicht. Ich bin gerade beim Streichen.«
»Mr. Rettig, wissen Sie, wo Ihre Frau ist?«
»Also, hier ist sie nicht. Sie wohnt nicht mehr hier. Warum suchen Sie sie denn?«
»Ihr Wagen steht verlassen auf einem Motelparkplatz. Dort wurde ein Mann ermordet, und sie ist möglicherweise auch in Gefahr.«
»Ermordet? Moment – ermordet? Wer denn? Geht es Laura gut?«
»Der Mann ist tot. Ihre Frau wird vermisst. Vielleicht taucht sie ja noch in ihrer Arbeitsstelle auf, aber zu Hause ist sie nicht, und, wie gesagt, ihr Auto steht noch am Motel.«
»Das muss ich erst mal verdauen.«
»Ja, es ist schockierend«, sagte Delorme. »Können wir uns drinnen unterhalten?«
»Äh, ja, natürlich, entschuldigen Sie.« Er trat zur Seite und hielt ihnen die Tür auf.
Cardinal und Delorme gingen hinein und zogen die Schuhe aus. Es roch stark nach Farbe. Der Boden war mit Zeitungen und Plastikfolie abgedeckt.
»Gehen wir ins Wohnzimmer«, sagte Rettig. »Das ist das einzige Zimmer, das nicht im Chaos versinkt. Ich bin erst vor einer Woche eingezogen.«
Die Möbel wirkten teuer, waren aber zu klobig, und zu viele waren es auch. Cardinal und Delorme setzten sich auf das Sofa. Rettig nahm in einem abgewetzten Klubledersessel Platz, neben dem eine Leselampe aus Messing stand. »Gott, das ist wirklich ein Schock. Ich weiß, dass Laura einen Liebhaber hat. Der Tote, hieß der Mark?«
»Mark Trent«, bestätigte Delorme. »Kannten Sie den Mann?«
Rettig schüttelte den Kopf. »Laura hat mir nur seinen Namen genannt. Also den Vornamen. Er ist der Grund für unsere Trennung.«
»Können Sie uns sagen, wo Sie den gestrigen Abend verbracht haben?«
Rettig schaute erst Cardinal, dann Delorme an. »Hm, sicher. Ich war die ganze Nacht hier, und auch den ganzen Tag, bis auf die Fahrten zum Baumarkt. Gestern Abend habe ich den Flur gestrichen und ein paar Spiegel aufgehängt, anschließend habe ich ferngesehen.«
»Kann das jemand bestätigen?«
»Mir hat niemand beim Streichen geholfen, falls Sie das meinen. Ah, warten Sie – ich habe Pay-TV gesehen. Vier Episoden von Mad Men, eine nach der anderen. Das müsste sich doch bei der Kabelfirma überprüfen lassen, oder?«
»Eigentlich schon.«
»Und gegen halb zehn habe ich tatsächlich einen Freund angerufen, um zu fragen, ob er sich auf ein Bier mit mir treffen möchte. Aber das war wirklich nur ein ganz kurzes Gespräch.«
»Trotzdem brauchen wir den Namen Ihres Freundes«, sagte Cardinal.
»Sollten Sie nicht Laura suchen?«
Delorme beugte sich vor. »Es gibt Hinweise, dass Ihre Frau zuerst angegriffen wurde, Mr. Rettig. Mr. Trent ist möglicherweise dazwischengegangen.«
»Hinweise? Was denn – Blut?«
»Nein. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Vielleicht taucht sie ja auch wohlbehalten wieder auf, aber im Moment wissen wir einfach nicht, wo sie steckt, und sie hat weder ihr Handy noch ihre Kreditkarte oder ihr Auto benutzt.«
»Sie wussten also, dass sie eine Affäre hatte, bevor Sie sich getrennt haben«, sagte Cardinal. »Das muss Sie doch gekränkt haben.«
»Gekränkt? Ich war am Boden zerstört.«
»Wie alt ist Ihre Frau, siebenunddreißig, achtunddreißig? Sie müssen doch so um die sechzig sein.«
»Achtundfünfzig. Jaja – das ist ein großer Altersunterschied. Aber wir waren acht Jahre zusammen. Es hatte sich nichts geändert zwischen uns, und ich habe ihr auch nichts verheimlicht. Ich dachte, sie wäre glücklich. Den Eindruck machte sie zumindest. Bis vor ungefähr einem Jahr.«
»So ein Altersunterschied kann einen Mann ganz schön verunsichern.«
»Mich nicht. Laura hat mir nie einen Grund dafür gegeben. Bis sie diesen Typ da kennengelernt hat.«
»Das war vor einem Jahr?«
»Eher vor acht, neun Monaten. Danach ist alles ziemlich schnell den Bach runtergegangen.«
»Sie müssen ganz schön wütend gewesen sein.«
»Wie auch nicht? Aber es war nicht bloß Wut. Ich war deprimiert, fühlte mich gedemütigt. Alles Mögliche. So hatte ich mir mein Leben jedenfalls nicht vorgestellt«, sagte er und deutete auf die Abdeckplanen und das übervolle Zimmer. »Natürlich hatte ich einen Hass auf diesen Mark. Aber ich bin ihm nie begegnet, habe ihn nie gesehen, und erschossen habe ich ihn erst recht nicht.«
»Niemand hat gesagt, dass er erschossen wurde«, bemerkte Delorme.
»Er ist nicht erschossen worden? Wie ist es dann passiert?«
»Das werden wir nach der Autopsie wissen«, erwiderte Cardinal. »Wie viel wiegen Sie, Mr. Rettig?«
»Wie viel ich wiege?«
»Ja, wie viel wiegen Sie? Siebzig Kilo?«
»Ungefähr achtundsechzig. Warum fragen Sie – spielt das eine Rolle?«
»Könnte sein.«
Delorme stand auf. »Mr. Rettig, darf ich mal Ihre Toilette benutzen. Der viele Kaffee …«
»Selbstverständlich. Die Tür rechts vor der Küche.«
»Mir ist klar, dass Ihr Leben im Moment kopfsteht«, sagte Cardinal, »aber wir brauchen unbedingt eine Liste mit sämtlichen Kontakten Ihrer Frau – Freunde, Verwandte, Kollegen. Alle eben.«
»Nun, Sie kriegen von mir natürlich alles, was ich habe, aber ihr Laptop oder ihr Handy geben mit Sicherheit mehr her.«
»Wissen Sie, ob Ihre Frau Feinde hatte?«
»Feinde? Laura ist Krankenschwester, die hat keine Feinde.«
»Na ja, vielleicht wissen Sie das ja nicht – ihr Liebhaber, Mark Trent, er war verheiratet. Mrs. Trent zum Beispiel wird ihr also kaum wohlgesinnt sein.«
Rettig legte die Hände auf die Armlehnen seines Sessels, sah zur Decke und schüttelte den Kopf. »Laura hat mir nichts davon gesagt, dass er verheiratet war. Das ist doch verrückt. Völlig sinnlos. Warum verlässt sie ihren Mann, der sie liebt und sie umsorgt, nur um … Na ja, das wollen Sie bestimmt nicht hören.«
»Was ist mit Stalkern – ein Ex-Freund, vielleicht ein verärgerter Patient? Irgendjemand?«
»Nicht dass ich wüsste.«
Delorme erschien in der Tür.
»Also gut«, sagte Cardinal. »Schreiben Sie sämtliche Namen auf, die Ihnen einfallen – das wäre dann alles im Moment. Sie werden verstehen, dass wir über Sie und Ihre Frau Erkundigungen einziehen müssen. Wir sind nicht an schmutziger Wäsche interessiert, aber manchmal taucht eben auch Unerfreuliches auf.«
»Hauptsache, ich bekomme keine Schwierigkeiten mit meinem Arbeitgeber. Ich möchte meine Rente in voller Höhe beziehen, wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Wo arbeiten Sie?«
»Brunswick Geo.«
»Bergbau?«
»Ich bin bloß Wirtschaftsprüfer. Hauptsächlich sorge ich für die Einhaltung von Vorschriften. Sorglosigkeit kann eine Firma teuer zu stehen kommen.« Er stand auf und deutete auf einen Stapel Kartons hinter Delorme. »Da drinnen hab ich vielleicht noch ein altes Adressbuch von Laura.«
»Während Sie nachschauen, würden wir uns gerne Ihr Auto ansehen«, sagte Cardinal.
»Mein Auto? Das darf doch nicht wahr sein!« Dennoch nahm Rettig die Schlüssel von einem Haken in der Diele und reichte sie Cardinal.
Cardinal und Delorme gingen nach draußen, um Rettigs Toyota zu untersuchen. Es gab weder Hinweise auf einen Kampf noch darauf, dass der Wagen gerade erst gründlich gereinigt worden war. Cardinal öffnete den Kofferraum und hob die Abdeckmatte an. »Hast du bei deinem Ausflug aufs Klo was Aufschlussreiches entdeckt?«
»Mr. Rettig leidet unter Verdauungsproblemen, Durchfall, Koliken, Verstopfung, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Haarausfall, Angstzuständen und Schlaflosigkeit.«
»Du verwechselst das nicht zufällig mit meinem Medizinschrank?«
»Nein«, erwiderte Delorme. »Eindeutig nicht.«
Auf der Twickenham Road stockte der Verkehr wegen eines Wasserrohrbruchs. Cardinal spürte Delormes Blick. Sie sagte nichts, sah ihn nur an. Sie brauchten zehn Minuten bis Algonquin, und nachdem er abgebogen war, sagte er: »Also gut, in welche Richtung sind deine schrägen Gedanken unterwegs? Hätte ich ihn härter anpacken sollen?«
»Eigentlich nicht.«
»Aber du wirkst angespannt. Mehr als sonst.«
Sie lockerte ihren Sicherheitsgurt ein wenig und drehte sich auf dem Beifahrersitz zu ihm um. »Ich muss dich was fragen, und ich möchte eine ehrliche Antwort von dir. Findest du es richtig, dass Loach die Ermittlungen in diesem Fall leitet?«
»Gut, okay. Themenwechsel. Nein, das finde ich nicht, Lise. Du bist länger dabei und solltest den Vorrang haben.«
»Und weshalb hat er den Fall dann bekommen?«
»Das musst du Chouinard fragen.«
»Chouinard wird sagen, dass Loach ein äußerst erfahrener Ermittler in Mordfällen ist.«
»Was auch stimmt –«
»Und er ist nur deshalb jetzt wieder Constable, weil jeder, egal wie erfahren er ist, im Rang eines Constable anfängt.«
»Was ebenfalls stimmt. Loach war zehn Jahre lang bei der Mordkommission in Toronto. Es wäre dumm, seine Erfahrung nicht zu nutzen.«
»Dann findest du es also doch richtig, dass er die Ermittlung leitet?«
»Nein. Du bist länger dabei, ganz zu schweigen von deiner Erfahrung.«
»Aber weshalb macht Chouinard das dann?«
»Na ja, die Sache mit Toronto wird ziemlich ins Gewicht fallen. Offenbar hat Loach dort beim Montrose-Mord ganze Arbeit geleistet. Keiner hat geglaubt, dass man den Täter fassen würde, doch er hat ihn zur Strecke gebracht. Ich meine, wenn man sich für einen Job bewirbt, dann macht man das am besten sofort, nachdem man einen Fall wie Montrose aufgeklärt hat.«
»Wenn er in der Großstadt so eine heiße Nummer ist, warum kommt er dann nach Algonquin Bay und fängt hier wieder im Rang eines Detective Constable an?«
»Ich bin damals doch auch aus Toronto hergekommen, schon vergessen?«
»Aber du warst damals dreißig, oder? Loach ist fünfundvierzig.«
»Ich glaube, seine Frau stammt von hier.«
»Sie hat im Alter von zehn Jahren mal ungefähr eine Woche hier gewohnt. Wusstest du, dass er das Hockeyteam von Chouinards Sohn trainiert?«
»Chouinard lässt sich von so was nicht beeinflussen. Für ihn ist allein diese Montrose-Geschichte ausschlaggebend. Nimm’s nicht persönlich.«
»Du kennst meine Arbeit, John.«
»Allerdings, und ich finde ja auch, dass es nicht fair ist.«
»Wirklich?«
»Klar.«
»Aber du bist einer Meinung mit dem Detective Constable, dass Loach so eine Art Supercop ist? Das beste Pferd im Stall?«
»Das muss sich erst noch erweisen.«
»Um ernst genommen zu werden, muss ich also einen publikumswirksamen Fall lösen?«
»Offenbar.«
»Und ein Mann sein.«
Laura Lacroix erschien nicht zur Arbeit. Alle Mitglieder der Mordkommission verbrachten den ganzen Tag damit, Leute zu befragen, die Laura kannten. Niemand wusste, wo sie sich aufhielt.
Cardinal aß allein an seinem Küchentisch zu Abend. Danach ging er zu Delorme hinüber, und sie sahen sich gemeinsam einen Film an. So hielten sie es schon seit einem Jahr, und manchmal beschlich Cardinal das Gefühl, dass dies keine besonders gute Idee war. Andererseits stand schließlich nirgendwo geschrieben, dass es verboten war, mit einer Kollegin befreundet zu sein.
Delorme hatte Mission ausgeliehen, mit Jeremy Irons als Jesuitenpater Gabriel, der im achtzehnten Jahrhundert nach Südamerika kommt, um die Eingeborenen zu missionieren und ihre Seelen – und ihr Leben – zu retten. Als der Film zu Ende war, blieben sie noch eine Weile schweigend sitzen, während der Abspann lief.
Cardinal wandte sich Delorme zu und wollte ihr gerade sagen, dass ihm der Film gefallen habe, als er bemerkte, dass sie weinte.
Er wusste nicht, was er tun sollte. Ob er überhaupt etwas tun sollte. Ihm fiel nichts Besseres ein, als zu sagen: »Hat dich wohl ganz schön mitgenommen.«
Delorme zuckte die Achseln. Sie rutschte auf die Sofakante, hielt sich eine Hand vor die Augen und weinte noch heftiger.
»Lise …«
Cardinal ging in die Küche, um eine Schachtel mit Papiertaschentüchern zu holen, setzte sich wieder neben sie und klopfte ihr sanft mit der Schachtel aufs Knie. Ohne hinzusehen, zog sie ein paar Taschentücher heraus. Sie wischte sich die Augen trocken, putzte sich die Nase und sagte ein paar Mal kopfschüttelnd: »Himmelherrgott.«
Cardinal sagte nichts.
Schließlich stieß sie hervor: »Ich glaube nicht, dass es was mit dem Film zu tun hat.«
»Womit dann?«
»Loach. Das macht mir mehr zu schaffen, als ich gedacht hätte. Ich habe wohl mein Ego falsch eingeschätzt – bis es jetzt so verletzt wurde.« Sie nahm noch ein Taschentuch und schneuzte sich. »Und jetzt geht es mir noch schlechter, weil ich dir die Ohren vollheule.«
»Vergiss es, Lise. Wir sind in erster Linie Freunde. Und danach Kollegen.«
»Vielleicht sind es aber auch nur die Hormone.«
»Ja«, sagte Cardinal. »Das kenne ich.«
Aus dem blauen Notizheft
Bevor ich ausführlicher berichte, was aus dem Arcosaur-Projekt geworden ist, sollte ich vielleicht etwas über die Gegend sagen.
Die Driftstation Arcosaur (Arctic Ocean Synoptic Automatic Resource) befand sich auf einer Eisinsel namens T-6; das T steht für »target« oder Angriffsziel – ein begriffliches Relikt aus der Zeit des Kalten Kriegs. Wir hausten auf einem Terrain, das früher einen Teil des Ward-Hunt-Shelf-Eises bildete, bis es sich Mitte der fünfziger Jahre von Ellesmere Island löste und selbst zu einer Eisinsel wurde. Über dreitausend Jahre lang war das Gebiet mit Kanada verbunden gewesen; bis 1992 hatte die neu entstandene Eisinsel die Polkappe bereits mehrmals umkreist und trieb ziellos – doch stets im Uhrzeigersinn – im Beaufortwirbel. Als wir das erste Mal unsere Zelte auf T-6 aufschlugen, befand sich die Insel weit östlich von ihrer ursprünglichen Lage, doch die Rillen und Furchen an der Oberfläche lieferten den Beweis für ihre Herkunft: Sie verliefen alle in dieselbe Richtung – was früher einmal, als das Gebiet noch zum Festland gehörte, von Osten nach Westen gewesen war.
Unsere Eisinsel – sie war zwanzig Kilometer lang und lag vier bis acht Meter höher als das umliegende Eis – war vom Polar Research Institute ausgewählt worden, weil auf ihr Flugzeuge landen konnten. Hin und wieder wurden wir im Eismeer eingekeilt und kamen erst wieder frei, wenn die Windrichtung oder die Strömung sich änderte oder wir mit einer anderen Treibeisscholle kollidierten. Aber durch unser Funkfeuer waren wir immer leicht zu finden.
(Ein Kuriosum der Geschichte: Man geht davon aus, dass Robert Peary eine Eisinsel wie die unsere irrtümlich für eine reale Insel hielt, ihr den Namen Crocker’s Land gab und sie in die Landkarte einzeichnete. Es wird vermutet, dass Peary sich von einer arktischen Fata Morgana täuschen ließ, aber solche Luftspiegelungen sind an der Tagesordnung, und einem erfahrenen Forscher wie Peary wäre ein derartiger Fehler nicht unterlaufen. Was dem Paläontologen der Fund einer unbekannte Spezies, ist dem Polarforscher der Fund einer unbekannten Insel. Crocker’s Land war Pearys Insel. Jedenfalls kamen ein paar Jahre später fast alle Mitglieder einer Polarexpedition ums Leben, als sie bei seinen Koordinaten nichts als offenes Meer vorfanden und ihr Schiff vom Packeis zermalmt wurde.)
Drei von uns – Wyndham, Vanderbyl und ich – waren schon seit April vor Ort, zusammen mit einer Hilfsmannschaft. Die anderen stießen erst im Juli dazu. In den Vertiefungen im Eis hatten sich ausgedehnte Schmelzwasserseen gebildet – einige davon zehn Kilometer lang –, und diese stellten den Gegenstand intensiver biologischer Forschung dar. Das Wasser dieser Seen ist von einem ganz besonderen Blauton und einer Klarheit, die ich noch nirgendwo sonst gesehen hatte. Die Augen bestimmter nordischer Kinostars kommen einem dabei in den Sinn.
Wer zum ersten Mal von Arktisforschung hört, wundert sich, dass jemand diese Abgeschiedenheit ertragen kann – ganz zu schweigen von den extremen Temperaturen. Die Vorstellung, monatelang in ständiger Dunkelheit zu verbringen, erscheint ihm äußerst deprimierend. Aber in Wirklichkeit sind es die arktischen Sommer, die an die Substanz gehen, zumindest auf einer Eisinsel. Auch wenn die Temperaturen nur selten über den Gefrierpunkt ansteigen, verwandelt die vierundzwanzigstündige Sonneneinstrahlung die Oberfläche in Schneematsch von bis zu einem halben Meter Tiefe, was alle Außenaktivitäten extrem erschwert. Da Versorgungsflugzeuge nicht mehr landen können, verschlimmert sich die Isolation dramatisch. Und dann ist da noch die Sonne selbst. Dreht ein Arktisforscher durch, passiert das meist an einem Sommertag bei gleißend hellem Licht, wenn er entkräftet ist vom Schleppen der Ausrüstungsgegenstände (bei all dem Matsch werden auch die kürzesten Entfernungen zur Qual), wenn er völlig durchnässt ist (und dadurch mehr friert als im Winter) und wenn erholsamer Schlaf nur noch ein Fremdwort für ihn ist.
Doch der Sommer war noch Monate entfernt, als Rebecca eintraf. Die Oberfläche unserer Insel war noch fest; man konnte noch an Stabilität glauben. Es gab keinen Grund für mich, aus dem Gleichgewicht zu geraten, wenn sie den Raum betrat.
Als ich eines Abends nach dem Abendessen mit Wyndham zusammensaß, sagte ich zu ihm: Bevor ich sterbe, möchte ich wenigstens einmal Shackletons Whisky probieren. (Eine ganze Kiste davon hatte man unter dem Fußboden seiner Hütte entdeckt.)
Das werden die nie erlauben, sagte Wyndham. Der wird für die Nachwelt aufbewahrt.
Er hätte gewollt, dass wir davon trinken.
Dafür bist du am falschen Pol. Außerdem spielt es überhaupt keine Rolle, was Shackleton vielleicht gewollt hätte. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Schluckspecht bist, fügte er lächelnd hinzu.
Man musste Wyndham einfach mögen. Selbst in wissenschaftlichen Kreisen, wo es vor Konkurrenz nur so wimmelte – um Jobs, Fördermittel, Anerkennung – und wo so viel böses Blut floss, hörte man nie ein schlechtes Wort über Gordon Wyndham, und er selbst ließ sich auch nie abfällig über andere aus. Allein deshalb war er bemerkenswert, und noch dazu ein erstklassiger Wissenschaftler: aufgeschlossen, wenn auch kritisch, präzise, gewissenhaft, großzügig.
Über sein Familienleben wusste ich nichts aus eigener Erfahrung, aber er sprach oft von seiner Frau, die er humorvoll und erfreulich unwissenschaftlich fand, und auch über seine beiden kleinen Söhne, von denen er Geschichten zum Besten gab, als handelte es sich um Anekdoten von Forschungsreisen. Ich schlug ihm vor, eine Monographie im Stil der alten geographischen Gesellschaft zu schreiben: Bemerkungen zum merkwürdigen Verhalten von vorpubertären männlichen Jugendlichen im Ottawa Valley. Er erzählte von ihnen mit einer derart rührenden Mischung aus Liebe und Respekt, dass selbst ich, den Familienanekdoten sonst zu Tode langweilen, gebannt zuhörte, wenn er von seinen Erlebnissen mit Phil und Milo – allein schon die Namen! – berichtete.
Elf Flaschen in Stroh und Zeitungen aus dem Jahr 1907 eingewickelt, sagte ich. Die Nimrod-Expedition. Eine Whiskymarke, die schon längst nicht mehr existiert. Mackinlay’s, wenn ich mich nicht irre.
Eine Schande, dass der arme Kerl nicht mehr dazu gekommen ist, sie selbst auszutrinken.
Und dann:
Der Duft von Rebeccas Haar, als sie sich auf den Stuhl neben mir setzt. Nach Minze und Rosmarin? Thymian? Jedenfalls würzig. Sie ignoriert mich, wie schon seit ihrer Ankunft vor einer Woche. Zu allen anderen ist sie total freundlich, besonders zu Wyndham, aber mir zeigt sie die kalte Schulter.
Ich beuge mich zu ihr vor, und als sie mein Eindringen in ihre Sphäre registriert, blicke ich ihr in die Augen und sage ganz leise: Wostok.
Wostok? Sie richtet die Frage nicht an mich, sondern an Wyndham, der irgendwelche Gleichungen auf einen Zettel neben dem Teller mit den Resten seines Rühreis kritzelt. Warum nennt er mich Wostok?
Wyndham dreht seinen Bleistift um, er radiert etwas aus, stellt eine neue Berechnung an. Füllhalter sind hier oben nutzlos; die Tinte verschwimmt. Er blickt verdattert auf und sagt: Wostok? Das ist der kälteste Ort auf der Welt.
Ich dachte, das wäre Oimjakon in Sibirien.
Wostok ist der kälteste unbewohnte Ort.
Rebecca sieht mich wieder an. Sie trägt einen unförmigen irischen Wollpullover, die dunklen Locken fallen ihr über die Schultern. Der elfenbeinfarbene Rollkragen verleiht ihr etwas Nonnenhaftes.
Minus dreiundfünfzig Grad Celsius Durchschnittstemperatur, sage ich. Windchill-Faktor nicht mitgerechnet.
Im Vergleich dazu herrscht hier eine schwüle Hitze, fügt Wyndham hinzu und stochert in den Resten seines Rühreis herum, doch Rebecca hat die Kantine bereits verlassen.
2
Während der gesamten Morgenbesprechung saß Detective Sergeant Chouinard auf der Stuhlkante und klopfte mit dem Kuli auf seinen Notizblock. Einer nach dem anderen fassten die Detectives ihre Befragungen von Laura Lacroix’ Freunden, Verwandten und Mitarbeitern zusammen. McLeod und Szelagy hatten mit Leuten gesprochen, die Mark Trent kannten.
Cardinal wurde den Eindruck nicht los, dass Chouinard nur mit einem Ohr zuhörte – als gäbe es etwas, worüber er viel lieber reden würde.
»Das Einzige, was wir über Mark Trent in Erfahrung bringen konnten«, sagte Szelagy, »ist, dass er bei der Stiftung We Are One in Ottawa gearbeitet hat. Bei denen hat es vor ein paar Jahren einen Skandal gegeben, falls ihr euch erinnert. Trent wurde nicht angeklagt, aber einige Leute sind im Gefängnis gelandet. Das könnte eine Spur sein.«
»Ja, da sollten wir nachhaken«, sagte Leod. »Ich werde aus Trents Frau nicht richtig schlau. Sie ist gestern derart hysterisch geworden, dass ich nicht hätte sagen können, ob das gespielt war oder echt. Ich glaube, sie wusste, dass ihr Männe fremdging, und sie war alles andere als erfreut darüber. Sie hat kein Alibi, ich werde also an ihr dranbleiben. Jemanden zu ersticken, indem man sich auf seinen Hals stellt – das kommt mir ziemlich persönlich vor; das macht man nicht bei einem kleinen Ganoven.«
»Wiegt sie denn ausreichend dafür?«, fragte Delorme.
Loach nickte. »Die Dame ist ein Schwergewicht.«
»Eigenartige Mordmethode«, sagte Cardinal. »Von so einem Fall habe ich bisher nur einmal gehört. Er ist in einer psychiatrischen Klinik passiert.«
»Guter Gedanke.« Loach schnippte mit den Fingern. »McLeod, finden Sie heraus, ob in irgendeiner Anstalt ein Patient abgängig ist.«
»Schon passiert«, erwiderte McLeod, und fügte noch hinzu: »Eure Hoheit.«
»Und?«
»Alle Irren sicher in Verwahrung.«
»Gut. Aber den Hoheitsblödsinn können Sie sich sparen.«
»Sehr wohl, Eure Majestät.«
»Ich dachte eigentlich nicht so sehr an psychiatrische Kliniken«, sagte Cardinal, »sondern an Gefängnisse. Zu solchen Methoden greift man, wenn keine Waffen verfügbar sind. Was gegen die These sprechen könnte, dass es sich um etwas Persönliches handelt.«
Loach zuckte die Achseln. »Möglich. Aber für mich riecht das immer noch nach etwas Persönlichem. Der Täter kommt, um Trent umzubringen. Die Frau ist da, und er lässt sich die unerwartete Gelegenheit nicht entgehen. Dann hätten wir zumindest ein Motiv für ihr Verschwinden.«
»Es könnte aber auch genau andersherum gewesen sein«, entgegnete Cardinal. »Der Täter stellt Laura Lacroix nach und will sie gerade entführen, als Trent auftaucht. Er tötet Trent und verschwindet.«
»Wie auch immer, irgendjemand muss es auf einen der beiden abgesehen haben«, sagte Loach. »Es sind noch eine Menge Leute zu befragen, also arbeiten Sie Ihre Listen ab, und bitte – das gilt für alle – fragen Sie gezielt nach Stalkern und Verflossenen. Auch nach Fremden, die Fragen gestellt haben. Die Spurensicherung ist noch am Tatort. Wenn wir Glück haben, finden die ja etwas, das uns weiterbringt.«
Szelagy und McLeod standen auf.
»Moment, Moment«, bremste sie Chouinard. »Wir wollen doch nicht vergessen, dass wir noch andere Fälle zu bearbeiten haben. Szelagy, Sie kümmern sich um die Baustellendiebstähle. Da verschwindet Dynamit, das muss aufhören. McLeod, Sie bearbeiten die Sachbeschädigung in Woodward. Delorme, was ist mit dieser misshandelten Frau?«
»Sie will keine Anzeige erstatten. Weigert sich, den Namen des Typen herauszurücken. Bestreitet, dass er sie prügelt.«
»Reden Sie noch mal mit ihr.«
»Chef, sie will nicht reden. Sie wissen doch, wie diese Frauen sind.«
»Hört, hört!«, rief McLeod. »Wenn ich das gesagt hätte, würde sie mich als sexistisches Schwein beschimpfen.«
»Ganz genau. Und es wäre die Wahrheit.«
»Das reicht«, sagte Chouinard. »Und apropos misshandelte und verschwundene Frauen: Wir dürfen Marjorie Flint nicht vergessen. Die Frau des Senators ist vor zehn Tagen verschwunden, und seitdem fehlt von ihr jede Spur.« Er hielt ein Foto im Format zwanzig mal fünfundzwanzig hoch. »Das Bild kennen Sie ja alle. Als Mrs. Flint zuletzt gesehen wurde, trug sie einen schwarzen Kaschmirmantel, ein Hermès-Halstuch und hockhackige Stiefel.«
»Hat sie irgendeinen Bezug zu Algonquin Bay?«, wollte Loach wissen.
»Nein. Aber sie ist die Frau eines Senators. Die Suche läuft daher landesweit. Haltet die Augen offen, Leute.«
Lise Delorme, frustriert, dass man ihr Loach vor die Nase gesetzt hatte, war mehr denn je davon überzeugt, dass sie unbedingt eine Kollegin in der Mordkommission brauchte. Da sie die einzige Frau war, wurden ihr automatisch alle Fälle von sexueller Belästigung und Gewalt gegen Frauen zugeschanzt, und sie hatte die Nase gründlich voll davon.
Als sie die Stelle angetreten hatte, da hatte sie sich mit Begeisterung zur Fürsprecherin misshandelter Frauen gemacht, und im Lauf der Jahre war es ihr zu ihrer Genugtuung auch gelungen, mehrere gewalttätige Ehemänner und mindestens drei Vergewaltiger hinter Schloss und Riegel zu bringen. Aber es gab zwei Dinge, die Delorme immer wieder schockierten: Erstens die Anzahl der Frauen (meist sehr junge), die logen; es hatten gar keine Übergriffe stattgefunden, sie waren einfach nur wütend gewesen und wollten sich rächen. Das Traurige an der Sache war, dass dadurch die Glaubwürdigkeit tatsächlicher Opfer von Gewalttaten unterminiert wurde.
Der zweite Schock war gewesen, wie viele misshandelte Frauen keine Anzeige erstatteten, sondern im Gegenteil zu ihren Peinigern zurückkehrten und bei ihnen wohnen blieben in der Hoffnung, die Männer würden sich ändern. Delorme kannte dieses Syndrom, aber es war ihr unbegreiflich, wie es selbst Frauen im Griff hatte, die eigentlich aufgeklärt wirkten.
Miranda Heap war fünfundvierzig, sah gut aus und leitete ein Dienstleistungsunternehmen für Firmen. Sie konnte sich in einer Nische behaupten, die für größere Betriebe nicht lukrativ genug war. Sie arbeitete überwiegend von zu Hause aus – wo Delorme sie auch antraf.
»Ihr Gesicht macht sich schon viel besser«, sagte Delorme.
»Ja, ich sehe nicht mehr aus wie ein Waschbär. Erstaunlich, was ein bisschen Make-up bewirkt. Möchten Sie einen Kaffee? Ich brauche sowieso eine Pause.«
»Nein danke. Ich komme nur auf einen Sprung vorbei, um zu sehen, wie es Ihnen geht.«
»Alles okay. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen überreagiert.«
»Nein, das haben Sie nicht. Er hat Sie verletzt. Sie sollten mir seinen Namen nennen, damit wir ihn gerichtlich belangen können.«
»Er wollte mir nicht weh tun. Er ist einfach ein leidenschaftlicher Typ, das ist alles. Das macht ihn ja auch anziehend, oder? Sehr sogar. Sie können das nicht verstehen, weil Sie ihn nicht kennen.«
»Geben Sie mir seinen Namen und seine Adresse, und ich gehe sofort hin, um ihn kennenzulernen.«
Miranda lachte. »Sie würden sich wahrscheinlich prächtig verstehen. So leidenschaftlich, wie Sie sind.«
»Leidenschaftlich ist nicht dasselbe wie gewalttätig. Wollen Sie sich weiter von ihm verprügeln lassen, nur weil er gut im Bett ist?«
»Sie kennen nur seine schlimmste Seite. Er verabscheut diese Seite an sich. Hinterher schämt er sich immer fürchterlich. Dann wartet er ab, bis ich aus dem Haus bin, und hinterlässt mir unglaublich lange, herzergreifende Nachrichten auf dem AB. Wirklich. Seine Entschuldigungen sind wahre Meisterwerke.«
»Er hat bestimmt jede Menge Übung darin.«
»Wenn man ihn kennenlernt, würde man nie auf die Idee kommen, dass er in diesem Ausmaß die Kontrolle über sich verlieren könnte. Er ist so intelligent, so großzügig – in vielerlei Hinsicht ein wunderbarer Mann.«
»Als würde das etwas ändern. Haben Sie Kontakt zu der Therapeutin aufgenommen, die ich Ihnen empfohlen habe?«
»Na klar, längst. Und sie ist wirklich großartig. Ich gehe zweimal die Woche zu ihr. Sie tut mir gut, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Wirklich.«
»So sind wir Frauen«, sagte Delorme, als sie Cardinal im Café traf, »wir verfügen über ein unerschöpfliches Potential, uns selbst zu betrügen. Nur das zu sehen, was wir sehen wollen – und sonst nichts; und zwar vor allem, wenn es um Männer geht. Ich bin auch nicht anders.«
»Das stimmt nicht.« Er hätte noch mehr zu diesem Thema zu sagen gehabt, aber er bemerkte, dass sie nicht in Stimmung dazu war. »Hör mal, bei meinen Befragungen ist ein sehr interessanter Name aufgetaucht.«
»Und welcher?«
»Wolltest du dir nicht einen Kaffee bestellen?«
»Die Schlange ist zu lang. Erzähl es mir unterwegs.«
Sie gingen nach draußen und stiegen in den Wagen. Cardinal fuhr Richtung Airport Hill. »Mir ist es endlich gelungen, mich mit Laura Lacroix’ bester Freundin zu unterhalten – Mia Neff. Sie hat nichts von ihr gehört. Und sie hat auch keine Ahnung, wo Laura stecken könnte. Sie macht sich von allen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die größten Sorgen. Sie sagt, das passe überhaupt nicht zu Laura – also nicht die Affäre, sondern ihr Verschwinden natürlich. Über die Scheidung und das Techtelmechtel mit Trent war Miss Neff übrigens im Bilde. Sieht ganz danach aus, als wäre die Affäre kein Einzelfall.«
»Ach?«
»Anscheinend hatte die ehemalige Mrs. Rettig schon einen anderen Liebhaber, bevor sie sich mit Mark Trent eingelassen hat.«
»Und das ist der, den wir jetzt aufsuchen?«
»Ja, Leonard Priest.«
»Ich werd verrückt«, sagte Delorme. »Ist das dein Ernst?«
»Ich sehe keinen Grund, an den Worten der Frau zu zweifeln. Es ist allgemein bekannt, dass sie und Laura eng befreundet sind. Sie hat mir erklärt, dass niemand außer ihr von der Geschichte wusste.«
»Leonard Priest«, murmelte Delorme. »Ist ja ein Ding. Das macht die Sache ja richtig interessant. Wie gern würde ich das Schwein einlochen.«
»Und ich erst. Ich war mir ganz sicher, dass ich ihn beim Choquette-Mord am Wickel hatte.«
Régine Choquette war in einem Bootshaus am Trout Lake ermordet worden. Man fand sie an einen Deckenbalken angekettet, nackt bis auf eine Lederkapuze mit Reißverschluss, die ihr Gesicht bedeckte. Die Spuren am Tatort legten den Verdacht nahe, dass ein mit Sadomasochismus angeheizter Abend außer Kontrolle geraten war und damit geendet hatte, dass sie durch einen Schuss in den Kopf aus einer Luger der Nazi-Zeit getötet wurde.
»Ich habe nie begriffen, warum der Staatsanwalt ihn nicht angeklagt hat. Das war doch Garth Romney, oder?«
»Der Stellvertretende Staatsanwalt. Ja, es war Romney.«
»Ich erinnere mich noch an dieses Foto von ihm, wie er so eine Ledermaske hochhält. Der edle Ritter im Kampf gegen die Mächte des Bösen.«
»Sprich mich lieber nicht auf das Thema an. Guck mal in den Umschlag auf dem Rücksitz.«
Delorme löste ihren Sicherheitsgurt, um nach hinten zu greifen. Sie öffnete den Umschlag und nahm zwei Fotos im Format zwanzig mal fünfundzwanzig heraus.
»Fällt dir irgendeine Ähnlichkeit auf?«
»Beide haben langes blondes, gewelltes Haar. Beide haben braune Augen, schön geschwungene Augenbrauen und hohe Wangenknochen. Beide könnten denselben Typen anziehen.«
»Und beide sind zierlich gebaut. Régine war eins fünfundfünfzig, Laura Lacroix ist eins sechzig.«
»Aber ich dachte, Priest hätte sein Haus da oben verkauft – nach all dem Ärger.«
»Nein. Und offenbar war er an diesem Wochenende in der Stadt. Miss Neff hat ihn am Freitagabend im Quiet Pint gesehen.«
»Leonard Priest«, sagte Delorme noch einmal. »Der Hammer.«
Sie fuhren die Airport Road entlang, dann weiter durch ein paar kleinere Straßen, bis sie eine Sackgasse namens Crosier Place erreichten. Hier stand nur ein einzelnes Haus, ein hohes Fachwerkgebäude, das, wie Delorme fand, eher in die Schweiz gepasst hätte. In der Einfahrt parkte ein auf Hochglanz polierter Jaguar X.
Cardinal hielt hinter dem Jaguar und schaltete den Motor ab. Normalerweise einigten sie sich im Wagen darauf, wer von ihnen die Befragung durchführen würde, doch Delorme stieg ohne ein Wort aus, marschierte zur Haustür und drückte den Klingelknopf.
Cardinal gesellte sich zu ihr. »Hast du’s eilig?«
»Du etwa nicht?«
Die Tür wurde geöffnet, und Leonard Priest stand da, ein Handy am Ohr und sichtlich genervt. Er klappte das Handy zu und ließ es in seine Tasche gleiten. »Ja?«
Delorme machte Anstalten, sich vorzustellen, doch Priest erkannte sie beide, bevor sie den Mund aufmachen konnte.
»Nein danke«, sagte er. »Ich brauche nichts.«
Delorme plazierte einen Fuß in der Tür, als Priest sie zuknallen wollte. »Wir wollen Ihnen nur ein paar Fragen stellen.«
»Kein Interesse. Nehmen Sie Ihren Fuß da weg, es wird kalt im Haus.«
»Über Laura Lacroix.«
»Immer noch kein Interesse. Und jetzt tun Sie mir den Gefallen, und verpissen Sie sich.« Selbst zwölf Jahre in Kanada hatten nicht ausgereicht, um seinen Londoner Akzent weicher zu machen. Ganz zu schweigen von seinem Rockstargehabe.
»Mr. Priest, es handelt sich nur um ein paar Fragen. Eine Frau wird vermisst, sie ist unter gewaltsamen Umständen verschwunden, und wir müssen jeden befragen, der sie kennt. Weshalb regen Sie sich denn so auf?«
Diesmal wandte sich Priest an Cardinal. »Sie wollten mich ins Gefängnis bringen. Und jetzt kommen Sie her und erwarten von mir, dass ich mich freue, Sie zu sehen?«
»Nein, ich hatte schon damit gerechnet, dass Sie sich wie ein Arschloch benehmen«, erwiderte Cardinal. »Und Sie enttäuschen mich nicht.«
Priest zog sein Handy wieder hervor und drückte auf einen Knopf. »Kurzwahl für meinen Anwalt.«
»Wow«, sagte Delorme. »Darauf können Sie sich mächtig was einbilden.«
»Bei der dürftigen Beweislage kriegen wir niemals eine Vorladung«, sagte Cardinal, als sie wieder im Auto saßen. »Wir haben nichts weiter als die vage Aussage einer Frau, dass Priest mal was mit Laura Lacroix hatte.«
»Ich weiß. Und er weiß es auch. Aber ich muss zugeben, dass er einen charmanten Akzent hat.«
»Du weißt aber doch, dass er ursprünglich hier aus der Gegend stammt? Er ist erst als Kind mit seinen Eltern nach England gezogen. Als seine Band sich aufgelöst hat, ist er wieder zurückgekommen. Schon komisch, wer so alles zurückkehrt. Bei einem Typen wie ihm würde man eher annehmen, er würde in London bleiben oder nach Los Angeles gehen oder sonst wohin.«
Cardinal wendete und fuhr den Hügel hinunter. Am Highway musste er an einer Ampel halten. Während der ziemlich langen Rotphase schwiegen beide. Schließlich sprang die Ampel auf Grün, und sie fuhren in die Algonquin Road.
»Ich glaube mich zu erinnern, dass Priest damals während des Prozesses versucht hat, mit dir anzubändeln«, bemerkte Cardinal.
»Mehr als einmal.«
»Ja, ich denke, du könntest sein Typ sein. Du hast dieselbe Haarfarbe, dieselbe Augenfarbe und auch so ungefähr die gleiche Größe wie Régine Choquette und Laura Lacroix. Du bist auch etwa genauso alt. Und denk mal an ihre Nachnamen.«
»Choquette. Lacroix. Bon, donc, nous sommes toutes les trois Canadiennes-françaises. Trois sœurs. Sehen jetzt schon alle Frankokanadierinnen gleich aus?«
»Nein, aber ihr drei seht alle aus wie Frankokanadierinnen.«
»Meinst du, ich sollte mich an ihn ranmachen? Abendessen und Kino und ein verstecktes Mikro am Körper?«
»Nein, bloß nicht. Das Mikro würde er viel zu schnell finden.«
»Sehr witzig.«
Aus dem blauen Notizheft
Es hat etwas Lächerliches, in der Arktis Schnee zu schippen. Wyndham hatte über seinem Schreibtisch ein Foto hängen, auf dem er und ich genau das taten. Wir waren Tag und Nacht da draußen zugange, zusammen mit einem oder zwei anderen Forschern, manchmal mit Schaufeln, manchmal auf den Knien, wenn wir mit Werkzeug kleiner als Küchenspachteln herumstocherten.
Die Schneedecke auf T-6 maß im Durchschnitt etwa einen Meter. Und doch ist die Polareiskappe eine Wüste. In den meisten Gebieten fallen nicht mehr als zweihundert Millimeter Niederschlag pro Jahr, aber was herunterkommt, bleibt liegen. Schneestürme sind meist bloß aufgewirbelter Schnee und kein tatsächlicher Schneefall, auf einer Flugzeugpiste können sie jedoch ein fürchterliches Chaos verursachen. Unsere Hütten und die Ausrüstung in Ordnung zu halten, war Aufgabe des erfahrenen Arktishelfers Murray Washburn; unsere Landepiste in Schuss zu halten, lag hingegen in der Verantwortung von Hunter Oklaga, einem Inuk und ehemaligen Army Ranger; er war wahrscheinlich der einzige Mensch – jedenfalls der Einzige von uns –, der sowohl über der Antarktis als auch über der Arktis mit dem Fallschirm abgesprungen war. Heldentaten, die keiner von uns hätte nachahmen wollen. Wenn einer sich über das Klima beklagte, sagte er immer: »Mann, du hast ja keine Ahnung. Du solltest mal nach Laurie Island fahren. In die Antarktis. Dort ist es richtig kalt. Dagegen ist das hier Miami.«
Wir waren nicht einmal 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt.
»Hunter« war die Übersetzung eines neunsilbigen Worts, das kein englischsprachiger Mensch behalten konnte, geschweige denn aussprechen. Hunter erklärte mir, dass es so viel hieß wie »Jäger mit beeindruckendem Penis«, aber für die englische Version seines Namens begnüge er sich mit dem ersten Teil. Er war ein gutgelaunter, gesprächiger Typ, der mir ständig Fotos von Expeditionen in die Antarktis und zu anderen Orten zeigte, an denen er teilgenommen hatte. Vermutlich tat er das, weil er wusste, dass ich früher Buschpilot war, und er irrtümlich annahm, ich sei aus dem gleichen groben Holz geschnitzt wie er. Die Fotos waren alle an sonnigen Tagen aufgenommen.
Von Arcosaur existieren nicht viele Fotos, und die meisten, die ich kenne, wirken wie Schwarzweißfotos. Was jedoch täuscht: Sie spiegeln einfach nur die tatsächlichen Lichtverhältnisse wider; meist war der Himmel wolkenverhangen. Das größte Objekt auf allen Fotos ist der achtzehn Meter hohe Funkmast voller Messinstrumente. Mit der Zeit gewöhnt man sich an die Rauhheit einer Eisstation. Nur anhand der Fotos erinnere ich mich heute noch daran. Leere Ölfässer. Wir unternahmen keine Anstrengungen, sie einzusammeln. Sie wurden vom Sturm umhergeweht wie Steppenhexen, bis sie schließlich irgendwo liegen blieben, einige aufrecht, andere längs, und sich auf ihnen eine Schneeschicht bildete.
Mit Hilfe von Brettern, die wir auf mit Meerwasser gefüllte alte Ölfässer legten, errichteten wir Stege zwischen dem Funkturm, dem Labor und den Schlafquartieren. Selbst diese Stege mussten wir manchmal von hohen Schneewehen befreien. Ich erinnere mich an ein Foto von Rebecca – es muss ein warmer Tag gewesen sein: Sie sitzt auf dem Steg, von der Kamera halb abgewandt, im Hintergrund der Funkmast wie ein hässlicher Eiffelturm. Sie isst einen Apfel. Ihre rote Daunenweste ist der einzige Farbfleck auf dem Foto. Ihr dunkles Haar weht in einer leichten Brise.
Auf einem anderen Foto posiert Ray Deville struppig und unrasiert vor einer AARI-Boje. Er kniet im Schnee, die Arme ausgebreitet wie ein Broadwaystar, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Neben der Boje steht ein Nansen-Schlitten, beladen mit Kisten voll Dynamit, die für eine Reihe reflexionsseismischer Experimente bestimmt waren. Ich kann mich nicht erinnern, Ray außer auf diesem Foto einmal lächeln gesehen zu haben.
Auf einem Foto im Internet sieht man das Versorgungsflugzeug landen. Der Himmel oben blassgrau, zum Horizont hin dunkelgrau. Schnee und Eis gehen brockig grau in grau, im Vordergrund fast weiß. Das weißeste Objekt ist eine Wolke am nordöstlichen Horizont. Es ist natürlich keine Wolke, sondern ein Sturm. In der Mitte des Fotos posiert Wyndham mit einer Schrotflinte Kaliber zwölf. Wir hatten damals eine Menge Ärger mit Bären.
Rebecca. Wie sie im bleichen Licht sitzt, das durch eines der Bullaugenfenster hereinfällt. Es ist kein Foto – ich habe nie Fotos gemacht und die Begeisterung von Hobbyfotografen auch nie verstanden; aber das Bild habe ich so deutlich in Erinnerung wie ein Porträt aus einem Fotostudio: Rebecca in Jeans und diesem elfenbeinfarbenen Rollkragenpullover, vertieft in einen Gedichtband, während ich über Berechnungen in meinem Notizheft brüte. Ich bin zunehmend beunruhigt über einige Ergebnisse und versuche, wenn auch in diesem Augenblick nicht sonderlich konzentriert, die Fehler zu finden.
Ich kenne niemanden, der Gedichte liest, sage ich.
Sie reagiert nicht. Das Brummen des Generators bleibt das einzige Geräusch. Wir stehen noch am Anfang einer neuerlichen Sechs-Wochen-Rotation, und jeder hält sich an einem anderen Ort auf. Einer sieht sich vielleicht gerade die Aufzeichnung eines Baseballspiels an, das vor Wochen stattgefunden hat. Andere arbeiten womöglich. Die Menschen verfallen in merkwürdige Verhaltensmuster, wenn es keine Nacht gibt. Am ersten Tag empfindet man noch ein gewisses Hochgefühl, weil man plötzlich der Dunkelheit entgeht. Viele bleiben auf, bis sie vor Müdigkeit ins Bett und in einen unruhigen Schlaf sinken. Wissenschaftler kennen keinen geregelten Tagesablauf.
Ich lege mein Notizheft weg, stelle mich vor sie und fasse mit einer Hand in ihre gewaltige Lockenpracht. Ich spüre die Wärme ihres Gesichts an meinem Handgelenk. Sie rührt sich nicht. Blickt nicht auf.
Nimmst du dir immer einfach, was du willst?
In diesem Fall kann ich das gar nicht. Es wäre dein Herz.
Das ist schon vergeben.
Sieht aber nicht danach aus.
Vieles ist komplizierter, als es scheint.
Sie hat einen Finger unter die nächste Seite geschoben, bereit, sie umzuschlagen. Das Papier zittert. Ein Teil eines Gedichts ist am Rand mit Bleistiftstrichen markiert: Let me break/ Let me make/Something ragged, something raw/Something difficult to take.
Ich nehme meine Hand aus ihren Haaren und beuge mich zu ihr hinunter. So nahe, dass ich ihr Haar rieche, ihre Haut, den schwachen Zedernduft ihres Pullovers. Ich weiß, dass sie meinen Atem an ihrem Ohr spürt, als ich ein Wort flüstere.
Wostok.
3
Der Stellvertretende Staatsanwalt Garth Romney nahm einen Stapel Akten aus einem Schrank und legte sie in einen Karton, der geöffnet auf seinem Stuhl stand. Nach achtjähriger Tätigkeit als Staatsanwalt war er an den Obersten Gerichtshof berufen worden. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, all diese Fälle jemand anderem zu übergeben. Noch zwei Wochen, dann mache ich einen Monat Urlaub in der Toskana«, sagte er, »und wenn wir uns das nächste Mal sehen, sitze ich auf der Richterbank, und zwar braungebrannt.«
Cardinal erklärte ihm, weshalb sie da waren.
»Keine Chance für eine Vorladung. Die Tatsache, dass einer vor einem Jahr mit einer Frau, die jetzt vermisst wird, ein Techtelmechtel hatte, macht ihn nicht zum Verdächtigen – auch nicht, wenn er Leonard Priest heißt.«
»Die vermisste Frau sieht Régine Choquette sehr ähnlich.«
»Ah ja. Régine Choquette.« Romney stellte den Karton voller Akten auf den Boden und nahm an seinem Schreibtisch Platz. Er öffnete einen Ordner, um ihn rasch wieder zuzuklappen. »Der Mord an Régine Choquette hat mir schwer zu schaffen gemacht. Ich hätte Leonard Priest liebend gern dafür hinter Gitter gebracht – wenn wir genügend Beweise gehabt hätten.«
»Meiner Meinung nach hatten wir die.«
»Das weiß ich. Aber schließlich steckt ja nicht Ihr Hals in der Schlinge, wenn der Richter zu dem Schluss kommt, dass der Staatsanwalt eine haltlose Anklage erhebt.«
»Wir hatten einen Augenzeugen, der Priest am Tatort gesehen hat. Er hat Priest und Reicher den Weg zum Bootshaus herunterkommen sehen, als er von dort wegging.«
»Sie meinen Thomas Waite. Aber Thomas Waite hat Régine Choquette nicht gesehen. Er hat behauptet, Leonard Priest und Fritz Reicher gesehen zu haben. Und danach wurde seine Erinnerung merkwürdig neblig.«
»Ja, weil Leonard Priest Reicher ein paar Wochen vorher dazu angestiftet hatte, sich als Nazi zu verkleiden und Waite zu fesseln und halb totzuprügeln. Priests Vorstellung von Vorspiel. Waite war davon überzeugt, dass er das nicht überlebt hätte, wäre ihm nicht die Flucht gelungen.«
»Früherer Sachverhalt. Nicht verfahrensrelevant, es sei denn, die Verteidigung hätte diese Angelegenheit vorgebracht, aber dazu waren Priests Anwälte viel zu clever. Abgesehen davon hatte Waite den Vorfall damals nicht zur Anzeige gebracht.«
»Das ist bei Opfern von Sexualdelikten nicht ungewöhnlich«, bemerkte Delorme.
»Hören Sie, der Mann hat es sich anders überlegt, und daran kann ich nichts ändern. Aber das ist jetzt ohnehin irrelevant, weil er nämlich tot ist.«
»Wie bitte? Seit wann?«, fragte Cardinal.
»Ich weiß nicht genau, vielleicht seit einem halben Jahr. Offenbar ein Hirnschlag.«
»Aber da war doch auch noch Fritz Reicher«, sagte Delorme. »Bei der Vernehmung hat er ausgesagt, dass das Ganze Priests Idee war. Priest hätte ihm befohlen zu schießen.«
»Sie werden kaum erleben, dass ein Gericht einen Angeklagten verurteilt, wenn der einzige Beweis auf der Aussage eines Komplizen beruht – erst recht nicht, wenn es sich um einen Mordkomplizen handelt. Und das gilt für Fälle, in denen der Zeuge unter Eid ausgesagt hat. Aber Fritz Reicher stand nicht unter Eid, und Sie vergessen anscheinend, dass er seine Aussage später widerrufen und nie wieder gegen Priest den Mund aufgemacht hat.«
»Wir hatten Priests Fingerabdrücke am Tatort«, entgegnete Cardinal. »Das allein –«
»Die stammten von einer früheren Gelegenheit«, fiel ihm Romney ins Wort. »Priest hat nie geleugnet, dort gewesen zu sein. Und auch nicht, an diesem grässlichen Ort Sex gehabt zu haben. Er hat nur geleugnet, sich in der fraglichen Nacht dort aufgehalten zu haben.«
»Wir hätten Reicher dazu kriegen können umzuschwenken«, sagte Delorme. »Ihn dazu bringen können, dass er seine ursprüngliche Aussage wiederholt. Sie hätten ihm einen besseren Deal anbieten sollen.«
Romney lachte. »Sind Sie Reicher mal begegnet?«
»Nur einmal bei Gericht, als er eine eidesstattliche Aussage gemacht hat.«
»Fritz Reicher war – abgesehen von seinem bemerkenswert niedrigen IQ – ein notorischer Phantast, um es freundlich auszudrücken. Was er über seine Herkunft erzählt hat und seine tollen Ideen für die Zukunft – alles komplett an den Haaren herbeigezogen. Er wäre der allerschlechteste Zeuge gewesen, den man sich nur vorstellen kann. Er hatte das Gemüt eines Zombies und einen Akzent, als käme er direkt aus einem Berliner Bunker.«
»Die Luger wurde in einem von Priests Sexclubs gefunden«, wandte Cardinal ein.
»Ein Club, in dem Reicher angestellt war. Er hatte rund um die Uhr Zutritt zu diesem Club in Ottawa. Und auf der Waffe befanden sich Reichers Fingerabdrücke, nicht die von Priest. Ich bitte Sie. Ich schätze Sie beide als erstklassige Ermittler, aber der Fall war vor zwei Jahren schon schwach, und jetzt ist er noch viel schwächer.« Romney stand auf und stellte den Karton mit den Akten wieder auf seinen Stuhl. »Ich verstehe, offen gesagt, nicht einmal, weshalb Sie eigentlich hier sind.«
»Weil Sie und ich gemeinsam eine Menge Fälle vor Gericht gebracht haben«, sagte Cardinal, »und wir gewöhnlich einer Meinung waren. Es passte überhaupt nicht zu Ihnen, Priest laufenzulassen.«
Romney wuchtete einen weiteren Stapel Akten in den Karton. »Er ist wegen der Charta der Rechte und Freiheiten freigekommen. Er ist aufgrund der Fakten freigekommen. Meinen Sie ernsthaft, ich würde nicht auf einer Anklage beharren, wenn ich davon überzeugt wäre, einen Fall zu haben? Glauben Sie vielleicht, der Mann hätte mich bestochen oder was?«
»Zu dem Schluss könnte ich gelangen«, erwiderte Cardinal, »wenn Sie jemand anders wären. Aber Sie genießen es viel zu sehr zu gewinnen.«
»Genau, und von nun an werde ich das Richterdasein genießen.«
Delorme stand seit mehr als einer halben Stunde vor dem Spiegel ihres Kleiderschranks und ging systematisch ihre Arbeitsgarderobe durch. Sie entschied sich für eines der gediegeneren Stücke. Ein graues Kostüm und eine weiße Bluse mit offenem Kragen – das vermutlich unerotischste Outfit, das sie besaß. Sie hatte es schon öfter bei Gericht getragen.
Sie betrachtete die Wirkung im Spiegel.