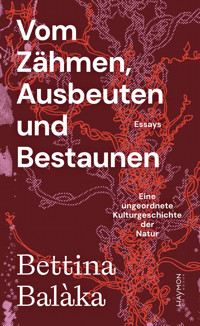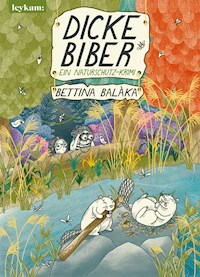Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
EINE TRAGIKOMÖDIE ÜBER DEN SCHMALEN GRAT ZWISCHEN LEIDENSCHAFTLICHER LIEBE UND STALKING VOR DER TRAUMHAFTEN KULISSE VON VENEDIG Judit Kalman und Markus Bachgraben sind ein Traumpaar - zumindest wenn es nach ihr geht. Mit ihm, dem jungen Erfolgsautor, will sie noch einmal ganz von vorne beginnen. Gefolgt von ihrer Freundin Erika, die endlich Judits neuen Freund kennenlernen will, reist sie zu Bachgraben nach Venedig, wo er an seinem neuen Roman arbeitet. Das Paar verbringt einen romantischen Abend, der ein unerwartetes Ende findet - und nicht nur Judit muss sich die Frage stellen: Welches Spiel wird hier gespielt - und wer bestimmt seine Regeln? MITREISSEND GEFÜHLVOLL UND MIT VIEL WITZ In ihrem neuen Roman erzählt Bettina Balàka von der Tragikomödie zwischenmenschlicher Beziehungen, vom Wunsch, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, und vom langen Schatten der Familiengeschichte, dem man nicht so leicht entkommt - doppelbödig, überraschend und mit einer gehörigen Portion Witz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Bettina Balàka
Kassiopeia
Roman
Zitate
Wie der Mensch doch selber arbeitet, daß das vor ihm Gewesene versinke, und wie er wieder mit seltsamer Liebe am Versinkenden hängt, das nichts anderes ist, als der Wegwurf vergangener Jahre.
Adalbert Stifter, „Die Mappe meines Urgroßvaters“
„Meanwhile aren’t we in Venice together, and what better place is there for the meeting of dear friends? See how it glows with the advancing summer; how the sky and the sea and the rosy air and the marble of the palaces all shimmer and melt together.“ My eccentric private errand became a part of the general romance and the general glory – I felt even a mystic companionship, a moral fraternity with all those who in the past had been in the service of art.
Henry James, „The Aspern Papers“
Widmung
für meine Tochter Pia
EINS
Als Judit Kalman in Venedig ankam, überraschte sie außergewöhnliches Wetter. Es regnete, und das mitten im Juli. Der Zug fuhr auf den Damm auf und sie konnte sehen, wie Wolken verschiedener Dunkelheitsstufen auf das entfärbte, von nervösen Winden aufgerührte Meer ihre Schatten warfen.
Sie hatte den Zug genommen, der zu Mittag ankam, und daher mit Sonnenhöchststand, einem entblößten, der weißen Dürre hingegebenen Firmament und stechender Hitze gerechnet. Nun war es zwar heiß, aber auf jene schwüle, tropische Art, die einen die Gerüchte glauben ließ, irgendwo im Po-Delta würden Flamingos leben. Eine Möwe, die neben dem Zug herflog, wurde von nassen Windböen durch die Luftschichten gedrückt. Es sah aus, als würde sie – schief und zerzaust – als Teil eines Mobiles an einem Faden hängen.
Judit stellte sich darauf ein, im Bahnhofsgebäude abzuwarten, ihre hellgrüne Lederhandtasche vertrug keinen Regen, die Bluse aus weißer Knitterseide höchstwahrscheinlich auch nicht. Schwarz vor Nässe saßen die vertrauten Holzpfähle in der Lagune. Jeweils drei aneinandergelehnt, von zwei Eisenbändern zusammengehalten, von denen orangefarbene Rostschlieren herabrannen. Normalerweise konnte man an der Wasserlinie sehen, wie das Salz-Luft-Gemisch die Pfähle biberartig abgenagt hatte und leuchtend grüner Tang nach oben kroch, aber jetzt lag alles verschwommen und silbrig im Dunst.
Wie man überhaupt im Juli nach Venedig fahren kann, ist mir unbegreiflich, und wenn ich einmal das Sagen haben werde, wird das auch nicht mehr vorkommen.
Als Judit aus dem Bahnhofsgebäude trat, war der Spuk vorbei. Letzte Wolken wurden weiß und korallenförmig, bevor sie davonliefen. Die Sonne begann Stufen und Vorplatz bereits aufzutrocknen. Die Kirche San Simeon Piccolo an der gegenüberliegenden Seite des Canal Grande war eingerüstet, was Judit den ersten Anblick verdarb. Die weißen Stufen, die weißen Säulen, das dreieckige Fries, darauf freute man sich, wenn man aus dem Bahnhofsgebäude trat und den ersten Blick in das Innere der Stadt warf, deren Schale man eben mit dem Zug durchbohrt hatte.
Vor dem Actv-Häuschen am Canal stand eine Touristenschlange, die schnell länger wurde. Judit beeilte sich, ihren Koffer die Stufen hinunterzuziehen und sich anzuschließen. Vor jedem Verkauf einer Vaporettofahrkarte führte die Actv-Bedienstete ausführlich Rücksprache mit einer Kollegin, die hinter ihr stand. Offenbar fand hier eine Einschulung statt. Mitten in der Hochsaison, zur heißesten Tageszeit, ausgerechnet am Bahnhof. Die ersten, die zu schimpfen begannen, waren die Italiener, die in der Schlange standen. Die Ausländer waren noch gewillt, die Wartezeit landesüblicher Gelassenheit zuzuschreiben und sich die Urlaubsstimmung nicht verderben zu lassen. Judit dagegen war zu gar nichts gewillt. Jeden Moment würde sie aus der Reihe treten und ein Wassertaxi nehmen. In die Ruhe eines leeren Bootes entkommen, in die Kühle, die von seinen blankgefirnissten Holzverkleidungen ausging. Aus dem offenen Dachfenster schauen, die Ellbogen auf dem Dach aufgestützt. Das Gesicht in den Fahrtwind halten, die Komplimente des Fahrers aufschnappen, wenn er sich lächelnd umwandte.
Die vom Regen blankgewaschene Sonne brannte, Engländer, Franzosen, Holländer, Deutsche wollten eine Vaporettofahrkarte kaufen, und natürlich ließ sich kein venezianisches Management davon abhalten, in dieser Situation in aller Ruhe eine Einschulung vorzunehmen.
Markus Bachgraben, wie kann man nur im Juli nach Venedig fahren.
Titas Wohnung lag direkt an den Fondamenta Nuove und war ganz anders, als Judit sie sich vorgestellt hatte. Schon die Fondamenta Nuove waren ganz anders, als sie zu sein pflegten, denn man hatte aus ihnen eine Baustelle gemacht. Was hier aufgerissen, umzäunt, zerbrochen und verwüstet werden musste, war nicht zu erkennen.
Titas Wohnung, von der Judit wusste, dass sie aus zwei zusammengelegten Wohnungen bestand, hatte sie sich weitläufig und großzügig vorgestellt, stattdessen war sie unübersichtlich und verwinkelt. Viel zu viele kleine Zimmer verschachtelten sich auf zwei Geschoßen, dem zweiten und dritten Stock des Hauses. Judit riss Türen und Fensterläden auf. Manche Räume gingen auf winzige Innenhöfe hinaus, die nicht mehr als Lichtschächte waren, manche auf enge Gassen, manche auf die Baustelle der Fondamenta und die Lagune. Der Postkartenblick auf die Friedhofsinsel mit ihren schwarz gezackten Zypressen hielt sie fest wie etwas Regloses, das plötzlich pulsierte. Tita sagte, dass einer Legende zufolge nachts Hexen mit ihren schwarzverschleierten Gondeln über die Mauer flogen, um auf den Gräbern Feste zu feiern, sie habe aber noch nie welche gesehen.
Judit ging nach unten, um sich das Haus von außen anzusehen. An einer Seite wurde es von einem Kanal begrenzt, über dem alle Fenster zugemauert waren. Tita hatte vor, die Fenster ihrer Wohnung wieder aufbrechen zu lassen, die seit der Zeit der österreichischen Herrschaft verbaut waren. Man habe damals versucht, sagte Tita, die Arbeit der Umstürzler zu behindern, indem man sie von den Kanälen abschnitt. So konnten sie keine schweren oder unappetitlichen Gegenstände auf vorbeifahrende Boote der Österreicher fallen lassen.
In dem Eisladen zwei Häuser weiter kaufte Judit eine Tüte mit einer Kugel Kokoseis. Auf einem Stehtischchen breitete sie den Stadtplan aus. Hinter den Bauzäunen wurde gebohrt, gehämmert und gestaubt. Sie musste zur Rialtobrücke gehen, um über den Canal Grande nach San Polo zu gelangen, wo Markus Bachgrabens Wohnung lag. Beim Campo Santa Sofia konnte sie auch mit dem Traghetto übersetzen, aber das fuhr nur vormittags. Wenn sie nicht laufen wollte, würde sie große Runden mit dem Vaporetto fahren oder sich ein Wassertaxi nehmen müssen. Es wäre praktischer gewesen, in einem der Hotels direkt am Canal Grande zu wohnen. Da Judit aber Tita seit Jahren ihr Haus in Irland zur Verfügung stellte, hatte Tita darauf bestanden, ihr nun ihre neue Wohnung in Venedig zur Verfügung zu stellen.
Ein Motorboot fuhr vorüber, an dessen Bug ein schneeweißer West Highland Terrier stand und in den Fahrtwind schnupperte. Der junge Mann am Steuer trug Shorts und eine Sonnenbrille. Er war braungebrannt. Er lachte Judit an, als er durch das Wasser schnitt, dass die Gischt spritzte. Judit lachte zurück. Sie fühlte sich untreu.
Sie ging wieder nach oben um nachzusehen, ob Signora Vescovo alle Anweisungen befolgt hatte. Es war vereinbart worden, dass die Haushälterin immer vormittags kommen sollte, beginnend am Tag von Judits Ankunft.
Es gab vier Schlafzimmer, in denen die Betten straff und sauber bezogen und mit Kissen dekoriert waren. Eines der Zimmer war so klein, dass nur ein Einzelbett hineinpasste. In einem anderen war es über die Maßen heiß, ohne dass Judit herausfinden konnte, weshalb. Vielleicht lag es unter einem Blechdach. Es blieben ein Schlafzimmer im dritten Stock mit Blick auf die Friedhofsinsel und eines im zweiten Stock mit Blick auf die Gasse. Hier würden die Fensterläden die meiste Zeit geschlossen bleiben müssen, wollte man nicht von den gegenüberliegenden Fenstern aus beobachtet werden.
Das Zimmer mit Blick auf die Friedhofsinsel war kühl. Obwohl durch die hohen Fenster die Sonne hereinfiel, hatte es etwas Düsteres. Wie die anderen Räume der Wohnung war es von Tita mit einem Sammelsurium an Antiquitäten gefüllt worden, die sie in mehreren Bootsladungen heranschaffen hatte lassen. Titas Mann, der seit Jahren darum kämpfte, in der Wiener Wohnung „Bodenfläche zurückzugewinnen“, hatte versprechen müssen, ihr in Venedig vollkommen freie Hand zu lassen. Auf einem Intarsienschränkchen stolzierte ein ausgestopfter Kronenkranich, daneben stand eine rot eingefärbte Bambuskoralle, vermutlich aus irgendeiner Wunderkammer. Aus dem mannshohen Kamin starrte ein Trupp afrikanischer Statuetten. In der Diagonale des Zimmers stand ein antikes chinesisches Hochzeitsbett. Lag man darauf, sah man genau auf die Friedhofsinsel. In einer so alten Stadt müsse man sich mit den Gespenstern anfreunden, hatte Tita erklärt. Überall lägen schließlich die Toten, in dicken Schichten, denn als man die alten Friedhöfe in der Stadt aufgelassen und die Toten auf ihre eigene Insel verlegt hatte, hatte man natürlich nur die oberste Schicht entfernt. Man ging und lebte auf einem einzigen Friedhof. Man hatte Gassen und Gebäude über den Gräbern errichtet, aber auch wenn man sie nicht sehe, seien sie doch da. Nicht jeder vertrüge ein solches Ausmaß an Vergangenheit, die ja immer eine Ansammlung von Todesfällen sei. Manche würden von Beklommenheit erfasst und sähen überall Omen. Andere meinten, etwas Fremdes kröche da in sie hinein, das sie verändere.
Die Küche lag im zweiten Stock. Judit setzte sich auf einen Stuhl und lauschte. Die Wohnung war voller Geräusche. Geräusche aus den Nachbarwohnungen, den Nachbarhäusern, der ganzen Stadt. In Venedig, sagte Tita, sei es seit jeher notwendig gewesen, vieles geheim zu halten, weil so vieles öffentlich war. Die Geräusche schienen aus allen Teilen der Wohnung zu kommen, ja selbst durch die Küche schien jemand hindurchzugehen. Es wäre unmöglich gewesen, bei all den Schritten und Stimmen, dem Knarren und Poltern einen Einbrecher herauszuhören. Um rechtzeitig zu bemerken, dass sich ein Einbrecher in der Wohnung befand, brauchte man einen Hund. Einen großen, beschützenden, einen English Shepherd vielleicht.
An der Wand hing eine Schwarz-Weiß-Fotografie vom Einsturz des Campanile di San Marco im Jahr 1902. 1902 war Judits Urgroßvater zwei Jahre alt gewesen. Auf der Anrichte stand eine Flasche Lagrein. Judit stand auf, um den Kühlschrank zu öffnen. Sie hatte für Signora Vescovo eine Einkaufsliste geschrieben, die von Tita weitergeleitet worden war:
1. Obst (einschließlich Zitronen).
2. Gemüse, das nicht gekocht werden muss.
3. Magerer Schinken.
4. Wasser (mit und ohne Kohlensäure).
5. Rotwein.
6. Prosecco.
7. KEIN BROT.
8. KEINE BUTTER.
9. AUCH SONST NICHTS.
Alles Gewünschte war da, das Nicht-Gewünschte war nicht da. Man sah die Signora vor sich: eine gepflegte Mittfünfzigerin, etwas korpulent. Freundlich, ohne indiskret zu sein. Verheiratet, Ehemann Fleischhändler am Rialto-Markt. Zwei erwachsene Kinder. Sohn Bankangestellter (und nachts illegaler Muschelfischer), Tochter Inhaberin einer kleinen Boutique.
Das Klingeln des Telefons schien aus allen Räumen gleichzeitig zu kommen. Eine Weile drehte Judit sich auf dem Flur lauschend im Kreis, dann betrat sie den Salon. Das Telefon stand auf einem Chinoiserie-Sekretär am Fenster. Es klingelte weiter, ohne dass sich ein Anrufbeantworter einschaltete. Judit sah aus dem Fenster. Im Lagunenwasser blitzten so starke Sonnenreflexe auf, als trieben Tausende Spiegelscherben darin. Eine mit fünf stehenden Ruderern besetzte Renngondel schoss, ohne im Geringsten abzubremsen, auf das von Murano kommende Vaporetto zu. Auch das Vaporetto drosselte seine Geschwindigkeit nicht. Der Schnittpunkt der beiden Routen, die Kollision und der Knall, den diese verursachen würde, zeichneten sich ab. Dann war die Renngondel vor dem Bug des Vaporetto vorbeigeflitzt, das Schicksal überlistet. Judit sah wieder auf das Telefon und es hörte zu läuten auf. Auf dem Sekretär lag ein Buch mit venezianischen Gespenstergeschichten. Als sie es öffnete, fiel ein von Tita handgeschriebener Zettel heraus: „NICHTS DAVON IST WAHR!“ Judit begann eine Geschichte über Marco Polos unglückliche Braut zu lesen. Sie war eine chinesische Prinzessin, die den kaiserlichen Hof, Heimat und Familie hinter sich gelassen hatte, um dem geliebten Mann nach Venedig zu folgen. Die Venezianer mochten sie nicht. Ihr Aussehen, ihr Akzent, ihr Benehmen waren nicht nur fremdartig, sondern befremdlich. Als schließlich auch Marco Polo sich von ihr abwandte, um eine Venezianerin zu heiraten, stürzte sie sich vom Balkon ihres Palazzo in den Tod. „Noch heute kann man sie in mondhellen Nächten seufzend auf dem Balkon auf und ab gehen sehen. Sie trägt ein weites gelbes Seidengewand, und das lange pechschwarze Haar fliegt wirr um ihren Kopf, wenn sie wehklagend die Hände ringt.“
Das Telefon klingelte abermals. Judit schlug das Buch zu und wartete. Die Monotonie des Klingelns machte sie schläfrig. Sobald es geendet hatte, schlug sie das Buch an einer neuen Stelle wieder auf. Es ging um den Bau der am Eingang des Canal Grande gelegenen Basilica Santa Maria della Salute. Bleiche Geisterkinder und schwarze, knurrende Geisterhunde erschreckten die Arbeiter. Unsichtbare Hände zogen an ihren Haaren oder teilten Ohrfeigen aus, körperlose Stimmen murmelten über die Baustelle, Blutbäche strömten aus dem Boden. Das Telefon begann wieder zu klingeln. Es stellte sich heraus, dass die Gebeine der Toten des alten Friedhofs, auf dem die Basilica errichtet wurde, nicht umgebettet worden waren. Die Toten bedurften der erneuten Bestattung an einem Ort der Ruhe. Judit schloss das Buch und hob ab.
Es war Katalin, ihre Schwester. Sie habe am Festnetz angerufen, da Judit am Handy nicht abnahm. Es sei wohl der Akku leer. Sie müsse ihr etwas Dringendes sagen. Judit legte auf.
Während andere Kinder in Momenten elterlicher Verständnislosigkeit (und auch, um den Kameraden gegenüber eine möglicherweise adelige Herkunft ins Spiel zu bringen) die Vermutung anstellten, dass sie adoptiert worden seien, hatte Judit Kalman schon früh den Verdacht gehegt, dass ihre Schwester Katalin ein Adoptivkind war. Das Gefühl der Fremdheit war von Anfang an da, Katalin passte nicht zur Familie. Sie war zwei Jahre älter als Judit, und es gab zumindest ein auffälliges Verdachtsmoment: In keinem einzigen Familienalbum war ein Foto von der Mutter zu finden, auf dem sie schwanger mit Katalin war. Zwar gab es auch kein Foto, auf dem sie schwanger mit Judit war, aber so schlau war man natürlich gewesen, hier keinen Unterschied zu machen. Es gab überhaupt keine Fotos, auf denen Johanna Kalman mehr als fünfzig Kilo wog. Auch nicht in den Schachteln mit den Fotos, die für die Alben nicht gut genug waren. Auch nicht in den hintersten Winkeln des Dachbodens oder des Kellers. Es sei ihr eben peinlich gewesen, so in die Breite zu gehen, erklärte die Mutter, und sie hätte es nicht gestattet, dass ihr Zustand dokumentiert würde.
„Das waren die Sechzigerjahre! Damals war es nicht schick, schwanger zu sein. Als Schwangere war man hässlich, asexuell und so etwas wie eine Stallkuh.“
Der Vater bestätigte die grundsätzliche Situation in den Sechzigerjahren, von der sich seine persönliche Haltung aber stets unterschieden habe: „Du warst niemals eine Stallkuh. Du warst immer wunderschön.“
Judit wunderte es nicht, dass die Eltern leugneten. Was sie ihr mit Katalin angetan hatten, war ihnen nur allzu bewusst.
Abgesehen von jenem allgemeinen Gefühl der Fremdheit, das dazu führte, dass die Schwestern kaum einen Satz austauschen konnten, ohne einander misszuverstehen, vermochte Judit schon früh drei Unterschiede zwischen sich und Katalin zu identifizieren:
1. Katalin mochte keine Bücher.
2. Katalin mochte keine Tiere.
3. Katalin konnte nicht alleine sein.
Zwar hatten sie jede ein eigenes Zimmer, dennoch war Katalin, seit Judit denken konnte, bei ihr einquartiert. In der Nacht fürchtete sich die Ältere, aber auch untertags war sie nur schwer zu bewegen, in ihr Zimmer oder in das gemeinsame Spielzimmer hinüberzugehen. Im Spielzimmer befanden sich das Barbieschloss, der Krämerladen, das Friseurstudio, die Sprossenwand, die Ballettstange, der Chinchillakäfig und das Aquarium, und auf Judits speziellen Wunsch eine Carrerra-Autorennbahn, da sie am Spielplatz das Gespräch zweier Mütter belauscht und den Satz aufgeschnappt hatte: Mädchen sollten auch mit Bubenspielzeug spielen in der heutigen Zeit.
Katalin klebte an ihrer kleinen Schwester. Sie hatte Angst vor den Chinchillas und fand die Goldfische ekelig. In ihrem eigenen Zimmer befürchtete sie, Fremde – mal Mitglieder eines Wanderzirkusses, mal Außerirdische – könnten in dieses eindringen und sie unbemerkt entführen.
Judit war vier, als ihr klar wurde, dass sie mit den Eltern ein ernstes Wort reden musste. Mit so viel Nachdruck, wie sie nur aufbringen konnte, erklärte sie, dass Katalin ja nun schon in die Schule käme und es an der Zeit wäre, sie in ihrem eigenen Zimmer wohnen zu lassen.
Die Mutter schüttelte bedauernd den Kopf: „Das wird wohl nicht gehen.“
„Ich kann das nicht einschätzen“, sagte der Vater und machte sich an der Stereoanlage zu schaffen.
„Ich halte es nicht mehr aus“, sagte Judit.
„Deine Schwester kann einfach nicht alleine sein, sie braucht dich eben“, sagte die Mutter sanft.
„Sie ist die Ältere!“
„Das hat damit nichts zu tun.“
„Dann soll sie doch bei euch schlafen!“
Die Eltern lachten herzlich, tauschten verliebte Blicke aus und begannen zu einer Roger Whittaker-Platte zu tanzen. Als Judit ihre Forderung wiederholte, legten sie eine andere Platte auf und tanzten Boogie-Woogie.
Ein Jahr später hatte Judit zu lesen begonnen, um ihrer Schwester zu entkommen. Mit einem Buch vor der Nase konnte sie sie ausblenden. Kein Wunder, dass Katalin Bücher verabscheute.
Wie sehr sie Katalins Anruf verärgert hatte, bemerkte Judit, als sie sich plötzlich vor der geöffneten Kühlschranktüre wiederfand. Ein weiterer Moment der Zerfahrenheit, und sie hätte etwas gegessen. Eine Scheibe Prosciutto, eine weitere, dann hätte sie schon hastig die Klarsichtfolien zwischen den Scheiben herausgezogen, um möglichst viele auf einmal in den Mund stopfen zu können. Sie hätte den Taleggio aus der Folie gerissen und direkt vom Stück abgebissen. Sie wäre vor dem geöffneten Kühlschrank gehockt und hätte Hände voll Oliven in sich hineingestopft, die Kerne hinunterschluckend, da sie keine Zeit gehabt hätte, sie auszuspucken. All das wäre passiert, hätte es Frau Dr. Soucek nicht gegeben.
„Iss niemals, weil du dich nicht auskennst in der Welt. Du wirst dich auch nach einem Salamibrot mit sehr viel Mayonnaise nicht auskennen“, hatte Frau Dr. Soucek immer gesagt.
Mit zehn Jahren hatte Judit zu fressen begonnen und war binnen kürzester Zeit zur Klassendicksten geworden. Mit fünfzehn, als die Pubertät unerträglich zu werden drohte, hatte sie alles wieder abgenommen und sich seither im Griff. Ihren Eltern hatte sie beides zu verdanken, sie hatten es immer gut gemeint und ihr Bestes getan. Ursprünglich hatten sie weder Essen im Allgemeinen noch Süßigkeiten im Speziellen rationiert, denn als Kinder hatten sie in dieser Hinsicht Dinge erlebt, die sie ihren Kindern nicht antun wollten. In der Familie des Vaters war es üblich gewesen, nur den erwachsenen Männern, die Geld nach Hause brachten, Fleisch und Wurst vorzusetzen, während Frauen und Kinder mit Brot und Kartoffeln vorlieb nehmen mussten. Wenn er als Kind etwas angestellt hatte, war Judits Vater ohne Abendessen ins Bett geschickt worden, was er später als „ärgste Menschenrechtsverletzung“ zu bezeichnen pflegte. Judits Mutter gehörte zu jenen Kindern, die ihr erstes Schokoladenstück von einem amerikanischen Soldaten geschenkt bekommen hatten, dann aber, wie sie stets hinzufügte, „war wieder zehn Jahre lang nichts mehr.“ So kam es, dass im Hause Kalman die Vorratskammern zum Bersten gefüllt waren, es Nachschlag ohne Ende gab, die Erdnüsschen und Drageekeksi überall griffbereit lagen. Als Judit dicker und dicker wurde, beteuerten ihre Eltern, wie hübsch sie doch sei, wie gut ihr ein bisschen Babyspeck doch stünde, und außerdem sei sie ja gar nicht so dick. Jahrelang ging das so, doch als Judit von der ersten Tanzstunde heulend nach Hause kam, weil keiner der Burschen sie aufgefordert hatte, korrigierten sie endlich ihren Kurs.
So kam Frau Dr. Soucek ins Spiel, eine praktische Ärztin, die sich einen Ruf in Ernährungs- und Figurfragen erworben hatte. Dieser Ruf basierte auf dem Umstand, dass Frau Dr. Soucek selbst in erstaunlich kurzer Zeit erstaunlich viel Gewicht verloren und sich von Kleidergröße 52 auf Größe 36 vermindert hatte. Auf dem Schreibtisch in ihrer Praxis stand eine Fotografie, die sie im geeigneten Moment umzudrehen pflegte, damit der Patient einen Blick darauf werfen konnte. Kein Ehemann, keine Kinder waren darauf zu sehen, sondern eine Ganzkörperaufnahme von Frau Dr. Soucek, wie sie einmal war. Der verblüffte Patient brauchte üblicherweise einige Augenblicke, bis ihm klar wurde, dass die beleibte Person in dem unförmigen Sackkleid auf dem Foto ident war mit der dürren Ärztin am Schreibtisch gegenüber, die in ihrem weißen Kittel nahezu verschwand.
Frau Dr. Souceks Empfehlungen basierten allesamt auf der Erkenntnis, dass man, um abzunehmen, weniger essen müsse als sonst. Das einzige Lebensmittel, das sie vollkommen ablehnte, war die allseits als gesund und schlankmachend angesehene Margarine. Der chemische Prozess, in dem das Pflanzenöl gehärtet wurde, erschien ihr barbarisch.
„Wenn mit einer solchen Brutalität Moleküle zertrümmert werden“, sagte sie, „kann dabei nichts Gutes herauskommen.“
An ihrem Schreibtisch mit der mahnenden Fotografie führte sie sowohl mit Judit als auch deren Mutter Gespräche. Judit hatte keinen Zweifel daran, dass die Mutter mehr litt als sie selbst. Sie musste ihrem Kind die zweite Schnitte Milchbrot verweigern, sie durfte auf den Christbaum nur Äpfel hängen. Judit aber stürzte sich mit Begeisterung in die Arbeit. Sie lernte, nur ein einziges Stück Schokolade zu essen und dann aufzuhören, sie lernte, bei Tisch nicht ewig weiterzuessen, nur damit ihre Eltern noch sitzen blieben und sich mit ihr unterhielten. Es war eine Arbeit, die sich ihr ganzes Leben lang fortsetzen sollte: die einzige kontinuierliche Arbeit, die sie je geleistet haben würde.
ZWEI
Was niemand ahnte, war, dass Frau Dr. Souceks Gewichtsverlust keineswegs bewusster Willensanstrengung und wissenschaftlicher Strategie zu verdanken war, sondern seine Ursache in einer schrecklichen seelischen Erschütterung hatte. Eines Tages nämlich war Frau Dr. Soucek durch die Getreidegasse gegangen und hatte ein sich innig küssendes Liebespaar erblickt. Als sie sich näherte, stellte sie fest, dass ihr der Mann irgendwie bekannt vorkam. Wenige Schritte entfernt, als die Hände des Mannes gerade auf den Hintern der Frau hinabglitten, wurde Frau Dr. Soucek klar, dass es sich um jenen Mann handelte, der Abend für Abend bei ihr am Tisch saß und Nacht für Nacht bei ihr im Bett lag. Der genau genommen erst zwei Tage zuvor mit ihr geschlafen hatte, und zwar in einer Art und Weise, dass sie sich beglückwünscht hatte, nach fünfzehn Jahren Ehe noch mit solchem Feuer gesegnet zu sein. Es handelte sich um Viktor.
Frau Dr. Soucek wich unwillkürlich in eine Passage zurück, als wäre sie diejenige, die sich verstecken musste, und starrte auf die Hände ihres Gatten, die mitten auf der Getreidegasse den Hintern einer Fremden kneteten, und auf den Ehering, von dem sie wusste, dass an seiner Innenseite „Auf ewig – Hildegard“ eingraviert war.
In diesem Moment hatte sie eine unheimliche Vision. Der Tod ging plötzlich die Getreidegasse hinunter, er trug eine schwarze Kutte, unter deren Kapuze sein Gesicht nicht zu sehen war, und in der Hand eine silberne, glänzende Sense. Dass es sich um eine Vision handelte, erkannte Frau Dr. Soucek daran, dass niemand sonst die alle überragende schwarze Gestalt zu sehen schien. Schließlich hatte der Tod das Liebespaar passiert und Frau Dr. Soucek erreicht, er näherte sich ihr mit einem kühlen, nach Holunderblüten riechenden Hauch, und sie sah sein Gesicht, das das Gesicht von Curd Jürgens war, der bei den Festspielen gerade den Jedermann gab. Der Besuch der Jedermann-Aufführung war ein Geschenk ihres Mannes anlässlich ihres neununddreißigsten Geburtstages gewesen, und Frau Dr. Soucek hatte noch jede Einzelheit deutlich in Erinnerung. Curd Jürgens sah ihr tief in die Augen, nickte ihr zu und ging weiter, und sie verstand sofort: Die Tatsache, dass Curd Jürgens hier den Tod verkörperte, während er in Wirklichkeit den Jedermann spielte, bedeutete nichts weniger, als dass alles aus seiner gewohnten Ordnung gefallen war.
Frau Dr. Soucek schwindelte, sie stützte sich an der Hausmauer ab, dann war der Tod mit einem Mal verschwunden und ihr Mann löste endlich die Lippen von denen der Fremden. Auch diese kam ihr bekannt vor, das war doch die Tochter von irgendwem. Auf jeden Fall war es ein ganz junges Mädchen, sie hätte eine von Viktors Schülerinnen sein können. Großer Gott, das war eine von Viktors Schülerinnen. Wie hatten sie nicht immer darüber gescherzt, dass er einer von einer Handvoll männlicher Lehrer an einer „Ganserlakademie“ war, wie hatte man ihn nicht im Freundeskreis augenzwinkernd bedauert, dem Übermaß erblühender Weiblichkeit an einem Mädchengymnasium ausgesetzt zu sein, und nun hatte sich der Herr Physikprofessor Soucek also eine Minderjährige angelacht.
Während das Liebespaar langsam Richtung Staatsbrücke schlenderte, fasste sich Frau Dr. Soucek wieder. Sie entschied, dass der gewohnten Ordnung zu ihrem Recht verholfen werden müsse. Es war ja im Grunde ganz einfach: Sie würde Viktor mit der Scheidung drohen, und er würde ganz schnell wieder zur Vernunft kommen.
Sie ging zurück in ihre Praxis, wo sie weiter ihren Dienst versah. Nach einer Weile fiel ihr auf, dass sie den Leiden ihrer männlichen Patienten erheblich weniger Verständnis entgegenbrachte als sonst. Was für ein wehleidiger Fatzke! Naja, wer lebte wie ein Hedonist, brauchte sich nicht zu wundern, dass er auch die Beschwerden eines Hedonisten bekam. Und immer wieder derselbe Hypochonder, der ständig nach Medikamenten verlangte, um dann vermeintlich an den Nebenwirkungen dahinzusiechen.
Zwischendurch rief Frau Dr. Soucek bei sich zu Hause an, um die Haushälterin anzuweisen, den Rinderbraten, der für das Wochenende vorgesehen war, schon heute Abend zuzubereiten. Und bitte mit allem Pipapo, gespickt und mit Essiggürkchen in der Soße. Keine Bratkartoffeln – Duchesse-Kartoffeln. Ob ihr Mann schon zu Hause wäre? Noch nicht?
Beim Abendessen beobachtete Frau Dr. Soucek ihren Mann genau. Wie es schien, roch er nur den einen Braten, den anderen aber nicht. Er aß mit ausgezeichnetem Appetit. Er lächelte seine Frau an, schenkte ihr Wein nach, erzählte von den Gesprächen im Konferenzzimmer und wie anstrengend die Gören wieder gewesen waren. Sie musste sich zusammennehmen, um den Wein nicht in einem Zug hinunterzukippen. Der Braten schmeckte ihr wie Holz, die Duchesse-Kartoffeln wie Lurch, die Essiggürkchen wie Gelatine.
Später im Wohnzimmer sagte sie dann beiläufig: „Ich habe dich heute in der Getreidegasse mit diesem Mädchen gesehen. Mir scheint, wir sollten uns scheiden lassen.“
Viktor starrte sie an. Er schritt auf sie zu – ihr schien, dass er taumelte. Als sein Gesicht über ihrem war, sah sie, dass er Tränen in den Augen hatte. Er schloss sie in seine Arme, so behutsam, als wäre sie Windgebäck. Er schmiegte seine Wange an ihre, seine Lippen an ihr Ohr. Er flüsterte: „Ich danke dir. Danke, danke, danke. Wir hatten solche Angst, dass du in die Scheidung nicht einwilligen würdest.“
Dann ging er ins Schlafzimmer, um sogleich einen Koffer zu packen. Wie sich herausstellte, war die junge Dame bereits bei ihren Eltern ausgezogen und die beträchtlichen Geldsummen, die Viktor in letzter Zeit abgehoben hatte, vorgeblich, „um einem alten Freund aus der Patsche zu helfen“, waren tatsächlich in Miete und Einrichtung ihrer neuen Wohnung geflossen. Und ja, sie war seine Schülerin, siebte Klasse. Die Schuldirektorin – davon war Viktor überzeugt – würde sich verständnisvoll zeigen, wenn man die Sache nur in Ordnung brachte. In Ordnung bringen, das hieß, Scheidung von Frau Dr. Soucek und sofortige Heirat der Schülerin. Wo die Liebe hinfällt, würde die Direktorin zweifelsohne sagen. Und jeder wusste, dass er ein integrer Lehrer war und seine Gattin notenmäßig ganz bestimmt nicht anders beurteilen würde als die anderen Schülerinnen.
(In seiner Einschätzung der Direktorin sollte Viktor recht behalten. Auch auf das Verständnis der anderen Lehrer konnte er zählen. Hatte nicht schon der große Charly Chaplin ein Faible für ganz junge Mädchen gehabt? Verheiratete man in gewissen Ländern Mädchen nicht mit dreizehn oder zwölf? Zwanzig Jahre später erfuhr Frau Dr. Soucek aus den Medien, dass sexuelle Beziehungen zwischen Lehrern und Schülerinnen strafbar geworden waren. Der Lehrer mache sich des „Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses“ schuldig, las sie. Diese Sicht der Dinge konnte Frau Dr. Soucek nicht teilen. In Wahrheit handelte es sich doch, spottete sie, um den Missbrauch von Miniröcken von Seiten der Mädchen.)
„Aber warum mitten in der Getreidegasse, am helllichten Tag, wo euch jeder sieht?“, fragte Frau Dr. Soucek plötzlich, während ihr Mann sorgfältig seine Krawatten einrollte. Er habe keine Ahnung, antwortete Viktor, es sei ihn und Tanja einfach so überkommen. Ab einem gewissen Punkt denke man nicht mehr an das Risiko. Er räume natürlich ein, dass möglicherweise der unbewusste Wunsch, entdeckt zu werden, eine Rolle gespielt haben könnte. Das ewige Versteckspielen – und das seit einem dreiviertel Jahr – habe man gründlich satt gehabt. Es sei klar gewesen, dass das nicht so weitergehen könne. Der Zwang zu Lüge und Verstellung sei auf Dauer unzumutbar. Wahrscheinlich habe man sich deshalb in der Getreidegasse Luft gemacht. Im Grunde sei das Ganze ja eine Frage der Menschenrechte.
Frau Dr. Soucek überstand die Nacht mit Hilfe von ein wenig Brandy und viel Rohypnol. In den darauffolgenden Tagen organisierte sie alles für ihre zweimonatige Abwesenheit. Sie gab bekannt, dass sie zu einer längeren Studienreise nach Indonesien aufbrechen würde. Die Patienten wurden beruhigt, getröstet und an kompetente Kollegen weiterverwiesen. Den beiden Sprechstundenhilfen wurde Urlaub bei vollen Bezügen gewährt.
Einmal kam sie nach Hause und fand unter dem Türschlitz ein Kuvert. Es enthielt die Hausschlüssel und eine Notiz ihres Mannes:
Hallo Hildegard,
habe mich entschlossen, Dir das Haus zu überlassen. Muss jetzt zwar meinen Lebensstandard runterschrauben, aber da Du schon als Kind darin gewohnt hast, soll es Dir bleiben. Ich danke Dir von Herzen für die schöne gemeinsame Zeit. Bestimmt wirst auch Du bald wieder jemanden finden.
Ganz liebe Grüße auch von Tanja,
Dein Viktor
P. S.: Du verzeihst, aber das Auto gehört mir.
Frau Dr. Soucek ließ sich unter dem Namen „Barbara Laimgruber“ in der Landesnervenklinik aufnehmen. Von ihrem alten Studienkollegen Karl, der Psychiater geworden war, ließ sie sich für zehn Tage in einen künstlichen Tiefschlaf versetzen. Als sie wieder erwachte, sah sie am Fenster den Tod in seiner schwarzen Kutte und mit seiner silbernen, glänzenden Sense stehen. Er drehte sich zu ihr um und sie stellte fest, dass er diesmal das Gesicht Hugo von Hofmannsthals hatte. Mit seinem kühlen Holunderblütenhauch trat er auf sie zu, starrte sie an und bewegte lautlos die Lippen. Nach einer Weile wurde ihr klar, dass er immer dieselben Verse wiederholte:
„Ha! Weiberred und Gaukelei!
Wasch mir den Pelz und mach ihn nit nass!
Ein Wischiwasch! Salbaderei!
Zum Speien ich dergleichen hass!“
Das waren die Worte des Teufels, nicht des Todes, Frau Dr. Soucek kannte das Stück genau.
„Karl!“, rief sie, „Karl, Hilfe!“ Hugo von Hofmannsthal machte eine Halsabschneider-Geste und verschwand hinter dem Kopfende ihres Bettes. Dort war offenbar schon die ganze Zeit Karl gestanden, der nun in ihr Blickfeld trat und ihre Hand nahm.
„Karl, ich hab dir gesagt, dass ich ein Einzelzimmer will!“, rief Frau Dr. Soucek.
„Das ist ein Einzelzimmer, liebste Hilde“, erwiderte Karl.
„Und was macht dann Hugo von Hofmannsthal hier?“
Frau Dr. Souceks „Studienreise“ nahm fünf Monate in Anspruch. Am Ende hatte sie vierzig Kilo abgespeckt, was hauptsächlich an der Ungenießbarkeit des Krankenhausessens lag. Bevor sie zurück in die Praxis ging, ließ sie sich unter der Höhensonne bräunen, sodass sie bewundernde Komplimente wegen ihres erholten und gesunden Aussehens erhielt. Karl bat seine Frau um die Scheidung und zog bei Frau Dr. Soucek ein. Frau Dr. Soucek reichte ebenfalls die Scheidung ein, klagte ihren Ex-Mann wegen Ehebruchs und böswilligen Verlassens auf Unterhalt sowie die Herausgabe des Autos und bekam recht. An die Intendanz der Salzburger Festspiele schrieb sie die Forderung nach der Absetzung des Stückes „Jedermann“, das sie als „haarsträubenden, erzkatholischen Mist“ bezeichnete, und bekam nicht recht.
DREI
Es gab nur ein Badezimmer, was bei voller Belegung der vier Schlafzimmer zu Spannungen führen musste, dafür war es, wie von Tita beschrieben, groß und hatte Tageslicht. Die Größe war durch das Niederreißen einer Wand erreicht worden, das Tageslicht durch Milchglas gedämpft, damit die Bewohner der gegenüberliegenden Häuser die intimen Verrichtungen der Badenden nicht beobachten konnten. Judit öffnete das Fenster einen Spalt und sah, dass gegenüber alle Fensterläden geschlossen waren. Dann zog sie die durchsichtigen Vorhänge zurück, stieß die Fensterflügel weit auf und zog die Bluse aus.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!