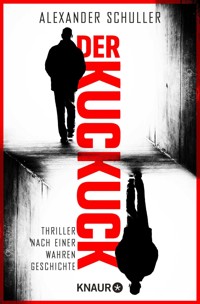6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof! Der rasante Thriller zur neuen Serie bei JOYN. Die Münchner "Rich Kids" Nellie, Max und Janosch wollen mal nicht in einem angesagten Szene-Club feiern, sondern auf einem illegalen Luxus-Rave in den geheimen Gängen unter dem Hauptbahnhof. Sie ahnen nicht, dass im Untergrund Menschen leben, die in der normalen Welt keinen Platz mehr finden: die Unsichtbaren. Plötzlich eskaliert die Party nach einem Feuer in den Tunneln, und Massenpanik bricht aus. Die verheerenden Auswirkungen der Partynacht werden erst am nächsten Morgen klar: Dutzende Verletzte und drei Vermisste – darunter auch Max. Weshalb bietet ausgerechnet Tyler aus dem Untergrund bei der Suche nach den Vermissten ihre Hilfe an? Und wer profitiert tatsächlich von den Verschwundenen? Ein hochspannender Thriller, der gleichzeitig ein Spiegel der Gesellschaft ist - denn in Panik und Not machen Geld und gesellschaftliche Stellung keinen Unterschied. Basierend auf der gleichnamigen Serie, kreiert von Florian Kamhuber und Jakob M. Erwa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alexander Schuller
Katakomben
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kaum jemand weiß von den Gängen unter dem Münchner Bahnhofsviertel, den Katakomben. Hier leben die Zurückgelassenen der Gesellschaft; die Münchner »Rich Kids« hingegen nutzen den geheimnisvollen Untergrund für illegale Partys. Auch Nellie, Max, Janosch und Wenzel – alle Anfang 20 – gehören dazu. Doch als während eines Raves Feuer und eine Massenpanik ausbrechen, sind am nächsten Morgen zwei Tote zu beklagen - und Max und Wenzel verschwinden spurlos. Bald wird klar, dass gleich mehrere Verdächtige großes Interesse an den Vorgängen in den Katakomben haben: eine profitorientierte Immobilienfirma, die labile Hauptkommissarin Magdalena Kaltbrunner – und sogar die eiskalte Mutter von Nellie und Max, Stadtbaurätin Anna Mahler. Denn nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in Familien gibt es tiefe Gräben. Dann geschieht ein Mord - der Wahnsinn ist offenbar nicht mehr aufzuhalten.
Inhaltsübersicht
1. Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
2. Teil
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
3. Teil
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49.
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
4. Teil
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
1. Teil
»Erziehung ist organisierte Verteidigung
der Erwachsenen gegen die Jugend.«
Mark Twain
1.
Nellie
Der Tag, an dem es mein Leben aus den Angeln hob, begann mit einem Kopfschuss: Ich deckte den Frühstückstisch, während unsere Haushälterin Eva im Auftrag meiner Mutter – »Bringen Sie das verdammte Tier um!« – seit einer Viertelstunde versuchte, einen verirrten Vogel durchs Fenster aus dem Arbeitszimmer zu scheuchen; während ich die Eier abschreckte (nach exakt sieben Minuten, in kochendes Wasser gelegt, denn anders als kernweich kriegt kein Mitglied unserer Chaos-Familie gekochte Eier runter) und gleichzeitig aufpassen musste, die Pancakes für meinen Bruder Max nicht anbrennen zu lassen; während es, obwohl es erst kurz vor neun war, an der Tür schellte und meine Mutter daraufhin von oben durchs ganze Haus brüllte, Eva soll die Tür öffnen! (eigentlich mit drei Ausrufezeichen), da sie wichtigen Besuch erwarte; während ich den Frühstückstisch mit den perfekt gekochten Eiern und den perfekt gebratenen Pancakes und dem perfekt ausgepressten Orangensaft komplettierte und dabei einen Seitenblick auf den Fernseher warf, in dem meine Mutter gerade auftauchte, laut dem Moderator vom Frühstücksfernsehen die streitbare Münchner Stadtbaurätin Anna Mahler, und ich den Ton lauter stellte, um mir ihr Statement anzuhören – Wissen Sie, diese Situation ist nicht haltbar. Sie ist unmenschlich und sie macht mich regelrecht betroffen. Denn in einer reichen Stadt wie München darf es einfach keine Kältetoten geben. Wenn solch eine Tragödie passiert, versagt offenbar die ganze Gesellschaft. Es liegt mir fern, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und Schuldzuweisungen zu erheben. Aber es gehört zu meinen Aufgaben, auf Missstände hinzuweisen. Wir als Politikerinnen und Politiker, wir sind doch jetzt gefragt. Aber die Probleme werden ja nicht einmal benannt! Wo bleiben die Kältebusse? Noch immer blockieren manche Kollegen bei der Stadtverwaltung diesen unbürokratischen Lösungsvorschlag, der quer durch alle Fraktionen Zustimmung erhalten hat. Deshalb werde ich ab sofort zusätzliche Notunterkünfte für die Münchner Obdachlosen bereitstellen lassen. Die Details –; und während ich den Ton des Fernsehers wieder leiser drehte, hörte ich, wie meine Mutter in echt die Treppe herunterkam, um im nächsten Moment unser Esszimmer mit ihrer Anwesenheit zu überfluten, ein menschlicher Tsunami, in jeder Hand einen Blazer, Hochspannung im Gesicht, und sie sagte: »Mein Gott, Nellie. Das sieht ja unglaublich aus! Jetzt können wir Eva doch entlassen!«
»Na ja, ich habe endlich mal wieder ein Familienfrühstück gemacht«, sagte ich, »aber bügeln oder Fenster putzen ist nicht so meins …«
»Das weiß ich doch, Schatz«, sagte meine Mutter, »das war nur ein Witz.« Sie fügte hinzu: »Natürlich, Thomas. Ich bin praktisch schon auf dem Weg!«
Erst jetzt bemerkte ich, dass sie ihr Headset trug und parallel zu ihrem fulminanten Auftritt telefonierte. Mit ihrem Referenten Thomas Streiter, den ich zwar schon immer ziemlich blöd fand, aber insgeheim bemitleidete. Die penetrante Dominanz meiner Mutter war nichts für schwache Nerven. Wenn sie einen Raum betrat, war der voll. Widerspruch sowieso zwecklos.
Nur wenn es um die Wahl ihrer Garderobe ging, war sie erstaunlich unsicher. Sie hielt die beiden Blazer hoch und sah mich fragend an. Ich zeigte stumm auf das dunkelblaue Jackett mit den goldenen Knöpfen. Sie warf das andere achtlos über eine Stuhllehne und streifte meine Entscheidung über. »Und?«
»Sieht gut aus«, sagte ich, »wie wäre es jetzt mit Frühstück?«
Meine Mutter hielt das Mikrofon ihres Headsets zu. »Tut mir leid, Nellie, aber ich hab leider einen Termin. Waren sie das eben, an der Tür?«
»Wer?«
»Investoren. Potenzielle Investoren, meine ich.« Sie warf einen Blick durchs Fenster hinaus in den Garten, wo Marcus Seewald, unser Chauffeur, Gärtner und außerdem Ehemann unserer Haushälterin, die Terrasse winterfest machte. »Danach muss ich gleich zu irgend so einem idiotischen Workshop in die Behörde, und dann fahre ich leider nach Nürnberg zu einer außerordentlichen Ausschusssitzung des Deutschen Städtetages. Ich werde wahrscheinlich über Nacht bleiben.«
In diesem Moment betrat Eva Seewald das Esszimmer. »Die Herrschaften sind eingetroffen, Frau Mahler.«
Meine Mutter nickte und sprach erneut in ihr Headset. »So, bin wieder da, Thomas. Also, nein, das müssen Sie nicht. Sehen Sie einfach zu, dass Sie die Akten fürs Bahnhofsviertel rankriegen, ja? Genau, das Gelände über den Katakomben. Und jetzt entschuldigen Sie mich – bis nachher!« Sie legte auf und wandte sich an Eva. »Haben Sie Frau Gordon und Herrn Durand einen Kaffee angeboten?«
»Selbstverständlich. Aber sie wollten keinen. Zumindest habe ich sie so verstanden. Mein Englisch ist leider nicht so besonders«, sagte Eva Seewald bedauernd.
»Und ist der blöde Vogel raus?«
»Natürlich. Ich musste ihn Gott sei Dank doch nicht umbringen.«
Meine Mutter lächelte und wandte sich ab, um in ihr Arbeitszimmer zu gehen. Doch jetzt hatte ich ein Problem. Mal wieder. Mit ihr. »Mama, echt jetzt? Heute? Nach Nürnberg? Du hast versprochen, dass wir –«
Meine Mutter drehte sich zu mir um. »Ich weiß doch, ich weiß, Nellie«, sagte sie sanft. Um sofort wieder zur Powerfrau zu werden. »Und ja: heute! Falls ihr nicht irgendwann unter der Brücke schlafen wollt!« Sie warf einen Blick auf die Frühstückstafel, dann auf Eva Seewald. Die hob abwehrend die Hände. »Hast du das tatsächlich alles selbst gemacht, Schatz?«
»Was denkst du?«, sagte ich leise.
»Das ist so lieb von dir.« Sie ordnete mit der Hand eine Haarsträhne. »Es tut mir wirklich leid, Nellie. Ich verspreche dir, morgen Abend haben wir bestimmt Zeit füreinander, wenn ich aus Nürnberg zurück bin. Wo ist eigentlich dein Bruder?«
»Er weiß Bescheid, dass es Familienfrühstück gibt.«
»Ach, lass ihn doch lieber noch schlafen – die beiden waren ja gestern wieder lang unterwegs! Ihr macht euch dann später einen schönen Tag, ja? Wie sehe ich aus? Brauchst du Geld?«
»Ja. Immer noch gut. Nein«, sagte ich. Eva Seewald hatte sich während unserer Unterhaltung, die im Grunde keine war, lautlos in die Küche zurückgezogen.
»Bist einfach die Beste! Meine Große!«, sagte meine Mutter ergriffen. Sie langte nach dem Glas Orangensaft, das an ihrem Platz am Kopf der Tafel stand, trank die Hälfte in einem Zug aus, stellte das halb leere Glas geräuschvoll auf ihrem Teller ab und rauschte hinaus. In unserer Eingangshalle kollidierte sie mit meinem jüngeren Bruder. Einem durchtrainierten Adonis in Boxershorts.
Den kleinen Prinzen und mich trennten gerade mal eineinhalb Jahre. Meine Mutter hatte die Dinge schon immer angepackt und durchgezogen.
»Du bist ja schon wach, mein Liebling«, sagte sie und wuschelte ihm durchs Haar, »hattet ihr Spaß gestern Abend?«
»Überwiegend«, sagte der kleine Prinz mit schleppender Stimme, und wer genauer hinsah, hätte an der Größe seiner Pupillen sofort erkennen können, dass der Spaß ziemlich groß gewesen sein musste. Doch die Gefahr, dass meine Mutter genauer hinsehen würde, war gering. »Bei diesem Lärm kann aber niemand pennen«, murmelte mein Bruder.
»Deine Schwester hat Frühstück gemacht!«, sagte meine Mutter beschwichtigend. »Und ich hab von jetzt auf gleich eine Besprechung. Ich bin dann im Arbeitszimmer. Keine laute Musik, Kinder, ja? Es wird nicht lange dauern.« Und schon war sie auf und davon.
»Klar, Mama«, rief Max ihr hinterher. Zu mir sagte er: »Mega, Nellie!« Und meinte damit den Frühstückstisch.
Ein paar Sekunden später kam auch schon Maja angeschlichen. Maja-Florence Mühlberg, seine neue Freundin, genannt MFM. Sie trug einen Bademantel, der mir sehr bekannt vorkam. War ja auch meiner. Oben spannte er etwas, denn MFM, die offiziell als Influencerin arbeitete und inoffiziell von einem amerikanischen Trustfonds ihrer Eltern lebte, hatte sich angeblich schon mit neunzehn ihre Brüste vergrößern lassen. Jetzt konnte ich deutlich sehen, dass dieses Gerücht stimmte. Aber, was ging mich das an? Es war schließlich ihre Entscheidung gewesen, und es war Max, der mit den Dingern fertigwerden musste. Oder durfte, kam auf den Blickwinkel an.
»Hallo, Nellie«, sagte MFM und sah an sich hinunter. »Ist doch okay, oder?« Sie war kein Stück verlegen.
»Sicher, Maja. Fühl dich einfach wie zu Hause. Guten Morgen! Gut geschlafen?«
»Zu kurz!« Sie lächelte mich an. Hübsch war sie, ohne Frage. Aber das war mein Bruder Max ja auch.
»Mann, ist das geil. Du bist wirklich supersupermega, Schwesterlein«, sagte Max. Er hatte die Pancakes entdeckt.
»Ja. Echt voll schön, Nellie«, sagte Maja-Florence. »Aber wir würden gern im Bett frühstücken. Ist das fine für dich?«
Ohne meine Antwort abzuwarten, begann MFM, den Frühstückstisch zu plündern. Max half ihr dabei. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihnen dabei zuzusehen. Ich hätte gerne was gesagt, aber mir fiel keine passende Bemerkung ein. Aber das schien auch keinen zu kratzen. Nichts Neues unter der Sonne.
Ein paar Minuten später war das Frühstücksensemble verwüstet, das Traumpaar zog mit vier übervollen Tellern ab und ließ mich allein zurück. Ich langte nach der Schachtel mit den Kaminhölzchen und fachte eins an, um die Kerzen auf dem Tisch zu entzünden. Auf einmal verschwamm mein Blick. Heulst du etwa, Nellie? Ich kniff die Augen zu und ließ das brennende Streichholz auf den Tisch fallen. Als ich meine Augen wieder öffnete, kokelte eine Serviette. Dann züngelte ein blaues Flämmchen. Es roch nach Qualm. Doch ich konnte den Blick nicht abwenden. Aus dem Flämmchen wuchs eine Flamme empor. Sie wurde rasch größer, und das gefiel mir. Sonderbar, dachte ich. Schon breitete sich im Tischtuch ein kreisrunder brauner Fleck aus. Ich erwachte aus meiner Trance, griff nach dem Glas meiner Mutter und löschte das Feuer mit dem Rest ihres Orangensafts.
»Jesus Maria! Brennt es hier etwa?«, hörte ich die Stimme unserer treuen Perle, die manchmal als unsere Ersatzmutter in Erscheinung trat.
»Ich hab nicht aufgepasst, Eva«, entgegnete ich. »So ein Mist …« Wir betrachteten das Malheur. Wir schwiegen. Dann flüsterte ich: »Am besten ist es vielleicht, Sie lassen das Tischtuch verschwinden.«
»Natürlich, Nellie«, sagte Eva Seewald und lächelte mich wissend an. Wir verstanden uns blind, seit Jahren schon. »Willst du denn nichts frühstücken?«
Ich winkte ab. »Nein. Ich habe echt keinen Appetit mehr.«
»Dann räume ich mal ab«, erwiderte sie.
»Wer war das eigentlich vorhin, an der Tür?«
»Amerikaner«, sagte Eva Seewald. Sie senkte ihre Stimme. »Eine Frau Gordon und ein Herr Durand. Wirklich komische Leute und unfreundlich noch dazu. Wie ein Gangsterpärchen.«
»Echt jetzt? Die waren doch schon ein paarmal da, oder?«
Unsere Haushälterin nickte. »Aber zu ganz merkwürdigen Zeiten.«
Ich beschloss spontan, Bonnie und Clyde einmal persönlich kennenzulernen.
Eine Viertelstunde später stand ich mit einem Tablett Kanapees vor dem Arbeitszimmer meiner Mutter. Die hatte Eva Seewald blitzschnell aus den Resten meines Frühstücks gezaubert. Laute, aggressive Stimmen drangen durch die Tür. Es klang bedrohlich, was es nur noch interessanter machte.
»Mrs. Mahler, you’re a smart woman. So you know that business is not a one-way-street, don’t you?« Da redete eine Frau. Ihre Stimme war eiskalt.
»Mrs. Gordon … I apologize, but …« Die Stimme meiner üblicherweise so dominanten Mutter klang flehentlich. Es war nahezu ein Wimmern. So hatte ich sie noch nie gehört.
»Shut up, Mrs. Mahler. Sit down and listen!« Jetzt sprach ein Mann, unangenehm krächzend. Das musste dieser Mr. Durand sein. »Your house is really lovely, you must enjoy it very much.«
»Oh yes! Yes, well, yes, we do. But, Mrs. Gordon, Mr. Durand …« Das Tablett wog inzwischen eine halbe Tonne, aber ich musste einfach weiterlauschen. »Well I’m sure you’re here, because you’ve heard about the city’s decision, concerning the main train station area, but I –«, setzte meine Mutter in beschwichtigendem Ton an.
»Obviously you have already invested our part of the deal very propperly here«, unterbrach sie Mrs. Gordon. »But in fact we are a little worried about your part. There is rumor.«
»Of course there is rumor! I am perfectly aware of it. But, listen: As a sign of my appreciation I could, well, I can offer you … I have another appartmenthouse in the city center and I would be more than glad –«
Was redete meine Mutter denn da?
»Bullshit!«, rief der obskure Mr. Durand. »Rumor is, the contract has already been signed!«
»No, no, no! That’s not the case!«, rief meine Mutter. »There’s still an opportunity. Everything is still possible for us. Just give me a little more time!«
»You’ve had enough time«, sagte das Arschloch.
»Please – give me the chance to show you –«, rief meine Mutter, als die Tür zu ihrem Arbeitszimmer aufflog und Supergirl erschien, um eventuelle Gefahren für meine Familie mit exquisiten Kanapees abzuwenden.
»Nein!«, schrie meine Mutter. Sie erschrak bis in die Haarspitzen, als sie mich bemerkte. Ich erschrak ebenfalls. Meine Mutter presste sich hinter dem Schreibtisch in ihren Chefsessel, während dieser amerikanische Schmierlappen beide Hände auf den Armlehnen abstützte, sich tief zu ihr hinunterbeugte und seine behaarte Nase viel zu nahe an ihr Gesicht hielt. Ich sah, dass meine Mutter Angst hatte. »Raus! Nellie – raus!«, rief sie. »Ich hatte mir doch explizit jede Störung verbeten!«
Explizit war eines ihrer Lieblingsadjektive.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Durand drehte sich zu mir um. Wer zur Hölle trug heutzutage sein Haar so gegelt? Mir kam der absurde Gedanke, hier würde ein Film gedreht. Ein ganz, ganz mieser Mafiafilm. Denn dieser Typ sah tatsächlich aus wie ein Schuldeneintreiber, während seine ganz in Schwarz gekleidete Partnerin vermutlich die Ansagen machte. Sie hatte eine Kelly Bag von Hermès. Wow, dachte ich. Ich nahm nicht an, dass es sich bei der Tasche um einen Fake aus dem Netz handelte.
»’tschuldigung«, sagte ich kleinlaut. »Ich dachte nur –«
»Bitte, Nellie!«, sagte meine Mutter und sah mich eindringlich an. »Ich habe alles im Griff.«
Danach sah es zwar nicht gerade aus, trotzdem stellte ich das Tablett mit den Kanapees auf dem runden roten Ledertischchen ab, das zu einem englischen Teemobiliar-Ensemble gehörte, das zwar von Eva Seewald regelmäßig abgestaubt, aber nie benutzt wurde. Ein Erbstück meines Vaters.
Als ich die Tür zum Arbeitszimmer leise hinter mir schloss, fragte die Schwarze Witwe meine Mutter: »So, this was your daughter?«
»Yes … Well …«, stotterte meine Mutter, »but let’s get back to the point. Just give me the chance to –«
»She’s really nice«, unterbrach Gordon sie. Ein Kompliment, auf das ich aus seinem Mund verzichten konnte.
»Listen, you can trust me and see for yourself tonight!«
So unterwürfig hatte ich meine Mutter noch nie reden hören. Wirklich nicht. Dass sie mit diesen beiden Gestalten Beef hatte, stand zweifelsfrei fest. Aber ich konnte mir nicht erklären, was da vor sich ging. Was meine Mutter dazu veranlasste, diese beiden Vollhonks nach Nürnberg zu einer Tagung des Deutschen Städtetages mitzunehmen. Sie überhaupt zu empfangen! Wäre da eben nicht dieses aggressive Knistern in der Luft gewesen, hätte ich mich über diese absurde Situation wahrscheinlich kaputtgelacht.
Dass es zwischen Töchtern und Müttern Konflikte gibt, ist keine neue Erkenntnis. Wir bildeten da keine Ausnahme. Ich war vor dreiundzwanzig Jahren in ihre perfekte Welt hineingeboren worden. Ich war in dieser perfekten Welt groß geworden, und meine Eltern hatten mehr oder weniger alles dafür getan, damit ich in dieser perfekten Welt unbesorgt weiterleben konnte. Auch wenn ihre etwas ungewöhnliche Ehe inzwischen nur noch auf dem Papier bestand. Bestimmt waren meine Mutter und mein Vater tatsächlich mal ineinander verknallt gewesen, vielleicht hatten sie sich sogar geliebt, doch in den vergangenen fünfzehn Jahren – das hatte ich mühsam nachgerechnet – hatten sich beide voneinander entfernt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Während meine Mutter damals begonnen hatte, sich politisch zu betätigen, und inzwischen das Amt der Stadträtin für Stadtentwicklung bekleidete, jettete mein Vater als geschäftsführender Gesellschafter seiner mittlerweile international operierenden Immobilienentwicklungsgesellschaft um die Welt und baute und verkaufte Einkaufszentren und luxuriöse Seniorenresidenzen. Zurzeit war er in Fernost unterwegs. Seit Monaten schon.
Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass für meinen Bruder und mich kein Kuschelkurs vorgesehen war. Wir beide fielen ins Ressort unseres Vaters, was einerseits ganz schick war, doch gegen ein bisschen mehr heile Familienwelt hätte ich auch nichts gehabt.
Ich versuchte dennoch, mich bei meinen Eltern zu revanchieren und eine gewisse Dankbarkeit zu zeigen, indem ich mein Studium durchzog. In spätestens einem Jahr würde ich meinen Bachelor in Sozialwissenschaften machen. Allerdings war ich dabei nicht, wie die meisten meiner Kommilitonen hier in München, darauf angewiesen, für meinen Lebensunterhalt Supermarktregale aufzufüllen oder als Tellertaxi durch ein Restaurant gescheucht zu werden. Mein Kontostand belief sich dank der monatlichen Zuwendungen meines Vaters auf aktuell 44.897 Euro und 72 Cent; darüber hinaus hatte meine Großmutter meinem Bruder und mir ein hübsches Aktienpaket hinterlassen, und für alle Fälle besaß ich auch noch eine Kreditkarte, unlimited, für die ebenfalls mein Vater bürgte. Mein Kleiderschrank war begehbar, ich hatte ein eigenes Badezimmer, wenn ich essen gehen wollte, ging ich essen, und wenn ich Lust auf Champagner hatte, trank ich Champagner. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht hatte, war ein Freund. In unserer Filterblase glaubten zwar viele, dass ich bangable war, aber, sorry folks: Ich war alles andere als eine Tinderella, sondern sehr wählerisch. Sehr, sehr wählerisch. Deshalb hatte ich bisher auch nur selten ein Date und noch seltener Sex, und die drei Beziehungen, die ich bisher eingegangen war, hatten jeweils nur ein paar Monate gehalten.
Mein Bruder Max war da anders. Vollkommen anders. Er verballerte hingebungsvoll sein Geld, nahm so ungefähr alles mit, was ging, und soweit ich mich erinnern konnte, war MFM seine erste längere Beziehung. Max war viel sorgloser als ich. Er investierte gern und viel in Partys und natürlich auch in seinen Rausch. Leider etwas zu viel, wie ich fand. Mein bester Freund Janosch besaß die notwendigen Connections und belieferte neben meinem Bruder noch ein paar weitere handverlesene Stammkunden. Mich interessierte das Zeug nicht sonderlich. Nur in winzigen Dosen, und das selten. Aber, hey: Bin ich vielleicht Mutter Teresa?
2.
Janosch
Nellie, Mutter Teresa? Genug Charakter hätte sie jedenfalls. Ich kann das beurteilen, denn Nellie und ich waren wirklich Freunde. Sie war für mich die große Schwester, die ich nie hatte. Dafür konnte ich ihre düsteren Gedanken vertreiben. Bei mir konnte sie sich ausheulen, sich gehen lassen und ihre Seele auftanken. Es ist nicht immer einfach, eins von diesen Rich Kids zu sein. Es kostet mehr als nur viel Geld, um dazuzugehören. Ich weiß, wovon ich rede. Denn im Gegensatz zu ihrem Bruder Max und der ganzen abgefuckten Crowd war ich aus der Kloake nach oben gespült worden. Aber ich bin kein Weltertränker. Alles in allem war es ja auch eine fette Party. Ein Mega-Rave, zu dem ich mich selbst eingeladen hatte.
Freunde kann man sich aussuchen. Eltern und Geschwister nicht. So fing es schon an: Wo ich geboren wurde, wer mich gezeugt hatte und wie ich aufgewachsen war, das machte den Unterschied.
Bei mir war es die Platte in Milbertshofen, in der siebten Etage. Meine Eltern stammten beide aus Ingolstadt. Als Kind hatte ich, soweit ich mich erinnern kann, nichts auszustehen, im Gegenteil. Eine Watschn kriegten immer die anderen, wenn sie was ausgefressen hatten. Bei uns daheim hieß die Höchststrafe Fernsehverbot, und meist wurde ich schon nach einem Tag begnadigt. Spätestens dann, wenn meine Eltern mit mir über meine Verfehlung geredet hatten. Doch dann hatte meine Mutter Tatjana meinen Vater Knall auf Fall verlassen, als ich dreizehn war, also vor knapp zehn Jahren. Sie hatte auch mich verlassen. Aber mein Vater redete niemals darüber, warum meine Mutter fortgegangen war. Das tut er bis heute nicht. Jedenfalls nicht mit mir.
Mein Vater heißt Hermann. Eher klein und untersetzt mit buschigem Oberlippenbart, der tagsüber für die Münchner Stadtentwässerung einen orangefarbenen Overall und einen weißen Bauarbeiterhelm spazieren trägt. Meistens arbeitet er allerdings unter der Erde. Dort, wo die Ratten herumlaufen und es höllisch nach Scheiße stinkt. Doch er ist stolz darauf, dass er bisher noch keinen einzigen Tag in seinem Job gefehlt hat. Sogar nachdem meine Mutter an jenem Sonntagabend mit zwei Koffern in der Hand grußlos unsere Dreizimmerwohnung verlassen hatte, um unten auf der Straße in den Mercedes eines Fremden einzusteigen, war er am nächsten Morgen wie immer zur Arbeit gegangen.
Ich dagegen hatte an jenem Tag die Schule geschwänzt. Hatte mich rumgetrieben, ein paar Mülleimer kaputt getreten, zwei Sechstklässler verprügelt, ein Fahrrad geklaut und im Supermarkt eine Schachtel Zigaretten. Ich hatte ebenfalls beschlossen, erwachsen zu sein und zu rauchen. Um dann am nächsten Tag in etwa genauso weiterzumachen.
Das einzige Vergnügen, das mein Vater sich bis heute gönnt, ist eine Dauerkarte für die Sechziger, im Oberrang der Allianz-Arena. Denn der wahre Münchner, hat er mir mal erzählt, würde niemals den FC Bayern im Stadion unterstützen. Dabei ist er Ingolstädter. Er hatte mich früher ein paarmal mitgenommen, aber Fußball geht mir so was von am Arsch vorbei, dass mein Vater es sehr schnell aufgegeben hatte. Dafür hatte ich bei allen Spielen des TSV1860 fortan sturmfreie Bude, von mittags bis in den Abend hinein, denn nach jeder Partie ging mein Vater noch ein paar Helle trinken, um mit seinen Fußballkumpeln von der Stadtreinigung das Spiel zu analysieren. Und wenn 1860 auswärts spielte, dann hockten sie alle in ihrer Stammkneipe. Früher hatte er wohl selbst ziemlich gut Fußball gespielt, in den Achtzigern, und es mit den Ingolstädtern bis hinauf in die Bayernliga geschafft. Im Grunde hätte er Profi werden müssen. Oder wenigstens Bundestrainer. Doch dann hatte ihm ein Gegenspieler im Bayernpokal das rechte Knie zertrümmert, und aus war es mit dem Traum von der Fußballerkarriere und dem großen Geld. Meine Eltern waren nach München umgezogen, mein Vater wurde Kanalreiniger bei der Stadt und legte im Laufe der nächsten Jahre dreißig Kilo zu. Gut möglich, dass meine Mutter auch deswegen in den Mercedes gestiegen war.
Immer dann, wenn der kleine Janosch allein zu Haus war, konnte er für ein paar Stunden ungestört verrückte Sachen machen und auf dem Balkon rauchen. Dummerweise besaß der kleine Janosch weder genug Geld für Zigaretten noch für seinen ausgefallenen Modegeschmack. So hatte er schon wenig später in einigen Münchner Läden und Kaufhäusern Hausverbot und vier Anzeigen wegen Ladendiebstahls kassiert. Die Hausdetektive wunderten sich jedes Mal, warum ich BHs, Röcke und Absatzschuhe hatte mitgehen lassen. Und Lippenstift, Nagellack, Kajal und Lidschatten. Ich fand es schon damals einfach geil, mich zu verkleiden.
Abgesehen von meinem Vater ist Nellie bis heute die Einzige, die von meiner Verurteilung zu einem Monat Jugendarrest und den 160 Sozialstunden weiß. Damals kam dann endgültig raus, dass ich anders war als die meisten anderen Jungs. Ich bin schwul, und dazu stehe ich, denn Versteck spielen liegt mir nicht.
Kaum war ich aus dem Arrest raus, stattete uns das Jugendamt einen Besuch ab. Mein Vater hatte nur genickt und das sozialpädagogische Gequatsche zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder rausgelassen. Ziemlich cool von ihm, aber es verblüffte mich. Sollte es ihn wirklich nicht aufregen, dass ich mich aufstylte wie ein bekiffter Flamingo? Dass ich monstermäßig geklaut hatte? Als die beiden Tussen vom Amt wieder weg waren, schaute er mich ernst an und sagte: »Wenn du unbedingt etwas besitzen willst, was dir nicht gehört, dann lass dich wenigstens nicht dabei erwischen.« Dann nahm er mich lange und fest in den Arm. So wie er und meine Mutter es früher immer getan hatten, als ich noch ein Kind gewesen war.
»Ich sag dir, Janosch, was du da in den Geschäften einsteckst, das könntest du dir doch ganz leicht selbst verdienen. Betrug lohnt sich erst ab fünf Millionen, verstehst du? Ach, wurscht. Was auch passieren mag, schwul oder nicht schwul: Du bist und bleibst mein Sohn.«
Diese Sätze von meinem Vater krieg ich bis heute nicht aus dem Schädel. Und es hatte damals auch was in mir ausgelöst. Ich hatte mich dann tatsächlich zusammengerissen, um zunächst mal die Schule hinter mir zu lassen. Was mir nach einer Extraschleife auch mit Ach und Krach gelang. Doch nach der Mittleren Reife wusste ich trotzdem nur drei Dinge ganz genau. Erstens: Ich war turbo in der Birne und konnte noch schneller quatschen. Zweitens: Ich war schwul und mochte kreischend bunte Klamotten. Und drittens: Ich interessierte mich null fürs normale Leben. Davon hatte ich bis dahin schon eine Überdosis bekommen.
Wo wir gerade bei Überdosis sind: Ich hatte mittlerweile André kennengelernt, der einen Concept Store besaß. Ein feiner und großzügiger Kerl mit einem exklusiven Kundenkreis. Geliefert wurden jedoch nicht nur Mode und die dazugehörigen Accessoires, sondern all das schöne Zeug, das so wunderbar entspannend wirkt. Oder anregend oder bunte Bilder vor den Augen tanzen lässt. Zwischen uns passte es, und die Sache lief gut, weil wir beide kein Täterprofil aufwiesen, wie es im Polizeideutsch heißt. Natürlich war es riskant, aber wir waren immer sehr vorsichtig. Und André konnte mir hundertprozentig vertrauen.
Doch die Katakomben-Sache hatte alles verändert, und zwar in Warp-Geschwindigkeit. André war nun mal sehr diskret, und so drohte plötzlich meine Geldquelle zu versiegen. Ohne die konnte ich mir meine Mitgliedschaft im exklusiven Kreis der wohlstandsverwahrlosten Rich Kids jedoch abschminken. Diese Sache sollte auch meine Freundschaft mit Nellie auf die Probe stellen. Aber das konnten wir alles noch nicht wissen, als sie an jenem Kopfschuss-Tag völlig down in Andrés Laden auftauchte.
Mein Therapeut ist der Meinung, ich würde gute Fortschritte machen. Jetzt wisst ihr’s: Ich bin in einer Klinik. Im Schwarzwald. Seit zwei Monaten schon, obwohl ich garantiert kein Psycho bin. Aber ich möchte in Zukunft schon gern besser mit mir klarkommen als in den letzten Jahren.
Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, sehe ich Grün, ganz viel Grün. Ich sehe Wald und Wiesen, Hügel und Berge. Kein Augen-Tinnitus durch Stroboskopblitze, kein Abschädeln, keine Bildschirmbräune mehr. Dafür Enterbrainment bei maximaler Entschleunigung. Diese Privatklinik ist jedenfalls kein Knast, sondern eher ein Luxushotel. Nichts für Kassenpatienten. Aber Nellie, André und sogar mein Vater haben die Differenz bezahlt. Diese drei Menschen lieben mich – und ich liebe sie und will weder sie noch mich enttäuschen.
Ich habe das Mountainbiken für mich entdeckt. Ich kiffe nicht mehr und trinke den ganzen Tag lang grünen Tee und Mineralwasser. Ich esse neuerdings sogar gerne Fisch, Gemüse und Salat. Und zweimal pro Woche habe ich Klangschalentherapie. Total abgespact. Neulich hat mein Therapeut vorgeschlagen, ich könnte diese ganze Katakomben-Sache doch mal aufschreiben. Mit Abstand und so. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Die Wahrheit hat in diesem Fall mindestens sechs Seiten, eher mehr. Damals waren schließlich eine Menge Leute auf diesem Rave in den Katakomben. Die müsste man mal fragen, was damals so krass schiefgelaufen war. Und warum. Trauriges Emoji, Leute!
3.
Nellie
Am Nachmittag wollte ich ein bisschen in Andrés Concept Store an der Maximilianstraße abhängen. Janosch arbeitete dort, dreimal pro Woche, manchmal auch öfter.
Sein Liebhaber André Falkenhagen behauptete gern, dass er erst neunundzwanzig sei. Ich schätzte ihn auf etwa fünfundvierzig.
André war gebildet, kunstinteressiert, charmant, weltoffen, und er passte immer schön darauf auf, dass sich sein lustiger Paradiesvogel mit den gefärbten blond-schwarzen Haaren nicht verflog. Aber dafür hatte ich heute kein Auge. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich war down. Ich war genervt. Ich brauchte dringend eine Auszeit.
Der Store glich einem Wohnzimmer, in dem ich mich schon immer heimisch gefühlt hatte. Zwei prächtige Louis-XIV-Sitzgruppen und wild gemusterte, dicke Orientteppiche bildeten die Kulisse für einige wenige verchromte Kleiderstangen. Keins der Teilchen daran hatte ein Preisschild. Eigentlich deutete nichts darauf hin, dass es sich um eine Boutique handelte.
Also fläzte ich mich auf eines der beiden barocken Sofas, nippte an meinem Champagnerkelch und gönnte mir ein paar belgische Trüffelpralinen, während ich Janosch dabei beobachtete, wie er eine seiner Stammkundinnen verarztete. Sie hieß Löwenstern oder Löwenstein oder so ähnlich und war, na ja, kompliziert. Kein Problem für Janosch, der trotz seiner gerade mal zweiundzwanzig Jahre Ruhe und Souveränität ausstrahlte – jedenfalls dann, wenn es ums Verkaufen ging. Nach gut eineinhalb Stunden Geduldsprobe verpasste er ihr ein Dolce-&-Gabbana-Cocktailkleid und dazu passend ein Bottega-Veneta-Abendhandtäschchen. Beides zusammen für 3495 Euro. Frau Löwenstern oder Löwenstein zahlte mit Karte, während Janosch das Kleid sorgfältig zusammenlegte, in Seidenpapier einschlug und beinahe schon andächtig in eine quadratische Papiertüte legte. Als die Karte durchgezogen war, überreichte er seiner Stammkundin zuerst die Tüte und dann die Handtasche. Ein feierlicher Moment. »Ihre neue Begleiterin, Frau Löwenstein«, sagte Janosch. »Warten Sie, ich bringe Sie zur Tür!«
Auf dem Weg zur Ladentür kramte Frau Löwenstein umständlich in ihrer alten Handtasche, die eigentlich auch noch sehr neu aussah.
»Und wie gesagt, wenn wir noch etwas ändern sollen …«, sagte Janosch. Sie reichte ihm die Hand. Janosch ergriff sie, und so standen die beiden ein paar Sekunden lang händeschüttelnd an der Ladentür. »Vielen Dank!«, sagte Janosch und deutete einen Diener an, »beehren Sie uns bitte bald wieder!«
»Nein, ich habe zu danken – für Ihre Geduld, Herr Janosch!« Sie zwinkerte ihm zu. »Und ich bestehe darauf!« Jetzt erst ließ sie seine Hand los und verließ den Store.
Janosch hatte wirklich ein unfassbares Talent, Menschen für sich einzunehmen. Besonders diese Art Frauen, die vorzugsweise auf High Heels in Andrés Concept Store stolperten, um sich zu den Klängen von softer Lounge-Musik glücklich zu shoppen.
Mein liebster Buddy von allen taumelte mit gespielter Erschöpfung auf mich zu und ließ sich neben mir aufs Sofa fallen. »Oh. Mein. Gott!«, sagte er und griff nach der Champagnerflasche.
»Du hast echt Nerven. Das muss man erst mal schaffen. Respekt.«
»Die Alte macht mich jedes Mal fertig. Aber wenigstens gibt sie immer Schmerzensgeld!« Er fummelte den Fünfzigeuroschein auseinander, den ihm Frau Löwenstein beim Abschied in die Hand gedrückt hatte, und steckte ihn einfach gefaltet in seine Hosentasche.
Ich blickte auf meine Armbanduhr. »Wollen wir dann? Langsam werde ich duselig.«
»Aber das ist doch das Beste an diesem Job!«
Wir stießen an. Janosch mit der Champagnerflasche, ich mit meinem Glas. Dann zückte er sein Handy, erhob sich vom Sofa, schaltete den Selfie-Video-Modus ein und machte eine Story: »Hey, ihr Rich Kids da draußen«, sagte er ins winzige Objektiv, »heute hab ich den ganzen Tag hier bei André im besten Concept Store der Welt verbracht. Und ich darf ihn managen. Hashtag LoveMyLife. Ich hoffe, ihr hattet auch einen so fantastischen Tag wie ich, ihr Süßies. Später zeige ich euch noch, welches Outfit ich auf der fettesten Party des Jahres tragen werde! Bleibt also dran – Knutscher …« Er setzte die Champagnerflasche an, gönnte sich den letzten Schluck, beendete das Video und drückte auf »Senden«.
»Das habe ich jetzt aber nicht gesehen!«, sagte André, der unbemerkt aus dem Lager an den Counter getreten war. Er grinste.
Was meinte Janosch mit Party?
»Whoops, sorry! Wasn’t me!«, sagte Janosch, stellte die leere Flasche ab und ging hinüber zu seinem Chef. »Nellie und ich sind dann gleich mal off!«, sagte er, umarmte André, küsste ihn auf den Mund.
»Hi, André!«, sagte ich.
Er winkte mir lässig zu und löste sich von seinem Toyboy. »Hallo, Nellie! Grüß dich!« Zu Janosch sagte er: »Ich mach auch gleich los. Soll ich nachher Essen für dich mitbestellen?«
Janosch zierte sich. »Ich glaube nicht, vielleicht bleibe ich heute bei Nellie. Könnte spät werden. Heute Nacht ist der geilste Rave ever!«
Was für ein Rave? Ich hatte tatsächlich keinen Schimmer.
»Na dann wünsche ich euch viel Spaß, ihr beiden Hübschen«, erwiderte André.
»Kommst du?«, fragte Janosch in meine Richtung.
»Willst du etwa so raus? Im Hemdchen?« Was Janosch am dringendsten benötigte, war pragmatische Lebenshilfe, am besten 24/7. »Draußen friert es!«
André verschwand im Durchgang zum Lager und kehrte wenige Augenblicke später mit einem Daunenwintermantel zurück. Ganz der besorgte Lover. Er half Janosch hinein.
»Und? Was sagst du?«
»Toll«, sagten André und ich gleichzeitig. Dann fragte ich Janosch endlich: »Was für eine Party?«
»Wait and see, Darling!«
Janosch öffnete mir die Ladentür und rief »Ciao, Ciao, Schatz!« nach hinten.
»Küsschen!« André lächelte ihn an.
Dann standen wir auch schon draußen auf dem zugigen Bürgersteig.
»Wollten wir es heute Abend nicht ruhig angehen lassen?«
»Nellie, was meine ich wohl, wenn ich Party sage?«
»No way, Janosch. Wir wollten chillen.«
»Keinen Bock? Echt nicht?«
»Seh ich vielleicht so aus?« Ich winkte einem Taxi, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite fuhr. Der Fahrer gab uns ein Handzeichen und bedeutete uns, dass er wenden und uns aufsammeln würde. Manchmal muss man Glück haben im Leben.
Janosch kuschelte sich in den Daunenmantel. »Ist wirklich arschkalt«, sagte er. »Aber André ist süß, nicht wahr?«
»Ja, ist er. Gestern Nacht haben sie übrigens einen Obdachlosen unter der Wittelsbacher Brücke gefunden. Tot, erfroren«, sagte ich.
»Alter, echt? Scheiße … Aber wer bei dieser Kälte unter ’ner Brücke schläft, muss auch einen Dachschaden haben.«
»Janosch, was bist du denn für ’n Asi!«, sagte ich. Das Taxi hielt. »Los, steig schon ein!«
Eine halbe Stunde später lagen wir auf meinem extrabreiten Bett, zappten ein bisschen und zogen uns knusprige lauwarme Nachos mit Käsesauce und Jalapeños rein. Aber Janosch zappelte herum wie ein kleiner Junge, der es bis zur Bescherung unterm Tannenbaum nicht aushalten kann, und stierte immer wieder auf sein Telefon. Gerade als der Vorspann zur dritten Episode von Stranger Things begann, ploppte eine WhatsApp auf dem Display auf. Janosch las die Nachricht und grinste breit.
»Ich wusste es!«, sagte er. »Endlich! Hier ist die Einladung mit den Koordinaten. OMG, das wird so fett, Nellie! Hör zu: Ich kann da nicht nicht hingehen! Wir können da nicht nicht hingehen!«
»Zeig mal!«, sagte ich. Er hielt mir sein Smartphone vors Gesicht. Auf dem Display stand in Versalien: »SECRET RAVE // MAIN STATION // CATACOMBS // DOORS11:00PM.«
Ich hatte keine Ahnung, was die Catacombs waren.
»Unterm Hauptbahnhof soll es massenhaft Gänge und Tunnel und Höhlen geben«, erklärte Janosch, »vermutlich sogar eine ganze U-Bahn-Station, die aber nie in Betrieb genommen wurde. Da gehen heute alle hin! Bitte, Nellie! Bitte, bitte, bitte! Wir sind auch GL-gecheckt …«
Ach so – wir standen also bereits auf der Gästeliste?
»Du hast es also schon die ganze Zeit gewusst!«
»Surprise, surprise!« Janosch lachte.
»Und ich hatte mich auf bestie-quality-time gefreut. Wer veranstaltet die Party überhaupt?«
»Auch surprise!«, sagte Janosch und wandte schnell den Blick ab. »Deshalb heißt es doch Secret Rave.«
»Ich hab aber nichts zum Anziehen.«
Janosch lachte laut auf: »Mrs. Nellie Mahler, Jesus Christ! Du hast einen begehbaren Kleiderschrank so groß wie ein Zimmer im Studentenwohnheim.«
Erwischt. Janosch hatte gewonnen. »Wie viel Zeit haben wir noch?«
»Zwei Stunden. Ich bräuchte allerdings ein bisschen von deinem Make-up. Und von deinem Kajal.«
»Kriegst du. Weißt du doch.«
»Love you, Babe!«, sagte Janosch und rollte sich von meinem Bett hinunter, um mein Bad zu verwüsten, während ich angestrengt überlegte, was ich anziehen könnte – zu einer Party im Untergrund. In den Katakomben. Und das bei der Kälte.
In diesem Moment flog die Tür zu meinem Schlafzimmer auf. Janosch kreischte erschrocken auf.
»Na, ihr Muschis? Was geht?«, rief mein Bruder. Max trug noch immer die Boxershorts vom Morgen. Er hielt mir sein Smartphone vors Gesicht und begann, eine Story zu machen.
»Was soll schon gehen?«, fragte ich. »Lass das!« Ich erhob mich und ging auf ihn zu. »Mach bitte dein scheiß Handy aus. Und dann löschst du diese letzte Aufnahme. Ich meine es ernst, hörst du?«
Max winkte ab. »Ist ja schon gut«, sagte er und entfernte das Videofragment aus dem Speicher.
»Brav«, lobte ich ihn.
»Schon von der Party gehört? Heute, unterm Bahnhof.« Max tippte auf sein Handy und zeigte Janosch und mir die Einladung. »Save. Kommt ihr mit?«
»Klar. Das wird fett, Mann! Ich kenn die Location: Ich hatte da unten mal was mit so ’ner Businessbraut. Mega abgefahren.«
»Die Businessbraut oder die Location?«, fragte ich. Too much information. Brüder haben nämlich keinen Sex. Eltern übrigens auch nicht. Und wenn doch, dann will ich nichts davon hören. Max kicherte. Ich sah ihn genervt an, denn er hatte offensichtlich bereits was eingeworfen. Meine Alarmglocken begannen zu läuten. »Ich hab keinen Bock auf Stress!«
»Wer redet denn von Stress? Wir wollen doch bloß zusammen feiern!«
»Ich rede von Stress.« So lieb ich ihn hatte, aber drauf war er einfach verdammt anstrengend. »Du ballerst mir in letzter Zeit einfach zu viel.«
»Und du nicht, oder was? Hör doch auf!«, sagte Max und startete ein neues Video.
Er wusste, wie er mich von null auf hundert bringen konnte. Ich riss ihm das Smartphone aus der Hand. »Aber zwischen Champagner und Gesichtskirmes ist immer noch ein eklatanter Unterschied!«, sagte ich. »Synthetisches Zeug habe ich jedenfalls noch nicht eingeworfen.«
»Hör auf zu singen, Schwesterherz!« Max lachte.
»Kannst du jetzt bitte gehen? Oder am besten gleich ganz ausziehen? Nimm einfach eine von Mamas oder Papas Wohnungen. Und tschüss!«
»Zieh du doch aus!«
Janosch desertierte auf Zehenspitzen vom Schlachtfeld und verschwand in meinem begehbaren Kleiderschrank. Gut so. Es würde keinen Zeugen geben.
»Ich will aber gar nicht ausziehen, Max. Ich studiere, und hier habe ich wenigstens ab und zu meine Ruhe.« Ich gab ihm sein Telefon zurück. »Und jetzt lass Janosch und mich bitte allein.«
»Tja, das ist eben der Unterschied. Ich muss nicht studieren.« Max dachte nicht daran, zu verschwinden.
»Trotzdem kein Grund, sich dauernd Pillen einzuwerfen wie Gummibärchen.«
»Immer diese Übertreibungen«, sagte mein Bruder. »Und wer redet denn von Pillen? Du solltest mal Liquid Ecstasy probieren.«
Jetzt waren es keine Alarmglocken mehr. Sondern Sirenen. »Max, du spinnst! Bist du etwa auf GHB?«
Er winkte lässig ab.
»Du weißt doch, ich hab das im Griff. Und ich bin heut Abend ganz sicher dabei…«
Eine Erleuchtung blendete mich. »Hast du etwa was mit diesem Rave zu tun?«
»Vielleicht«, sagte er, meinte aber selbstverständlich und drückte mir einen feuchten Kuss auf die Wange. Einen richtigen Schmatzer. Ekelhaft.
»Wenzel und ich sind die Veranstalter. Die Bouncer wissen Bescheid, du und Janosch, ihr seid GL! Bis später dann!«, rief er und trat endlich den Rückzug an.
»Nein! Garantiert nicht bis später!«, rief ich ihm hinterher. Aber das hätte ich mir auch sparen können, wenn ausgerechnet mein kleiner Chaos-Bruder ein Mitveranstalter dieser Party war. Eines illegalen Raves. Denn beim Feiern brachte Max sich vorzugsweise selbst in Gefahr. Jemand musste auf ihn aufpassen. Dieser Jemand war ich.
»Hat er sich verzogen?« Janosch lugte vorsichtig aus der Tür meines Kleiderschranks. »Was hältst du davon?« Er kam ins Zimmer und legte einen Catwalk direkt aus GNTM hin. Mein Paillettenjäckchen schmiegte sich perfekt an seine schlanke Statur.
»Schlichter geht es kaum«, sagte ich tonlos.
»Aber schlicht wäre ja auch nicht ich«, sagte der Superposer vor dem Spiegel. Er zückte sein Telefon und machte mehrere Selfies, selbstverliebt und narzisstisch, aber das war schließlich sein Kapital. »Wieso hast du mir diese Jacke eigentlich nicht längst geschenkt?«
»Du kannst sie sofort haben.«
»Bist du verrückt? Ich sag dir was, Nellie: Du bist viel zu nett für diese Stadt!«
»Okay, dann behalt ich sie.«
Janosch schüttelte den Kopf. »Geschenkt ist geschenkt!«
Der Verlust meiner Paillettenjacke war sicher nicht der Grund für die dumpfe Schwermut, die mich in diesem Augenblick überkam. Ich setzte mich auf mein Bett und vergrub das Gesicht in den Händen.
»Was hast du denn?«, fragte Janosch besorgt.
»Weiß nicht.« Mir war zum Heulen. Ich wusste nur nicht, warum.
»Moment, Nellie-Darling«, rief Janosch, »gib mir genau sieben Sekunden!« Er verschwand in meinem Kleiderschrank, und ich konnte hören, wie er meine Klamotten durchwühlte. »Hier! Das ist es doch!«, rief er, als er nach einer halben Ewigkeit mit einem Paillettenkleid zurückkehrte. Ich hatte völlig vergessen, dass ich es besaß.
»Was hältst du von Partnerlook?« Er setzte sein Janosch-Grinsen auf, damit ich mich wieder gut fühlte.
Ich gab mich geschlagen. »Yeah!«, sagte ich fröhlich, »ich hol uns dann mal eine Flasche!« Doch in Wahrheit dachte ich: »Oh, fuck.«
Ich erhob mich vom Bett, hielt Janosch am Ärmel fest. »Hör mal, Bro! Ganz im Ernst: Hast du meinem Bruder Liquid Ecstasy vertickt?«
»In den vergangenen drei Wochen hab ich Max gar nichts vertickt. Und von GHB lass ich die Finger.«
Ich sah ihn fragend an. Durchdringend. Janosch nickte heftig.
»Ich würd dich doch nicht anlügen, Nellie. Das Zeug geht gar nicht. Ich hab Max sogar davor gewarnt.«
4.
Magdalena
Mensch, Kollegin Kaltbrunner: Was hat Sie da bloß wieder geritten?« Oberkommissarin Christiane Sommer stützte sich mit beiden Händen auf meinem Schreibtisch ab und blickte mir zornig ins Gesicht. Sommer leitete die Dienststelle der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof. Sie war neunundfünfzig Jahre alt, eine erfahrene Beamtin, die im nächsten Jahr in den Ruhestand gehen würde und sich selbst als Mutter der Kompanie beweihräucherte. Doch leider war ich, Hauptkommissarin Magdalena Kaltbrunner, eines ihrer ungezogenen Kinder, das ständig über die Stränge schlug.