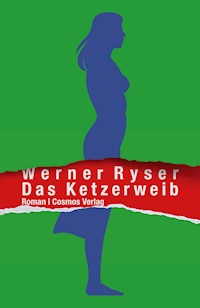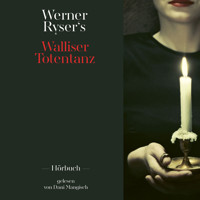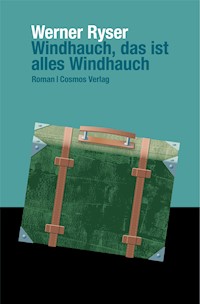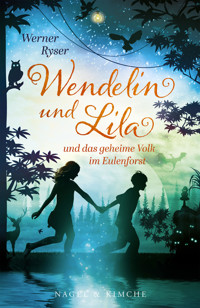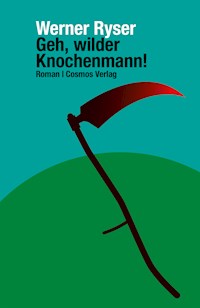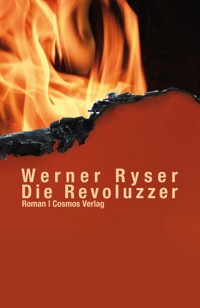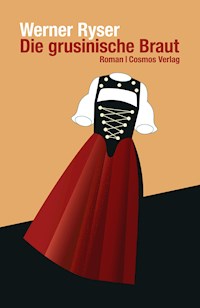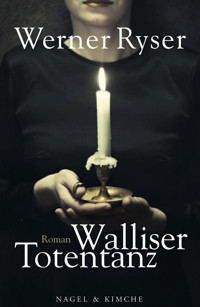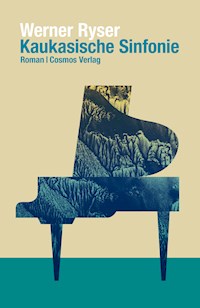
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cosmos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Werner Ryser erzählt die Geschichte von Simon, dem Emmentaler Auswanderer, der seinen Traum, in Grusinien Grossbauer zu werden, verwirklicht hat, und von Sophie, seiner Frau, die mit einem Fuss in der diesseitigen und mit dem andern in der jenseitigen Welt lebt. Sie haben drei Söhne, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Karl, den Arzt, der sich gegen die Ungerechtigkeiten der ständischen Gesellschaft im Zarenreich empört, Hannes, den Bauern, der einmal das elterliche Gut Eben-Ezer erben wird, sowie Jakob, den begnadeten Musiker, der mit seiner "Kaukasischen Sinfonie" seiner Seele ein Haus baut. "Kaukasische Sinfonie" ist der dritte Band einer Familiensaga, die mit den Romanen "Geh, wilder Knochenmann!" und "Die grusinische Braut" begonnen hat. Der Roman spielt vor dem Hintergrund weltgeschichtlicher Ereignisse: des Grossen Kriegs von 1914/18 und der Russischen Revolution, die das Schicksal der Menschen im kleinen Land zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer prägen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Ryser
Kaukasische Sinfonie
Roman
Für René Karlen
Alle Rechte vorbehalten
© 2021 by Cosmos Verlag AG, Muri bei Bern
Lektorat: René Karlen, Roland Schärer
Umschlag: Stephan Bundi, Boll
Satz und Druck: Merkur Druck AG, Langenthal
Einband: Schumacher AG, Schmitten
ISBN 978-3-305-00490-4
eISBN 978-3-305-00491-1
Das Bundesamt für Kultur unterstütztden Cosmos Verlag mit einem Förderbeitragfür die Jahre 2021–2024
www.cosmosverlag.ch
Inhalt
Sankt Petersburger Blutsonntag
Jakob
Alexander von Kutzschenbach
Ratischwili
Sophie
Baltische Suite
Katharinenfeld
Mayranoush
Erntedankfest 1917
Simon
Die Bolschewiki
Hannes
Sakartvelo
Eben-Ezer
Kaukasische Sinfonie
Das verheissene Land
Lipanali
Sankt Petersburger Blutsonntag
Er schlägt die neun Akkorde an, mit denen das Klavierkonzert Nr. 2 von Sergei Rachmaninow beginnt. Nur diese neun Akkorde. Immer wieder. Ein gewaltiges Crescendo. Die Ankündigung für etwas, das weit über ein musikalisches Ereignis hinausgeht. Er sitzt am Flügel auf der Bühne des Pavillons, der den Katharinenfeldern als Konzertsaal und Theater dient. Die Kerze, die er angezündet hat, beleuchtet kein Notenblatt, nur sein Gesicht. Während der ersten sechs Akkorde bleibt sein Oberkörper reglos. Nur der linke Arm bewegt sich, die rechte Hand schwebt bis zum nächsten Anschlag über den Tasten. Er hat die Augen geschlossen. Beim achten und neunten Akkord wirft er den Kopf ruckartig vor und zurück, so dass ihm sein rotes Haar in die Stirn fällt. Dann bricht er ab, legt beide Hände auf die Oberschenkel, konzentriert sich, beginnt von neuem. Er scheint mit seinem Spiel nicht zufrieden zu sein. Ich weiss nicht, weshalb. Mein Gehör ist nicht so geschult wie seines.
Am 8. Januar 1905 hat er Rachmaninows zweites Klavierkonzert im grossen Konzertsaal des Konservatoriums von Sankt Petersburg gespielt. Es gab nichts anderes als seine Musik. Sie war in mir, um mich. Nach dem dritten Satz, dessen Schluss seine ganze Kraft und Virtuosität erforderte, war es totenstill. Er bewegte sich nicht. Endlich brach tosender Applaus den Bann. Er stand auf und verbeugte sich. Und ich war unendlich stolz auf meinen jüngeren Bruder, Jakob Diepoldswiler.
Und jetzt, neun Jahre später, spielt er immer wieder die Eingangstakte dieses inzwischen berühmten Konzertes, als müsse er sich ihm ganz neu annähern. Nach dem zehnten oder zwölften Mal bricht er sein Spiel ab und wendet sich zu mir. «Wir werden es aufführen, Karl», sagt er, «am Erntedankfest im Oktober, hier in diesem Saal.» Er lächelt. «Du warst soeben Zeuge der ersten Probe.»
Ich bin fassungslos. «Das geht über unsere Fähigkeiten», wende ich ein. Ich spiele selbst Klarinette im Orchester und kenne unsere Grenzen. Rachmaninow liegt jenseits von ihnen. Definitiv.
«Wir werden üben!», erklärt er. Er macht sein Ich-will-es-und-so-wird-es-gemacht-Gesicht, und ich weiss: Er wird das Klavierkonzert Nr. 2 spielen, und wir werden ihn begleiten, so gut wir es eben können.
«Aber warum?», frage ich.
«Ich weiss nicht, was sich Sergei Wassiljewitsch gedacht hat, als er es komponierte. Aber für mich ist in diesem Stück mit seiner Melancholie und seinem Heroismus die Weite unserer Landschaft enthalten, das Leid der Bauern und Arbeiter und gleichzeitig die Auflehnung der gedemütigten und getretenen Menschen gegen ihr Schicksal. Es ist kein Zufall, dass ich meinen Entschluss heute gefasst habe.» Er schaut mich an. Und als ich schweige, fragt er vorwurfsvoll: «Welches Datum haben wir?»
«Den 22. Januar 1914, nach dem gregorianischen Kalender», sage ich, «und den 9. nach dem julianischen.»
Er nickt. «Seither sind genau neun Jahre vergangen. Erinnerst du dich nicht mehr?»
Erneut schlägt er seine neun Akkorde an. Diesmal aber spielt er weiter. Ohne Noten. Er kann das Konzert auswendig. Und während er spielt, ist es wieder da: das Gefühl, Teil seiner Musik zu sein. Ich verstehe, was er meinte, als er sagte, das ganze Land sei in diesem Stück enthalten. Ich sehe uns drei: Jakob, Hannes und mich, drei Brüder, die im Sommer auf ihren Kabardinern durch das unendliche Grasland am Fuss des Dschawachetischen Gebirges reiten. Gleichzeitig ist mir, als sehe ich die ausgemergelten Gestalten der Fabrikarbeiter vor mir, ihre bleichen, von Not und Elend gezeichneten Gesichter. Während meiner Zeit als Arzt in Sankt Petersburg behandelte ich in den Armenvierteln einmal in der Woche unentgeltlich Kranke. Die Verhältnisse schrien zum Himmel. Prostitution und Kriminalität gehörten zum Alltag. Es waren vom Land zugewanderte Menschen, die hofften, in der Stadt Brot und Arbeit zu finden. Sie hausten in Baracken oder überfüllten Wohnungen, in denen sich drei Schichtarbeiter ein einziges Bett teilten. Ihre Frauen und Kinder lagen neben dem Ofen auf dem nackten Boden. Alle waren schlecht ernährt und litten unter zahlreichen Krankheiten. Jeder vierte Säugling starb. Jenen, die als Kind nicht von Scharlach oder Diphtherie dahingerafft worden waren, bereiteten Schwindsucht, Pocken, Typhus- oder Choleraepidemien einen frühen Tod. Die Überlebenden, die im Durchschnitt nicht älter als fünfunddreissig wurden, litten unter Geschlechtskrankheiten und vor allem unter den Folgen der Trunksucht. Natürlich erinnere ich mich an jenen 9. Januar 1905, als sie in ihrer Hilflosigkeit gegen ihr Schicksal aufbegehrten.
Wie könnte ich den Petersburger Blutsonntag je vergessen? Mein Bruder hatte mit einem Konzert am Vorabend seine zweite Russlandtournee beendet. Heute würde er den Nachtzug nach Moskau nehmen und von dort zurück nach Tiflis reisen. Ich hatte ihn in diesen Tagen bei mir beherbergt. Schon während meines Medizinstudiums an der Universität von Sankt Petersburg hatte ich mit dem Geld, das ich von meiner Mutter erhielt, eine geräumige Wohnung in einem der oberen Stockwerke eines herrschaftlichen Hauses am südlichen Ufer der Mojka mieten können. Es befand sich zwischen dem Rathaus und dem Stroganow-Palais und gehörte der Witwe eines Generals, der erfolgreich gegen die Türken gekämpft hatte.
An diesem 9. Januar äusserte Jakob nach dem Frühstück den Wunsch, vor seiner Abreise einen ausgedehnten Spaziergang durch die Stadt zu machen. «Wie in alten Zeiten!» Er spielte auf jene drei Jahre an, in denen er am Konservatorium studiert und bei mir gewohnt hatte. Wir waren damals oft zur Strelka auf der Wassiljewskij-Insel spaziert. Dort, zwischen den beiden grossen Säulen, sassen wir dann auf einer Bank, schauten hinüber zur Peter-und-Paul-Festung und unterhielten uns über Gott und die Welt. Heute standen wir auf der Dreifaltigkeitsbrücke. Wir lehnten uns gegen das Geländer und sahen den vermummten Gestalten zu, die ins Eis der Newa Löcher hackten und fischten. Über ihnen flatterten Möwen, eine zänkische Schar, die sich um das Gekröse jener Fische stritt, die aus dem Strom gezogen und ausgenommen worden waren.
Kurz vor Mittag näherte sich uns von der Petersburger Insel her ein langer Menschenzug. Der Gesang frommer Lieder stieg in den kalten, blassblauen Winterhimmel. Kirchenfahnen flatterten im Wind, und manche trugen Ikonen und Porträts des Monarchen.
Jakob schaute mich an. «Eine Prozession?», fragte er. «Welchen ihrer Heiligen verehren sie denn heute?»
«Keinen Heiligen», sagte ich. «Sie sind unterwegs zum Winterpalast, wo sie Zar Nikolaj eine Bittschrift überreichen wollen.»
Im Dezember hatte die Direktion der Putilow-Metallwerke, die im Südwesten der Stadt Schiffe, Maschinen und Waffen produzierte, vier Arbeiter entlassen. Ihre Kollegen forderten vergeblich deren Wiedereinstellung. Darauf brachen in ganz Sankt Petersburg Unruhen aus. In rund vierhundert Betrieben streikten über hunderttausend Arbeiter.
Am 7. Januar, als ich von einem Krankenbesuch im Hafenviertel zurückkehrte, war ich zufällig Zeuge einer Versammlung geworden. Sie fand unter freiem Himmel statt. Pater Giorgij Gapon, der mit dem Segen der Obrigkeit einen Arbeiterverband gegründet hatte, stand in seinem Priesterrock auf einer Kiste. Der etwa dreissigjährige Geistliche mit seinem dunklen, gewellten Haar und dem akkurat gestutzten Bart war erregt. Er hatte eine Petition verfasst, die er jetzt vorlas. Im Namen der Fabrikarbeiter bat er den Zaren untertänigst um die Einführung des Achtstundentags, um die Garantie von Mindestlöhnen, eine Sozialversicherung, freie Gewerkschaften und Bürgerrechte. «Der Zar soll endlich erfahren», schrie Gapon, «wie seinem Volk von geldgierigen Unternehmern, erbarmungslosen Vorgesetzten und bestechlichen Beamten das Leben zur Hölle gemacht wird, während sie ihn über das Leiden seiner Kinder im Dunkeln lassen.» Seine Stimme hatte sich überschlagen.
Ein paar revolutionäre Sozialisten, die sich unter die Menge gemischt hatten, riefen, Nikolaj wisse sehr wohl, wie es den Arbeitern gehe, aber deren Schicksal sei ihm gleichgültig. «Eine Bittschrift!», höhnte einer. «Nikolaj lacht über euch. Er und sein Pack verstehen nur die Sprache der Gewalt.»
Ich gab ihm im Stillen recht. Abgesehen von meiner karitativen Tätigkeit in den Elendsquartieren der Stadt, in denen die Arbeiter mit ihren Familien dahinvegetierten, hatte ich es meistens mit Patienten zu tun, die in der Lage waren, meine Dienste zu bezahlen. Dazu kam, dass meine Vermieterin, die Generalin, mich in ihren Kreisen empfahl. So wurde ich ab und zu in die Paläste und Villen der wirklich Reichen gerufen. Ich habe ihren luxuriösen Überfluss und die Scharen von Bediensteten, die sich um sie kümmern, gesehen. Da mein Grossvater, Vitus von Fenzlau, ein Adeliger gewesen war, hatte man mich auch schon zu einem jener üppigen Festmähler und rauschenden Bälle eingeladen, mit denen sich die Petersburger Oberschicht selbst zelebrierte. Der Gegensatz zwischen reich und arm, der in dieser Stadt und im ganzen Land nebeneinander existierte, empörte mich.
Ich war damals Mitglied in einem der vielen geheimen Lesezirkel, in dem sich Leute aus der Intelligenzija – Juristen, Techniker, Lehrer, Ärzte – zusammenfanden. Wir tauschten untereinander sozialistische Literatur aus und diskutierten darüber, ob eine Veränderung der untragbaren Verhältnisse mit der friedlichen Durchsetzung von Ansprüchen, wie sie Pater Gapon anstrebte, oder nur durch einen revolutionären Umsturz erreicht werden könne. Einig waren wir uns in unseren Forderungen nach Pressefreiheit, nach der Gleichheit vor dem Gesetz und nach einer Volksvertretung. Wir waren in ständiger Angst, es würde der Ochrana, der Geheimpolizei, gelingen, einen ihrer Spitzel bei uns einzuschleusen. Wer denunziert wurde, hatte mit Gefängnis und Folter zu rechnen, mit der Verbannung nach Sibirien und Zwangsarbeit.
Die Aufrührer, die an jener Versammlung vom 7. Januar dabei waren, wurden von der Menge niedergeschrien. Es kam zu Handgreiflichkeiten, und sie wurden weggejagt. Als wieder Ruhe eingekehrt war, erklärte Pater Gapon, dass am nächsten Sonntag die Sankt Petersburger Arbeiterschaft durch die Strassen der Stadt zum Winterpalast ziehen und dem Zaren die Bittschrift überreichen werde. Es gehöre sich nicht, schärfte er den Leuten ein, Waffen oder rote Fahnen mitzunehmen, wenn man zu seinem Monarchen gehe. «Wir wollen den Soldaten keinen Vorwand geben, uns wegzutreiben!», rief er.
Als sie jetzt über die Dreifaltigkeitsbrücke zogen – eine von sechs Marschkolonnen aus allen Teilen der Stadt – war zu sehen, dass sie sich an seine Anweisungen hielten. «Ikonen, Kirchenfahnen und Bilder von Nikolaj», staunte Jakob, «und damit glauben sie, den Zaren zu überzeugen?»
Die Spitze des Zuges bildeten Facharbeiter. Man erkannte sie an ihren Sonntagskleidern. Sie waren die Einzigen, die sich welche leisten konnten. Die Ungelernten, die zu Hungerlöhnen Hilfsarbeiten verrichteten, hatten sich hinter ihren besser bezahlten Kollegen eingereiht. Viele hatten ihre Frauen und Kinder mitgebracht. Es waren arme Menschen, die sich mit dünnen Mänteln und von Motten zerfressenen Schaffellmützen gegen die beissende Kälte schützten. Während sie an uns vorbeizogen, sangen sie Rette, o Herr, dein Volk.
Eine Frau löste sich aus der Menge und kam auf mich zu. In den Händen trug sie eine Ikone des heiligen Nikolaus von Myra, des Namenspatrons des Zaren. Sie hatte einen wollenen Schal um den Kopf geschlungen, unter dem eine Strähne ihres aschblonden Haars hervorguckte. Ich erkannte sie: Jelisaweta Iwanowna. Vor ein paar Wochen hatte ich ihre zwei Jahre alte Tochter, die an Keuchhusten litt, behandelt. Sie und ihr Mann lebten mit ihren vier Kindern in einer Holzhütte unweit des Hafens. Jelisaweta und ihr Ältester, der zehnjährige Alexej, sortierten Lumpen in einer Papierfabrik.
«Begleitet Ihr uns zum Winterpalast, Karl Simonowitsch?», fragte sie. Seit sie von mir erfahren hatte, dass mein Vater, ein Emmentaler, der 1866 nach Grusinien ausgewandert war, Simon hiess, nannte sie mich so.
Ich schüttelte den Kopf. «Nein, und ich befürchte, dass auch Ihr nicht bis dorthin gelangen werdet.»
Vom Marsfeld her war eine Infanterieeinheit Richtung Dreifaltigkeitsbrücke marschiert Sie besetzte den Brückenkopf, um den Demonstranten den Zugang zum Zentrum der Stadt zu verwehren. Jetzt stellten sich die Füsiliere in zwei Reihen hintereinander auf.
Der Zug kam ins Stocken. Rund zwanzig Meter vor den Soldaten blieben die Arbeiter stehen. Jemand stimmte die Hymne Bewahre Gott den Zaren an. Ein Bekenntnis zum Herrscher, aus Tausenden von Kehlen. Als das Lied zu Ende war, trat ein Offizier vor die Reihen der Infanteristen. Ich kannte ihn, denn ich behandelte seine Mutter. Er hiess Anatolij Michajlowitsch Maximow und diente als Major in der Armee. «Geht nach Hause, der Zar will euch nicht empfangen!», schrie er. «Wer dem Befehl nicht Folge leistet, muss damit rechnen, erschossen zu werden.» Der Offizier trat zur Seite. «Legt an!», befahl er.
Die Soldaten aus der ersten Reihe richteten ihre Gewehre auf die Demonstranten. Dann durchschnitt das Kommando: «Feuer!» die Stille. Die Soldaten schossen über die Köpfe der Leute. Man hörte Angstschreie, Mütter zogen ihre weinenden Kinder an sich.
«Das war die letzte Warnung. Das nächste Mal gibt es Tote. Geht nach Hause!», rief Maximow. Er gab den Befehl vorzurücken. Die Infanteristen standen jetzt nur noch fünf Meter vor der ersten Reihe der Arbeiter und richteten die aufgepflanzten Bajonette gegen sie.
Ich drängte mich dem Brückengeländer entlang vorwärts zu Anatolij Michajlowitsch. Er erkannte mich. «Was machen Sie denn hier, Herr Doktor? Sie gehören doch nicht zu den Aufrührern?» Er sprach Deutsch.
«Natürlich nicht. Ich und mein Bruder waren auf dem Heimweg, und es scheint, dass wir hier auf der Brücke zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Hätten Sie die Freundlichkeit, uns durchzulassen?»
«Selbstverständlich, aber beeilen Sie sich.»
Ich winkte Jakob. Er kam. Jelisaweta folgte ihm.
«Wer ist die Frau?», fragte Maximow scharf.
«Sie ist meine Magd», antwortete Jakob geistesgegenwärtig. «Ich reise noch heute nach Moskau, und sie muss meine Sachen packen.»
Durchschaute der Offizier die Lüge? Er liess es sich nicht anmerken. Er gab einen knappen Befehl. Einige Soldaten rückten beiseite. Wir schlüpften durch die Gasse. Dann blieben wir stehen und sahen zu, wie die Menge zurückwich. Nach zehn Minuten war die Brücke bis auf Maximows Infanterieeinheit menschenleer.
Als wir am Südufer Richtung Zentrum gingen, sahen wir, dass Hunderte von Männern, Frauen und Kindern den vereisten Strom überschritten. Offenbar gaben sie ihr Vorhaben, um vierzehn Uhr auf dem Schlossplatz zu sein, nicht auf.
Wir bogen nach links in eine Nebenstrasse ein, die uns zur Mojka führte. Jelisaweta, die bisher geschwiegen hatte, fragte: «Weshalb tun sie das?»
«Was meint Ihr?»
«Weshalb wollen uns die Soldaten nicht zu Väterchen Zar lassen?»
Väterchen Zar! Ich habe nie begriffen, weshalb die Russen für ihre Unterdrücker das Diminutiv verwenden. «Ihr habt gehört, wie der Offizier gesagt hat, dass er euch nicht empfangen will.»
«Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er weiss, dass seine Soldaten drohen, auf uns, seine Kinder, zu schiessen.»
Ich wechselte einen Blick mit Jakob. Er zuckte mit den Schultern. «Habt Ihr immer noch vor, zum Winterpalast zu gehen?»
«Gewiss, ich will dabei sein, wenn Pater Gapon Zar Nikolaj unsere Bitten vorträgt.»
«Wir begleiten Euch dorthin», mischte sich Jakob ins Gespräch, und zu mir auf Berndeutsch: «Dieses Schauspiel möchte ich mir nicht entgehen lassen.»
Was zu diesem Zeitpunkt weder Jelisaweta Iwanowna noch wir wissen konnten: Der Priester würde den Schlossplatz nicht erreichen. Die Prozession, die er vom Südwesten der Stadt Richtung Winterpalast führte, war beim Narva-Triumphbogen von Truppen aufgehalten worden. Anders als jene, welche über die Dreifaltigkeitsbrücke ins Zentrum gelangen wollten, hatte Gapons Prozession, als zwei Salven in die Luft abgegeben worden waren, die Warnung ignoriert. «Freiheit oder Tod», hatte der Priester gerufen, und die Leute waren mit ihm weiter vorwärtsmarschiert. Darauf zielten die Soldaten auf Körperhöhe. Dreimal schossen sie. Tote und Verwundete lagen auf dem Narva-Platz. Gefährten brachten Giorgij Gapon in Sicherheit. Er war verzweifelt. «Es gibt keinen Gott mehr», soll er gesagt haben. Und: «Es gibt keinen Zaren.» Immer wieder diese zwei Sätze.
Wir hatten inzwischen den Winterpalast erreicht. Jakob und ich blieben beim Gebäude des Gardekorps stehen. Von hier aus überschauten wir den weiten Platz. Im Hintergrund glänzte die vergoldete Spitze der Admiralität. Mir erschien sie wie ein mahnender Zeigefinger. Aber vielleicht bilde ich mir das auch erst nachträglich ein. Die Leute hatten sich vor der Alexandersäule aufgestellt. Jelisaweta gesellte sich zu den Tausenden von Männern, Frauen und Kindern, die es, den Sperrungen durch die Truppen zum Trotz, geschafft hatten, über die Newa oder durch die vielen engen Gassen bis zum Winterpalast vorzudringen. Wir sahen ihr nach: eine kleine, schmächtige Gestalt, die sich, die Ikone des heiligen Nikolaus an ihre Brust gepresst, den Weg durch die Menge bahnte, um vorne mit dabei zu sein, wenn die Bittschrift dem Zaren überreicht werden sollte.
Die Leute warteten. Als es von der nahen Isaaks-Kathedrale zwei Uhr schlug, wurde es still. Die Menschen starrten auf die Fassade des Winterpalastes, die grün, weiss und golden in spätbarocker Pracht prunkte. Sie warteten vergeblich auf Pater Gapon mit seiner Bittschrift. Und auch der Zar zeigte sich nicht auf dem Balkon über dem Hauptportal, um, wie erhofft, seine Kinder zu begrüssen.
Stattdessen marschierte eine Gardeeinheit auf. Über ihren Uniformen trugen die Männer lange Wintermäntel. Sie nahmen in zwei Reihen Aufstellung. Ein Hornsignal ertönte. «Erste Warnung», sagte ich zu Jakob, der mich am Oberarm gepackt hatte. Die Arbeiter starrten ungläubig auf die Soldaten, die ihre Gewehre anlegten. Das Horn schallte zum zweiten Mal über den Schlossplatz. «Zweite Warnung», flüsterte ich. Viele in der zerlumpten Menge bekreuzigten sich. Manche sanken auf die Knie, falteten die Hände. Ich suchte Jelisaweta Iwanowna. Noch immer hielt sie die Ikone mit Sankt Nikolaus gegen ihre Brust gepresst. Auf ein Zeichen des kommandierenden Offiziers blies der Hornist zum dritten Mal. Eine Salve krachte. Getroffene Demonstranten wälzten sich schreiend im Schnee. Panik brach aus. Die Leute flohen, rannten um ihr Leben, suchten Schutz unter dem Triumphbogen des Generalstabsgebäudes, flohen durch die Grünanlagen zur Newa – und noch immer schoss die Garde, lud ihre Gewehre nach, schoss weiter.
Als die Soldaten das Feuer endlich eingestellt hatten, wagte ich es nach einer Weile quer über den Platz zu gehen, dorthin, wo ich zuletzt Jelisaweta gesehen hatte. Jakob folgte mir. Jetzt war nichts anderes mehr zu hören als die Schreie, die Klagen und das Stöhnen der Verwundeten. Und das Weinen und die Rufe der Überlebenden, die nach ihren Angehörigen und Freunden suchten.
In einem der vielen Tagebücher, die mein Grossvater hinterlassen und die mir meine Mutter zum Lesen gegeben hatte, war auch eine Schilderung der Schlacht von Achalziche im Jahr 1828. Er hatte als junger Leutnant daran teilgenommen. Jetzt, am Fuss der Alexandersäule, von der ein eherner Engel, der ein riesiges Kreuz trug, auf den weiten Schlossplatz hinunterschaute, konnte ich das Entsetzen nachvollziehen, das aus seinen Zeilen sprach. Ich sah Kinder, nicht älter als acht oder neun Jahre, die nach ihren Eltern riefen, während die sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmten. Ich sah Männer und Frauen, welche beide Hände gegen ihren Leib pressten, als könnten sie das Blut, das zwischen ihren Fingern hervorquoll, zurückhalten. Ich sah eine junge Mutter. Sie war tot, aber an ihrer Brust weinte ein Säugling, als wüsste er, dass man ihn zur Waise gemacht hatte. Ich sah zahllose Leichen: Männer, Frauen, Kinder. Sie lagen kreuz und quer im Schnee, der sich rot verfärbt hatte. In grotesken Verrenkungen lagen sie da: auf dem Rücken, auf dem Bauch, übereinander.
Und endlich sah ich Jelisaweta. Sie sass am Boden, gegen das Podest der Alexandersäule gelehnt. Ihr Kopf neigte sich zur Seite. Ihre erloschenen Augen starrten hinauf zum Balkon über dem Hauptportal, als könne sie selbst im Tod nicht fassen, was Väterchen Zar seinen Kindern angetan hatte.
Die Ikone des heiligen Nikolaus lag neben ihr am Boden. Ich beugte mich zu ihr, schloss ihr mit dem Zeige- und Mittelfinger meiner Rechten die Augen. Dann hob ich die Ikone auf. Ich habe sie noch immer. Sie hängt jetzt in meiner Wohnung. Die Soldaten des Zaren hatten nicht einmal den Namenspatron ihres Monarchen verschont. Die Brust des Heiligen aus Myra ist von einer Kugel durchbohrt, wohl derselben, die Jelisaweta getötet hat. Jelisaweta Iwanowna, fünfundzwanzig Jahre alt, die mit fünfzehn ihr erstes Kind geboren, die mit ihrer Familie in erbärmlichen Verhältnissen gelebt, gehungert und gefroren hatte, die von ihrem Mann, wenn er betrunken nach Hause kam, verprügelt worden war und die gehofft hatte, Pater Giorgijs Bitten würden Nikolaj II. erweichen … Nikolaj, dieses mässig begabte Subjekt, in dem der Hochmut und die Grausamkeit von dreihundert Jahren jener aus dem Haus Romanow zu Fleisch geworden war. Nikolaj, der wie seine Vorfahren durchdrungen war vom Wahn, Gott habe ihn persönlich dazu berufen, als absoluter Monarch über einen Sechstel des Erdkreises zu herrschen. Dieser Nikolaj hatte seine Bluthunde losgelassen, um Kinder, Frauen und Männer, die nichts anderes wollten, als ihn um die Verbesserung ihrer elenden Lebensbedingungen zu bitten, abschlachten zu lassen. Und während seine Garde wütete, hatte er den Tag, wie man später erfuhr, mit seiner Familie ausserhalb der Stadt, im Katharinenpalast von Zarskoje Selo, verbracht. Jener 9. Januar 1905 forderte Hunderte von Toten und noch mehr Verwundete. Die genaue Zahl wurde nie bekannt. Weshalb auch? Es waren ja nur Arbeiter, Proletenpack, das gegen sein Schicksal aufbegehrt hatte. Nein, ich finde keine Worte, die stark genug wären, Nikolaj Romanow, diesen Massenmörder, zu verfluchen.
Als ich mich aufrichtete, stand Jakob hinter mir. Er war blass. Seine Wangen waren tränenüberströmt. Zwei- oder dreimal öffnete er den Mund, als wolle er etwas sagen, brachte aber nicht mehr als ein krampfhaftes Schluchzen über seine Lippen. Er warf sich mir an den Hals, legte seinen Kopf an meine Schultern. So blieben wir lange stehen. Endlich hatte er sich ausgeweint. Ich nahm ihn am Arm und führte ihn von diesem Platz des Grauens weg. Manchmal blieb er stehen, betrachtete die Leiche eines Kindes, als wolle er sich den Anblick in die Seele einbrennen. Behutsam schob ich ihn weiter. Zuhause half ich ihm, seine Koffer zu packen. Dann begleitete ich ihn zum Nikolaj-Bahnhof, wo der Zug nach Moskau bereits wartete. Wir sprachen nicht viel. Jeder von uns war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Aber als er sich aus dem Abteilfenster herauslehnte, sagte er: «Du solltest nicht in dieser Stadt bleiben. Sie ist verflucht. Komm zurück zu uns nach Grusinien.»
Eine verfluchte Stadt? In den folgenden Wochen dachte ich oft über Jakobs Bemerkung nach. Manchmal spazierte ich vom Haus der Generalin zum Senatsplatz und betrachtete den Ehernen Reiter. Auf einer gigantischen Welle aus Granit zügelt, lorbeerbekränzt, Peter I., den die Geschichtsschreibung den Grossen nennt, sein sich aufbäumendes Pferd.
Ich versuchte, mir vorzustellen, wie der Zar, dieser über zwei Meter lange Mensch, hoch zu Ross, zusammen mit seinen Höflingen das sumpfige Gelände des Mündungsgebiets der Newa durchstreifte, irgendwann anhielt und mit grosser Geste über den Strom und die vielen Inseln zeigte und verkündete: «Hier soll meine neue Hauptstadt entstehen, grösser und schöner als alles, was wir kennen. Ich will es.»
Im Geschichtsunterricht im Adelsgymnasium von Tiflis hatte man uns beigebracht, dass es dem Kaiser darum gegangen sei, für das russische Reich das Tor zur Welt weit aufzustossen, ihm den Zugang zum Meer zu öffnen, genau hier, wo sich die Newa in die Ostsee ergiesst. Und so legte er am 16. Mai 1703 auf der strategisch günstig gelegenen Haseninsel den Grundstein zur Peter-und-Paul-Festung und damit zu Sankt Petersburg. Man verschwieg uns, dass das Fundament der Stadt von achtzigtausend Sträflingen, Bauern und Kriegsgefangenen gelegt worden war. Achtzigtausend Verdammte, die unter den Peitschenhieben ihrer Aufseher ganze Wälder abholzten. Sie mussten Pfähle herstellen und sie in den sumpfigen Boden rammen, damit auf ihnen jene Paläste und Kirchen erbaut werden konnten, die später vom Glanz und der Glorie der Romanows zeugten. Was scherte es den Zaren, dass die Zwangsarbeiter dabei zu Tausenden verreckten: in den Hochwassern der Newa ertranken, in den bitterkalten Wintern in ihrer dürftigen Kleidung erfroren und verhungerten. Zweifellos verfluchen die Schatten der Unglücklichen die Stadt, die auf ihren Leichen erbaut worden ist.
Der Petersburger Blutsonntag hatte wie ein Fanal gewirkt. Das ganze Land befand sich danach in Aufruhr. Nach der Niederlage der russischen Armee im fernen Osten gegen die vom Zaren als Makaken verhöhnten Japaner war das Ansehen von Nikolaj II. auf einen Tiefpunkt gesunken. Truppen meuterten, die Arbeiter in den Fabriken streikten, Bauern verwüsteten Gutshöfe und verjagten deren Besitzer. Die Regierung des Zaren reagierte mit gnadenloser Härte. Täglich wurden Aufständische hingerichtet oder in die Verbannung geschickt.
Im Spätsommer erreichte mich ein Brief Jakobs. Er schrieb mir, Doktor Erchinger, der seit über fünfzig Jahren Arzt in Katharinenfeld gewesen war, sei gestorben. Man suche dringend einen Nachfolger. Komm zu uns in unser friedliches Schwabendorf, forderte er mich auf, wir brauchen dich!
Von wegen friedlich: Auch in Transkaukasien waren Unruhen ausgebrochen. Der Ruf nach nationaler Eigenständigkeit wurde laut. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Sturm auch die deutschen Einwanderer erreichen würde, die übers ganze Land verstreut in ihren Dörfern lebten.
Was mich letztlich bewog, nach zwölf Jahren meinen Aufenthalt in Sankt Petersburg abzubrechen, weiss ich selbst nicht genau. Vielleicht wollte ich dabei sein, wenn sich Georgien von Russland lösen würde, vielleicht hatte ich Heimweh nach meinen Eltern, nach unserem Gutshof Eben-Ezer und nach der Steppe, wo ich aufgewachsen bin, vielleicht sehnte ich mich nach einem Leben mit Jakob und Menschen, die wie ich Deutsch sprechen.
Wie auch immer: Mitte Oktober 1905 übergab ich meine Praxis einem Nachfolger und fuhr nach Katharinenfeld. Seither lebe ich an der Kreuzgasse im Haus meines verstorbenen Vorgängers. Rosina Dieterle, eine Witwe aus dem Dorf, besorgt meinen Haushalt.
Jakob holt mich aus meinen Erinnerungen zurück ins Jahr 1914. Er ist unterdessen beim dritten Satz von Rachmaninows Klavierkonzert angelangt und singt den Auftakt, der dem Orchester vorbehalten ist, ohne Worte natürlich, allein mit Tatata und Tataratata, bevor er am Klavier in eine Zwiesprache mit den imaginären Musikern tritt. Schon in den ersten beiden Sätzen hat er einzelne Instrumente singend nachgeahmt.
In den letzten Takten des Stücks intoniert Jakob mit seiner Stimme den Part des Orchesters, welches das Grundthema wieder aufnimmt. Seine Finger hämmern wie rasend auf die Tasten. Sein Gesicht ist schweissüberströmt. Die Musik, scheint mir, überträgt sich auf seinen ganzen Körper, der in ständiger Bewegung ist. Er spielt den furiosen Schluss mit der ihm eigenen Brillanz. Dann legt er, wie er es häufig tut, seine Hände auf die Oberschenkel und rührt sich nicht.
Mein jüngster Bruder galt als Wunderkind. Von seinem sechsten Lebensjahr an lebte er während der Wintermonate in Katharinenfeld im Haus des Advokaten Georg Erchinger und seiner Frau Lotte, der Freundin meiner Mutter. Er wuchs mit deren Töchtern, Martha und Marie, auf. Mit Marie ist er inzwischen verheiratet. Von Ludwig Wieland, dem Organisten und damaligen Dirigenten des Sinfonieorchesters, erhielt er Klavierunterricht und wurde in Musiktheorie ausgebildet. Daneben erlernte er das Orgelspiel. Drei bis vier Stunden am Tag sass er am Piano und übte. Jeweils am letzten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst luden die Erchingers ihre Freunde zu einer Matinee in ihr Haus. Jakob spielte auf dem Klavier Eigenkompositionen und begleitete Solisten des Orchesters, die ihre Kunst vorführten. Daneben besuchte er die Dorfschule und musste in den Sommermonaten auf dem elterlichen Gutshof, neben den Übungen, die ihm Ludwig Wieland aufgegeben hatte, mit Hilfe unseres Hauslehrers, Cornelius Fresendorff, nachholen, was der Schulmeister in Katharinenfeld versäumt hatte, ihm beizubringen. Unser Vater legte Wert darauf, dass wir unser Wissen mehrten. Was einer im Kopf habe, pflegte er zu sagen, könne ihm niemand stehlen.
In der Mitte des zweiten Satzes des Klavierkonzerts hat Jakobs Frau den Pavillon betreten und eine Reihe hinter mir Platz genommen. Unsere Familie ist mit den Erchingers gleich doppelt verschwägert. Maries ältere Schwester, Martha, ist mit Hannes verheiratet. Ich brauchte mich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass sie da war. Maries Duft ist unverkennbar. Keine andere Frau in Katharinenfeld benutzt Moschusparfum. Sie ist ihrer siebenunddreissig Jahre zum Trotz noch immer eine Schönheit. Sie macht auch einiges dafür. Allein für ihre Frisur wendet sie viel Zeit auf. Mit dem Brenneisen kräuselt sie ihr volles, dunkles Haar, steckt es mit Kämmen aus Perlmutt hoch und lässt es dann kaskadenartig über ihren schmalen Rücken fallen. Kein Wunder, dass sie auffällt in einem Dorf, in dem die Frauen ihr Haar zu einem strengen Dutt knüpfen oder es zu Zöpfen flechten und als Kranz auf dem Kopf oder Schnecken über den Ohren tragen. Marie ist stets elegant gekleidet. Ausserdem trägt sie einen goldenen Halsreif und grosse, goldene Ohrringe, die Jakob für sie kurz nach der Hochzeit in Sankt Petersburg gekauft hatte. Im frommen Katharinenfeld gibt es keinen Juwelier. Wenn sie durch die Strassen geht, fast schwebend wie ein Wesen aus einer anderen Welt, wagen ihr die braven Schwaben nur verstohlen nachzuschauen. Sie fürchten ihre scharfzüngigen Ehefrauen, die über die kleine Erchinger, wie sie sie immer noch nennen, herziehen. Dieses herausgeputzte Weibsbild, behaupten sie, habe den Pfad der Tugend verlassen und sei längst in die breite Strasse eingebogen, die direkt in die Hölle führt.
Ihr Vater, Georg Erchinger, ist viel zu früh, ein Jahr vor der Hochzeit seiner jüngeren Tochter verstorben. Jakob und seine Frau leben zusammen mit Maries Mutter im elterlichen Haus am Äusseren alten Wingert. Mein Bruder hat in seiner Wohnung ein geräumiges Arbeitszimmer, in dem sein Flügel steht. Dort komponiert und übt er. Im Übrigen lässt er sich von den beiden Frauenzimmern verwöhnen. Sie lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab.
Marie hatte zahlreiche Verehrer. Aber sie wollte stets nur Jakob, den sie seit ihrer Kindheit liebt. Während der Sommerfrische, die Tante Lotte mit ihr und Martha auf Eben-Ezer verbrachte, stand sie, wenn Jakob Klavier spielte, stundenlang neben ihm und wendete auf sein Nicken hin die Notenblätter. Sie bewunderte ihn, wich nicht von seiner Seite, es sei denn, er wurde ihrer überdrüssig und schickte sie fort. Dann zog sie sich zurück, war unglücklich, weinte. Im Prinzip ist das noch heute so. Als Kind hat er ihr beigebracht, Klavier zu spielen, und sie ist eine ganz passable Pianistin. Ihr eigentliches Instrument ist aber die Geige. Das gab ihr die Möglichkeit, mit ihm zusammen zu sein, zu üben und später gemeinsam mit ihm aufzutreten.
Auch wenn die Katharinenfelder hinter ihrem Rücken die Mäuler über Marie zerreissen, so hindert sie dies nicht, ihr zuzujubeln, wenn sie zusammen mit ihrem Mann Vittorio Montis Czardas spielt. Sie steht in ihrem schulterfreien roten Kleid auf der Bühne, lächelnd, mit halb geschlossenen Augen, und lässt den Bogen über die Saiten ihrer Violine tanzen. Sie scheint nicht zu bemerken, dass sie ihr Publikum verzaubert und es von seinen Vorfahren träumen lässt, die einst, wie unser Vater, die Donau hinunter zum Schwarzen Meer gefahren sind.
Sie ist Primgeigerin im Orchester. Niemand neidet ihr den Posten. Marie ist unbestritten eine begnadete Violinistin, eine Künstlerin. Der Preis, den sie dafür bezahlt, ist allerdings hoch. Manchmal sucht sie mich in meiner Praxis auf. Sie hat Schmerzen im Nacken und in den Schultern, ausserdem im Handgelenk. Dazu kommt ihre ständige Angst, den hohen Ansprüchen Jakobs nicht zu genügen. Ich verschreibe ihr schmerzlindernde Salben, die ich nach den Rezepten von Mariam Stepanyan, der verstorbenen Hebamme und Kräuterfrau von Eben-Ezer, herstelle. Schon mein Vorgänger, Josef Erchinger, Maries Grossvater, hielt grosse Stücke auf die Heilkunst der Steppenhexe, wie er Mariam nannte. Was Marie Not täte: für ein paar Monate ganz mit dem Geigenspiel aufzuhören, um sich richtig auszukurieren. Am besten in Bordshomi, wo es Mineralquellen gibt, die Wunder bewirken sollen. Aber als ich ihr einmal den Vorschlag machte, schaute sie mich entgeistert an. «Das geht nicht», sagte sie. Ich vermute, sie hat Angst, dass Jakob sich eine andere Violinistin suchen würde, wenn sie, auch nur vorübergehend, mit dem Geigenspiel aufhörte.
Endlich richtet sich Jakob auf, schaut vom Podium herunter zu mir und begrüsst seine Frau mit einem Kopfnicken. «Rachmaninow schreibt für die Instrumentierung des Orchesters zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, vier Hörner, zwei Trompeten, drei Posaunen und Tuba vor», zählte er auf. «Ausserdem Pauken, grosse Trommel, Becken und natürlich die Streicher. Nur die Hörner bereiten mir Bauchweh. Wir haben lediglich zwei im Orchester. Was meint ihr, soll ich mich damit begnügen oder mir bei den Generälen Ersatz besorgen?»
Generäle nennt er die Mitglieder der Blaskapelle. Die Musikanten tragen schmucke Uniformen und ziehen hinter Jakob mit schmetternden Klängen durchs Dorf. Er erwartet keine Antwort auf seine Frage. «Wenn wir das Klavierkonzert am Erntedankfest spielen wollen, kommt eine harte Zeit auf euch alle zu», sagt er stattdessen. «Ich werde wöchentliche Proben ansetzen, und natürlich Extraproben, getrennt für die Bläser und Streicher. Und üben müsst ihr, üben, üben.» Er streicht sich das rote Haar aus der Stirn.
Wir schweigen, denn wir kennen Jakob gut genug. Er wird jeden Einwand von Seiten der Orchestermitglieder weglächeln, wird keine Ausrede gelten lassen. Wer in einer Probe fehlt, wird sie einzeln nachholen müssen. In seiner sanften, hartnäckigen Art wird er nicht lockerlassen, bis alle ihren Part zu seiner Zufriedenheit beherrschen.
Die braven Katharinenfelder Musiker werden heimlich murren, aber sie werden sich seinem Willen beugen. Auch ich. Marie ohnehin. Wir alle sind stolz auf ihn, auf ihn, seine Begabung, sein Können und seine Erfolge.
Zwischen 1895 und 1898 hat Jakob am Konservatorium von Sankt Petersburg Komposition und Instrumentation studiert. Zusätzlich besuchte er Vorlesungen über musikalische Formenlehre und kontrapunktischen Satz. Ausserdem nahm er Klavierunterricht in einer Meisterklasse, sass täglich vier bis sechs Stunden am Flügel und vervollkommnete sein Spiel. Abends ging er oft in die Oper, ins Konzert oder ins Ballett. Ab und zu begleitete ich ihn. Er pflegte mit geschlossenen Augen dazusitzen. Manchmal zog er eine Kladde aus der Innentasche seines Fracks und machte sich Notizen. Er komponiert schon seit seiner Kindheit. Ein halbes Jahr vor Abschluss seiner Ausbildung wurde ihm die Aufgabe gestellt, das Gedicht Sehnsucht von Joseph von Eichendorff zu vertonen. Er schuf eine Melodie, die mir noch heute die Tränen in die Augen treibt. Jakob schloss sein Studium mit der Kleinen Goldmedaille ab.
Anschliessend begann er eine Laufbahn als Pianist. Er spielte in Kasan, Jekaterinburg, Moskau und Sankt Petersburg, gab Konzerte in Riga, Königsberg, Berlin und Dresden, in Böhmen und Mähren und sogar in Wien. Manchmal trat er gemeinsam mit Marie auf, die bereits damals konzertreif spielte. Aber um 1900, als Ludwig Wieland starb, kehrte er nach Katharinenfeld zurück und übernahm dessen Aufgaben. Seither dirigiert er nicht nur das Sinfonieorchester und die Blasmusik, sondern leitet auch den Kirchenchor und verleiht dem sonntäglichen Gottesdienst mit seinem Orgelspiel Glanz. Ab und zu geht er noch auf Tournee. Aber lediglich für wenige Konzerte in Georgien, nur ausnahmsweise auch Russland.
Ich fragte ihn einmal, ob es ihm nicht leidtue, sein Talent in unserem grusinischen Krähenwinkel versauern zu lassen. Jakob sah mich erstaunt an. «Weshalb sollte es mehr wert sein, mit seiner Kunst einem Publikum aus blasierten Adeligen und reichen Bürgern die Zeit zu vertreiben als den Nachkommen schwäbischer Einwanderer die Freude an der Musik und am Musizieren zu wecken? Und wer sagt dir, dass ich mein Talent versauern lasse?» Er ereiferte sich. «Ich versuche ständig, mein Spiel zu verbessern, komponiere und …» Er stockte, ein schüchternes Lächeln huschte über sein Gesicht. «Ich will ein grosses Orchesterwerk schaffen. Ich weiss schon, wie ich es nennen werde.» Er errötete. «Kaukasische Sinfonie», sagte er schliesslich. «In ihr soll alles enthalten sein, was wichtig ist: die Schönheit unseres Landes und die Menschen, die hier leben, arbeiten, Kinder zeugen, sie grossziehen und sterben. Und ihre Sehnsucht nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit.» Er machte eine hilflose Handbewegung. «Alles. Ich stelle mir ein Werk vor, das die wichtigsten Episoden, die das Leben ausmacht, in Tönen zum Ausdruck bringt und sich unmerklich zu einem Ganzen vereint.»
Dass er seinen Traum erzählte, war zweifellos ein Vertrauensbeweis. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Auch nicht mit unserer Mutter. Obwohl ich weiss, dass sie nicht verwundert wäre, wenn sie davon erführe. Was immer mein Bruder macht, ist für sie richtig. Wenn sie an Feiertagen mit Vater, Hannes und Martha und deren Kindern zum Gottesdienst nach Katharinenfeld kommt, versäumt sie es selten, mir zu erzählen, wie er sich bereits 1879 als Dreijähriger das Klavierspiel selbst beigebracht hat. Sie war vernarrt in Jakob – sie ist es immer noch. Er ist ihr Liebling, so wie für den Vater Hannes, der einzige von uns drei Brüdern, in dessen Blut das bäuerische Erbe unserer Emmentaler Vorfahren fliesst.
Jakob
1
Im Frühjahr 1879 entdeckte Sophie Diepoldswiler, dass Jakob über ein ausserordentliches musikalisches Talent verfügte. Wenn sie am Piano sass, wich der Dreijährige nicht von ihrer Seite. Er kniete neben ihr auf der Klavierbank und schaute gebannt auf ihre Finger. Manchmal sang sie mit ihm Kinderlieder, die sie mit einfachen Akkorden begleitete. Wenn sie im Gemüsegarten arbeitete, spielte er im Kies zwischen den Beeten. Immer wieder stellte er ihr Fragen zur Musik, die ihn beschäftigten. Sophie antwortete, so gut sie konnte. Wurde es ihr zu viel, schickte sie ihn zu Mayranoush. Die Armenierin war ihre Amme gewesen. Heute führte sie die Hauswirtschaft auf Eben-Ezer.
Einmal, als Sophie aus dem Garten zurückkehrte, sass Mayranoush auf der Veranda und rüstete Gemüse. Auch wenn immer mehr graue Strähnen ihr einst rabenschwarzes Haar durchzogen, war sie, fand Sophie, die schönste Frau, die sie kannte. Niemand hatte Augen wie Mayranoush: mandelförmig, unergründlich, dunkel. Sie neigte zur Melancholie. Nur selten spielte ein Lächeln um ihre vollen Lippen. Sie war gross und schlank. Nach dem Tod ihres Verlobten, von dem sie ein Kind empfangen hatte, wollte sie nichts mehr von Männern wissen. Seit ihr Sohn, Hovan, Sophies Milchbruder, einjährig an der Bräune verstorben war, hatte sie ihre ganze Liebe Sophie geschenkt, die an ihr hing, wie man an einer Mutter hängt. Wenn sie unter sich waren, sprachen sie Armenisch miteinander.
«Wo ist Jakob?», fragte Sophie.
Mayranoush unterbrach ihre Arbeit. «Er ist oben und spielt Klavier.»
«Er spielt Klavier?» Sophie schaute sie ungläubig an.
«Gewiss, er macht das schon seit einiger Zeit. Immer wenn er aus dem Gemüsegarten kommt, geht er in eure Wohnung und spielt. Hörst du ihn nicht?»
Sophie lauschte. Tatsächlich waren aus dem Fenster ihrer Wohnung ganz leise Töne zu vernehmen – manchmal sogar Dreiklänge. «Wer hat ihn das gelehrt?»
Mayranoush lächelte. «Wenn nicht du, wer dann?»
Sophie schüttelte den Kopf. Sie ging ins Haus und stieg die Treppe hoch. Die Tür zur Wohnung war offen. Ebenso jene zum Salon. Auf der Schwelle blieb sie stehen.
Jakob kniete auf der Klavierbank, damit er die Tasten des Pianos erreichen konnte. Er sang eine offenbar selbst erfundene Melodie, verwendete dazu Worte in einer eigenen, unverständlichen Sprache und begleitete sie mit Akkorden. Sophie trat hinter ihn und schaute ihm über die Schultern. Er schlug mit dem Zeigefinger der linken Hand den Grundton an und mit Zeige- und Ringfinger der rechten die entsprechenden Tasten der grossen Terz und der Quinte. Scheinbar bereitete es ihm keine Mühe, Dreiklänge zu bilden.
Das Kind spürte, dass es nicht mehr allein war. Es brach sein Spiel ab, drehte sich um und schaute die Mutter schuldbewusst an.
Sophie hob den Kleinen hoch und schloss ihn in die Arme. «Wer hat dich das gelehrt, Jakob?»
«Niemand, es ist ganz einfach.» Der Bub löste sich von ihr. «Ich zeige es dir.» Er kniete sich wieder auf die Klavierbank. «Wenn du hier beginnst», er schlug ein C an, «und dann alle weissen Tasten der Reihe nach hintereinander spielst, dann passen die Töne zueinander, bis du wieder denselben hast wie am Anfang, nur höher. Du kannst damit weiterfahren bis ans Ende des Klaviers. Es sind immer dieselben Töne, von ganz unten bis ganz oben, genau gleich wie eine Treppe.» Sein Zeigefinger hämmerte mit rasender Geschwindigkeit drei Tonleitern hintereinander hinauf und hinunter.
Sophie war bass erstaunt. «Und schaffst du es auch, wenn du die Tonleiter», sie korrigierte sich: «die Reihe mit einer anderen Taste anfängst, beispielsweise mit dieser?» Sie zeigte aufs G. Gespannt beobachtete sie, wie Jakob einen Ton nach dem andern anschlug und nach dem E, ohne zu zögern, ein Fis spielte, bevor er mit dem eine Oktave höheren G zum Abschluss kam.
«Aber diese Reihe kannst du wohl nicht.» Sophie zeigte aufs H. Die H-Dur-Tonleiter mit ihren fünf Kreuzen schien ihr denn doch zu schwierig für den Kleinen. Jakob lachte glücklich. Im Nu spielte er h-cis-dis-e-fis-gis-ais-h und schaute die Mutter stolz an. Sie drückte ihm einen Kuss auf den Scheitel.
«Ich kann noch mehr.» Jakob spielte sein Lieblingslied: C-a-f-f-e-e, trink nicht so viel Caffee! Er sang es und spielte dazu, zeitlich versetzt, die zweite Stimme auf dem Klavier.
«Ich fasse es nicht», flüsterte Sophie. «Sag einmal Jakob», sie trat zu ihm ans Piano, «weisst du auch wie die Töne heissen? Zum Beispiel dieser hier?» Sie deutete aufs C.
Der Kleine sah sie verwundert an. «Haben sie denn Namen?»
«Und wie nennt man das?» Sophie spielte eine Tonleiter.
«Eine Reihe?», fragte Jakob zweifelnd.
«Kannst du drei Töne, die zusammenpassen, gleichzeitig spielen?»
Der Bub schlug verschiedene Dur- und Moll-Akkorde an.
«Und wie sagt man diesen drei Tönen?»
«Ich weiss es nicht.»
Sophie fuhr ihm über den Kopf: «Das musst du auch nicht wissen, mein Liebling, noch nicht. Ich bin stolz auf dich!» Sie nahm sich vor, ihm zu zeigen, wie man richtig spielt, welche Finger auf welche Tasten gehören.
Von diesem Tag an setzte sie sich jeden Morgen eine Stunde mit Jakob ans Klavier. Zuerst brachte sie ihm bei, wie man Tonleitern hinauf und hinunter korrekt mit den fünf Fingern der rechten Hand spielt. Sophie gab ihm auf, das Erlernte fleissig zu üben. «Du musst so weit kommen», erklärte sie ihm, «dass deine Finger, ohne dass du denkst, die richtigen Tasten von allein finden.» Aber das war kein Problem für ihn. So konnte sie ihm schon bald zeigen, wie man die linke Hand einsetzt.
Lange bevor sie Jakob im Klavierspiel unterrichtete, hatte Sophie mit ihm zahlreiche Kanons gesungen. Jeden Abend vor dem Einschlafen: Dona nobis pacem oder O wie wohl ist mir am Abend, tagsüber: Froh zu sein, bedarf es wenig, auch Hejo, spann den Wagen an und natürlich Bruder Jakob, an dem er wegen der Namensvetternschaft besonders Freude hatte.
Zwei Jahre später war Jakob in der Lage, anspruchsvolle Stücke zu spielen. Sophie würde jenen Sonntag Ende März wohl nie vergessen. Als sie und Simon von einem Spaziergang zurückkehrten, überraschten sie ihre beiden grusinischen Mägde, die im Treppenhaus standen und andächtig dem Klavierspiel lauschten, das durch die angelehnte Wohnungstür in der Beletage klang. Sophie hielt ihren Mann am Arm zurück. «Jakob hat ein neues Stück entdeckt», flüsterte sie.
«Kennst du es?», fragte Simon.
Sie nickte. «Es ist der Fandango in d-Moll von Padre Antonio Soler, einem spanischen Komponisten. Ich habe ihn im letzten November geübt. Aber er spielt ihn besser als ich!»
«Der Kleine ist ein Künstler», behauptete Ekaterina, als die Schlussakkorde verklungen waren. Tamara nickte bestätigend.
«Was sagt sie?», fragte Simon, der nicht Georgisch konnte.
«Jakob sei ein Künstler», übersetzte Sophie. Sie registrierte, wie ihr Mann lächelte.
«Ein Künstler», wiederholte er. Jakob, das wurde er nicht müde zu behaupten, sei seinem eigenen, viel zu früh verstorbenen Bruder, dem Maler, dessen Namen er trug, wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie sein Onkel war der kleine Jakob feingliedrig, hatte ein von Sommersprossen übersätes Gesicht und rotes, weiches Haar. Sophies Schwager hatte einige Bilder und Skizzen hinterlassen, die in ihrer Wohnung hingen. Sie hätte ihn gerne gekannt.
Auf dem Treppenabsatz im ersten Stock erschien Jakob.
«Das hast du wunderbar gespielt!», rief Sophie.
«Ich habe es mit Herrn Fresendorff heimlich geübt», sagte der Bub. «Es ist ein Geschenk für dich.»
2
Seit einem Jahr gab es auf Eben-Ezer einen neuen Bewohner: Cornelius Fresendorff, den Hauslehrer von Karl und Hannes, die inzwischen acht-, respektive siebenjährig waren. Er wolle nicht, dass seine Buben bei den Schwaben in Katharinenfeld zur Schule gehen, hatte Simon erklärt. Dort würden sie zusammen mit fünf Dutzend anderen Kindern unterrichtet und lernten wenig bis nichts. Er wusste, wovon er sprach. Er selbst war in seiner Kindheit im Emmental während sechs Jahren im Winterhalbjahr mit fünfundsiebzig Leidensgenossen in einer engen Stube eingepfercht gewesen, wo ein überforderter Schulmeister mit zweifelhaftem Erfolg der ungebärdigen Schar die Grundlagen des Schreibens und Rechnens eingeprügelt hatte. Tatsache war, dass Simon noch heute keinen fehlerfreien Brief zustande brachte. Dass er fähig war, die Bücher eines Gutsbetriebes zu führen, verdankte er den Brüdern Hieronymus und Benedict Lüthi, bei denen er das Käserhandwerk erlernt hatte.
«Ich will, dass wir für Karl und Hannes einen Hauslehrer anstellen», hatte Simon gesagt. «Am besten einen aus dem Baltikum.» Dort spreche man Deutsch und Russisch, und richtig Russisch sprechen und schreiben müssten die Buben lernen, wenn sie es in Grusinien zu etwas bringen wollten. Er hatte einem Agenten in Tiflis den Auftrag gegeben, in Riga in der Zeitung für Stadt und Land ein entsprechendes Inserat aufzugeben.
Immer wenn sie an Cornelius Fresendorffs Ankunft auf Eben-Ezer dachte, musste Sophie lächeln. Sie und Simon hatten am Teich im Blumengarten miteinander geplaudert, als ein Fremder durch die Birnbaumallee aufs Herrenhaus zuritt. Sie sahen ihm belustigt entgegen. Der Mann fühlte sich sichtlich unwohl auf seinem Maulesel. Ein zweites Tier, das sein Gepäck trug, führte er am Halfter neben sich her. Er war kleingewachsen und etwas rundlich. Seinem noch unfertigen, bartlosen Gesicht konnte man entnehmen, dass er nur wenig über zwanzig war. Er trug einen schwarzen Anzug, ausserdem einen breitkrempigen Hut. Durch die runden Gläser seiner Brille musterte er das Ehepaar und fragte, ob dies hier das Gut der Diepoldswilers sei.
Sophie wurde warm ums Herz. Er sprach das Deutsch der Balten, dasselbe, das ihr Vater gesprochen hatte. «Ihr seid gewiss unser neuer Hauslehrer. Herzlich willkommen auf Eben-Ezer!», begrüsste sie ihn.
Er stieg umständlich von seinem Tier und zog den Hut, unter dem ein schwarzer Haarschopf zum Vorschein kam. Er deutete eine Verbeugung an und schlug die Hacken zusammen. «Gestatten», sagte er, «Cornelius Fresendorff.» Die lange Fahrt mit der Eisenbahn und in Postkutschen habe ihm die Seele aus dem Leib geschüttelt, klagte er. Dass er am Schluss in Katharinenfeld noch zwei Maulesel habe mieten müssen, ausgerechnet er, der weiss Gott kein Reitersmann sei, habe seiner Reise nach Grusinien die Krone aufgesetzt.
«Ihr seid also aus den Ostseeprovinzen», eröffnete Simon beim Nachtessen, das man wie üblich gemeinsam mit dem Gesinde einnahm, das Gespräch. Er bemühte sich, jenes Hochdeutsch zu sprechen, das er aus den Büchern Gotthelfs kannte. Üblicherweise blieb er beim Berndeutschen. Mit den Dienstboten und den Leuten aus dem Dorf redete er ein fehlerhaftes Russisch, das er sich im Laufe der Jahre mühsam angelernt hatte.
«Aus Kurland», beantwortete Fresendorff Simons Frage, «um genau zu sein, aus Libau, wo mein Herr Vater als Arzt praktiziert.»
«Und studiert habt Ihr in Sankt Petersburg?»
«Ja. Mein Vater, dem ich in meiner Jugend oft assistiert habe, hätte es zwar lieber gesehen, wenn ich nach Dorpat gegangen und Medikus geworden wäre, wie er. Aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, klassische Philologie und Geschichte zu studieren.»
«Philosophie, meint Ihr wohl?», fragte Simon.
«Nein, Philologie – Sprachwissenschaften.» Der junge Mann säbelte ein grosses Stück vom Schmorbraten ab, den Sophie nach einem Rezept ihrer Grossmutter zubereitet hatte. Er balancierte es auf seinen Teller, zerkleinerte es, spiesste ein Stück ums andere mit seiner Gabel auf und spülte alles mit einem tüchtigen Schluck Wein hinunter. Klassische Philologie, dozierte er, beschäftige sich mit altgriechischen und lateinischen Texten, mit Dramen, Epen und Lyrik, aber auch mit historiographischen, naturwissenschaftlichen und philosophischen Zeugnissen der alten Römer und Griechen.
«Aha», sagte Simon und machte ein ratloses Gesicht. Ihm wurde bewusst, dass er einen seltsamen Vogel auf den Hof geholt hatte.
Sophie wirkte eher besorgt. «Und das alles müssen meine Buben jetzt bei Euch lernen?»
«Gott bewahre!» Fresendorff hielt Wassilij, dem alten Diener des Barons, der den Mundschenk machte, das leere Weinglas hin. «Ich bringe ihnen zuerst einmal Lesen und Schreiben bei, auf Deutsch und Russisch, dann Rechnen, später Geschichte, Naturkunde und Geografie. Wenn es Euch recht ist, beginne ich mit dem Unterricht gleich morgen: vier Stunden am Vormittag, zwei am Nachmittag. Am Mittwoch- und am Samstagnachmittag sollen sie frei haben.»
Sophie sah ihren Mann fragend an. Der zuckte mit den Schultern. «Das ist in Ordnung», meinte sie. «Ich habe im Anbau ein Schulzimmer eingerichtet: ein Pult und eine Wandtafel für Euch, zwei kleine Tische und Schiefertafeln samt Griffel für Karl und Hannes. Wenn Ihr mehr braucht, so sagt es mir.»
Cornelius Fresendorff lebte sich auf Eben-Ezer ein. Sobald sie die Schulstube betraten, war ihr Lehrer für Karl und Hannes die höchste Autorität. Sie fügten sich willig seinen Anweisungen, bemühten sich, seinen Anforderungen gerecht zu werden, und gierten nach seinem Lob. Mayranoush schloss den jungen Mann, der ihr, so gelehrt er auch sein mochte, etwas weltfremd erschien, in ihr Herz. Sie half ihm, seine beiden Kammern unter dem Dach einzurichten: einen Schlafraum und eine Stube mit einem Kanonenofen, der im Winter für behagliche Wärme sorgte. In dieser kleinen Wohnung hatte Simon vor seiner Heirat gelebt. Die Armenierin bat Hovhannes Stepanyan, den Zimmermann, für den neuen Lehrer ein Regal anzufertigen, in das er seine vielen Bücher einordnen konnte. Sie selbst nähte ihm Kleider, die hier draussen in der Steppe praktischer waren als sein schwarzer Anzug.
Wenn die Buben im Bett waren, trafen sich die Diepoldswilers mit Mayranoush und Cornelius im Salon. Wie schon zu Zeiten des Barons wurde für die Männer Cognac serviert, während die Frauen aus winzigen Tassen stark gesüssten türkischen Kaffee tranken. Man plauderte, erzählte sich Geschichten und Fresendorff las aus Büchern vor, welche die anderen nicht kannten. Ab und zu sang Sophie Lieder aus Des Knaben Wunderhorn und begleitete sich dazu auf dem Klavier.
Eines Abends brachte der Balte eine Klarinette mit. Er habe in Sankt Petersburg in einem Orchester mitgespielt, sagte er, und wenn sie nichts dagegen habe, so könne man gemeinsam musizieren.
«Was möchtet Ihr denn spielen?», fragte Sophie.
Ob sie den Walzer aus der Schönen Helena von Jacques Offenbach kenne?
Sophie erstarrte. Im Sommer vor neun Jahren hatte eine Kosakeneinheit, die zur russisch-osmanischen Grenze unterwegs war, auf dem Gutshof drei Tage gerastet. Baron von Fenzlau hatte den Offizieren in seinem Haus Gastrecht gewährt. Auf seinen Wunsch hatte Sophie, damals ein siebzehnjähriges, törichtes Ding, zur Unterhaltung der Gäste Leutnant Schota Awalischwili, der seine Violine mit sich führte, auf dem Piano zu Offenbachs Walzer begleitet. Sie hatte sich in den gut aussehenden jungen Mann verguckt. Am nächsten Tag war sie auf dem Hügel bei der alten Kapelle, dort, wo jetzt das Grab ihres Vaters war, von ihm verführt worden. Hätte Simon sie nicht geheiratet und ihren Erstgeborenen, Karl, als eigenen Sohn anerkannt, würde sie heute ein vaterloses, unter liederlichen Verhältnissen gezeugtes Kind aufziehen müssen. Ihr Mann wusste nichts Genaues von den Umständen, die zu ihrer Schwangerschaft geführt hatten. Er wollte es auch gar nicht wissen, denn das gehörte zu den Dingen, über die man auf Eben-Ezer nicht sprach.
Und jetzt kam dieser Mensch aus Kurland und wollte mit ihr den Walzer spielen, der sie, nachdem der Leutnant weitergeritten war, über Wochen als Ohrwurm gequält hatte. «Nein!», sagte sie schroff. «Ich kenne das Stück nicht und will es auch nicht kennenlernen.»
Fresendorff schaute sie verwundert an und spielte dann die ersten Takte von Ännchen von Tharau. «Aber das habt Ihr gewiss schon gehört?»
Sophie nickte. Sie kannte das populäre Liebeslied.
Von diesem Abend an spielten die beiden regelmässig deutsche und russische Volkslieder – er mit seiner Klarinette die Grundmelodie, sie die Begleitung. Wenn Sophie sang, dann intonierte der Hauslehrer, zum Vergnügen von Simon und Mayranoush, die zweite Stimme. Karl, Hannes und der fünfjährige Jakob stiegen aus den Betten und schlichen sich in ihren Hemden vor die Tür des Salons, um zuzuhören. Und selbst der alte Wassilij, zu dessen Pflichten es gehörte, die sechs Ulmer Doggen aus ihrem Zwinger zu befreien, damit sie nachts das Anwesen schützten, blieb draussen auf dem Platz vor dem Haus unter dem offenen Fenster stehen und lauschte.
Cornelius Fresendorff war ein musikalischer Mensch, dem Jakobs Talent nicht verborgen blieb. Er war der Meinung, das Kind sei alt genug, die Grundzüge der Musiktheorie kennenzulernen. «Wenn mich nicht alles täuscht, verfügt Euer Jüngster über eine ausserordentliche Begabung, die unterstützt werden muss», sagte er zu Sophie. Er würde sich freuen, Jakob einmal in der Woche unterrichten zu dürfen. Zögernd stimmte sie zu, und so lehrte Fresendorff Jakob seit