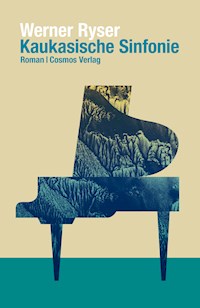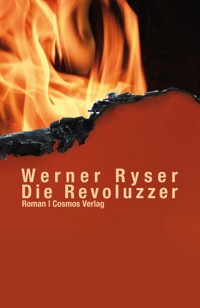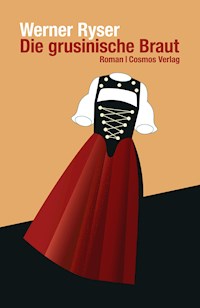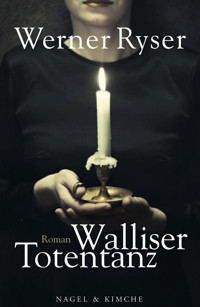10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eines Tages wird Wendelin, ein kleiner Junge, beim Arzt des Dorfes in einem Korb vor die Tür gelegt. Balthasar Melchior kümmert sich um dieses Findelkind und nimmt es bei sich auf. Einige Zeit später gibt er auch dem Mädchen Lila und ihrer Mutter ein Zuhause. Wendelin und Lila sind gleichaltrig und wachsen wie Geschwister miteinander auf - die beiden sind ein richtig gutes Team.
Eines Tages geraten sie durch eine Nebelwand in den Eulenforst – in den Wald, von dem alle Dorfbewohner glauben, er sei verhext. Dort treffen Wendelin und Lila auf Wassergeister, auf Elfen, Feen, Drachen, Zwerge, Hexen und Geister.
Als Wendelin einmal den Mut verliert, ist es Lila, die furchtlos voranschreitet, dann ist es wieder Wendelin, der sich nicht ins Bockshorn jagen lässt. Und so besiegen sie gemeinsam den Drachen, bestehen noch weitere Abenteuer und retten am Ende das magische Reich Seeland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Nagel & Kimche
Für Alba, Mila, Xenia, Nick, Noam und Jana
1
Doktor Melchior bekommt ein Kind
Das Städtchen Rabensberg hatte sich kaum verändert seit jenen Zeiten, als es noch Könige und Prinzessinnen, Edelfrauen und Ritter gab. Eine Stadtmauer mit zwei Toren, dem Ober- und dem Untertor, schützten die schmalen Fachwerkhäuser in den engen Gassen. Mittendrin war das Schloss. Auf der Zinne des Turms wehte die Fahne des Städtchens im Wind: ein schwarzer Rabe auf silbernem Grund.
Hier hatten vor Zeiten die Grafen von Rabensberg gelebt. Über sie konnte man aber nur noch in alten Büchern nachlesen, denn sie waren längst ausgestorben. Heute arbeiteten der Bürgermeister und seine Angestellten im Schloss. In einem Nebengebäude, das an den Hof mit seiner großen Linde grenzte, befanden sich der Polizeiposten sowie die Garage und das Magazin der Feuerwehr.
Das Städtchen lag auf einem Hügel mit dem Rücken zum südlichen Gebirge mit seinen schneebedeckten Gipfeln. Nach Norden hatte man einen weiten Blick über die fruchtbare Ebene. Äcker und Weideland erstreckten sich bis zum Eulenforst, einem dunklen und unwegsamen Wald.
Eines Tages ging Doktor Balthasar Melchior im Eulenforst spazieren. Das heißt, eigentlich suchte er Kräuter. Der Doktor war der einzige Arzt in Rabensberg und da er die meisten seiner Salben und Pillen selbst herstellte, war es nicht zu vermeiden, dass er ab und zu in den Wald ging. Im Herbst sammelte er dort auch Pilze.
Außer ihm wagte sich kein Rabensberger in den Eulenforst, denn im Städtchen war jedermann überzeugt, es sei dort nicht geheuer. Man erzählte sich, der Wald sei verhext. Der Doktor allerdings glaubte nicht an Hexen, Feen und Elfen, auch nicht an Waldgeister, Zwerge und Wassernixen und schon gar nicht an Gespenster. »Die alle gehören in Märchenbücher und dort sollen sie schön bleiben«, sagte er und lachte, wenn die Leute ihn vor seinen Ausflügen warnten.
Heute aber sollte Doktor Melchior eine Überraschung erleben. Gerade als er auf einer Lichtung ein paar Waldmeisterchen pflückte, rief eine glockenhelle Stimme: »Balthasar!« Vor ihm, wie aus dem Nichts aufgetaucht, stand eine Frau. Sie trug ein langes blaues Kleid, das mit Goldfäden bestickt war. Ihr blondes Haar, in dem sie einen goldenen Reif trug, fiel offen auf die Schultern. Sie war schön. Am allerschönsten aber waren ihre großen blauen Augen, die ihn wie zwei Sterne freundlich anlächelten. »Balthasar«, wiederholte sie, »Du wirst ein Kind bekommen, einen Jungen. Sei gut zu ihm!«
Der Doktor starrte die Frau mit offenem Mund an. Er war völlig verblüfft. Woher war sie so plötzlich gekommen? Und was sollte das mit dem Kind? Man muss nämlich wissen, dass Balthasar Melchior, Balz, wie ihn seine Freunde nannten, unverheiratet und nicht mehr der Jüngste war. »Ja, aber«, stammelte er, als er sich einigermaßen von seiner Überraschung erholt hatte, »weshalb sollte ich alter Junggeselle noch ein Kind bekommen?«
Die Frau ging nicht auf die Frage ein. »Ich bin sicher, dass du ihm ein guter Vater sein wirst«, lächelte sie. Sie wandte sich um und ging so leichtfüßig davon, dass man hätte glauben können, sie schwebe. Und mit einem Mal war sie verschwunden. Einfach so. Als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Der Doktor rieb sich die Augen, aber das nützte nichts. Die Frau war weg. Still lag die Waldwiese vor ihm. Nur ein paar Gräser zitterten. »Hol’s der Kuckuck«, murmelte er, »ich glaube, bei mir ist ein Schräubchen locker.« Nachdenklich machte er sich auf den Heimweg.
Am Fuß des Hügels, unterhalb des Städtchens, hatten Fahrende ihr Lager aufgeschlagen. Vier bunt bemalte Wohnwagen standen in einem weiten Kreis, in dem sich Männer, Frauen und Kinder um ein Feuer scharten, über dem ein Kessel hing. Sie alle hatten dunkle Gesichter, schwarze Haare und schwarze Augen. Die Frauen und Mädchen, die mit Halsketten und großen Ohrringen geschmückt waren, trugen lange, farbige Röcke. Außerhalb des Lagers grasten einige struppige Pferdchen.
Doktor Melchior lachte in sich hinein. Heute Abend würden die Roma, wie sie sich selber nannten, ihre Waren – geflochtene Körbe und Taschen, Schmuck aus Silberdraht und bunte Tücher – im Schlosshof feilbieten. Gewiss war auch eine Wahrsagerin unter ihnen, die den guten Leuten gegen klingende Münzen Glück in der Liebe und unermesslichen Reichtum prophezeite.
Er selbst hatte nicht vor, hinzugehen, denn er war müde und auch ein wenig verwirrt von der Begegnung im Eulenforst. »Ein Kind«, grummelte er, »ausgerechnet ich.« Er freute sich auf sein Abendessen. Anschließend wollte er ein Glas Wein trinken und dann ins Bett gehen.
Doktor Melchior hatte einen leichten Schlaf. Als der Türklopfer dreimal gegen die Hauspforte schlug, erwachte er sofort. Als Arzt war er es gewohnt, zu allen Tages- und Nachtzeiten gestört zu werden. »Ich komme ja gleich«, brummte er. Er zog den Morgenrock an, schlüpfte in die Pantoffeln und trat ans Fenster.
Ein Rom stand auf der Gasse unter einer Laterne. Er war ein großer, breitschultriger Mann mit einem prächtigen Schnurrbart und mit Haaren, die ihm über die Ohren fielen. Er trug eine schwarze Weste, darunter ein feuerrotes Hemd, dazu enge, schwarze Hosen und halbhohe Stiefel. In seinem Gürtel steckte ein reich verzierter Dolch. Er sah zum Fenster hinauf und deutete eine Verbeugung an, indem er mit einer ausholenden Geste den flachen, runden Hut gegen die Brust drückte. Dazu lachte er und ließ das Gold in seinen weiß blitzenden Zähnen sehen.
»Nur einen Moment«, rief Doktor Melchior. Dann lief er die Treppe hinunter und öffnete die Tür. Auf der Schwelle stand ein Korb, in dem, in ein warmes Lammfell gehüllt, ein Kindlein lag. Aber der Mann war verschwunden.
»Das soll doch der …«, rief der Doktor und rannte in den Pantoffeln und mit wehendem Morgenrock durchs Städtchen bis zum Untertor. Außer Atem blieb er stehen und spähte den Hügel hinunter.
Über dem Eulenforst war der Mond aufgegangen. Wenige Handbreit nur stand er über den Tannenwipfeln. Sein silberner Schein übergoss die Ebene mit mildem Licht. Doktor Melchior schaute zum Lager der Fahrenden, das heißt dorthin, wo es am Abend noch gewesen war. Aber es war verschwunden. Die Menschen, die Pferde, die Wohnwagen – alles war weg. Nur das zusammengesunkene Feuer glühte noch schwach.
Ärgerlich schüttelte er den Kopf. Dann ging er langsam zurück. Vor der Haustür weinte das Kind in seinem Korb. Er bückte sich und hob es hoch. »Du armer Wurm«, seine Stimme klang zärtlich. Er drückte es fest an seine Brust. Als er den Korb aufnahm, sah er im Fell etwas aufleuchten. Es war ein goldener Fingerring, mit einem wertvollen, blauen Stein. Er nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn genau. Im Stein eingraviert war ein zierliches Einhorn.
Doktor Melchior verstand etwas von Säuglingen. Schließlich hatten er und die Hebamme des Städtchens gemeinsam vielen kleinen Rabensbergern auf die Welt geholfen. Im Behandlungszimmer bewahrte er Windeln, eine Schoppenflasche und Babymilchpulver auf. Als er das Kind wickelte, stellte er fest, dass es ein Bub war. Anschließend bereitete er das Fläschchen zu und gab sie ihm zu trinken.
»Na, kleiner Mann«, sagte der Doktor, »das schmeckt, was?« Dann legte er ihn in sein Körbchen. Bevor er selbst zu Bett ging, legte er den Ring mit dem Einhorn behutsam in eine kleine Schatulle, die er sorgfältig in seinem Schreibtisch verschloss.
2
Das Kind bekommt einen Namen und Doktor Melchiors Haushalt wird größer
Balz Melchior war vierundvierzig Jahre alt, nicht zu groß und nicht zu klein. Seine ehemals braune Lockenpracht hatte sich an der Stirn bereits gelichtet. Aus dem runden Gesicht blickten, umrahmt von unzähligen Lachfältchen, zwei kluge, braune Augen hinter blitzenden Brillengläsern hervor. Er hatte ein kleines Bäuchlein. Das kam daher, dass er gut und gerne kochen konnte und noch lieber aß.
Aber an diesem Morgen war er fuchsteufelswild. Bürgermeister Guggenbichler und der Polizeigefreite Knobloch standen kleinlaut in seinem Behandlungszimmer vor ihm und ließen das Gewitter über sich ergehen. Dabei konnten sie wirklich nichts dafür.
»So eine Gemeinheit«, polterte der Doktor, »ein so kleines, unschuldiges Kerlchen einfach auszusetzen. Diesen Halunken möchte ich behandeln dürfen, wenn er einmal krank ist. Dem würde ich einen Suppenteller voller Lebertran verschreiben, den er vor meinen Augen auslöffeln müsste.«
»Vielleicht lassen sich die Fahrenden noch einholen«, versuchte Guggenbichler das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. »Knobloch«, wandte er sich an den Polizisten, »Sie gehen jetzt ans Telefon und alarmieren alle Polizeiposten in der Umgebung. Man soll die Bande festnehmen, sobald sie auftaucht.«
»Zu Befehl, Herr Bürgermeister«, der dicke Knobloch in seiner zu engen Uniform salutierte. Es sah nicht gerade stramm aus. Dann trollte er sich. Er war froh, dem wütenden Doktor zu entrinnen.
Doktor Melchior beachtete ihn gar nicht. »Oder Rizinus«, sagte er in Gedanken versunken.
»Wie bitte?«, fragte der Bürgermeister.
»Rizinusöl sollte man dem Kerl einflößen, nicht zu knapp, das gibt nämlich einen bildschönen Dünnpfiff, müssen Sie wissen.«
»Ach so«, Guggenbichler verzog den Mund zu einem säuerlichen Lächeln. »Ich frage mich nur, was wir mit dem Kind machen, wenn Knobloch den Rom wiederfindet. Nach allem, was geschehen ist, können wir es ihm kaum zurückgeben.«
»Das fehlte noch«, rief der Arzt, »diesem Verbrecher!«
»Dann müssen wir es wohl in einem Kinderheim versorgen«, meinte der Bürgermeister und zuckte mit den Schultern.
In diesem Moment erwachte das Baby in seinem Körbchen und begann zu weinen. Sofort hob es der Doktor hoch. »Nananana«, tröstete er es mit ganz feiner Stimme. »Dubidubidu, wer will den gleich weinen? Du bist doch bei Onkel Balz.«
Er kitzelte das Büblein unter dem Kinn. »Kommt gar nicht infrage«, sagte er streng zu Guggenbichler.
»Was kommt nicht infrage?«
»Das Kind in ein Heim zu stecken. Was soll so ein prächtiges Kerlchen in einem Riesensaal, wo zwanzig Bettchen in Reih und Glied stehen und die Pflegerinnen keine Zeit haben für die unglücklichen Würmer. Mit kleinen Kindern muss man nämlich schmusen, falls Sie das noch nicht gewusst haben.« Er drückte das Baby fest an sich und gab ihm links und rechts einen Kuss auf seine Pausbacken.
»Bei allem Respekt, Herr Doktor, aber wer, bitteschön, soll das Büblein großziehen?«
»Ich natürlich«, Balz Melchior schaukelte den Säugling behutsam auf seinen Armen, »wir zwei gehören zusammen, nicht wahr, Wendelin?«
»Wer ist Wendelin?«, fragte der Bürgermeister verwundert.
»Da, mein kleiner Findling. Ich habe beschlossen, ihn Wendelin zu nennen. Wendelin Melchior.«
»Sie wollen das Baby behalten? Aber verstehen Sie denn etwas von Kindern? Es braucht doch so etwas wie eine Mutter.«
»Ich bin eine gute Mutter«, knurrte der Arzt, »Gemeinsam mit unserer Hebamme, Frau Glättli, habe ich in meinem Leben schon mehr Kinder zur Welt gebracht als alle Ihre Tanten zusammen.«
Guggenbichler wiegte zweifelnd den Kopf hin und her, aber bevor er noch etwas sagen konnte, stürmte der Polizeigefreite Knobloch ins Zimmer. »Verzeihung, Herr Bürgermeister«, er salutierte, »die Fahrenden sind verschwunden.«
»Was soll das heißen? Vier Wohnwagen und acht Pferde können doch nicht einfach verschwinden!«
»Eben doch«, Knobloch wischte sich mit seinem rot-weiß karierten Taschentuch den Schweiß von der Stirn, »man hat sie in keinem der umliegenden Dörfer gesehen. Wahrscheinlich verstecken sie sich im Eulenforst.«
»Dann suchen Sie sie eben im Eulenforst«, meinte der Doktor.
»Keine zehn Pferde bringen mich dorthin«, schwor Knobloch, »der Wald ist verhext.«
»Unsinn«, sagte der Arzt, »Hexen gehörend in Märchenbücher.« Aber dann stockte er. Seine Begegnung mit der Frau im blaugoldenen Kleid fiel ihm ein. »Na ja«, meinte er versöhnlich, »dann lassen Sie es halt bleiben.»
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich im Städtchen die Nachricht, der Doktor habe ein Kind bekommen. Auf dem Markt, im Kaufladen und in den Straßen sprach man von nichts anderem. Viele Rabensberger wurden krank, nur damit sie zum Arzt gehen und das Büblein sehen konnten.
Und sie sahen es. Doktor Melchior hatte niemanden, der Wendelin hütete, wenn er tagsüber seine Patienten untersuchte und ihnen Rezepte ausstellte. So stand das Körbchen im Behandlungszimmer und immer wieder einmal mussten sich die Kranken gedulden, bis sie eine Spritze oder einen neuen Verband erhielten, weil der Doktor zuerst Wendelin die Flasche geben oder ihn frisch wickeln musste. Er hatte sich einen Kängurusack gekauft, eine Art Tasche, die er sich vor die Brust band und in die er das Kindchen steckte, wenn er einen Patienten in der Stadt oder der Umgebung besuchte.
Der Doktor musste jede Nacht aufstehen, denn pünktlich um zwei Uhr erwachte Wendelin und verlangte lauthals nach seiner Milch. Es war eine harte Zeit für den guten Mann, der sich auf einmal neben seiner Arbeit und dem Haushalt zusätzlich um ein Baby kümmern musste. Und in der Tat bildeten sich schon nach drei Wochen Ringe unter Doktor Melchiors Augen, sein molliges Bäuchlein schmolz dahin und man hätte sich Sorgen um seine Gesundheit machen müssen, wenn nicht …
… ja, wenn nicht eines Tages Maria mit Lila aufgetaucht wäre. Maria war eine junge Frau mit viel Temperament und schwarzem Haar. Sie stammte aus dem Land südlich der hohen Berge. Eines Tages erschien sie mit ihrer kleinen Tochter in Rabensberg. Lila, die etwa gleich alt war wie Wendelin, hatte hohes Fieber, sodass ihre Mutter als Erstes den Arzt aufsuchte. Ganz verzweifelt streckte sie das Mädchen dem Doktor entgegen, der es untersuchte und ein bedenkliches Gesicht machte.
»Eine schwere Lungenentzündung«, sagte er schließlich. »Die Kleine braucht unbedingt Ruhe. Sie gehört ins Bett und dann geben Sie ihr Medikamente.« Er stand auf, um den Rezeptblock aus dem Schränkchen hinter seinem Schreibtisch zu holen. Dann sah er, dass Maria weinte. Dicke Tränen kullerten über ihre Wangen.
»Na, na«, brummte Doktor Melchior, der immer schrecklich verlegen war, wenn jemand weinte, »wir werden das kleine Ding schon durchbringen. Es braucht Bettruhe, die richtigen Medikamente und dann wird es gewiss wieder werden.«
»Wir haben aber kein Bett«, schluchzte die junge Frau. Und dann erzählte sie, dass sie in ihrer Heimat als Hebamme ausgebildet worden sei. Aber einer unverheirateten Mutter gebe man in ihrem Dorf, wo strenge Sitten herrschten, keine Stelle – schon gar nicht als Geburtshelferin. »Deshalb bin ich nach Rabensberg gefahren«, fuhr sie fort. »Ich hoffte, hier arbeiten zu können – wobei ich ja auch noch ein kleines Kind habe, um das ich mich kümmern muss. Und jetzt dieses Unglück! Wir sind eben erst angekommen.« Maria war ganz verzweifelt. »Ich weiß nicht, wo wir hinsollen. Wir kennen doch niemanden.«
Der gute Doktor betrachtete sie nachdenklich. Dann sah er auf das kleine Mädchen mit den fieberroten Wangen. »Sie können bei mir wohnen«, sagte er kurz entschlossen. »In meinem Haus ist Platz genug für Sie und Lila. Außerdem können wir in Rabensberg jemanden mit Ihrer Ausbildung gut gebrauchen. Das Städtchen ist in letzter Zeit gewachsen und Elisabeth Glättli, unsere Hebamme, hat alle Hände voll zu tun. Sie ist jetzt auch schon über fünfzig und hat mir kürzlich gesagt, sie wäre froh, jemanden zu haben, der sie ab und an vertreten könnte. Wenn Sie damit einverstanden sind, werde ich Sie mit ihr bekanntmachen.«
Maria strahlte. Sie trocknete ihre Tränen und tanzte aus lauter Freude mit ihrem kranken Töchterchen im Behandlungszimmer herum. »Oh, Herr Doktor«, rief sie, »Sie sollen es nie bereuen, uns aufgenommen zu haben.«
»Schon gut, schon gut«, brummte der Arzt, »ich glaube, wir brauchen Sie ebenso wie Sie uns. Übrigens«, und jetzt hob er voller Stolz Wendelin aus seinem Körbchen, »das Büblein heißt Wendelin, Wendelin Melchior.«
Maria nahm den Jungen in den linken, die kranke Lila in den rechten Arm und folgte dem Doktor, der sie in seine Wohnung führte.
3
Die Geschichte vom Gespenst im Eulenforst
Die Jahre kamen und gingen. Im Rabensberger Doktorhaus wuchsen Lila und Wendelin wie Geschwister auf. Da sie gleich alt waren, nannte man sie im ganzen Städtchen nur »die Zwillinge«. Mit dem Einzug Marias hatte sich manches zum Guten gewendet. Sie kochte so ausgezeichnet, dass sich das Bäuchlein des Doktors wieder voll und rund über dem Gürtel wölbte. Stets standen frische Blumen im Wohnzimmer, und wenn Maria fröhliche Lieder aus ihrer südlichen Heimat sang, blieben die Leute auf der Straße unter dem offenen Fenster stehen und lächelten sich zu
Die resolute Elisabeth Glättli und Maria verstanden sich ausgezeichnet. Die erfahrene Hebamme hatte bald erkannt, dass die Jüngere ihr Handwerk beherrschte. Wenn sie einmal krank war oder in die Ferien fuhr, ließ sie sich von Maria vertreten. Sie übergab ihr auch die Aufgabe, werdende Mütter in Kursen auf die Geburt vorzubereiten und ihnen beizubringen, wie man mit Säuglingen umgehen musste.
War Maria einmal tagsüber beruflich unterwegs, sorgte eine Nachbarin für die Kinder, wurde sie abends oder in der Nacht zu einer Entbindung gerufen, kümmerte sich der Doktor um die beiden.
Lila hatte feuerrotes, wildes Haar, das sich kaum bändigen ließ. Sie trug es meist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihr Gesicht war voller Sommersprossen und sah aus wie der Sternenhimmel. Über ihren runden Wangen blitzten schalkhaft zwei grüne Augen, die sich, wenn sie ungehalten war, wie bei einer Katze zu zwei engen Schlitzen verengen konnten. Sie hatte runde Arme und Beine und war wieselflink. Das Temperament hatte sie von ihrer Mutter geerbt. Meist war sie aufgekratzt und fröhlich. Sie konnte aber auch in Wut geraten und auf den Boden stampfen.
Anders als Lila war Wendelin eher nachdenklich. Seinen klaren hellblauen Augen, die ernsthaft in die Welt hinausschauten, entging wenig. Wenn ihn Doktor Melchior auf die Knie nahm und ihn zärtlich »mein kleiner Rom« nannte, so war doch offensichtlich, dass er nicht vom fahrenden Volk abstammte. Er hatte weiches, blondes Haar und ein schmales Gesicht.
Auch wenn eigentlich nur Maria und Lila zusammengehörten, fühlten sich die vier wie eine Familie. Das Schicksal hatte sie zusammengewürfelt und daran wollte niemand von ihnen etwas ändern. Die Kinder nannten den Doktor Onkel Balz. Sie liebten ihn, wie sie Maria liebten. Sie war für Lila Mami, Wendelin sprach sie mit ihrem Vornamen an. Er wusste, dass niemand, nicht einmal Onkel Balz, seine richtigen Eltern kannte. Das machte ihn aber nicht traurig, denn er fühlte sich bei ihm, Maria und Lila daheim und wäre nie auf die Idee gekommen, sich etwas anderes zu wünschen.
Die Zwillinge gingen inzwischen bereits zur Schule, wo ihnen Frau Friedmann das ABC beibrachte. Lila schwärmte für ihre junge Lehrerin, in deren linker Wange sich ein Grübchen bildete, wenn sie lachte. Und sie lachte oft. Besonders beeindruckte sie, dass Carmen Friedmann in der Rabensberger Stadtmusik Trompete spielte. Lila träumte davon, später auch einmal, in einer schmucken Uniform und keck aufgesetzter Mütze auf dem roten Haar, dabei sein zu dürfen, um einem Instrument, am liebsten einer Zugposaune, flotte Melodien zu entlocken.
Am Sonntag nahm sich der Doktor jeweils Zeit für die Kinder. Am Vormittag stand er am Kochherd. Er sagte zwar, er mache das nur, damit sich Maria ausruhen könne, aber alle wussten, dass er fürs Leben gern in den Pfannen und Töpfen rührte. Er zauberte jedes Mal ein Festessen auf den Tisch und natürlich gab es stets ein Dessert: Kuchen, Eis oder Pudding, sodass die Kinder sich wünschten, jeder Tag wäre ein Sonntag. Nach dem Essen unternahm er mit Lila und Wendelin weite Streifzüge in die Umgebung. Einmal, es war ein wunderschöner Vorfrühlingstag, gingen sie zum Eulenforst. Am Waldrand setzten sie sich ins Gras.
»Erzähl uns eine Geschichte, Onkel Balz«, bat ihn Lila, denn Doktor Melchior steckte stets voller Geschichten.
»Eine Geschichte«, brummte er, »immer wollt ihr Geschichten hören. (Dabei machte er nichts lieber, als Geschichten zu erzählen, aber er wollte darum gebeten werden.)
»Bitte, bitte, bitte«, rief Lila und auch Wendelin stimmte ein.
»Was soll ich euch denn erzählen?« Er legte sich auf den Rücken, verschränkte die Arme unter dem Kopf und blinzelte vergnügt in die Sonne.
»Vielleicht kennst du eine Geschichte vom Eulenforst«, drängte Wendelin. »Die Leute sagen, der Wald sei verhext und Maria hat uns verboten, hineinzugehen.«
»Soso, hat sie das«, Doktor Melchior schloss die Augen. »Die Leute reden viel«, meinte er schließlich, »und das meiste ist Unsinn. Ich suche hier manchmal Kräuter und ich habe noch nie eine Hexe getroffen.« Er verstummte und wurde ein wenig rot, »das heißt, vielleicht habe ich einmal eine Fee gesehen.«
Lila machte große Augen. »Eine richtige Fee, Onkel Balz?«, sie drängte sich ganz nah an ihn, »erzähl!«
»Nein«, er setzte sich wieder auf, »das war, bevor der Rom Wendelin brachte. Diese Geschichte erzähle ich erst, wenn ihr größer seid.«
Wendelin schwieg. Er wusste, dass nichts zu machen war, wenn der Doktor in diesem Ton redete.
Lila schmollte: »Immer sind wir zu klein.« Sie rückte von ihm ab.
»Nun zieh nicht gleich eine Schnute, kleines Fräulein«, lächelte Onkel Balz, »habt ihr übrigens gewusst, dass es im Eulenforst ein Gespenst geben soll?«
»Ein Gespenst?«, riefen die Kinder wie aus einem Mund.
»Tief im Wald, sagt man, gibt es eine Ruine, in der das Gespenst haust. Ich habe es allerdings noch nie gesehen, auch nicht die Ruine«, fuhr der Doktor fort, »aber dass vor vielen Hundert Jahren im Eulenforst ein Wehrturm stand, der den Grafen von Rabensberg gehörte, das weiß man aus alten Dokumenten. Bürgermeister Guggenbichler hat es mir einmal erzählt. Und dass Graf Ruppert seine Tochter Isabelle dort einsperrte, weiß man auch.«
»Warum hat er das gemacht?«, fragte Lila empört.
»Isabelle wollte einen armen Ritter, den sie liebte, heiraten. Als ihr Vater damit nicht einverstanden war, lief sie mit dem jungen Mann davon. Die Soldaten des Grafen jagten den beiden nach und brachten sie nach Rabensberg zurück. Dem Ritter wurde der Kopf abgeschlagen und Isabelle kam in den Turm. Wenige Tage später brach Feuer aus und der Turm brannte bis auf die Mauern nieder. Das Edelfräulein kam in den Flammen um.«
»Und das Gespenst im Eulenforst ist der Geist von Isabelle?« Lila hatte sich längst wieder an den Doktor geschmiegt.
»So sagt man. Es wird erzählt, dass sie in Vollmondnächten durch die Ruine huscht und nach ihrem Liebsten ruft.«
Wendelin und Lila schwiegen beeindruckt.
»Ich habe allerdings meine Zweifel«, meinte der Doktor. »Woher kann man das alles wissen, wenn noch keiner so tief im Wald war, dass er die Ruine gesehen hat. Wahrscheinlich gibt es sie gar nicht mehr.«
»Ich werde sie suchen«, sagte Wendelin entschlossen.
»Das wirst du schön bleiben lassen, junger Mann!«
»Warum?«
»Ob es hier Gespenster, Hexen oder Feen gibt, weiß ich nicht«, erklärte der Doktor, »aber ich weiß genau, dass der Wald wild und groß ist, und ich will nicht, dass ihr euch darin verirrt.«
Eine Weile schwiegen alle drei und schauten den weißen Schönwetterwolken nach, die über den Himmel zogen.
Es war Frühling. Die Blätter der Bäume und Sträucher am Waldrand waren hellgrün. Die Sonne malte goldene Kringel ins Geäst.
»Wendelin«, flüsterte Lila nach einem Weilchen, »Onkel Balz schläft.« Sie riss einen Grashalm aus und kitzelte den Doktor unter der Nase. Ohne zu erwachen drehte er sich unwillig brummend auf die andere Seite. Die Zwillinge kicherten.
»Lass ihn«, sagte Wendelin. »Komm, wir gehen ein bisschen in den Wald hinein.«
»Aber das dürfen wir doch nicht.«
»Nur ein bisschen.«
Und leise schlichen die Kinder durchs Gebüsch. Geheimnisvolles Dämmerlicht umfing sie.
»Schau!« Wendelin hatte einen hohlen Baum entdeckt, eine alte, knorrige Eiche. Sie schlüpften ins Loch. Es war dunkel und etwas feucht.
»Huch«, Lila zitterte, »was machen wir, wenn der Bär kommt?«
»Welcher Bär?«
»Der, dem diese Höhle gehört.«
Wendelin lachte unsicher: »Hier gibts doch keine Bären!«
In diesem Moment hörten sie Zweige knacken. Die Kinder verstummten und drängten sich aneinander. Das Geräusch kam näher. Jetzt vernahmen sie Stimmen. »Das lief ja wie geschmiert«, sagte ein Mann.
»Ja«, ein anderer lachte hämisch, »einen schönen Fischzug haben wir gemacht, nachdem wir ihm den roten Hahn aufs Dach gesetzt haben.«
Die Schritte entfernten sich. Lila und Wendelin steckten die Köpfe hinaus und sahen zwei Männer, die schwere Säcke trugen. Sie hatten an den Beinen Stulpenstiefel, waren dunkel gekleidet und trugen beide einen Schlapphut. Der eine war lang und dürr, der andere klein und rund. Da sie den Zwillingen den Rücken zuwandten, konnten sie ihre Gesichter nicht sehen. Außerdem verschwanden sie jetzt im Dickicht.
»Warum Fischzug?«, flüsterte Lila, »hier gibt es doch gar keinen See.«
»Ja, und weshalb ein roter Hahn?«, fragte Wendelin.
»Kinder!«, hörten sie Doktor Melchior rufen, »wo seid ihr?«
Sie liefen rasch zum Waldrand.
»Zum Donnerwetter, habe ich euch nicht verboten…«
»Nicht schimpfen, Onkel Balz«, Lila war ganz aufgeregt. »Wir haben einen hohlen Baum entdeckt und zwei Fischer gesehen, die aber, glaube ich, keine Fischer waren.«
»Mädchen, Mädchen, was soll das?« Der Doktor schüttelte den Kopf. Aber als er die bleichen Gesichter der Zwillinge sah, strich er ihnen durchs Haar: »So, nun erzählt mal, aber immer schön der Reihe nach.« Er hörte aufmerksam zu. »Sonderbar«, murmelte er, »und ihr seid sicher, dass sie in den Wald hineingegangen und nicht aus ihm herausgekommen sind?«
»Ganz sicher, Onkel Balz«, beteuerte Wendelin, »aber was haben sie mit dem Fischzug gemeint und mit dem roten Hahn?«
»Ein Fischzug, mein Sohn, muss nicht unbedingt etwas mit Fischen zu tun haben. Der Ausdruck meint, jemand habe eine fette Beute gemacht, und vom roten Hahn spricht man, wenn es brennt. Das tönt gar nicht gut.«
»Waren das vielleicht Räuber?«, Lila haschte ängstlich nach der Hand des Doktors.
»Um Gottes willen«, Doktor Melchior schnupperte. »Da riecht es irgendwo nach Rauch.« Und dann, aufgeregt: »Schaut, dort vorne, der Hof des Bauern Zetermeier steht in Flammen. Kommt!« Sie rannten zur Brandstelle.
4
Der rote Hahn
Gierig leckte das Feuer am Haus. Schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel. Rote und gelbe Flammen züngelten aus dem Dachstock. Manchmal hörte man das dumpfe Krachen eines stürzenden Balkens. Vor dem Hof stand das Rabensberger Feuerwehrauto. Der Schlauch lag am Boden. Sinnlos schoss das Wasser über das Pflaster.
»Wo in aller Welt ist denn Messerli!«, rief der Doktor und beschleunigte seine Schritte.
»Onkel Balz«, schrie Wendelin, »schau, dort liegen zwei Menschen.«
Tatsächlich: Auf der Türschwelle lag der Feuerwehrmann Messerli und neben ihm Zetermeier, der Bauer. Beide hatten das Bewusstsein verloren. Oder waren sie schon tot? Der Türrahmen über ihnen brannte lichterloh und konnte jeden Moment auf die beiden hinunterfallen.
Geistesgegenwärtig nahm Wendelin den Schlauch in beide Hände. Der Wasserdruck war so stark, dass der Junge beinahe umfiel. Er nahm alle seine Kräfte zusammen und richtete den Strahl gegen die Tür. Dabei ging er so weit nach vorne, dass ihm die Hitze die Haare versengte. Doktor Melchior kämpfte sich hustend durch den Rauch zu Zetermeier und Messerli, die er kurz entschlossen am Kragen packte und wie zwei Säcke hinter sich her schleifte. Sobald er sie aus der Gefahrenzone heraushatte, beugte er sich über sie und begann sie zu beatmen. Der Feuerwehrmann schlug schon bald die Augen auf, aber beim Bauern blieb der Doktor lange knien. Mit der einen Hand stützte er ihn im Nacken, mit der andern drückte er sein Kinn nach unten und blies ihm mit großer Anstrengung regelmäßig Luft in den Mund.
»Wendelin«, Lila packte den Pflegebruder am Arm, »der Hund!«
Zetermeier, der allein auf dem Hof wohnte, besaß einen großen, weißen Hirtenhund. Das arme Tier war den ganzen Tag an der Kette, und wenn sich ein Fremder dem Haus näherte, bellte er jeweils fürchterlich und versuchte ihn anzuspringen, sodass ihn das Halsband würgte. Er galt als böse. Auch jetzt versuchte er sich loszureißen, diesmal allerdings aus Angst. Die Flammen würden ihn bald erreichen. Vergeblich zerrte er an der Kette. Lila rannte zu ihm.
»Komm zurück, das ist zu gefährlich«, rief Wendelin. Aber sie hörte nicht auf ihn und so richtete der Junge den Wasserstrahl über sie, um sie zu schützen. Inzwischen war Lila beim Hund. Geschickt löste sie die Kette und das Tier sprang davon. Auch Lila rannte – keinen Augenblick zu spät, denn in diesem Moment fielen zwei brennende Balken polterten über die Stelle, wo sie vor wenigen Sekunden gestanden war. Lilas Augen weiteten sich entsetzt. Sie wurde kreidebleich und begann am ganzen Körper zu zittern. Sie warf sich auf den Boden. Auf einmal spürte sie, wie ihr jemand mit einem feuchten Lappen über den Nacken fuhr. Immer wieder. Sie beruhigte sich und öffnete die Augen. Vor ihr stand der große Hirtenhund, von dem es hieß, er sei böse, und leckte sie. Er legte seine Pfoten auf ihre Schultern und schaute sie aus seinen großen, braunen Augen an. Lila legte ihren Arm um seinen Hals und schmiegte sich an sein weiches, zottiges Fell. »Du lieber, lieber Hund« sagte sie und kraulte ihn.
Inzwischen waren Bürgermeister Guggenbichler und der Polizeigefreite Knobloch mit einem Auto vorgefahren.
»Was ist denn hier geschehen, Messerli?«, fragte Guggenbichler den sichtlich erschöpften Feuerwehrmann, der sich gegen den Zaun des Gemüsegartens lehnte.
»Ich habe Rauch aufsteigen sehen und da bin ich losgefahren. Aber es war schon zu spät. Als ich ankam, stand der Hof in Flammen und im ersten Stockwerk schrie Zetermeier um Hilfe. Da bin ich die Treppe hinaufgerannt, um ihn zu retten. Überall war Feuer, es war heiß wie in der Hölle. Den Bauern habe ich im Huckepack hinuntergetragen«, er schwieg einen Moment »tja, und dann weiß ich von nichts mehr.« Messerli schaute ratlos in die Runde. Er war ein großer, magerer Mann. Jetzt gerade sah er erbarmungswürdig aus. Seine schwarze Uniform war voller Brandlöcher, sein Gesicht mit Ruß verschmiert. »Ich glaube, der Doktor hat mich gerettet.«
»Nur zum Teil«, Doktor Melchior war hinzugetreten, nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Bauer einigermaßen wohlauf war. »Nur zum Teil«, wiederholte er. »Wendelin hat Sie entdeckt und hat mir Wasserschutz gegeben, sodass ich Sie und Zetermeier von der Türschwelle, wo Sie beide zusammengebrochen sind, in Sicherheit bringen konnte.«