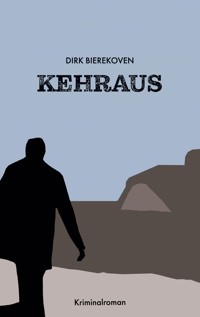
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ich überlegte, wie ich noch Zeit schinden konnte. Nur noch zehn Minuten, nur noch eine Minute, doch es war alles gesagt, bis auf: - Warum lebe ich noch? - Mulders zweiter Fall Berlin, im Mai 1990. Benedikt Mulder, suspendierter Oberleutnant des MUK-Ostberlins ist am Boden zerstört. Sarah Schuhmann, seine heimliche Liebe und Nachbarin, hat ihren Mann getötet und sitzt in Untersuchungshaft. Mulder fühlt sich dafür verantwortlich, und das ist er auch, irgendwie. Um ihr helfen zu können benötigt er einen Anwalt. Seine letzte Freundin Grete, Kneipenbesitzerin und gute Seele des Kiezes, kennt jemanden für ihn. Unglücklicherweise sitzt dieser jedoch selbst gerade unter Mordverdacht im Gefängnis. Er soll in einer Dorfkneipe an der Ostsee drei Menschen getötet haben. Die Beweise sind erdrückend. Schon bald geht es nicht mehr nur um Schuld oder Unschuld, sondern um Auswege und Vertuschung. Alte Geschichten und Machenschaften, weit über Mulders Kosmos hinaus, leiten die Geschicke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für:
Dirk Jansen und Philipp Eichstädt
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Eine Wahrheit
Die Geschichte: Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Epilog
Prolog
Eine Wahrheit
Auszug aus der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik:
Abschnitt II
Kapitel 1
Artikel 33
Absatz (2)
Kein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik darf einer auswärtigen Macht ausgeliefert werden.
„Seiner Majestät, dem Herrn Admiral auf SMS, ,Seebad Binz‘ untertänigst übermittelt.
In Anbetracht der guten Stimmung auf dem Oberdeck bitten 10 Berliner stellvertretend für die meisten Passagiere um Fortsetzung der Fahrt in Richtung Bornholm.“
Dietrich Gerloff und Jürgen Wiechert, Mitglieder der Jungen Gemeinde Berlin-Schmöckwitz, feiern am 18. August 1961 ihre Rüstzeit mit weiteren Angehörigen der Kirchengemeinde auf einer Dampferfahrt mit ursprünglichem Ziel der Dreimeilenzone vor der dänischen Insel Bornholm. Doch zur Enttäuschung aller Passagiere an Bord verkündet der Kapitän, dass es wegen der rauen See nur eine Fahrt rund um Rügen gibt. Es wird vermutet, dass der Kapitän wegen des kurz zuvor begonnenen Mauerbaus die Anweisung hat, nicht bis nach Dänemark zu fahren. Die Gruppe klatscht, pfeift und skandiert: „Wir wollen nach Bornholm!“
Jürgen Wiechert kommt auf die Idee, einen Zettel zu schreiben und ihn gemeinsam mit Gerloff dem Kapitän zu übergeben.
„Es war ein Spaß. Etwas übermütig. Aber ohne böse Absicht.“
Der Kapitän informiert per Funk die Grenzpolizei und vierzehn Mitglieder der Gemeinde werden verhaftet.
Am 26. August 1961 werden Gerloff und Wiechert vor das Bezirksgericht Rostock gebracht, wo sie wegen „planmäßiger und staatsgefährdender Hetze und Nötigung“ zu je acht Jahren Zuchthaus verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Haft für beide gefordert.
„Ich wollte mich nicht für die DDR-Staatspropaganda einspannen lassen. Außerdem weigerte ich mich, seltsame Getränke einzunehmen, die angeblich für mich als Sportler gut waren. So flog ich aus der Mannschaft für Olympia 1960, obwohl ich mich dafür qualifiziert hatte.“
Hans Seidel, prominenter Radrennfahrer, DDR-Meister und Mitglied der Bahnsport-Nationalmannschaft, wird zum erbitterten Gegner des SED-Regimes. Er wird Fluchthelfer, schneidet Löcher in den Grenzzaun, zerschießt Scheinwerfer im Todesstreifen, bis er gefasst wird. Doch während des Verhörs gelingt ihm die Flucht, er springt aus einem acht Meter hohen Fenster und schlüpft in der Kiefholzstraße durch den Zaun in den Westen. Danach schließt er sich mit weiteren Fluchthelfern zusammen und wird zum Tunnelgräber. Sechs Tunnel graben sie vom Westen bis in den Osten. Aus dem Keller einer Gaststätte in Westberlin bis zu einem Fotogeschäft in der Elsenstraße auf der Ostseite. Rund 150 Menschen verhilft er zur Flucht. Sein Kamerad Jens Jercha wird angeschossen, kann sich zurück in den Westen schleppen und verstirbt. Kurze Zeit später tappt Seidel in eine Falle des Staatssicherheitsdienstes. Er schafft es noch, seine Helfer zu warnen, sodass sie einer Festnahme entkommen. In einem Schauprozess wird er am 29. Dezember 1962 wegen des Verstoßes gegen das „Gesetz zum Schutze des Friedens“ als „republikflüchtiger Gewaltverbrecher“ mit „staatsgefährdender Gewalttätigkeit“ zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
„Dass einer an mich gedacht hat.“
Ein Tischler, der achtzehn Jahre zuvor von einem sowjetischen Militärtribunal zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, die er teilweise in Einzelhaft, teilweise in Dunkelhaft verbringen musste, bricht nach seiner Freilassung zusammen und stammelt nur diesen einen Satz.
„Als ich seine Akte gelesen hatte, erschloss es sich mir nicht, weshalb dieser Mann so hart bestraft worden war“, erklärte Ludwig Rehlinger, Rechtsanwalt und Beamter im Ministerium für gesamtdeutsche Fragen in der BRD. Ihm obliegt die schwere Aufgabe, unter strengster Diskretion 1.000 DDR-Häftlinge aus den Akten von 12.000 Häftlingen, die in der Westberliner Rechtsschutzstelle lagern, herauszusuchen. Eine „… Qual, abzuwägen, wessen Schicksal schwerer wog, wer den größeren Anspruch auf Freilassung hatte …, gern hätte ich Rat von Dritten geholt, doch die Notwendigkeit zur absoluten Geheimhaltung verbot es …“
Alle vier oben genannten Personen waren unter den ersten Häftlingen, die zwischen 1963 und 1989 von der Bundesrepublik aus DDR-Gefängnissen freigekauft wurden.
135.000 D-Mark war der Preis für die ersten acht Freilassungen. Das Geld wurde in bar über die Grenze geschmuggelt. Mit der S-Bahn vom Bahnhof Lehrter Straße im Westen zum DDR-Bahnhof Friedrichstraße im Osten und dort an einen Rechtsanwalt übergeben.
Die Freigelassenen verblieben in der DDR. Die meisten bis 1989 Freigekauften verblieben in der DDR und ihr Leben wurde wenig besser. Nach ihrer Entlassung wartete ein wahrer „Spießrutenlauf“ im DDR-Alltag auf sie. Minderwertige Arbeitsplätze, Schikanen gegen sich und die Familie, Überwachung durch offizielle und inoffizielle des MfS, Bildungs- und Ausbildungsbeschränkungen und das Versagen von Aufstiegschancen. Die Enttäuschung bei diesen Freigekauften war somit trotz wiedererlangter Freiheit entsprechend groß. Oftmals wurde eine Eingliederung in die sozialistische Gesellschaft so nicht mehr möglich. Viele fanden sich schnell im Gefängnis wieder, einige flüchteten in den Suizid.
Das sollte sich zum großen Glück einiger ändern. Im Laufe der Jahre wurden mehr und mehr Freigekaufte unmittelbar aus den DDR-Gefängnissen in den Westen ausgeliefert. Dies sparte den Behörden im Osten erhebliche Mühen und Kosten. Während die ersten „Abgeschobenen“ noch persönlich mit der Limousine von Vertretern der westdeutschen Behörden im Osten aus den MfS-Gefängnissen abgeholt wurden, setzte man später ganze Busse für den Transport in die BRD ein.
Manchmal gab es Übergaben auf der Glienicker Brücke im Ostteil von Berlin.
Das führte zu einem immensen psychologischen Druck unter den Freigekauften, da keiner bis zu dem Moment der Entlassung wusste, ob er in den Westen durfte oder im Osten zu bleiben hatte.
Der Preis für einen Gefangenen wurde von den Behörden in der DDR festgelegt beziehungsweise zwischen Anwälten, die zu Vermittlungszwecken auf beiden Seiten eingesetzt wurden, ausgehandelt. Zu Beginn war er am Ausbildungsstand des Freizukaufenden orientiert und lag zwischen 15.000 und 25.000 D-Mark. Später einigte man sich auf einen „Pauschalpreis“ von 40.000 D-Mark. Jedoch war dieser nur ein Richtwert. Bald setzten sich gestaffelte Preise durch. Danach musste für einen mit einem „X“ gekennzeichneten Häftling 40.000 D-Mark bezahlt werden, für die mit „XX“ 80.000 D-Mark und für solche mit einem „(X)“ 20.000 D-Mark. Für Personen, für die Ostberlin nichts in Rechnung stellte, stand eine „0“ hinter dem Namen.
Es glich einem Sklavenhandel.
Während man der Bundesrepublik einen Akt der Menschlichkeit und der Güte in diesem zu verachtendem Geschäft unterstellen darf (die Alternative, sich nicht darauf einzulassen, hätte weit schlimmere Konsequenzen für die Häftlinge bedeutet), kann man den Verantwortlichen in der DDR nur schamlose Unmenschlichkeit, Heuchelei und Gier vorwerfen.
Am Ende waren es mehr als 33.000 Menschen, die so durch die Bundesrepublik ihre Freiheit wiedererlangten.
Über 3,4 Milliarden D-Mark lässt sich die Regierung in Bonn, verteilt über verschiedenste Regierende, diesen Austausch kosten.
Ausgezahlt in:
bar
Waffen
Kalisalz
Eisenblech
Kunstdünger
Steinkohle
Des Weiteren benötigte der Arbeiter- und Bauernstaat dringend auch:
Butter
Mais
Kaffee
Südfrüchte
Zink
Blei
Kadmium
Mangan
Kupfer
und
Erdöl,
welche über verstrickte Netzwerke, Klüngeleien, Zwischenhändler, eingeweihte Firmen und die Kirchen in ausgeklügelten Wegen über speziell definierte Grenzen transportiert wurden.
Verheimlicht vor Öffentlichkeit und Presse.
Zur Wahrung des Scheins auf der einen Seite und zur Entscheidungsfreiheit ohne Debatten auf der anderen.
Die Geschichte
Kapitel eins
Ich habe mal etwas gelesen:
„Die Anstrengung, diszipliniert zu sein, schmerzt weit weniger als die Reue, es nicht gewesen zu sein.“
oder so ähnlich …
Hätte mir Weihnachten ‘89 jemand erzählt, dass es mir in ein paar Monaten noch beschissener gehen würde, hätte ich mir wahrscheinlich einen Strick genommen, oder mich totgelacht. Doch tatsächlich ist es dann so gekommen. Das Loch, in das ich nach den letzten Ereignissen gefallen war, hatte eine Tiefe, dass ich mir beim Aufprall das Rückgrat gebrochen habe. Also blieb ich liegen und rührte mich nicht. Ich versuchte erst gar nicht, mich aufzuraffen und zu befreien, stattdessen gab ich mich meiner Lage hin und betäubte die Schmerzen mit allem, was ich bekam.
Sarah Schuhmann hatte ihren Mann getötet und ich war dafür verantwortlich gewesen.
Das war mein Loch.
Und das gebrochene Rückgrat …
war in Wirklichkeit mein Herz.
Und ich hatte weder die Medizin noch das Wissen, um es allein flicken zu können. Nur Mittelchen gegen die Schmerzen.
Also gab ich auf.
Jeden Kampf, den ich täglich zu kämpfen hatte, trat ich einfach nicht mehr an.
Alkohol
Tabletten
Gebrochenes Herz
Scham
Versagen
Ließ ich alles geschehen. Betrank mich stattdessen jeden Tag aufs Neue, schüttete Pillen obendrauf bis zur Besinnungslosigkeit und verdrängte auf Teufel komm raus. Das raubte mir den Verstand und die letzte Kraft, mich meinen Dämonen zu stellen.
Ich wollte nur noch meine Ruhe.
…
Doch das Glück ist ja bekanntlich mit den Doofen, oder in meinem Fall mit mir Doofen, der einen ehemaligen weichherzigen Kollegen besaß, der mir ein Lasso überwarf, mich damit aus der Gosse zog und wieder halbwegs zurück auf Spur brachte.
Sein Name war Manfred Krug.
Oberleutnant bei der Morduntersuchungskommission Ostberlin, kurz MUK.
Das, was ich auch einmal war. Und nun nie wieder sein werde.
Ihm hatte ich vor ein paar Wochen, im Zuge meines ersten Auftrags als privater Schnüffler, die Familie Schulte mit ihren Missetaten zugespielt und er hatte sich in sie verbissen. Doch er brauchte weitere Informationen. Also suchte er nach mir. In den Wirren des Wandels durchpflügte er alle für mich in Betracht kommenden Kneipen Berlins und ich muss ihm ehrlich zugutehalten, dass das ein enormer Aufwand für ihn gewesen sein musste. Es gab Dutzende, in denen ich mich aufhielt. Ich trieb wochenlang durch meine Stadt und ihre Tavernen wie ein heimatloses Piratenschiff auf der Suche nach einem Hafen. Verbrachte die Nächte in kalten Gärten, auf harten Bänken oder in Gassen und Gossen, auf kantigen Stufen. Manchmal, wenn es etwas besser lief, schaffte ich es bis zu mir nach Hause, bis in den Keller. Und wenn die alte Frau Arendt aus dem zweiten Stock das mitbekam, schleppte sie sich zuerst die Stufen herunter zu mir in den Keller und dann mich hinauf in meine Wohnung.
Und wie dankte ich es ihr?
Gar nicht.
Wenn es wieder ging, war ich wieder weg.
Ohne Gruß, ohne Reue oder schlechtes Gewissen.
Bis mich Krug fand.
„Heilige Scheiße, Mulder“, waren die einzigen Worte, an die ich mich erinnern konnte.
Dann erst wieder, als ich von Sonnenstrahlen geblendet auf einer fremden Couch aufwachte. Ich schaute mich um. Weiße Wände, hohe Decken, bodentiefe Fenster und ein alter Holzfußboden, auf dem ein Eimer unmittelbar neben meiner Liege stand. In weiser Voraussicht. Ich teilte ihn gleich seiner Bestimmung zu. Füllte ihn mit Galle und kläglichen Resten aus meinem Magen.
Bis auf meine Jeans war ich kleiderlos und während ich würgte, stand Krug im Türrahmen.
„Deine Hose wollte ich dir nicht ausziehen. Die stinkt zwar zum Himmel und mein Rat lautet, verbrennen, aber das ging mir dann doch einen Schritt zu weit.“
„Schon in Ordnung“, antwortete ich kopfüber im Eimer, „danke, dass du meine Lage nicht für dich ausgenutzt hast. Ich hoffe, ich habe dir die Couch nicht versaut.“
„Liegt ne Decke drunter.“
„Gut.“
„Wenn du fertig bist, komm in die Küche, ich muss mit dir reden. Da liegen saubere Sachen für dich, die müssten passen. Deinen alten Kram habe ich entsorgt.“
Drehte sich um und ging in die Küche.
Ich hörte Geschirr klappern und roch frischen Kaffee. Zog die fremden Klamotten an und schlurfte ihm hinterher. Nahm am Holztisch platz und hielt mir den Kopf. Die Sonne blendete, so schob ich mich mit dem Stuhl geräuschvoll weiter in den Schatten.
„Hier trink, ist echter Kaffee, hab ich drüben geholt. Kostet ein Vermögen, aber nachdem ich ihn einmal probiert habe, geht nichts mehr anderes.“
„Danke.“ Ich nahm eine Nase voll vom göttlichen Geruch, griff die Tasse mit beiden Händen, um das Zittern besser zu kontrollieren, und schlürfte die Oberfläche ab.
„Herrlich, hast du ein paar Titretta für mich?“
Er sah kurz prüfend auf.
„Ist nur gegen die Kopfschmerzen.“
Dann ging er ins Bad, kam zurück und legte mir zwei strahlend weiße Tabletten auf den Tisch.
„Aspirin. Ist auch von drüben. Helfen schnell und kann man keinen Mist mit bauen.“
Ich hatte meine Zweifel, ob sie stark genug sein würden, darum nahm ich sie gleich beide in einem Schwups.
„Und“, fragte Krug dann, „wie geht das jetzt mit dir weiter?“
Ich zuckte mit den Schultern, denn ich hatte keine Ahnung.
„Kann ich mir die Mühen sparen, meine Zeit mit dir zu verschwenden? Wirst du dich weiter in deinem lächerlichen Selbstmitleid suhlen?“
„So ist das nicht“, antwortete ich, doch tatsächlich war es genau so, das wollte ich mir zu dem Zeitpunkt nur noch nicht eingestehen.
„Okay, und wie ist es dann?“
„Es ist kompliziert.“
„Mann, Ben, was ist nur aus dir geworden. Krieg endlich deine Scheiße auf die Kette. Das ist nicht „kompliziert“. Deine Nachbarin hat ihren Mann erstochen, okay, das ist hart, verstehe ich, aber ein Grund, sich so gehen zu lassen? Oder hat das noch etwas mit den Schultes zu tun? Das kann doch nicht sein, da haben wir doch ganz andere Dinge hinter uns gebracht, oder? Also, was ist das Problem? Was schiebt dich so aus dem Gleichgewicht?“
„Du kannst das nicht verstehen.“
„Was kann ich nicht verstehen?“
Ich schaute auf von meinem Kaffee und ihm in die Augen. Er zog die Brauen hoch. Doch mich selbst zu entblättern und Gefühle zu offenbaren, vor einem anderen Mann …, Herr im Himmel, was gibt es Schlimmeres? Obwohl meine Selbstachtung längst im Ausguss die Elbe hinuntergespült und ich kurz davor war, die große Grätsche zu machen, fiel es mir unbeschreiblich schwer, Krug zu sagen, dass mir Sarah Schuhmann mein verknotetes Herz zerrissen hat und dass ich verantwortlich für ihre Lage war.
Er schwieg und sah mich durchdringend an, wie bei einem Verhör, wenn wir einen vermeintlichen Täter oder einen entscheidenden Zeugen so weit hatten, dass er kurz davor war auszupacken. Und normalerweise konnten wir beide das gleich gut, schweigen und ausdrucksvoll starren. Waren wir jahrelang drauf trainiert worden, nur war ich zu diesem Zeitpunkt mit meiner Kraft am Ende gewesen, sodass ich schnell nachgab, und zu erklären versuchte:
„Es ist ein bisschen mehr als das“, ich nahm einen dritten Schluck Kaffee und hoffte, dass Krug mich doch noch unterbrechen würde, um zu sagen, dass ihn das nichts angeht, aber er starrte weiter erwartungsvoll, „ich meine, das zwischen Sarah Schuhmann und mir.“ Jetzt lehnte er sich in seinen Stuhl zurück, entspannte und sagte:
„Okay und weiter?“
„Nun, ich habe gewisse Gefühle für sie, schon lange Zeit, zuerst ganz harmlos, nur ein leichtes Schwärmen. Doch dann, vor ein paar Monaten, ergab es sich, dass ich meinte ihr helfen zu müssen, sie zu beschützen, vor ihrem Ehemann, und es entwickelte sich etwas zwischen uns, etwas, womit ich nie gerechnet hätte. Sie gab mir das Gefühl, dass sie mich braucht, dass ich sie retten sollte, und ich ließ mich blind darauf ein. Ich habe ihren Mann bedroht, sie hat aus Angst die Nacht bei mir verbracht, es ist nichts passiert, doch es war trotzdem intim, vertraut und verbindend, bis ich es verbockt habe und die Kontrolle verlor.“
Krug sah mich scharf an.
„Was heißt das, die Kontrolle verloren? Was ist passiert? Was hast du getan, Ben?“
„Gar nichts habe ich getan, zumindest nicht direkt, ich habe IHM nichts angetan und ich habe SIE nicht angestachelt, wenn du das meinst“, schob ich schnell ein, um dann kleinlaut weiterzureden, „aber ich habe ihn getrieben, nicht absichtlich, aber zu weit. Ich war dumm und überheblich, sodass er Hand an Sarah angelegt, sie geschlagen und bedroht hat, offensichtlich mehr als je zuvor und so sehr, dass sie nur noch einen Ausweg für sich sah, ihn zu töten, um selbst zu überleben.“
Krugs Anspannung löste sich.
„Mann, Ben, das tut mir leid, hört sich aber verdammt nach Selbstverteidigung an.“
„Und doch sitzt sie im Gefängnis.“
„Na schön, und was willst du jetzt tun? Oder ist das hier …“, dabei wedelte er mit seiner Hand vor mir auf und ab, „… deine Antwort? Aufgabe und Selbstzerstörung?“
„Vielleicht, ja“, wurde ich kurz laut, „vielleicht ist das meine Antwort darauf. Möglicherweise kann ich gar nicht anders als so, jedenfalls nicht mehr.“ Und aus irgendwelchen Gründen schossen mir Tränen in die Augen.
„Siehst du, das meine ich, jetzt heule ich. Irgendetwas in mir ist gebrochen und ich bekomme es nicht repariert. Ich kämpfe jeden Tag dagegen an: das erste Bier, den ersten Schnaps, das erste Glas Wein zu trinken und verliere jeden Tag. Und dann ist es vorbei, ich kann dann nicht mehr aufhören, muss es durchziehen, bis zur Bewusstlosigkeit. Ich schaffe es nicht mehr, dagegen anzukämpfen, es ist wie ein Schalter, der umgelegt wird, dann vergesse ich alles, das Kämpfen-Müssen, die Schmerzen, dann geht es mir gut. Und ich will, dass es mir gut geht, auch wenn ich weiß, dass es mich umbringen wird. Und am nächsten Tag beginnt es von vorne.“
Ich konnte Krug ansehen, dass er damit nicht gerechnet hatte. Er war erschrocken.
„Ben, du brauchst Hilfe.“
„Ich brauche keine Hilfe, ich kann mir nur selbst helfen, und ich muss Sarah Schuhmann helfen, das schulde ich ihr.“
„Okay, wäre das nicht etwas, woran du dich festhalten könntest, Sarah Schuhmann und ihr zu helfen?“
„Glaubst du etwa, das versuche ich nicht? Tue ich, jeden Tag, jede Minute, jeden verdammten Moment, bis ich nicht mehr denken kann, bis ich ausreichend intus hab, um nicht mehr denken zu müssen.“
Krug wurde sichtlich ratloser, er realisierte, dass seine amateurhaften, nett gemeinten, aber plumpen Alltagsratschläge hier für mich bei weitem nicht ausreichen würden, also hörte er nur zu. Und ich ließ für einen kurzen Augenblick los. Einfach so. Da haben sich schon Dutzende Freunde, Familie und zwei Psychologen die Zähne dran ausgebissen, dass ich das einmal tue, loslassen und erzählen. Und an diesem Morgen am Frühstückstisch von Krug ließ ich einen kleinen Schwank herausschwappen.
„Manchmal fühle ich mich wie ein Gebilde aus Tausenden von Strohhalmen, das nur von sich selbst getragen wird und nur im Gesamten stabil ist. Und ich bin ständig damit beschäftigt, dass kein Halm bricht, verrutscht oder weggezogen wird, denn dann stürzt alles in sich zusammen. Um mich herum sind Dutzende Hände, die permanent danach greifen, und wenn ich nur einen Moment der Schwäche zeige, nur für einen Wimpernschlag abgelenkt bin, ist es schon zu spät und das Gebilde knickt ein und ich schmiere ab. Dann muss ich wieder alles neu aufbauen, auf null stellen und es beginnt von vorne. Ich kann es dir nicht anders erklären, oder wie es so weit gekommen ist, manchmal glaube ich, dass der Verlust von Charlotte und alles, was danach kam, mich heftiger getroffen hat, als ich mir zugestehen wollte. Doch das nutzt jetzt nichts mehr, ich muss jeden Tag neue Kraft finden, um zu kämpfen, an allen Ecken und Fronten. Nur bin ich des Kämpfens müde und es fällt mir schwer, gute Gründe zu finden, wofür ich kämpfen soll. Und der einzige Grund, der ausreichen sollte, um zu kämpfen, ist der letzte, der mich im Moment motiviert: mein Leben zu leben.“
Dann war für eine lange Zeit Stille.
Krug stand auf und schenkte frischen Kaffee nach. Ich wartete darauf, dass die viel zu seichten Pillen aus Leverkusen endlich zu wirken begannen, und wir beide wussten zunächst nichts weiter zu sagen. Irgendwann klingelte es an der Wohnungstür. Krug stand auf und sprach mit einem Nachbarn. Da war ich kurz davor, aufzustehen und zu verschwinden. Ich kam mir mit einem Mal so dumm, schwach und verletzlich vor und ich schämte mich dafür, was aus mir geworden war. Doch Krug kam mir zuvor. Er kehrte zurück in die Küche und sagte:
„Ich kann dir hier keinen Rat geben, Ben, tut mir leid, dafür reicht meine Westentaschenpsychologie nicht aus. Du bist echt im Arsch.“
„Danke für die aufmunternden Worte.“
„Ich bin nur ehrlich und möchte dich bitten, dir dringend Hilfe zu suchen. Professionelle Hilfe, sonst wird es dich auffressen. Wenn dir dein Leben so egal ist, dann denk halt nicht mehr darüber nach. Such nicht nach Gründen, warum du weitermachen solltest, finde dich damit ab, dass es da im Moment nichts gibt, was dir hilft. Dass sich das aber wieder ändern wird und bis dahin halte dich an Sarah Schuhmann fest. Denke nur an sie, nicht an dich. Verdränge, so gut es geht, und konzentriere dich auf sie, wenn du dann wieder Kraft hast und lange genug nüchtern bleibst, um klar denken zu können, such dir Hilfe, um zu verarbeiten, sonst wird es dich wieder einholen. Verdrängen hilft vielleicht eine Zeit lang, um aus dem Gröbsten herauszukommen, die Realität wird sich aber irgendwann von hinten heranschleichen und dir mit Anlauf in die Nüsse treten.“
Er setzte sich wieder hin.
„Möglicherweise ist das aber auch vollkommener Blödsinn, den ich dir da gerade erzählt habe, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es das Falscheste, was du tun kannst“, er zuckte mit den Schultern, „keine Ahnung. Mir fällt nur nichts anderes ein, es ist deine Entscheidung, und die eigentlich Richtige wäre sicher, dir einen Profi zu suchen.“
Ich wusste, dass er recht hatte, doch ich wusste auch, dass ich das nicht tun würde.
Warum?
Stolz
Angst
Scham
Dann fügte Krug an:
„Wenn du dich ausnüchtern möchtest, kannst du ein paar Tage hierbleiben, das ist mein Angebot. Ein Bier, einen Schnaps und du fliegst raus.“
„Was ist mit Claudia?“
„Die ist vor einem Jahr ausgezogen.“
„Das tut mir leid.“
„Mir nicht.“
Zwei Wochen später saß ich zu Hause in meiner Küche auf meinem Stuhl und schaute über die Dächer Berlins ins Nichts hinein. Ausgenüchtert und voller Tatendrang. Krug hatte mich in Ruhe gelassen und ich in seiner Wohnung einen üblen Entzug durchgemacht.
Krämpfe
Schmerzen
Schwitzen
Leiden
Als ich einigermaßen ansprechbar war, haben wir uns über die Schultes unterhalten. Krug hatte viele Fragen, die ich aber, zu seiner Enttäuschung, nur spärlich beantworten konnte. Irgendwann ließ er es dann ganz sein und wir lebten wie ein altes Ehepaar. Er besorgte mir aus der Apotheke meine notwendigen Herzmittelchen und ging arbeiten. Währenddessen kümmerte ich mich um den Haushalt und das Essen.
Wieder zurück in meiner Wohnung, war es nötig, mich gleich zu beschäftigen. Bloß keine Langeweile aufkommen, bloß keine dummen Gedanken wachsen lassen. Aber so weit konnte es gar nicht kommen. Es glühte in mir, es glimmerte und ließ mir keine Ruhe. Ich wollte wieder produktiv werden und es gab nur eines, was mir wichtig war, genau wie Krug es gesagt hatte. So schob ich alles beiseite und widmete meine Konzentration nur einer Sache:
der Rettung Sarah Schuhmanns.
Kapitel zwei
„Was soll ich ihm sagen?“
„Sagen Sie ihm, es ist vorbei.“
„Einfach so, nach all den Jahren, lassen wir ihn fallen wie einen lahmenden Gaul.“
„Ganz genau.“
„Das können Sie nicht tun, das bedeutet seinen Untergang.“
„Das können wir und das werden wir und seien wir ehrlich, das hat er auch verdient.“
„Nach allem, was er für uns getan hat?“
„Das hat er nicht für uns getan, das wissen Sie ebenso gut wie ich, das hat er nur für sich getan, er ist ein Verräter.“
„Mag sein, trotzdem haben wir eine Verantwortung für ihn, wir sind eine Verpflichtung eingegangen.“
„Das hat sich erledigt und das war nie Teil des Abkommens, das konnte niemand vorhersehen.“
„Aber so sollte es sein.“
„Vieles sollte sein und doch ist vieles nicht mehr, und er ist nur noch ein Problem, um das er sich jetzt selbst kümmern muss.“
„Und was glauben Sie, wird er dann tun? Glauben Sie, er wird uns nicht mitreißen? Glauben Sie, er wird nicht versuchen, denselben Deal, das gleiche Abkommen noch einmal abzuschließen, um seine Haut zu retten?“
„Dazu wird es nicht kommen.“
„Wie meinen Sie das?“
„Wir haben unsere Mittel.“
„Sie wollen ihm etwas antun.“
„Niemand wird ihm etwas antun. Machen Sie ihm das klar, beruhigen Sie ihn und sehen Sie zu, dass er das auch glaubt. Sprechen Sie ihm Mut zu, sagen Sie ihm, dass für ihn ein neues Leben beginnt, dass er es als Chance sehen soll, wie wir alle.“
„Das ist doch Blödsinn.“
…
Kapitel drei
Mittlerweile war es bereits Mitte Mai und der Frühling hielt Einzug. Nach dem langen, harten Winter mit seinen ungewöhnlichen Wetterkapriolen lag die Sehnsucht nach wärmeren Tagen überall in der Luft und schon die spärlichsten Sonnenstrahlen trieben die Massen aus den Häusern auf die Straßen.
Richtung Westen.
Klar!
Gebrauchtwagenhändler und Sexshops hatten jetzt Hochkonjunktur.
Ich schaute auf in ein tiefes Himmelblau. Keine Wolke kreuzte den Blick in die Ewigkeit. Schloss die Augen und genoss die warmen Sonnenstrahlen in meinem Gesicht. Die Luft war noch kühl und frisch und dieser Wechsel auf der Haut fühlte sich so sehr nach Leben an.
Ich träumte mich kurz auf eine grüne Wiese, unter einen schattigen Baum, wo ich auf einer warmen Wolldecke lag, voller Vorfreude auf einen tiefen, erholsamen Mittagsschlaf, mit Träumen voll von Liebe und Erotik, bis mir, mit einem Mal, das hohle, metallisch laut widerhallende Öffnen des riesigen Stahltores, vor dem ich stand, um die Ohren knallte. Sicher gaben sie sich äußerste Mühe, das Tor so geräuschvoll wie irgend möglich zu öffnen, um seiner Bedeutung auch akustisch den gebührenden Stellenwert einzuräumen.
Das Tor wurde aufgezogen und ein Wärter in dunkelblauer Uniform stand vor mir, sah mich kurz an, dann rechts und links an mir vorbei, die Straße hinunter, nickte und gab den Weg frei. Ich trat ein und das Tor wurde laut scheppernd wieder hinter mir geschlossen. Ich war der einzige Besucher an diesem Tag gewesen und stand dann in einem Käfig aus grauem Rundstahl in dem zwei Lastwagen Platz gefunden hätten. Vor mir ein weiteres Tor aus demselben Rundstahl wie der Käfig.
Der Wärter schritt an mir vorüber, dass Tor öffnete sich und wir traten hindurch. Dann über einen Hof und in das Hauptgebäude hinein. Links ein Tresen mit einem zweiten Wärter dahinter. Geradeaus die nächste Tür, jetzt aus Massivstahl mit einem kleinen viereckigen Schaufenster darin.
Ausweis abgeben bei dem Wärter hinter dem Tresen und weiter in den nächsten Raum.
Durchsuchung und mehr Türen und Räume. Bis ich letztlich einen Gang entlanglief. Auf beiden Seiten Reih an Reih einzelne Zellen, manche belegt, die meisten aber leer.
„Halt“, rief die Stimme des Wärters hinter mir und ich blieb stehen. Er schob mich beiseite und öffnete die schwere Holztür, mit der eisernen Klappe in der Mitte, gleich zu meiner Rechten. Die überdimensionalen Schlüssel, die er dafür benutzte, schlugen klappernd bei jeder Umdrehung gegen das Holz. Mit Hand und Fuß öffnete er die beiden Schieber, die die Tür von außen zusätzlich absicherten, und ich kam nicht umhin, ihn für diesen geschickt ausgeführten Move leicht zu bewundern. Ich sah in die geöffnete Zelle und fast hätte ich sie übersehen. Sie saß in der linken Ecke des Raums, ganz hinten an der Wand im Halbdunkel, auf einem Stuhl und schaute auf den Boden. Der Wärter öffnete die Zellentür und forderte mich auf einzutreten. Ich tat, wie mir geheißen. Die Zelle war rundherum in einem kühlen Weiß gekachelt, mit einer Pritsche rechts, einem Waschbecken und einer Kloschüssel aus Edelstahl links. Ein kleines vergittertes Fenster in der Außenwand. Sarah Schuhmann hatte sich nicht gerührt. Sie hatte nicht einmal gezuckt, als die Zellentür donnernd aufgeschlagen worden war, geschweige denn aufgeschaut. Ich trat vorsichtig an sie heran, wie an ein pickendes Huhn. Ich befürchtete, sie zu verschrecken, wenn ich mich zu hastig bewegte.
„Sarah?“, sagte ich zaghaft. Doch sie rührte sich nicht. Fragend sah ich zu dem Wärter zurück, der in der offenen Tür stehen geblieben war. Der zuckte aber nur mit den Schultern, drehte mir dann den Rücken zu und stellte sich auf dem Gang neben die Zelle. Ich setzte mich auf das Bett, dicht an Sarah heran. Streckte meine Hand aus und berührte ihren Arm leicht. Dann sah sie auf. Ihre einst so wunderschönen blonden Locken, die wie Sprungfedern wild von ihrem Kopf in alle Himmelsrichtungen abgestanden hatten, waren kurz geschnitten worden und die mickrigen Reste schienen jegliche Kraft verloren zu haben. Sie hingen blass wie schwere Lianen an zu schwachen Ästen herunter. Von grauen Strähnen durchzogen, fahl wie ihre Gesichtshaut. Sie war ausgemergelt. Ihre Wangenknochen stachen hervor und ihre Augenhöhlen waren tief und dunkel. Sie sah mich an. Und es schien so, als würde sie einen Augenblick brauchen, um mich zu erkennen, doch ihr Blick änderte sich nicht. Er blieb gleichgültig, auch nach einer Weile. Dann schaute sie wieder auf den Boden. Ich nahm ihre Hand. Hielt sie mit meiner Rechten und streichelte sie sanft wie ein Vogelbaby mit der Linken.
„Sarah“, wiederholte ich, „ich bin’s, Ben!“
Abrupt zog sie ihre Hand weg und verbarg sie zwischen ihren Schenkeln.
„Bitte Sarah“, und dabei berührte ich sie leicht an ihrer Schulter, doch sie zuckte am ganzen Körper zusammen.
„Mein Gott, was haben sie dir angetan?“
Ich war echt schockiert und hatte das Schlimmste befürchtet, sie wäre gefoltert worden, eingeschüchtert, auf brutalste Weise versucht zu resozialisieren.
„Verdammte Kacke, was habt ihr mit ihr angerichtet, ihr miesen Schweine?“
Der Wärter drehte sich wieder um und wollte gerade ansetzen, da drosch Sarah dazwischen.
„Halt deine Klappe, Mulder!“
Kapitel vier
Ich kramte eine zerknautschte Packung Caminett aus meiner Hosentasche, nahm eine Zigarette heraus, strich sie glatt und zündete sie an. Dann drehte ich mich um und schaute zurück auf das Gefängnisgebäude in meinem Rücken. Hinter den Mauern und Zäunen konnte ich die Zellenfenster der oberen Stockwerke erkennen. Ich zählte sie einzeln ab in der vagen Hoffnung, Sarah dort noch einmal erblicken zu können, nahm einen tiefen Zug vom Glimmstängel, schüttelte den Kopf, warf den Sargnagel weg und stieg in meinen Wagen ein. Drehte den Zündschlüssel und der Motor startete. Nur einmal kurz den Anlasser gekitzelt und mein Baby war dabei. Was nicht der Regel entsprach. Doch es wurde Frühling und so entspannte sich mein Schatz sichtbar mit den steigenden Außentemperaturen. Und ja, ich rede von meinem Auto. Ein Citroën CX Prestige, eine Ausnahmeerscheinung zu dieser Zeit in dieser Stadt und in diesem Land. Und mein ganzer Stolz. Doch sie ist eine Französin und offensichtlich aus dem Süden Frankreichs, mit divenhaften Allüren. Sie hasst Kälte und verweigert so gerne einmal die Mitarbeit. Jetzt aber gleich dabei, also erst einmal zurück nach Hause.
Dietrich-Bonhoeffer-Straße vierzehn.
Was beängstigend nah war.
Runter zur Landsberger Allee und bis zur Danziger Straße nur geradeaus. Rechts die Danziger runter bis zum Arnswalder Platz. Links in die Bötzowstraße und wieder rechts in die Dietrich-Bonhoeffer.
Auf meinem Weg passierte ich zahllose gestrandete Automobile. Ladas und Trabanten entweder achtlos auf Gehwegen, in Grünstreifen am Straßenrand zurückgelassen oder absichtlich gegen Bäume und Mauern gecrasht. In manchen steckten noch die Zündschlüssel, andere qualmten vor sich hin, während weitere bereits komplett ausgebrannt waren. So wurden sie respektlos von ihren ehemaligen Besitzern verheizt, oder von wild gewordenen Jugendlichen gestohlen, bis zum letzten Tropfen Benzin ausgesaugt und zum Vergessen zurückgelassen. Früher einmal Jahre darauf gewartet, um Stolz wie Oskar präsentiert zu werden, waren sie nun nur noch als Ventil und Symbol der Verachtung gut genug. Niemandem mehr einen Pfennig wert. Jetzt wollten alle nur BMW und VW Golf fahren. Keinen nach feuchtem Muff stinkenden, klappernden Müllhaufen mit folgend, benötigtem Startablauf:
Gang raus.
Benzinhahn auf.
Choke ganz rausziehen und
kein
Gas geben.
Starten.
Motor läuft; leicht Gas geben und den Choke zur Hälfte reinschieben.
Zügig losfahren.
Während der Fahrt, wenn der Motor wärmer wurde, Choke wieder ganz reinschieben.
Und das am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, um einen Wagen vernünftig zum Laufen zu bringen. Ist kein großer Fortschritt zu den Zeiten eines Henry Ford. Und doch tat es weh, zusehen zu müssen, wie ein einstiges Symbol so schnell fallen gelassen und gedemütigt wurde.
Überhaupt befand sich Ostberlin im Mai 1990 in einem Zustand, den man nur mit Anarchie beschreiben kann. Junge Menschen aus Ost und West fielen ein, um ganze Stadtviertel in Beschlag zu nehmen und eine monatelange Party zu feiern. Alte Gebäude und Keller wurden besetzt und zu illegalen Kneipen und Clubs umfunktioniert, bis sie vollends ruiniert, vollgeschissen und faktisch unbewohnbar geworden waren. Dann wurde eingepackt und eine Ecke weitergezogen. Wände wurden eingerissen, um Wohnungen zu vergrößern und zu besetzen. Auf den Straßen herrschte Chaos. Massen von Punks, New Waves und Ravern trieben sich rum, suchten Streit und verbarrikadierten Straßen.
Polizisten und Ordnungshüter waren völlig überfordert und unterbesetzt. Inmitten des Wandels wurden sie ihrer einstmaligen Macht beraubt und wussten nicht damit umzugehen. Konnten nicht erkennen, wo ihre neuen Kompetenzen begannen und ihre Zuständigkeiten endeten und sosehr ich diesen unbändigen Drang nach Freiheit und Chaos nachvollziehen konnte, ging mir das dann schnell zu weit. Hier wurde die Freiheit vieler durch das falsche Verständnis von Freiheit weniger beschnitten, und so sollte Freiheit auf gar keinen Fall aussehen.
Ich parkte den Wagen gegenüber der Hausnummer vierzehn, meinem Zuhause, ging dann aber die Straße zu Fuß weiter runter bis zur Greifswalder. Gleich um die Ecke war Willy Bresch, meine Stammkneipe.
Ich trat ein. Grete, Besitzerin und gute Seele des Willy Bresch, empfing mich mit einem herzlichen Lächeln auf dem Gesicht, kam um die Theke herum, breitete die Arme aus, umarmte mich und sagte:
„Ben, ich hab mir Sorgen gemacht. Wo warst du die ganzen Wochen? Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du mich nicht einmal erkannt oder wahrgenommen, so standest du neben dir.“
„Ist nett von dir, Grete. Ich war bei einem Freund, jetzt geht es mir besser.“
„Komm, setz dich, ich mache dir einen Kaffee.“
Und sie verschwand wieder hinter der Theke und dort durch eine Tür in die Küche. Ich pflanzte mich an einen Tisch gleich neben dem Durchgang zu den Toiletten, mit Blick in Richtung Tür. Alte Gewohnheit. Grete kam mit zwei Tassen dampfendem Mona Kaffee und stellte sie ab. Ich hatte mich mittlerweile an echten West-Kaffee gewöhnt, doch hier in der Kneipe, zusammen mit Grete, schmeckte der Mona wie nach Hause kommen.
Wir saßen eine Weile und schwiegen. Was schön war. Kein peinliches Schweigen, weil keiner wusste, was es zu erzählen gab, sondern ein erholsames Schweigen, das beide genossen, weil man keine Worte brauchte.
„Du siehst besser aus“, sagte Grete schließlich, „und nicht nur besser zu letztem Mal, sondern insgesamt.“
„Ich hab mich gut erholt, bin zur Ruhe gekommen, regelmäßig gegessen, geschlafen, Dinge verarbeitet.“
„Das ist schön. Ich freue mich wirklich, dich hier zu haben und zu sehen, dass du wieder auf dem Damm bist. Ich bin mir nicht sicher, an wie viel du dich erinnern kannst, aber bei deinem letzten Besuch hast du mir ernsthaft Angst gemacht.“
Ich war echt erschrocken, als sie das sagte.
„Was, Grete, wieso?”
„Nun, wie gesagt, hast nicht einmal mit mir geredet oder mich begrüßt, hast nur dagesessen und in dich hineingekippt. Bis du irgendwann aufgestanden bist und wie wild herumgebrüllt hast. Du hast jedem Einzelnen, der da war, vor allen anderen lauthals um die Ohren gehauen, wann sie wen angeblich an die Stasi verraten haben und wie sie für die Stasi tätig waren, das war echt gruselig.“
„Ernsthaft? Verdammt, das tut mir echt leid, Grete, und ehrlich, ich weiß überhaupt nichts, über irgendjemanden. Ich war bei der Mordkommission, wir hatten kaum Berührungspunkte mit der Stasi, geschweige denn, dass es mich interessiert hätte, wer für die arbeitet.“
Ich schlürfte einen kleinen Schluck ab und fügte an:
„Konnte sich doch eh keiner dagegen wehren, also warum jemandem Vorwürfe machen?“
„Das sah aber anders aus“, antwortete Grete, „eher, als hättest du bei einer ganzen Menge Nägel eine ganze Menge Köpfe getroffen. Die sind fast alle unmittelbar raus hier wie geprügelte Hunde, und ganz so entspannt wie du sehe ich das nicht, es gab verdammt viele, die genau wussten, was sie taten, und darin ihren Vorteil suchten.“
„Mag sein, aber trotzdem, ich weiß gar nichts, ehrlich.“ Erneut entstand eine kleine Pause, dieses Mal allerdings, war sie unangenehm. Grete durchdrang mich mit einem wissenden Blick und schließlich gab ich auf. „Okay, ein bisschen was weiß ich schon, bleibt nicht ganz aus, so als Bulle, doch nur wenig, hat mich nie wirklich interessiert, wenn es nicht meine Arbeit betraf. Und noch mal, Grete, tut mir echt leid, du bist die Letzte, die ich verletzen will oder der ich schaden möchte. Ich hoffe, das hat dem Geschäft keinen Abbruch getan.“
Sie nahm meine Hand, „halb so wild, mach dir keine Gedanken mehr, und ehrlich gesagt …“, jetzt zog sie ihren rechten Mundwinkel zu einem hämischen Grinsen hoch, „… irgendwie war es auch lustig. Ich wünschte, du würdest dich an ihre Gesichter erinnern, als du ihnen das vor den Latz geknallt hast. Wie alte, adlige Damen, die beim Klauen erwischt wurden.“
Dann musste ich auch grinsen und war froh, dass sie es so locker genommen hatte.
„Doch jetzt mal ernsthaft, mir war ja klar, dass du irgendwann wieder hier aufschlagen würdest, aber ich hätte geschworen, haubitzenvoll und heulend wie ein Kind.“
„Warum das?“
„Hm, lass mich mal kurz überlegen … Weil dir der Stoff ausgegangen ist, dich aber keine Kneipe in Berlin und Umgebung mehr einlässt, du mich als deinen letzten Ausweg siehst und winselnd angekrochen kommst?“
„Ach so, das, nein, wie gesagt, das ist vorbei. Seit zwei Wochen trocken, das habe ich hinter mir gelassen.“
„Zwei Wochen?“
„So ist es“, plusterte ich mich auf mit stolzgeschwellter Brust, und das war ich tatsächlich, mächtig stolz auf mich.
„Das ist gut, Ben, ich freue mich für dich. Und ich freue mich, dass du bei mir bist.“
Das gab mir ein schlechtes Gewissen, denn ich war nicht nur gekommen, um Grete zu besuchen, vielmehr wollte ich sie um Hilfe bitten. Ich benötigte dringend jemanden, der Sarah aus dem Gefängnis holte. Ihr Zustand war beängstigend gewesen. Nachdem sie mir gesagt hatte, ich solle meine Klappe halten, sprach sie kein zweites Wort mehr mit mir. Ich hatte noch ein paarmal versucht, an sie heranzukommen, nach Verwandten oder weiteren engen Freunden gefragt, doch sie ignorierte mich komplett. Kurze Zeit später musste ich das Gefängnis wieder verlassen. Und wenn mir der Besuch eines gezeigt hatte, war es, dass Sarah Schuhmann sich aufgab, konsequenter, als ich das je hätte tun können. Doch um ihr zu helfen, benötigte ich selbst Hilfe, professionelle Hilfe, einen Advokaten. Ich hoffte, Grete würde jemanden kennen, wenn nicht eine Wirtin, wer dann?
„Grete, es tut mir leid, aber ich bin nicht nur gekommen, um dir einen Besuch abzustatten, ich brauche deine Unterstützung.“
Ohne eine Sekunde zu zögern, antwortete sie: „Klar, Ben, wenn ich kann, schieß los.“
„Ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich habe Sarah Schuhmann besucht.“
„Oh Gott, das arme Ding. Was für ein tragisches Leben, vom Ehemann misshandelt und dafür weggesperrt. Wie geht es ihr?“
„Nicht gut, gar nicht gut. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um sie. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, doch sie antwortet nicht. Sie vergräbt sich, ist abgemagert und wenn sie nicht bald Hilfe bekommt, befürchte ich das Schlimmste.“
„Oh, Ben, das tut mir unglaublich leid. So eine nette Seele, das hat sie nicht verdient. Es war doch Notwehr, oder? Wieso ist sie dann noch im Gefängnis?“
„Genau darum geht es ja. Ich weiß es nicht, ich weiß überhaupt nichts. Hat sie einen Pflichtverteidiger? Wenn ja, wer ist das? Hat man sie vergessen? Kümmert sich überhaupt irgendjemand? Ein Verwandter? Hat sie Verwandte? Kennst du jemanden? Weißt du was? Mir sagt niemand etwas.“





























