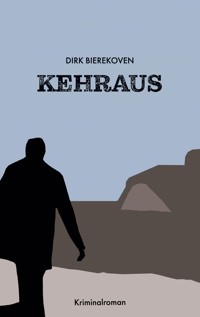Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wenn Macht zerbröckelt, bleibt Panik zurück. Winter 1989. Es sind außergewöhnliche Zeiten, die Hauptkommissar Benedikt Mulder vom MUK Ost-Berlin zu durchleben hat. Die Welt ist im Wandel und er wird seines geliebten Dienstes enthoben. Zwei Tage nach dem Mauerfall war ein junger Mann in Köpenick erstochen worden, und Mulder hatte es verweigert den Fall zu übernehmen. Er kannte das Opfer und sah sich unmöglich in der Lage objektiv zu handeln. Jetzt treibt er durch das von Wetterkapriolen und Umschwung gezeichnete Berlin und verliert sich in Alkohol und Tabletten, bis ihn eine Frau anspricht, es ist die Mutter des Messeropfers… Aus einer Mordserie aus Rache, wird ein Katz- und Mausspiel nach Vermissten. Alte und neue Freunde sind nicht mehr die, die sie zu sein scheinen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Danksagung
Für:
Jimi, Charlie und Nic
„Your world is nothing more, than all the tiny things you`ve left behind.“
Jamie Cullum
Prolog
Re I vo I lu I ti I on: französisch révolution
Ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Er kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen.
Friedlich, das war sie.
Die wenigsten verliefen friedlich. Die meisten waren gewaltsam und brutal, und die Fundamente, auf denen sie erbaut wurden, waren Gruben voll von Leichen.
Unsere aber war friedlich.
Sie war laut.
Sie war ausdauernd.
Sie war klug und überwältigend.
Und hat nicht ein einziges Menschenleben gekostet.
Ich stand auf einem Auto, das jemand inmitten der Massen auf der Bornholmer Straße hatte stehen lassen, und sah die Menschenmengen auf das Nadelöhr Bornholmer Brücke zufließen wie Reisig in einem langsam fließenden Fluss auf einen quer gelegten Ast. Nach Schabowski war ich mit ein paar weiteren aus Metzer`s Eck hierhergekommen, um mich selbst zu überzeugen. Ich war knapp haltlos vom Alkohol und knapp klar von den Amfis, die ich intus hatte, um eine weitere Nacht durchzustehen. Es brachte mich in einen Zustand, in welchem mir die Realität schubweise entglitt und es mir unmöglich wurde, die Emotionalität des Moments aufzunehmen und zu speichern. Was ich fürchterlich bereute und mir wünschte, ich hätte zwei Tage früher noch einmal neu beginnen können. Dann wäre ich nüchtern und ausgeschlafen gekommen, um diesem einzigartigen geschichtlichen Ereignis die angemessene Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. So aber fühlte ich mich äußerst mies und hatte das Gefühl, den Kampf meiner Brüder und Schwestern mit Füßen zu treten. Doch jetzt mal ernsthaft, wer hätte das vor zwei Tagen denn ahnen sollen?
So schwebte ich in einer Metaebene über dem Geschehen, beobachtete und registrierte.
Ich sah zu, wie die Masse sich langsam vor dem Schlagbaum nach hinten hin aufstaute. Wie sich aus anfänglichem Zögern Mut erhob. Wie aus diesem Mut, Frust und Wut über altgewohnte Starrköpfigkeit wuchs. Und doch blieb es weiter friedlich. Ein Wunder und Sieg der Menschlichkeit. Hunderte standen vor einer Handvoll. Nichts wäre leichter gewesen, als sich seiner Wut hinzugeben und sie zu überrennen. Was Leben gekostet hätte, hüben wie drüben, egal. Stattdessen wurde gesungen, skandiert und diskutiert, bis der Staudruck übermächtig wurde und der Durchbruch gelang. Die Massen kamen wieder in Bewegung. Zuerst nur langsam, einzeln flutschten sie durch die erste Spalte, die sich ergab. Und dann immer mehr und immer schneller, bis sich der Pfropfen schließlich ganz löste und die Bornholmer Straße sich mit einem langen, riesigen Schwall entleerte. Von drüben waren Gesang, Jubel und Böller zu hören, und ich stand mit offenem Mund auf dem Trabant und suchte die Szene zu fassen. Es gab nicht mehr viel, was mich sprachlos machen konnte, dieser Moment aber überwältigte mich sogar in meinem desolaten Zustand so sehr, dass sich ein riesiges Vakuum in mir ausbreitete. Bis jemand an meinem Hosenbein zupfte und zu mir sprach:
„Ist das Ihr Auto?“
Ich schaute runter und sah einen Mann in grauer Hose mit leichtem Schlag. Grünem Rollkragenpulli und braunem Mantel darüber. Er trug eine dicke Hornbrille, hatte lange Koteletten, einen Schnäuzer, schütteres Haar, welches er sich von links nach rechts über die Platte gekämmt hatte und sah mich herausfordernd von unten an.
„Wer will das wissen?“, fragte ich ihn.
„Kommen Sie sofort da runter.“
Ich tat wie mir geheißen. Rutschte dabei von einem Kotflügel ab und klatschte vor ihm auf die Straße. Rappelte mich wieder auf, spürte aber keinen Schmerz.
„Fahren Sie bitte weiter, Sie können hier nicht stehen bleiben.“
Ich sah mich um. Autos fuhren an mir vorbei und hupten, was mir bis dahin gar nicht aufgefallen war.
„Nun ja, würde ich ja gerne, ist aber nicht mein Auto und außerdem bin ich viel zu betrunken zum Fahren.“
„Nicht Ihr Auto, wie?“
„Nein, mein Herr.“
Er schaute an mir vorbei und betrachtete den Wagen.
„Sie haben das Dach verbeult und, wie mir scheint, auch die Motorhaube.“
Ich drehte mich um und sah prüfend auf das Dach.
„Glauben Sie? Sieht doch halb so wild aus.“
„Folgen Sie mir bitte!“
„Ach hören Sie schon auf“, erwiderte ich, „offensichtlich ist dem Besitzer der Wagen nicht so wichtig, sonst hätte er ihn ja nicht einfach so hier stehen lassen, und an solch einem Tag …“, ich zeigte in Richtung Brücke, „… wen interessieren da ein paar Beulen? Hier wird gerade Geschichte geschrieben und wir sind mittendrin. Davon können Sie Ihren Enkeln einmal erzählen. Genießen Sie das Spektakel.“
„Folgen Sie mir!“, wiederholte er.
Stattdessen zog ich meinen Ausweis und schwankte nach Hause.
10. November 1989
Heute wird es enden, dachte er. Nach so vielen Jahren wird es tatsächlich heute Nacht enden, so oder so.
Seine Hand entspannte sich für einen kurzen Moment und der Griff ums Messer löste sich leicht, doch nur um gleich danach umso fester wieder zuzupacken.
Er hielt sich das Messer eng an seine Brust gepresst.
Er musste seine Nähe spüren.
Er brauchte gerade ein wenig Halt.
Viel zu früh war er da gewesen und bereute dies nun.
Zweifel krochen in ihm hoch wie eine verdammte Schmarotzerranke an einem alten Baum.
So viel Zeit war vergangen, seit alles begonnen hatte. So viel Zeit, dass er schon fast gelernt hatte, damit zu leben. Doch dann ging plötzlich alles ganz schnell. Gestern war er noch einsam und unsichtbar eine Million Lichtjahre von seiner Vergangenheit entfernt, um sich nun, einen Tag und einen Anruf später, mitten in ihr wiederzufinden.
Und er war so aufgeregt gewesen, dass er es nicht abwarten konnte und zu früh gekommen war, was er jetzt bereute. Zu viel Zeit zum Nachdenken.
Alles hatte er damals aufgegeben und war weggerannt. Es gab nichts mehr, was er hätte tun können. In diesem Land war er nicht nur von dicken Mauern aus Beton und hohen Zäunen aus Stahl umgeben gewesen, sondern auch in einem undurchdringlichen Geflecht von Korruption und Vertuschung gefangen.
Deshalb war er fortgelaufen, sonst hätte es ihn seinen Verstand gekostet. Hatte alles, was er noch liebte, aufgegeben und war an einem neuen Ort in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und er hatte überlebt. Getragen von der Hoffnung auf Vergeltung überlebte er die Jahre. Doch die Zeit heilt nun einmal die Wunden, und der Wunsch nach Rache verblasste allmählich unter einer stetig wachsenden Kruste aus Normalität.
Dann kam der Anruf und die Kruste juckte wie ein Sack voll Krätze. Und er kratzte sie auf und all der Hass und die Verzweiflung quoll wieder hervor, wie stinkender Eiter. Blanke Wut packte ihn und trieb ihn zur Eile an.
So kam er unverzüglich hierher.
Ohne richtigen Plan. Ohne einen Moment innezuhalten, um einen klaren Gedanken daran zu fassen, was er tat und was dies für den Rest seines Lebens bedeuten würde. Keinen Gedanken daran, ob er das, was er vorhatte, tatsächlich wird ausführen können, denn Vergleichbares hatte er nie zuvor getan. Keinen Gedanken, bis eben.
Und ihm war kalt.
Seine Knie zitterten und seine Füße waren fast taub. Er presste die Nachtluft bibbernd in seine Lungen und wieder hinaus.
Er trat auf der Stelle leise von einem Fuß auf den anderen, bewegte seine Zehen in den Schuhen, um sie ein wenig warm zu halten, und er fürchtete, sich kaum mehr bewegen zu können, wenn es losging. Seine kalte Hand umschloss zwar noch die lange Klinge. Doch seine Kraft ließ langsam nach. Vielleicht hätte er doch eine Schusswaffe nehmen sollen, dachte er. Es wäre einfacher gewesen und schneller. Doch einfach wollte er es ja nicht, er wollte es von Angesicht zu Angesicht und er wollte es fühlen. Fühlen wie der Stahl in ihn dringen und der Hauch des Lebens aus ihm schwinden würde.
Er schüttelte sich. Schüttelte die zweifelnden Gedanken aus seinem Kopf und seine Gliedmaßen ein wenig warm.
Nein, es gab kein Zurück mehr. Kein Leben für ihn morgen, wenn er dies heute nicht zu Ende bringen würde.
Ja, es war ein Fehler gewesen, so früh zu kommen, aber er hatte unter keinen Umständen den Moment verpassen wollen. Er wollte ihn auskosten, solange es ging. Er wollte den Augenblick tief in sich spüren, endlich einmal wieder etwas spüren, und wenn es nur die Vorfreude auf den Tod war.
Wo blieb der verdammte Mistkerl nur, dachte er und schaute auf die Uhr an seinem Handgelenk. Kurz nach 22 Uhr. Jetzt musste er gleich kommen, wer weiß, ob ihn seinerseits nicht schon ein Anwohner entdeckt hatte und beobachtete.
Und dann sah er, wie im Hausflur gegenüber das Licht anging.
Er hielt den Atem an und Adrenalin schoss ihm ins Herz, dass es ihn fast von den Füßen riss. War ihm tatsächlich eben kalt gewesen?
Er sah, wie die Haustür aufging und ein Mann auf die Straße trat. Er sah, wie der Mann kurz stehen blieb, sich umsah, den Kragen seines Mantels hochschlug und die Straße hinunterging, fort von ihm.
Er wartete, bis Max Schulte sich ein paar Meter vom Haus entfernt hatte, und trat dann aus seinem Versteck heraus.
Nicht zu früh, warnte er sich. Schulte musste weit genug weg sein von diesem Haus, jemand könnte aus dem Fenster schauen und ihn beobachten.
Als er sich in Bewegung setzte, merkte er erst, wie steif er tatsächlich vom unbewegten Warten in der Kälte geworden war. Er bekam seine Beine kaum vernünftig voreinander, und der Bürgersteig war nass und rutschig.
Er war zu langsam, verlor den Abstand zu seinem Opfer und hatte auch noch die Straße zu überqueren, die zwischen ihnen lag.
Vor Panik wurde er unvorsichtig, beschleunigte seinen Schritt und es hallte von den Wänden wider.
Warum war es nur so verdammt ruhig hier.
Langsam kam er ihm wieder näher. Er trat auf die Straße, doch das Kopfsteinpflaster war zum Teil schon überzogen mit gefrierender Nässe, sodass er ausrutschte und sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte.
Hatte er dabei gestöhnt?
Schulte beschleunigte seinen Schritt, er hatte ihn bemerkt, zweifellos. Er wurde zu schnell für ihn und in Panik rief er nach ihm. Es war eine völlig unsinnige Idee, doch er wusste sich nicht anders zu helfen. Zweimal, dreimal rief er seinen Namen und tatsächlich, überraschenderweise blieb Schulte stehen.
Verdutzt stoppte er ebenfalls und haderte einen Moment. Mit dieser Reaktion Schultes hatte er nicht gerechnet, eher schon mit Flucht. Und für den Moment hielt die Welt den Atem an, gespannt auf die Explosion. Dann besann er sich, stürmte auf ihn zu und in dem Moment, als er bei ihm war, drehte sich Max Schulte zu ihm um.
Sie standen Aug in Aug.
Es war eine völlig skurrile Situation für ihn, unwirklich, wie ein nachwirkender Traum am frühen Morgen, gleich nach dem Erwachen.
Sie starrten sich an und Schulte stand die Frage im Gesicht geschrieben: Wer zum Henker bist du denn?
Wie hypnotisiert hob er das Messer, das er fest in seiner Hand hielt, bis in Bauchhöhe von Schulte – und stach zu.
Langsam, eher zögerlich.
Er spürte den Widerstand der Bauchdecke und nach ein wenig mehr Druck, wie er brach und seine Hand tief in den Leib seines Opfers fiel. Er sah ihm dabei fest in die Augen und suchte nach dem Moment, in dem Schulte klar wurde, wer sein Henker war und warum er jetzt zu sterben hatte. Er drehte das Messer um hundertachtzig Grad, drückte es nach unten, zog es langsam wieder heraus und durchschnitt ihm dabei abermals Magen und Gedärm. Warmes Blut lief über seine kalte Hand.
Schultes Mund öffnete sich, doch sein Schrei blieb stumm. Seine weit aufgerissenen Augen, voller Angst und Schmerz, sahen hilfesuchend wild umher.
Dann stach er kopflos auf sein Opfer ein. Wutentbrannt und mit blinder Raserei. Bauch, Hals, Nacken und Rücken. Fünfmal, zehnmal, er wusste es nicht mehr. Warme Tränen liefen ihm über sein Gesicht, und als er fertig war, stand er auf und sah auf sein Opfer hinab. Ein lebloser, verstümmelter Körper. Die Gliedmaßen weit von sich gestreckt. Der Kopf fast abgetrennt.
Er erbrach sich gleich neben ihm.
Er spürte keine Angst, setzte sich erschöpft auf die Bordsteinkante und wollte nur noch dort sitzen bleiben und sich erholen. Was würde jetzt kommen?
Ben Mulder
Wenn die Nacht schon so richtig übel war, kann der Morgen danach einfach nicht besser sein.
Es gibt Nächte, die Heilung bringen, und, geknüpft an deren Morgen, der Abend zuvor wunderschön und keine Verschwendung war.
Doch so ein Morgen war dieser Morgen nicht. Keine Heilung. Kein wunderschöner Abend. Nichts zum Schönreden. Nur Schmerzen, Übelkeit und Reue.
Wenn ich trinke, schlafe ich mies. Das ist einfach so. Zuerst falle ich in eine Art Koma. Doch irgendwann in der Nacht wache ich auf, gequält von Müdigkeit und den Folgen des Alkoholkonsums. Kämpfe mit dem Kater, gegen das Kotzen und mein Herz legt Doppelschichten ein, um mich rein zu waschen. Ich spüre den Pulsschlag in jeder kleinsten Ecke meines Körpers.
Es ist die Hölle.
Jedes Mal.
Wenn ich mit der Nacht durch bin und der Morgen sich gnädig zeigt, pelle ich mich aus dem Bett, dankbar, dass es vorüber ist, und zugleich fluchend, dass keine weitere Zeit für Erholung bleibt. Meine ersten Gedanken sind dann nicht „Nie wieder", diesen Selbstbetrug habe ich schon lange aufgegeben. Nein, die ersten Verknüpfungen kümmern sich darum, wie ich den Tag bis zum Abend ordentlich hinter mich bringen kann. Denn die Erfahrung sagt mir, ab Mittag wird es noch mal richtig schlimm. Dann kommt der Einbruch und die Übelkeit, Hand in Hand mit einer hinterhältigen Müdigkeit, wie dunkle Schatten in eine schmale Häusergasse, und mit ihnen die folgenschwere Entscheidung, die Qualen wie ein Mann auszutragen oder eben mit Alkohol und Tabletten zu überbrücken, um am nächsten Tag von vorne zu beginnen.
Raten Sie mal, wie das ausgeht.
Trotzdem stehe ich jeden Morgen auf und beginne den Tag pünktlich, und wissen Sie, warum? Weil ich meine Arbeit liebe und das bisschen Selbstachtung, welches ich noch besitze, mir klar vor Augen führt, dass dies der einzige Grund ist, um nicht komplett im Delirium zu verschwinden.
Ich bin Polizist.
Mit Leib und Seele.
Morduntersuchungskommission Ostberlin. Oder kurz: MUK.
Das war ich nicht immer. Ich stand auch schon mal ein paar Stufen höher auf der Leiter der Befehlskette, aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht für später.
Jedenfalls quälte ich mich auch an diesem Morgen mit krampfendem Magen und schmerzenden Beinen aus dem Bett.
Im Nachhinein sei gesagt, dass ich mir das an diesem Tag ausnahmsweise einmal hätte sparen sollen. Es war eine folgenschwere Entscheidung, die ich traf, aber das konnte ich natürlich noch nicht wissen.
Also stolperte ich quer durch meine Wohnung bis ins Badezimmer. Fluchend über mein verdammtes Pflichtbewusstsein fiel ich dort vor der Schüssel auf die Knie, um sie ordentlich anzubrüllen. Einer hatte es schließlich auszubaden.
Meinen ganzen verdammten Frust der versoffenen letzten zwei Tage brüllte ich ihr entgegen und als ich fertig war mit Brüllen, setzte ich mich neben sie, erschöpft und leer, schaute durch das runde Dachfenster in den Himmel und sah die Sonne durch einen kleinen Riss im tiefen Grau kurz in mein Bad hineinkieken. Es war wunderschön. Ich mag Wolkenspiele und Weitblick. Deshalb lebe ich in einer Dachwohnung.
Eine heiße Dusche ist so eine Art schwereloser Raum für Befindlichkeiten. Alles, was sich unter ihr abspielt – wie gut man sich auch immer fühlt – es zählt nicht für außerhalb. Sie täuscht über die Tatsachen hinweg wie eine magische Käseglocke und es ist wichtig, das zu wissen, dann ist die Enttäuschung später nicht so groß, wenn man merkt, dass man sich doch noch so richtig kacke fühlt und der Tag noch eine Ewigkeit dauern wird.
Ich drehte die Dusche auf heiß, so richtig heiß, stieg hinein, stützte mich an der Wand ab und pinkelte. Hab mal gelesen, das würde Wasser sparen, und ja, warum eigentlich nicht.
Ich blieb unter der Dusche, bis mein Kreislauf stotterte.
Stieg aus der Dusche und stellte mich dampfend vor das Waschbecken. Die Zahnbürste in der rechten Hand haltend, schaute ich auf meine neblige Silhouette im beschlagenen Spiegel. Hob langsam die linke Hand, um die Feuchtigkeit vom Spiegel zu wischen, stockte kurz, denn ich wusste, dass mir nicht gefallen würde, was ich gleich sah. Presste dann meine platte Hand auf den Spiegel und zog sie quer hinüber.
Und ja, Volltreffer.
Diese Ränder ...
Die Falten sind mir egal. Auch mit den feinen geplatzten Äderchen auf meiner Nase und den Wangen kann ich leben. Rote Augen, die werden bald wieder weiß sein. Aber die Ränder unter meinen Augen, die werden bleiben und jeder wird sie sehen. Und jeder wird denken, wie übel ich aussehe. Und ich hasse das. Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, mir ginge es nicht gut. Ich will nicht, dass sich irgendjemand überhaupt Gedanken darüber macht, wie es mir geht.
Damit kann ich so gar nicht mit umgehen: eigene Schwächen!
Ich betrachtete mein Gesicht im Spiegel, die Narbe über dem rechten Auge. Ich konnte mich schon lange nicht mehr daran erinnern, wie ich ohne ausgesehen hatte.
Seit Tagen nicht rasiert und ich hätte fast alles an diesem Morgen lieber getan, als mich zu rasieren.
Also ließ ich es sein.
Freute mich stattdessen auf die Sprüche im Büro und beschloss einfach, dass ich heute Morgen nicht zum Chef gerufen werden würde.
Ich ging näher an den Spiegel heran und suchte in meinem grauen Haar nach meiner eigentlichen Haarfarbe, schwarz. Hier und da noch zu entdecken, aber im Gesamtbild nicht mehr zu erkennen.
Ich war alt. Aber das scherte mich nicht. Solche Eitelkeiten waren mir schon vor langer Zeit abhandengekommen. Ich hatte andere.
Jeans, schwarzer Rollkragenpullover und ab in die Küche, die zwar sehr klein war, aber ich fand sie urgemütlich. Links Kühlschrank, Gasherd und Spüle, rechts ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen und geradeaus eine Glastür mit schmaler Terrasse dahinter.
Zwei Tassen ganz starker Kaffee mit reichlich Zucker, dazu zwei Titretta im Wasserglas und Bisoprolol in fast vorgeschriebener Menge. So langsam kam ich in Tritt.
Schwarze Lederjacke, schwarze Lederstiefel, einen Toast mit Marmelade auf die Hand, so schlug ich die Eingangstür hinter mir zu und stieg die ausgetretenen und quietschenden Holztreppenstufen der Haustreppe von meiner Dachwohnung bis runter auf die Straße.
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 14
Im Eingangsbereich blieb ich kurz stehen.
Toast war weg, Zeit für eine Kippe.
Ich kramte in meiner Jackentasche und fand ein zerknautschtes Päckchen mit zwei Zigaretten darin. Die erste hatte einen Riss. Heiland, bitte nicht. Die zweite war ebenso ramponiert wie die erste, ich strich sie vorsichtig glatt und, Themis sei Dank, sie war in Ordnung.
Ist das normal, solch eine Erleichterung wegen einer Kippe?
Ich zog mein silbernes Benzinfeuerzeug aus der rechten Hosentasche und zündete mir die Zigarette an. Dabei schaute ich auf die Klingeln neben der Haustür und auf die Namensschilder all der Personen, die im Haus lebten.
Ich ging die Namen von oben an nach unten durch.
- Mulder
- Schneider
- Garetzki
- Schuhmann
Schuhmann ... hhhmmm!!
Hier blieb mein Blick hängen und ein kleines Kribbeln machte sich in meinen südlichen Gefilden breit.
Nein, so weit südlich nicht, mehr in Höhe meines Magens. Ein warmes, schönes Kribbeln, ein echtes Gefühl.
Ich schlug den Kragen meiner Jacke hoch und trat auf die Straße.
Es regnete.
Bindfäden im Winkel von sechsunddreißig Grad.
Ich sah die Straße hinunter.
Am Horizont gossen sich die weichen Linien des wolkengrauen Himmels über die scharfkantigen Schattierungen der Stadt und verschluckten ihre Tiefe.
Es sah aus wie ein Bild von Emil Nolde. Ein bisschen weniger bunt vielleicht.
Der kalte Regen drang in alle ungeschützten Ritzen meiner Kleidung ein.
Ich schritt zu meinem Wagen und seufzte laut.
Jaaahh, mein Wagen, mein Baby!
Ich stieg ein, drehte den Zündschlüssel, und es folgte ein motzendes rööhhr, rööhhr, rööhhr, was zu erwarten war.
Ich liebe mein Auto, wirklich, ich liebe es sehr, aber es ist halt eine Französin und offensichtlich im Süden Frankreichs geboren und aufgewachsen. Es hasst Kälte und Feuchtigkeit.
Aber es ist mein ganzer Stolz. Ein schwarzer Citroën CX. Und ist dies nicht schon außer- gewöhnlich genug, ist es ein Citroën CX Prestige, eine Luxuslimousine, ganz in Schwarz.
Wie ich zu diesem Auto gekommen bin, hier in diesem Land? Wie die Jungfrau zum Kinde. Dieses Auto ist mein ganzer Stolz. Meine Insel der Freiheit inmitten versperrter Wege. Meine direkte Verknüpfung zum Außergewöhnlichen, zum Besonderen, zum heimlichen Protest. In ihm hebe ich mich vom Rest um mich herum ab.
Scheiße, ich weiß, das klingt arrogant, aber es ist viel mehr als Arroganz. Für mich ist es ein Grund. Ein Grund, nicht zu viel über mein Leben außerhalb der Arbeit nachzudenken. Ein Grund, all die Einschränkungen so zu nehmen, wie sie sind, und nicht zu analysieren, warum ich wieder allein bin. Ohne mein Auto wäre ich nichts anderes als ein weiteres dunkles Partikel in einer schwarzen Masse.
Ich brauche keinen Urlaub am Meer in Bulgarien, mir reicht es, hin und wieder unbedacht mit meiner sanften Französin über die einsamen Feldwege im Norden zu schweben, die weichen Stoßdämpfer unter meinem Arsch und John Coltrane im Ohr.
Und ja, mein Auto ist eine Sie.
So glitt ich auch diesen Morgen über die nassen Straßen Ostberlins dahin.
Dietrich-Bonhoeffer-Straße bis zum Arnswalder Platz, mit seinem monumental hässlichen Stierbrunnen oder auch Fruchtbarkeitsbrunnen. Furchteinflößend. Am Platz rechts, in die Bötzowstraße, beidseitig flankiert von Altbauten aus der Jahrhundertwende, wunderschön und großzügig angedacht, jedoch sah man ihnen ihr Alter exakt auf den Tag genau an. Abgeplatzter Putz, bröckelnder Stuck, leider keine Ausnahmeerscheinung. Hier kümmerte man sich einen Scheiß um seine Gebäude, oder Straßen, oder ..., ach hören wir auf damit. Bötzowstraße bis zum Ende, und dann rechts abbiegen in die Straße Am Friedrichshain. Vorbei am großen Bunkerberg im Volkspark, und von dort bis zur Ecke Greifswalder Straße, dann links abbiegen, und immer geradeaus bis zur Hans-Beimler-Straße. Hier wurde die Straße schon fast verschwenderisch breit.
An Ampeln, an denen ich hielt, lugten die Menschen unter ihren Regenschirmen hervor und warfen Blicke auf meine Süße, aber das war ich gewohnt. Männlein wie Weiblein schauten immer, wenn wir vorfuhren, meistens allerdings mit Argwohn.
Polizeipräsidium Keibelstraße
Vielleicht steht´s ja aber auch in irgendeinem Nebensatz von Engels oder Marx: Lasst es grau sein!
Oder so ähnlich.
Während ich meinen Wagen quer durch Berlin steuerte und mich an den freien weiten Straßen erfreute, war die Stadt wie ausgestorben. Die meisten Einwohner lagen sicher noch mit einem angemessenen Kater im Bett. Schon seit ein paar Wochen war der übliche Alltag ins Wanken geraten, und mit jedem Montag wurde es chaotischer. Doch nun, seit zwei Tagen, nach dem großen Fall, war unsere Welt vollends aus den Angeln gehoben und es schienen keine Automatismen mehr zu greifen. Die einen feierten und die anderen diskutierten. Bei Weitem nicht alle freuten sich, einige hatten auch etwas zu verlieren. Und an diesem Morgen lag die Stadt lahm und ich war gespannt, wann wieder Normalität eintreten würde. Wobei, wahrscheinlicher war, dass es damit vorbei ist und unsere Normalität nie wieder sein würde.
Ich parkte meinen schwarzen Schatz auf dem Parkplatz vor dem Revier. Stieg aus, verschloss sie und streichelte ihr beim Vorbeigehen sanft über den Kotflügel. Hätte ich gewusst, dass dies für lange Zeit unser letzter gemeinsamer Moment sein sollte, wäre ich auf die Knie gegangen, hätte sie umarmt und gebeten, sie solle gut auf sich achtgeben.
Ich betrat das Gebäude durch den Haupteingang. Grüßte kurz die Wachhabenden, stieg in den Aufzug ein und im vierten Stock wieder aus. Der Flur vor mir spaltete sich in zwei Richtungen, einmal links und einmal rechts. Beide beleuchtet von kaltem Licht aus standardisierten halbrunden, länglichen Neonlampen, kein Tageslicht. Die Flurwände waren mit Holzvertäfelungen beschlagen und auf dem Boden lag ein grüner, kurzer Teppich.
Ich wählte den rechten.
Zu beiden Seiten waren Büros angeordnet, rechts mit Blick auf die Keibelstraße und das ansässige Untersuchungsgefängnis, links mit Blick auf die zugehörigen Parkplätze auf der Hans-Beimler-Straße.
Das Gebäude an sich war ein langer, sechsstöckiger, rechteckiger Kubus, schlicht und monumental. Sozialistischer Klassizismus. Oder, richtigerweise, Eisenbetonskelettbau. Muss ich mehr sagen?
Es war kalt, hässlich und einfallslos funktionell.
Ich lief den Gang entlang in Richtung meines Büros. Vorbei an endlosen Türen, manche geöffnet, die meisten jedoch geschlossen.
Mehr noch geschlossen als die letzten Wochen. Die Revolution legte auch unseren Laden lahm. Und rückblickend auf die Ereignisse der letzten Wochen und der damit zusammenhängenden Untaten, die hier in diesem Gebäude Bruder und Schwester zuletzt angetan wurden, war es nur allzu verständlich, dass viele es nicht mehr mit sich einen konnten, im Moment hierherzukommen. Und ob es nun Angst vor den möglichen zukünftigen Konsequenzen war, die meine Kollegen fernhielt, oder Zweifel, konnte ich nicht sagen und es änderte auch nichts an der Tatsache, dass das Gebäude erschreckend leer war und mir das gar nicht gefiel.
Oberst Karl Steinhoff
Drei Abteilungen waren in dem Geschoss untergebracht, ein Teil der Verkehrspolizei, Kriminalpolizei und wir vom MUK.
Insgesamt acht zuständige Mitarbeiter inklusive einer Stenosachbearbeiterin zählte unsere glorreiche Truppe.
Unsere Büros lagen am Ende des Ganges und meines war das letzte hiervon. Ein Eckbüro mit Blick auf den Alexanderplatz. Absoluter Hauptgewinn.
In den letzten vier Büros rechts und links vor meinem saß normalerweise der Rest der Kollegen.
Im ersten Büro links arbeitete Melanie Schober, besagte Stenosachbearbeiterin.
Rechts gegenüber Helmut Krug, Kriminaltechniker.
In den nächsten zwei Büros vier weitere Mitarbeiter, die sich zu zweit ein Büro teilten, und dann, wie gesagt, meines am Ende.
Ich schaute im Vorbeigehen in jedes einzelne Büro und erntete gähnende Leere. Das war jetzt schon seit Tagen so. Nicht mal die Schober war da, die eigentlich immer da war, was verdammt frustrierte.
Ich betrat mein schmales Büro, schmiss die Lederjacke an den Kleiderständer und ließ mich in den weich gefederten Drehstuhl fallen. Der Schreibtisch vor mir, aus hellem Hartholz, quoll über von Akten, Papieren, einer Schreibmaschine und dem beigen Telefonklotz mit Drehwählscheibe. Ein Holzregal stand an der gegenüberliegenden Wand und bog sich bis aufs Äußerste gespannt unter Büchern und weiteren Aktenordnern. Hinter mir hing als einziges Bild im Raum, in feinem Holzrahmen, das Konterfei des Genossenbosses Honecker.
Kaum dass ich saß, ließ der erste Koffein-Zucker-Aufpäppler von zu Hause bereits nach und die verlorenen Nächte forderten ihren Tribut. Ich sackte in mich zusammen und fühlte mich furchtbar alt und erschöpft. Verdrängen hilft ja eine Weile, aber eben nicht ewig. Entschloss mich aber weiter fürs Verdrängen. Öffnete die Schreibtischschublade, nahm mir zwei weitere Titretta, ein Glas und eine Flasche Wodka heraus. Schmiss die Titretta in den Mund und zerkaute sie. Der bittere Geschmack brachte mich zum Würgen, aber die Tabletten wirkten schneller so und irgendwie hatte ich diese leichte Geißelung auch verdient. Füllte das Glas bis zum Rand voll mit Wodka und spülte die Arznei runter. Dann stand ich auf, schlenderte ans Fenster und schaute rechts hinüber auf den sich ausbreitenden Alexanderplatz.
Feiner Nieselregen bedeckte den Platz mit einer dünnen Schicht Wasser und ließ ihn aussehen wie einen riesigen Spiegel, vereinzelt durchzogen von schwarzen Regenschirmen, die scheinbar selbständig über den Platz zu schweben schienen.
Der Regen traf im leichten Winkel auf mein Fenster, sammelte sich dort zu kleinen Tropfen und perlte dann in langen Streifen ab.
Ich schaute den schmalen Rinnsalen zu und wurde verdammt schwermütig. Es sollte noch ein paar Tage so regnerisch bleiben, hatten sie im Radio gesagt. In der Nacht zuvor hatte es einen Temperatursturz gegeben. Innerhalb kurzer Zeit waren die Temperaturen um fast fünfzehn Grad gesunken. Die Luft kühlte sich schnell ab, aber der Boden brauchte etwas länger, so bildeten sich Nebelschwaden, die noch immer durch die Straßen zogen wie herrenlose Schäferhunde auf der Suche nach Abwechslung.
Oh, Mann, jetzt analysiere ich schon das Wetter, dachte ich gerade, als das Telefon klingelte.
Ich wollte es ignorieren, wirklich. Fühlte mich gerade so richtig schön mollig warm eingepackt in meiner Melancholie und hätte noch Stunden am Fenster stehen und rausschauen können, doch das schrille Läuten überstrapazierte meine Nerven unmittelbar, also lief ich zurück zum Schreibtisch, hob ab und trällerte: „Jawoll!“
Die Stimme am anderen Ende sagte: „Mulder, sind Sie das?“
Hauptmann Sacher, mein Boss.
„Jawoll“, wiederholte ich.
„Warum dauert das so lange?“
„`tschuldigung, war grad beschäftigt, der Regen zeichnet so wunderschöne Formen auf mein Fenster und …“
„Kommen Sie in mein Büro, sofort!“ Und legte auf.
Ihnen auch einen schönen guten Morgen, wollte ich nachschieben, aber die Leitung war bereits tot.
Jemand hat mal geschrieben: „Man kann immer nett zu jenen sein, die uns nichts angehen.“ Ich lächelte, schüttete mir noch mal von dem Klaren ein, stellte die Flasche zurück in die Schublade und leerte den Magenwärmer in einem Zug. Dachte kurz über ein paar Amfis nach, die Aponeuron-Packung lächelte mich schief unter einem Stapel Papieren an. Verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Es war besser, halbwegs nüchtern beim Chef anzutanzen. Könnte wichtig sein und da wollte ich nicht wie ein Wackeldackel auf dem Armaturenbrett eines Rallyewagens erscheinen und irgendwas verpassen.
Ich stiefelte zurück in den Flur, horchte kurz noch einmal in die Stille und erschauderte. Der Laden ging ernsthaft den Bach runter.
Das Büro von Sacher lag zwei Stockwerke über unserem. Ein Treppenhaus befand sich gleich neben meinem Büro. Zum Aufzug hätte ich den gesamten Flur wieder zurück durchqueren und mir den Frust des Zerfalls noch einmal vor Augen führen müssen. Ich entschloss mich, die Treppe zu nehmen, und hoffte, dass die Bewegung mir guttun würde.
Tat sie nicht.
Oben angekommen, war mir übel, und mein Hirn pochte im Einklang mit meinem Puls an seine Rinde. Das war definitiv noch nicht genug Wodka zum Überbrücken gewesen.
Vor Sachers Büro standen zwei Gestalten Spalier. Einer links, einer rechts. Beide groß und grimmig dreinschauend. Beide trugen Cordhose, Rollkragenpulli und Lederjacke.
Geleitschutz.
War gespannt, wer da wohl im Büro wartete. Mir wurde ein wenig mulmig. Hatte ich Mist gebaut? Kramte in den letzten Tagen, fand aber nichts, oder vielleicht das Auto auf der Bornholmer Straße? Zuckte kurz mit den Schultern und trat ein.
Mein Boss saß hinter seinem Schreibtisch und unterhielt sich mit einem weiteren Mann, der auf einem Stuhl in der Ecke des Büros saß. Der Mann, ich schätzte ihn auf Mitte fünfzig, hatte schwarzes Haar, mit grau durchzogen und zum Seitenscheitel gekämmt. Schmale Lippen eine große, leicht schiefe Nase und seine Augenbrauen waren an ihren Enden leicht hochgebogen. Eigentlich gutaussehend, so ein bisschen wie Klaus-Peter Thiele, wenn er nicht diese beschissen hässliche Uniform getragen hätte, die ihn automatisch zum Arschloch abstempelte.
Sie unterbrachen ihr Gespräch abrupt, als ich eintrat, und Sacher bat mich Platz zunehmen.
Er sah mich mit seinen dunklen Augen, die weit verborgen hinter seinen buschigen Augenbrauen saßen, ausdruckslos an. Ich konnte nichts daraus lesen. Keinen Ärger, keinen Zorn und definitiv keine Freude. Das war nicht gut, so viel war klar, und es irritierte mich.
Ich kannte Sacher jetzt seit einigen Jahren und mit den Jahren lernt man kleinste Hinweise in Gestik und Mimik zu lesen, beabsichtigte und unbeabsichtigte, doch an diesem Tag, in diesem Raum schenkte mir sein rundes, aufgequollenes Gesicht nicht den kleinsten Furz eines Hinweises.
Das war ein Fehler gewesen und das hätte ihm klar sein müssen. Das konnte ich ihm nie mehr verzeihen.
Ich nahm auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch Platz und er begann:
„Mulder, das ist Oberst Karl Steinhoff vom Staats-sicherheitsdienst, er wird an unserer Unterhaltung teilnehmen.“
Stasi? Hier? Warum? Eigentlich hatten wir mit denen nichts an der Backe, das war gar nicht gut.
Ich drehte mich um und nickte der Uniform zu. Sie nickte zurück und versuchte kläglich, freundlich zu grinsen. Das war gruselig.
„Mann, Mulder, Sie sehen beschissen aus“, bemerkte Sacher, „in welchem Loch haben Sie die letzten Tage gesteckt?“
„Hab nur schlecht geschlafen, Chef, alles gut.“
Sacher schaute in die Ecke und zog die Augenbüschel hoch, nahmen sie mir natürlich nicht ab.
„Sicher“, sagte er, „aber egal jetzt, ich bin froh, dass Sie hier sind“, und hierbei zeigte er das erste Mal eine Regung, die ich deuten konnte. Er war nicht froh, dass ich da war.
Und er fuhr fort: „Ich habe Arbeit für Sie. Ich möchte, dass Sie einen Mordfall übernehmen.“
Mordfall? Plötzlich ging es mir besser. Adrenalin schoss mir in den Magen, dass es fast weh tat.
„Gestern Abend gegen 22 Uhr ist ein Mann auf offener Straße angegriffen worden. Der Angriff ereignete sich in Berlin-Köpenick, Alfred-Rand-Straße Ecke Sandschloßweg. Der Mann wurde mit über zwanzig Messerstichen in Oberkörper, Hals und Kopf getötet, hat ihm dabei fast den gesamten Kopf abgetrennt, bestialisch. Offensichtlich ein Verrückter. Ich habe Krug bereits hingeschickt, um die Spuren zu sichern, und Schober, damit sie ihm assistieren kann.“
„Moment“, unterbrach ich ihn, „Melanie Schober, die Stenosachbearbeiterin?“, fragte ich.
„Ja, ich weiß“, antwortete er, „das ist eigentlich nicht ihre Arbeit, aber wie Sie wissen, sind wir zurzeit dünn besetzt …“, (was die Untertreibung des Jahres war), „…und sie soll lediglich dokumen- tieren, was Krug findet. Es gibt wohl zahlreiche Hinweise am Tatort. Fußabdrücke, Stofffetzen und Erbrochenes.“
Ich stockte.
„Kotze?“, fragte ich.
„Ja, möglicherweise vom Täter. Könnte den Hunden helfen. Ich möchte, dass Sie den Fall übernehmen. Packen Sie Ihre sieben Sachen und fliegen Sie mit Ultraschall ein. Dürfte kein großes Problem sein, den Kerl zu fassen“, und schmiss mir die Akte rüber.
Ich nahm sie an mich, ohne aber gleich reinzuschauen, ich wollte den ersten richtigen Fall seit einer kleinen Ewigkeit in meinem Büro mit einer heißen Tasse Kaffee genießen.
Blieb aber erst mal noch sitzen und fragte: „Irgendwelche Zeugen, Tatverdächtige, Verwandte, Freunde?“
„Lesen Sie die Akte!“, antwortete Sacher.
„Alles klar, bin schon bei der Sache.“
Blieb aber weiter sitzen.
Was machte die Stasi hier?
Für einen Durchschnittsmordfall sortierten die normalerweise nicht mal ihre Eier in der Hose neu und jetzt saß ein Oberst des MfS hier im Büro und hörte sich unsere Unterhaltung an.
Irgendetwas fehlte.
Alle schauten sich an, aber schwiegen und als letztlich scheinbar doch keiner mehr etwas hinzuzufügen hatte, erhob ich mich vom Stuhl, sagte kurz: „Alles klar, Chef, bin schon bei der Arbeit“, und schlurfte zurück zur Tür. Gerade wollte ich die Türklinke drücken, da seufzte Sacher ein lang gedehntes „Muuldeer“ aus. Ich blieb stehen, sah ihn an und dachte: „Jetzt aber.“
„Sehen Sie sich die Akte an“, wiederholte er genervt.
„Äh, jetzt gleich hier?“, fragte ich. „Ich wollte eigentlich in mein Büro gehen, mir eine Tasse Kaffee machen und …“
„Sehen Sie sich die Akte an. Jetzt. Hier.“
Ich nahm wieder Platz, schaute die Uniform kurz an, dann meinen Chef.
Die Luft knisterte, ich öffnete die Akte und begann zu lesen:
Polizeibericht, vom 11.11.1989, ... bla, bla, bla … das Opfer, Max Schulte, wurde aufgefunden mit ca. 20 Messerstichen,
bla, bla, bla …
.
.
.
Mooomentchen, dachte ich, und es begann mir in den Ohren zu klingeln, das ist jetzt nicht wahr, oder?
Ich sah über die Akte hinweg meinen Chef an und eigentlich hätte ich mir die Frage sparen können. Seine Augen verrieten mir bereits die Antwort, doch ich fragte trotzdem:
„DER Max Schulte?“
Sacher sah in die Ecke, dann wieder zu mir und nickte.
Ich drehte mich auf meinem Stuhl um und starrte die Uniform an, er verzog keine Miene.
„Das ist ein Scherz, oder?“, fragte ich, sprang auf, zeigte auf die Uniform in der Ecke und zischte: „Ist er deswegen hier, um mir Angst einzujagen, falls ich ablehne?“
„Setzen Sie sich“, antwortete Sacher, doch ich wollte mich nicht setzen, ich wollte Stunk.
„Warum ich?“, fragte ich und schmiss die Akte auf den Schreibtisch, als würde sie mir die Finger versengen.
„Was soll das?“, fuhr ich fort. „Ich dachte, Sie mögen mich. Ich dachte, Sie schätzen mich ein wenig. Wie können Sie mir jetzt mit so einem Scheiß kommen. Alles geht den Bach runter und Sie wollen mir jetzt noch einen draufsetzen? Das mache ich nicht, auf keinen Fall! Suchen Sie sich jemand anderen, das geht so nicht.“ Drehte mich um und wollte wieder die Türklinke drücken, als Sacher schrie:
„Setzen Sie sich verdammt noch mal hin, Mulder, und lassen Sie uns wie vernünftige Erwachsene darüber reden.“
Ich sah ihn an. „Wie vernünftige Erwachsene?“, fragte ich. „Was zum flotten Erich ist daran vernünftig?! Sie kennen meine Vergangenheit mit Schulte, wie kann das vernünftig sein, was Sie von mir verlangen?“ Ich sah im Augenwinkel, wie die Uniform beim „flotten Erich“ kurz zuckte, aber sie sagte nichts.
Sacher hob beschwichtigend die Hand. „Bitte setzen Sie sich, damit wir darüber reden können.“
„Ich will nicht darüber reden. Das widerspricht einfach jeglicher Logik und Ethik. Sie können doch nicht ernsthaft eine objektive und professionelle Aufklärung von mir verlangen nach allem, was passiert ist. Polizeiarbeit braucht Leidenschaft, Polizeiarbeit braucht Instinkte, dass wissen Sie genauso gut wie ich. Die einzige Leidenschaft, die ich hier aber gerade verspüre, ist, eine Flasche Krimsekt zu köpfen und auf den Leichensack dieses Arschlochs zu pinkeln. Und mein Instinkt rät mir dringend dazu, genau dies jetzt auch zu tun. Suchen Sie sich jemand anderen.“
Die Uniform schickte sich an aufzustehen, aber mein Chef gebot ihm mit seiner Hand, einen Moment Geduld zu bewahren. Hier lief gerade etwas mächtig schief und war im Begriff zu eskalieren.
„Das ist das Problem“, sagte Sacher, „ich habe keinen anderen, Mulder. Sehen Sie sich um. Es ist niemand hier außer Ihnen, keiner aus Ihrer Einheit, und der Fall gehört nun einmal zu Ihrer Einheit, das ist einfach so. Und da Sie der Einzige und zudem auch noch der Beste sind, werden Sie den Fall übernehmen, das kommt von ganz oben und ist nicht diskutierbar.“
Mir blieb die Spucke weg.
Ich stand da und Hitzewallungen durchzogen meinen Körper.
Rücken rauf, Rücken runter.
Meine Gedanken sprangen in Panik vor den Konsequenzen dessen, was in den nächsten Minuten alles passieren könnte, hin und her.
„Glauben Sie nicht, dass mir das gefällt, Mulder“, fuhr Sacher fort, „und wenn ich könnte, wie ich wollte, würde das anders laufen. Kann ich aber nicht, also tut es mir leid, aber so ist es jetzt.“
Ich war sprachlos, schaute von Sacher zur Uniform und wieder zurück und sagte: „Tut mir leid, Chef, geht nicht.“
Sacher wollte gerade noch einmal ansetzen, wurde aber von der Uniform unterbrochen, die sich nun erhob und auf mich zutrat. Sacher lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Er war jetzt raus aus dem Spiel.
Steinhoff sah mich an und begann ganz ruhig zu sprechen. Seine Stimme war ein wenig zu hoch für seine Körpergröße und viel zu sächsisch für meinen Geschmack.
„Hören Sie gut zu, Mulder. Sie werden den Fall bearbeiten, und zwar mit aller nötigen Objektivität und Professionalität, die hierfür vonnöten ist. Schalten Sie von mir aus Ihre Leidenschaft aus, und Ihre Instinkte können Sie ebenfalls zu Hause lassen. Halten Sie sich an die Fakten und finden Sie den Mörder. Und wenn Sie ihn gefunden haben, werden Sie als Allererstes mich und nur mich alleine darüber informieren. Und finden Sie ihn schnell.“
„Das kann ich nicht tun“, antwortete ich, „oder nein, besser gesagt, ich will das nicht tun.“
Steinhoff trat näher an mich heran, sodass wir jetzt Nase an Nase standen.
„Das ist keine Bitte, Mulder“, fuhr er fort, „das ist ein Befehl!“
„Schon klar“, sagte ich, „geht aber trotzdem nicht.“
Das war eine direkte Befehlsverweigerung.
Verdammt.
„Ist Ihnen klar, was Sie da sagen“, fletschte Steinhoff.
Scheiße, dachte ich und antwortete: „Ja.“
„Hören Sie“, versuchte ich es noch einmal vorsichtig, „wenn Sie meine Vorgeschichte mit Schulte kennen würden, dann würden Sie verstehen, dass ich …“
„Ich kenne Ihre Geschichte sehr gut, Oberleutnant Mulder“, zischte er mir dazwischen. „Ich weiß, was Sie früher getan haben. Denunzierungen. Einige meiner Freunde und Kollegen hatten große Schwierigkeiten wegen Ihnen und Ihresgleichen, Mulder, und seien Sie versichert, dass es mir außerordentlich zuwider ist, Ihnen hier gegenüberzustehen, im selben Raum, vermeintlich auf derselben Seite, und die Luft einatmen zu müssen, die Sie ausatmen. Ich könnte kotzen wegen Ihres Gestanks nach billigem Schnaps und Verrat. Und doch stehe ich hier und beuge mich tief runter auf Ihre Höhe, und zwar nur weil Max Schulte und seine Familie langjährige Freunde von mir sind. Und ich befehle Ihnen nun noch einmal, klären Sie den Fall, und zwar schleunigst, ansonsten wird Ihr Rausschmiss noch der angenehmste Teil aller Konsequenzen sein.“
Jetzt verstand ich langsam, es ging um etwas Persönliches, darum war die Stasinase hier.
Aber das interessierte mich einen Scheiß, im Gegenteil, das spornte mich nur noch mehr dazu an, den beiden Herren hier klarzumachen, dass sie sich den toten Schulte und ihre Kumpaneien mit all der restlichen Verbrecherfamilie dahin schieben konnten, wo die Sonne niemals scheint.
Ich war noch nicht fertig.
Ich fuhr meinen Ton runter und fragte höflich: „Das heißt, ich unterstehe Ihrem direkten Befehl und habe Ihnen Bericht zu erstatten.“
„Das ist korrekt“, sagte die Uniform.
„Also direkt Ihnen“, wiederholte ich, „ohne Umschweife, nicht zuerst Hauptmann Sacher, sondern gleich Ihnen?“
„Ja, unmittelbar und unverzüglich mir“, antwortete er mit Nachdruck und bereits leicht genervt, was sich aber in Kürze noch zu einem wahren Nervenzusammenbruch steigern sollte.
„Okay“, sagte ich, „wer hat das autorisiert?“
„Ich habe Ihnen einen klaren Befehl erteilt“, zischte die Uniform.
„Mag sein, ja, aber tatsächlich sind Sie nicht autorisiert, mir Befehle zu erteilen. Von wem kommt der Befehl?“
Und sah meinen Chef an, doch die Uniform grätschte wieder dazwischen.
„Der Befehl kommt von mir, und ich bin autorisiert, ich bin die Autorisierung in Person.“
„Sind Sie nicht“, sagte ich knapp und sah weiter Sacher an, der antwortete: „Hören Sie, Mulder, dies ist eine klare Anweisung eines Oberst des Staatssicherheitsdienstes und dieser haben Sie sich zu fügen, also fangen Sie an zu arbeiten. Und ich möchte da jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Gehen Sie und …“
„Entschuldigung, Chef, aber ich kann das so nicht akzeptieren. Die Zusammenarbeit mit dem Mfs muss autorisiert werden, Sie wissen das. Ich unterstehe nicht dem Befehl des MfS. Ich unterstehe dem Befehl des Dezernats II, MUK, und ein Einsatz für das MfS kann nur auf Weisung des Präsidenten der VP Berlin, des Stellvertreters für den Dienstzweig der VP, des Leiters der Abteilung KP des PdPV oder des Leiters des Dezernats II erfolgen. Also – ist einer der Herren involviert oder hat eine entsprechende Weisung veranlasst?“
Ja, in dieser Verwaltungsscheiße bin ich wirklich gut. Das war mal Teil meiner Arbeit, das alles zu wissen, früher einmal. Wenn Sie nicht verstehen, wovon ich rede, schlagen Sie es nach.
Das Gesicht der Uniform hatte mittlerweile die Farbe einer Brombeere angenommen und Sacher starrte mich mit Funken in den Augen nur noch an.
Dann lächelte er leicht und schüttelte den Kopf.
Die Uniform wollte wieder beginnen, doch ich unterbrach ihn und setzte nach.
„Gibt es ein Führungsdokument?“, fragte ich in die Runde und wollte jetzt so richtig einen raushauen.
„Wenn es eine Anweisung gibt“, fuhr ich fort, „sollte es ein offizielles Führungsdokument geben, wo unter anderem das Zusammenwirken von uns und dem MfS organisiert und dargestellt ist. Ein Führungsdokument von Ihnen aufgestellt und abgezeichnet ...“
Und exakt das war der Moment, in dem es eskalierte, wo der letzte Tropfen meines spuckenden Mundes das Fass zum Überlaufen brachte und mein Leben auf den Kopf stellen sollte.
Während Sacher mich immer nur weiter ungläubig kopfschüttelnd angaffte, verlor die Uniform komplett die Haltung.
„Hören Sie auf mit dem Scheiß!“, unterbrach er mich, doch ich sprach ruhig, aber betont laut weiter.
„… unterschrieben vom Präsidenten der VP Berlin, in dem die Anweisung zur Zusammenarbeit mit dem MfS angeordnet wird uuunndd …“, hob meinen Zeigefinger in die Höhe, machte eine dramatische Pause und fuhr dann fort, „… weiß der Staatsanwalt darüber Bescheid?“
Dann, Stille.
Tiefe, körperlich fast schmerzende Stille trat ein, bis die Uniform sie durchbrach und zitternd stammelte: „Zum letzten Mal, ich befehle Ihnen, Ihre Arbeit zu tun.“
Aber um das Gesagte noch einmal kurz zusammenzufassen, hatte dieses Arschloch mir gar nichts zu befehlen und das sagte ich ihm dann auch.
„Sie haben mir gar nix zu befehlen, Arschloch.“
Er packte mich beim Rollkragen, jetzt so rot, dass sein Kopf drohte zu platzen, stierte mich mit blutunterlaufenen Augen an und fletschte: „Wo waren Sie denn letzte Nacht, Mulder? Vielleicht beziehen wir Sie in den Kreis der Verdächtigen mit ein? Grund genug hätten Sie ja, schließlich hat der Mann Ihnen Ihre Karriere versaut!“ Und grinste.
Da dachte ich mir: Scheiß drauf, und gab ihm eine Kopfnuss par excellence, mitten ins Gesicht.
Patsch.
Ein bisschen überreagiert?
Vielleicht.
Ob ich das im Nachhinein bereue?
Nie im Leben.
Danach war jedenfalls der Teufel los.
Mein Boss auf mich drauf und brüllte mich an, die zwei Lederjacken vor der Tür stürmten den Raum und ebenfalls auf mich drauf. Und bevor ich auch nur ordentlich „Aua“ sagen konnte, fand ich mich in einer Zelle im Untergeschoss des Nebengebäudes Keibelstraße wieder. Nur einen Bierflaschenwurf von meinem geliebten Büro entfernt, in dem ich eben noch so wunderschön melancholisch den Nieselregen auf der Fensterscheibe beobachtet hatte.
Wer das wohl war?
Flackernde, zuckende Bilder.
Jubelnde Menschentrauben liegen sich in den Armen.
Hammer und Meißel gehen nieder auf die bunte Mauer.
Überfüllte Kneipen, laut und stinkend.
Gesänge durch dicke Nebelschwaden aus
Zigarettenrauch und Körperdunst.
Biergläser und Schnaps, über den Köpfen alles benetzend.
Irgendwann wurde ich wach und fand mich in einer kahlen, weiß gekachelten Zelle wieder. Meine Wunden waren provisorisch versorgt und mein Kopf dröhnte unerträglich. Ich stand auf, schleppte mich zur Schüssel und erleichterte mich in drei Varianten. Schaute in den Spiegel aus Metall und sah genau das, wonach ich mich fühlte. Alles tat weh und der Affe tanzte auf meiner Schulter. Ich schlurfte zurück zur Pritsche, legte mich und fiel in einen weiteren unruhigen Schlaf.
Ein kalter Boden in einer kalten Gasse.
Kindergelächter auf einer Parkbank.
Taumelnd in die nächste Kneipe.
Einsam in der Ecke.
Türme von Bier- und Schnapsgläsern.
Nasse, nach Schnaps und Zigaretten stinkende Küsse.
Weiches, dickes Fleisch, das mich benutzt und im Hausflur liegen lässt.
Nach ungewisser Zeit kam ich wieder zu mir. Jetzt ging es meinem Körper ein wenig besser, doch die ersten klaren Gedanken schmerzten dafür umso mehr. Ich hatte meine Arbeit verloren. Das Einzige, was mir noch wichtig und teuer gewesen war. Das Einzige, was mich morgens hatte aufstehen lassen.
Und das tat dann mal richtig weh.
Ich weinte wie ein kleines Kind.
Ein Polizist kam und gab mir Medikamente, Essen und Wasser. Ich inhalierte die Drogen und schlief wieder ein. Irgendwann weckte mich der Polizist und sagte, ich solle jetzt aufstehen, ich könne jetzt gehen. Er geleitete mich durch das Gebäude, schloss eine Tür auf und entließ mich in eine Nebenstraße. Es regnete immer noch, es war kalt und der Tag verabschiedete sich gerade in die Nachtruhe. Ich schlug den Kragen meiner Lederjacke auf, lief um das Gebäude herum und stand auf dem Alexanderplatz. Schlich weiter, zurück in die Hans-Beimler-Straße bis auf den Parkplatz und schaute hoch in den vierten Stock, sah, wie die Lichter im Eckbüro angeschaltet wurden, und fragte mich, wer das wohl war.
Ich stand da, und der Regen lief mir vom Kopf am Hals herunter, am Lederkragen vorbei und unter meinen Rollkragenpullover. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich dort stand, doch irgendwann gab es nichts Warmes mehr in mir und außen war alles nass. Ich zitterte schubweise. Tastete meine Taschen ab nach einer Zigarette, fand aber keine.
Dann sah ich mich um und versuchte, klar zu denken, suchte nach einem Ziel, das mich auffangen konnte, da ich im Begriff war, haltlos zu fallen. Doch ich fand keines.
Ich ging fort, mitten hindurch die riesige Steinwüste, die vollgestopft war mit einzelnen Leben, von denen keines meines kreuzte. Ich wollte nur weg von diesem Ort, der mir nun nur noch Hoffnung nahm statt wie bislang gab.
Ich durchzog von da an die Stadt und meine Zeit wie ein Neutron seinen Weg durch die Weiten des Raumes, einsam und ohne Kollision.
Alles um mich herum war im Wandel und freudeerregt. Eine neue Weltordnung entstand, eine neue Zeitrechnung begann, doch all dies perlte an mir ab wie ein klarer Wassertropfen auf einem Lotusblatt.
Ich fühlte mich wie in einer geistigen Zwangsjacke. Es war, als hätte mein Verstand aufgegeben, ohne das mit mir zu diskutieren.
Es war, als wären meine äußeren Schalen abgestorben und hätten mit dem toten Gewebe einen dicken Panzer um mich herum gebildet, in dem ich tief unten drin verborgen hockte und darum kämpfte, nicht ganz und für immer zu verschwinden.
Alles, was in den darauffolgenden Tagen und Wochen folgte, waren lediglich kurzsichtige Reaktionen meines Instinktes, der bei mir offensichtlich auf vollkommene Selbstaufgabe programmiert war.
Ich tingelte zwischen den Kneipen hin und her wie eine Kugel in einem Flipperautomaten, abwechselnd zwischen haltlos und knapp haltlos betrunken.
Nahm Betablocker für meinen Körper, und Faustan mit blauem Würger für meinen Verstand.
Tage und Nächte verschwammen ineinander zu einer grauen, unwirklichen Masse. Zeit war ohne Bedeutung für mich.
Ich strapazierte meine Anwesenheit in den Kneipen auf das Äußerste, bis ich in den meisten keinen Einlass mehr erhielt und das Einzugsgebiet erweitern musste. Meine Heimat, Prenzlauer Berg, wurde nur noch Durchgangsstation für mich.
Wenn ich nicht in einer Kneipe war, schlief ich meinen Rausch aus. Wahlweise in irgendeiner Gasse, bei irgendeiner weiteren verlorenen Seele im Bett oder, wenn ich Glück hatte, bei mir zu Hause.
Ich beobachtete meinen eigenen körperlichen Verfall im Spiegel und konnte nichts dagegen tun.
Es gibt nicht viel, was mir aus diesen Tagen in Erinnerung geblieben ist, aber eines weiß ich noch: Der Name Max Schulte schwebte über mir und allem, was ich tat, wie eine Schmeißfliege über einem Haufen Kuhscheiße. Ich konnte um mich schlagen, wie ich wollte, mich betäuben oder betäuben lassen, nichts nutzte. Bis ich aufgab und akzeptierte, dass er für den Rest meines Lebens an mir kleben würde wie Haare auf nasser Seife.