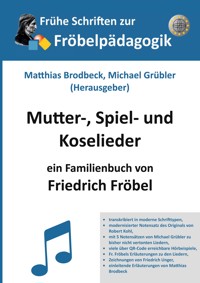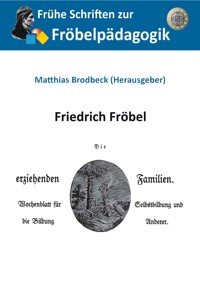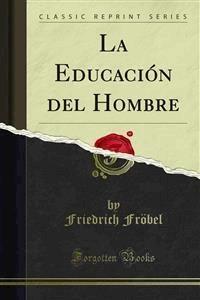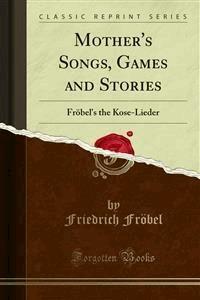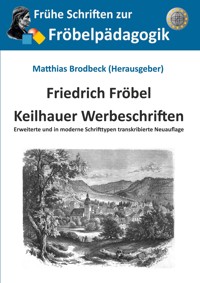
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Friedrich Fröbel neu entdecken - in seiner ganzen Tiefe und Weitsicht Vorliegende Sammlung vereint Friedrich Fröbels sogenannte 'Keilhauer Werbeschriften' (1820 - 1823) sowie in Erweiterung dieser seinen Briefwechsel mit dem Philosophen Karl Christian Friedrich Krause, den Visitationsbericht des Superintendenten Christian Zeh von 1825 und Dokumente zum visionären Helba-Plan. Sie zeigt Fröbel als leidenschaftlichen Erzieher, als philosophisch reflektierten Denker und als gesellschaftlich engagierten Reformer. Besonders aufschlussreich ist Fröbels sphärephilosophisches Gedankengebäude, das in der zweiten Keilhauer Schrift entfaltet wird und bis heute als eines der Fundamente seiner Pädagogik gilt. Krauses kritische Impulse führen Fröbel zu einem humanistischen Verständnis von 'Menschenerziehung', das den nationalen Rahmen sprengt und universelle Gültigkeit beansprucht. Die Texte wurden behutsam orthografisch und typografisch modernisiert, bleiben aber inhaltlich unverändert. Sie richten sich an Studierende, Pädagogen und alle, die Fröbels Werk nicht nur historisch, sondern als zeitloses Bildungsdenken verstehen wollen. Ein Buch für alle, die Bildung als Entfaltung des Menschseins begreifen - und Fröbel als Vordenker einer Pädagogik, die unserer Zeit noch immer voraus zu sein scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abbildung auf der Titelseite: Die Erziehungsanstalt Keilhau auf dem Thüringer Walde. (Die Gartenlaube 1867, Seite 581), gemeinfrei
Dem Andenken
meiner Freunde
Wolfgang Anschütz
Robert Nauer
gewidmet
Euer Fröbel wird nicht vergessen!
FRÜHE SCHRIFTEN ZUR FRÖBELPÄDAGOGIK – DAS HEIßT:
Der Erziehungswissenschaftler Michael Winkler sah sich 2010 zu der bemerkenswerten Feststellung veranlasst, dass Fröbel nicht zeitgemäß sei:
[...] nicht, weil er dem Denken und der Sprache des beginnenden 19. Jahrhunderts verhaftet blieb. [...] vielmehr [...], weil er unserem gegenwärtigen pädagogischen Denken voraus ist, [...] Was er erkannt und verstanden hat, vor allem: wie er versucht hat, für die Komplexität vorrangig der kindlichen [...] Entwicklung [...] eine angemessene theoretische Sprache, zureichende Begriffe und eine sinnvolle Praxis zu entwickeln, das geht kaum zusammen mit dem, was gegenwärtig als Pädagogik diskutiert wird. [....] Da geht es [...] um Steuerung, Messung und Bewertung, um Integration von Bildungslandschaften, um neue Institutionen, [...] um Choreographien des Unterrichts, vor allem jedoch überall um Schule und Instruktionspädagogiken [...]1
Allenthalben ist ein anwachsendes Interesse an Friedrich Fröbel, seinen Ideen und seinem Wirken zu spüren. Dies wurde sicherlich auch von Veröffentlichungen wie Norman Brostermans „Inventing Kindergarten" und Mitchel Resnicks „Lifelong Kindergarten" inspiriert.
Wir haben uns darum entschlossen, im Vorfeld des 175. Todestages Friedrich Fröbels (21.Juni 2027) sowie seines 250. Geburtstages (21.April 2032) den Interessenten von heute den Zugang zu Werken Fröbels, seiner Mitstreiter, Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolger zu erleichtern, indem wir die nur noch schwer erhältlichen und noch dazu nur in Frakturschrift zugänglichen Werke der Fröbelzeit und der ersten Jahrzehnte danach in zeitgemäß rezipierbare Buchform bringen.
Die Transkription aus der Frakturschrift in zeitgemäßen Schriftsatz erfolgte jeweils unter weitestgehender Anpassung an die orthografischen Regeln, die zum Bearbeitungszeitpunkt Gültigkeit hatten. Ausnahmen bilden Archaismen sowie Friedrich Fröbel zuzuschreibende Wortschöpfungen. Der Satzbau blieb unverändert.
Matthias Brodbeck
(Herausgeber)
1 Winkler, Michael: Der politische und sozialpädagogische Fröbel. In: Karl Neumann, Ulf Sauerbrey, Michael Winkler {Hrsg.): Fröbelpädagogik im Kontext der Moderne - Bildung, Erziehung und soziales Handeln - edition Paideia, Jena 2010, S. 28ff.
Inhalt
Vorbetrachtungen des Herausgebers
An unser deutsches Volk (1820)
Durchgreifende, dem deutschen Charakter erschöpfend genügende Erziehung ist das Grund- und Quellbedürfnis des deutschen Volkes (1821)
Grundsätze, Zweck und inneres Leben der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau (1821)
Die allgemeine deutsche Erziehungsanstalt in Keilhau betreffend (1822)
Über deutsche Erziehung überhaupt und über das allgemeine Deutsche der Erziehungsanstalt in Keilhau insbesondere (1822)
Einschließlich:
Karl Christian Friedrich Krause: Einige Bemerkungen zu Fröbels Abhandlung (1823)
Friedrich Fröbel – Brief an Karl Christian Friedrich Krause autobiografischer Brief; Keilhau, 24. Mai / 2. Juni / 17. Juni 1828
Fortgesetzte Nachricht von der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau (1823)
Bericht über die Fröbelsche Erziehungsanstalt zu Keilhau. Superintendent Christian Zeh (1825)
Anzeige der Volkserziehungsanstalt in Helba, unweit Meiningen Gegeben von Friedrich Wilhelm August Fröbel, Vorsteher derselben und der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt. (1829)
Vorbetrachtungen des Herausgebers
Die hier vorgelegte Sammlung vereint Friedrich Fröbels sogenannte „Keilhauer Werbeschriften" (1820-1823), seinen Briefwechsel mit dem Philosophen Karl Christian Friedrich Krause, den Visitationsbericht des Superintendenten Christian Zeh (1825) sowie Dokumente zum sogenannten Helba-Plan (1828/29) – einer visionären, wenn auch letztlich gescheiterten Idee einer Volkserziehungsanstalt. Gemeinsam zeichnen diese Texte ein vielschichtiges Bild eines Pädagogen, dessen Denken nicht nur seiner Zeit voraus war, sondern bis heute erstaunliche Aktualität besitzt.
Die sechs Keilhauer Werbeschriften, die Fröbel zwischen 1820 und 1823 verfasste, tragen die Titel:
An unser deutsches Volk
(1820)
Durchgreifende, dem deutschen Charakter erschöpfend genügende Erziehung ist das Grund- und Quellbedürfnis des deutschen Volkes
(1821)
Grundsätze, Zweck und inneres Leben der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau
(1821)
Die allgemeine deutsche Erziehungsanstalt in Keilhau betreffend
(1822)
Über deutsche Erziehung überhaupt und über das allgemeine Deutsche der Erziehungsanstalt in Keilhau insbesondere
(1822)
Fortgesetzte Nachricht von der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau
(1823)
Diese Texte sind leidenschaftliche Appelle, in denen Fröbel seine pädagogischen Ideen offenlegt und zur Mitwirkung an einer neuen Erziehungsbewegung aufruft. Besonders hervorzuheben ist die zweite Schrift (Durchgreifende ...), in der Fröbel sein sphärephilosophisches Gedankengebäude entfaltet – ein Konzept, das für das Verständnis seiner Pädagogik grundlegend ist.
Jeder dieser Texte wurde vom Herausgeber mit einem eigenen Vorwort versehen, das den historischen und inhaltlichen Kontext erschließt. Diese Vorbetrachtungen sollen besagte Einzeltexte miteinander verbinden, sie in einen größeren Zusammenhang stellen und zugleich den Lesern – Studierenden, pädagogisch Interessierten und auch Fachleuten - eine Orientierung bieten.
Fröbel zwischen Zeitgeist und geistiger Selbstständigkeit
Fröbel war ein Mann seiner Zeit – und zugleich ein Denker, der sich von ihr zu lösen wusste. Seine frühen Schriften zeigen ihn als engagierten Pädagogen, der sich um eine „deutsche Erziehung" bemüht, eingebettet in die kulturellen und politischen Strömungen und Realitäten des frühen 19. Jahrhunderts. Doch der Briefwechsel mit Karl Christian Friedrich Krause offenbart eine bemerkenswerte Wandlung: Fröbel findet zu einem zutiefst humanistischen Verständnis von Bildung, das nicht mehr national, sondern universell gedacht ist. Die „Menschenerziehung" wird zum zentralen Leitmotiv seines pädagogischen Denkens.
Krause kritisierte an dem Text „Über deutsche Erziehung überhaupt und über das allgemeine Deutsche der Erziehungsanstalt in Keilhau insbesondere" (1822) die starke Betonung des Nationalen und plädierte für eine Erziehung, die den Menschen als geistiges Wesen in seiner universellen Würde anerkennt.
Krauses Impulse fielen bei Fröbel – wie sein autobiografischer Brief von 1828, vor allem aber der Titel seines Hauptwerkes belegen - auf bereits bereiteten, fruchtbaren Boden. Fröbel war kein bloßer Empfänger philosophischer Ideen, sondern ein eigenständiger Denker, dessen pädagogische Intuitionen durch die Kommunikation mit Krause eine neue Tiefe erhielten.
Der Helba-Plan – Vision einer Volkserziehungsanstalt
Besondere Aufmerksamkeit verdient der sogenannte Helba-Plan, Fröbels Vision einer umfassenden Volkserziehungsanstalt. Auch wenn dieses Projekt scheiterte, zeigt es doch, wie weit Fröbels Denken reichte: Bildung sollte nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich verankert sein. Im Helba-Plan tauchen erste systematische Überlegungen zur frühkindlichen Erziehung auf-ein Bereich, der heute als Schlüssel zur Bildungsbiografie gilt und in Fröbels Werk eine erstaunliche Tiefe besitzt. Die Idee, Erziehung als gemeinschaftliche Aufgabe zu begreifen, war zu seiner Zeit revolutionär – und ist es in mancher Hinsicht bis heute.
Außensicht und Bestätigung – Der Bericht von Christian Zeh
Der Visitationsbericht des Superintendenten Christian Zeh bietet eine seltene Außensicht auf Fröbels Wirken. Er bestätigt nicht nur die pädagogische Qualität der Einrichtung, sondern stärkt Fröbels hier wiedergegebene Texte durch eine unabhängige Perspektive. Zehs Beobachtungen zeigen, dass Fröbels Ideen nicht nur theoretisch überzeugten, sondern auch praktisch Wirkung entfalteten. Die pädagogische Atmosphäre, die Zeh beschreibt, ist geprägt von Ernst, Klarheit und einem tiefen Vertrauen in die Entwicklungskraft des Kindes. Diese Bestätigung von außen verleiht Fröbels Ansätzen zusätzliche Glaubwürdigkeit.
„Freedom with Guidance" – Fröbels internationale Relevanz
Ein Begriff, der heute weltweit mit Fröbel in Verbindung gebracht wird, ist „Freedom with Guidance"- Freiheit mit Anleitung. Er beschreibt das Spannungsverhältnis zwischen individueller Entfaltung und pädagogischer Begleitung, das Fröbel wie kaum ein anderer zu gestalten wusste. Diese Balance ist nicht nur ein zentrales Element seiner Pädagogik, sondern auch ein Grund dafür, warum gerade in Zeiten weltweit tiefgreifender Transformationsprozesse „reconnecting Froebel" die Forderung ausdrückt, Fröbels bahnbrechende Ideen wieder in unsere Diskussionen und unser praktisches Handeln einzubeziehen.
Fröbel ist einzigartig in seiner Fähigkeit, Freiheit nicht als Beliebigkeit, sondern als verantwortete Selbsttätigkeit zu denken – ein Gedanke, der gerade in Zeiten wachsender Bildungsunsicherheit neue Bedeutung gewinnt.
Zeitlosigkeit als roter Faden
Der Erziehungswissenschaftler Michael Winkler hat 2010 treffend formuliert, Fröbel sei nicht zeitgemäß, weil er unserer Zeit voraus sei.
Diese paradoxe Einschätzung trifft den Kern: Fröbels Ideen wirken oft wie Antworten auf Fragen, die wir heute erst zu stellen beginnen. Die Bedeutung des Spiels, die Rolle der Selbsttätigkeit, die Idee der ganzheitlichen Erziehung-all das sind Konzepte, die in aktuellen Bildungsdebatten wieder an Relevanz gewinnen. Fröbel verstand Bildung nicht als bloße Wissensvermittlung, sondern als Entfaltung des Menschseins – ein Anspruch, der heute wieder neu gedacht werden muss.
Die hier versammelten Texte zeigen, wie Fröbel diese Gedanken nicht nur theoretisch entwickelte, sondern auch praktisch umzusetzen versuchte. Sie sind keine abstrakten Traktate, sondern leidenschaftliche Appelle, Erfahrungsberichte und Reflexionen eines Mannes, der Bildung als Lebensaufgabe verstand. Ihre Sprache mag aus einer anderen Zeit stammen – ihr Anliegen ist es nicht.
Zur Edition und Textgestaltung
Die Texte wurden in ihrer originalen Substanz bewahrt. Die Modernisierung beschränkt sich auf die Schrifttypen und die Orthografie, um heutigen Lesegewohnheiten zu entsprechen, ohne den Charakter der Originale zu verfälschen. Diese editorische Entscheidung folgt dem Grundsatz, Fröbel möglichst unverstellt sprechen zu lassen – nicht als museales Objekt, sondern als lebendigen Gesprächspartner.
Die Vorworte zu den Einzeltexten sollen den Zugang erleichtern. Sie sind bewusst knapp gehalten, um Raum für die eigene Interpretation zu lassen.
Einladung zur Lektüre
Diese Sammlung ist keine bloße Dokumentation, sondern eine Einladung: zur Auseinandersetzung mit einem Denken, das Bildung als Entfaltung des Menschseins versteht. Sie richtet sich an alle, die sich für pädagogische Fragen interessieren – sei es aus wissenschaftlicher, beruflicher oder persönlicher Motivation. Fröbel bietet keine fertigen Antworten, sondern Denkansätze, die zur Weiterentwicklung herausfordern. Wer sich auf seine Texte einlässt, wird nicht nur historische Einsichten gewinnen, sondern auch Impulse für die Gegenwart finden.
In diesem Sinne wünsche ich eine inspirierende Lektüre – und vielleicht auch die Erfahrung, dass Fröbel nicht nur gelesen, sondern verstanden und weitergedacht werden will.
Matthias Brodbeck, 2025
An unser deutsches Volk
(1820)
Vorwort
Dieser Text ist ein Zeugnis tiefster pädagogischer Überzeugung und zugleich ein Aufruf an das deutsche Volk, sich seiner geistigen und sittlichen Verantwortung bewusst zu werden. Entstanden in einer Zeit des Umbruchs und der Neuorientierung, spricht hier eine kleine Gemeinschaft von Menschen, die sich der Erziehung als dem höchsten und heiligsten Werk menschlicher Tuns verschrieben hat.
Was in diesen Zeilen zum Ausdruck kommt, ist nicht bloß ein pädagogisches Programm, sondern ein Lebensentwurf: Die Erziehung des Einzelnen soll zugleich der Erziehung des Volkes dienen. Die Familie, der Stand, das Vaterland und das Volk werden als ineinander verwobene Kreise verstanden, in denen sich das Menschliche entfaltet und in denen Erziehung als verbindende Kraft wirkt.
Die Verfasser sprechen aus der Erfahrung gemeinsamer Arbeit, aus der Tiefe gelebter Überzeugung und aus dem Vertrauen in die göttliche Ordnung, die allem menschlichen Streben Richtung und Sinn verleiht. Ihre Worte sind getragen von einem hohen Ernst, von Liebe zum Menschen und von dem Glauben, dass wahre Bildung nur aus dem lebendigen Wechselverhältnis zwischen Gott und Mensch hervorgehen kann.
Dieses Schriftstück ist kein flüchtiger Gedankengang, sondern ein Fundament. Es ist eine Einladung zur Prüfung, zur Mitwirkung und zur Erneuerung – für jeden, der sich als Teil des deutschen Volkes versteht und bereit ist, an dessen geistiger und sittlicher Hebung mitzuwirken.
Möge dieser Text auch heute noch jene berühren, die in der Erziehung mehr sehen als bloße Wissensvermittlung – nämlich die Gestaltung des Menschen in seiner ganzen Tiefe und Würde.
An unser deutsches Volk
(Friedrich Fröbel, Keilhau 1820)
Aus einem unbekannten Punkt, aus einem kleinen, verborgenen Tal unseres gemeinsamen Vaterlandes redet eine kleine Gesellschaft von Menschen, welche Glieder von nur wenigen Familien, sämtlich Deutsche sind, zu euch.
Sie sind Glieder aller Familienverhältnisse: Sie sind Vater, Mutter, Eltern; sie sind Bruder, Schwester, Geschwister; sie sind Verwandte und Freunde. Vater- und Mutter-, Bruder- und Schwester-Sinn und -Liebe, Liebe zu den Verwandten und Sinn für Verwandtschaft, Freundesherz, Liebe zu den Freunden verknüpfen sie – und verknüpfen sie seit Langem.
In verschiedenen deutschen Landschaften, in drei deutschen Gebirgsregionen wurden sie geboren und erzogen; aber eine Liebe vereinte sie: die Liebe zum Menschen, zur Ausbildung und Darstellung des Menschlichen, der Menschheit im Menschen.
Da diese Liebe echt, lauter und rein war, konnte sie in keinem Streben, in keinem Zweck entsprechender, umfassender und genügender hervortreten, sich gegenseitig betätigen, als im Wirken für gegenseitige Erziehung – in gegenseitiger Erziehung, in gegenseitig vereinter Tätigkeit für diesen Zweck.
Lange schon hatte in allen dieses Bedürfnis, teils in Beziehung auf sich, teils in Beziehung auf die, welche Gott ihnen schenkte und mit welchen Gott sie durch das Blut verband, gelebt.
Seit Langem hatten einige die Bedingungen dazu unter den mannigfachsten, entgegengesetztesten Verhältnissen in sich bearbeitet und sich anzueignen gesucht, bis endlich das gemeinsame Bedürfnis sich lebendig in ihnen allen aussprach und sie aus den verschiedenen Gegenden des Vaterlandes durch eine Liebe, durch Liebe zu einem für gleichen Zweck geeinten Ganzen, zu einer einzigen Familie, zu einer erziehenden Familie in einem kleinen Dorf eines stillen Tales zusammenzog.
So ist nun seit einigen Jahren angewandte Erziehung der Zweck aller unserer Tätigkeit. Was früheres, ja lebenslängliches Nachdenken, Forschen und Vergleichen uns als Wahrheit lehrte, wurde nun der Gegenstand der Anwendung an uns und in unserem Kreis mit ununterbrochenem Nachdenken, Forschen und Vergleichen.
Wir stehen aber nicht allein in der Welt; außerdem, dass wir Glieder verschiedener Familien aus allen bürgerlichen Verhältnissen sind, sind wir auch Glieder eines Volkes – eines großen Volkes. Wir konnten und durften uns also nicht für uns allein, sondern wir mussten – so wie in jeder in sich geschlossenen Familie sich jedes Glied für die Erhaltung, für das Bedürfnis der Familie erzieht und ausbildet – auch uns für unser Volk, für das Bedürfnis, für die Forderungen unseres Volkes erziehen.
Um dies zu können, mussten wir die Bedürfnisse und Forderungen unseres Volkes zur Erkenntnis und Einsicht bringen; wir mussten über alle Bedürfnisse und alle Forderungen unseres Volkes nachdenken und ihre entweder verschiedenen oder gemeinsamen Quellen aufsuchen.
Hier kamen wir von allen Seiten, aus allen Beziehungen, aus allem, was uns äußerlich darüber ausgesprochen wurde, was wir als Forderung an andere hörten und sahen, was uns aus den mannigfaltigen Erscheinungen und Bestrebungen im Volk, mit dem Volk, in den verschiedenen Ständen des Volkes, in den verschiedenen Geschäftskreisen und bürgerlichen Verhältnissen, in dem verschiedenen Alter nur immer bekannt wurde, einstimmig zur Erziehung, zur Volkserziehung durch die Erziehung jedes Einzelnen für seine Familie, für seine Geburt, sein Vaterland, für seine Tätigkeit, sein Tun – als zu dem Grund- und Quellenbedürfnis des deutschen Volkes, in welchem alle Erscheinungen desselben, wie sie auch Form und Namen haben mögen, ihren Grund haben.
Wir fassten daher den Gedanken, für dieses Bedürfnis zu wirken. Wir erkannten es für uns wie für jeden Einzelnen überhaupt als Pflicht, über die Erfüllung dieser Forderung, über die Befriedigung dieses Bedürfnisses mit allem Ernst und unter genauer Beachtung dessen, was uns Forschung und Erfahrung über Erziehung gelehrt haben, nochmals nachzudenken. Und wir fanden bald, dass Familien-, Standes-, Landschafts-, Vaterlands- und Volkserziehung – dass alle Erziehung eine Erziehung, Menschheitserziehung sei, nur in verschiedenen Graden des Umfangs und der Ausbildung; dass alle Erziehung aus einer einzigen Quelle, der Einheit des Geistes, hervorgehe, ein Ziel und einen Zweck – Entwicklung, Ausbildung und Anwendung des Geistes – haben müsse.
Da sich unsere Lehre, unser Unterricht, unsere Erziehung auf das allgemein Menschliche gründet; da alle Lehre, aller Unterricht, alle Erziehung für besondere Zwecke aus ihr – wie verschiedene Zweige nach verschiedenen Seiten hin – hervorwachsen; da wir überhaupt in allem von der Entwicklung und Ausbildung des allgemein Menschlichen zu dem Besonderen und Besondersten herabsteigen: so erkannten wir, dass diese Erziehungsweise, der Erziehungsgang, den wir gehen, jeder Familie, jeder Landschaft, dem ganzen Vaterland, dem ganzen Volk und allen Gliedern desselben angemessen sei und sein müsse.
Wir legen, da ja jeder gut erzogen werden soll, unsere Erziehung – ihren Grundsätzen, ihrem Wirken und Leben nach – dem ganzen Volk, jedem Glied des Volkes, welches mit uns erkennt, dass der Einzelne und das Ganze Bedürfnisse und Forderungen haben, zur Prüfung vor, damit es selbst entscheide: ob eine durchgreifende, auf die Forderungen und Bedürfnisse des Lebens und der Zeit gegründete Erziehung allen Forderungen, allen Bedürfnissen des Volkes entspreche, sich in ihnen auflöse; ob ihre Darstellung und Ausführung gleichsam die Quelle der Mittel zur Befriedigung aller sich aussprechenden Bedürfnisse und Forderungen des Volkes als eines Ganzen und jedes Einzelnen – in Beziehung auf sich allein und als Glied dieses Ganzen – erfassend in sich schließe.
Wir gründen unsere Erziehung auf die einfachste, von allen Menschen gemachte, von jedem Menschen in jedem Augenblick wiederholt zu prüfende Erfahrung und Erkenntnis: dass kein Ding in der Natur – also auch der Mensch, als Teil der Natur und in ihr lebend – sich sein Dasein selbst gegeben hat; dass vielmehr alle Dinge der Natur – also auch die Menschen – ihren Grund in einem letzten, allumfassenden Einen – Gott – haben. Und wir bemerken (wie jeder, der auf sein tägliches Leben aufmerksam ist, jeder Lebende und Sprechende bemerken kann, und wie – so wie uns scheint-jeder Mensch diese Erfahrung machen muss), dass wir, so wenig wir uns unser Leben und Dasein gegeben haben, ebenso wenig durch unsere eigene Macht, sondern durch den Gebrauch und die Kraft der Mittel, die Gott in uns durch eine Seele, einen Geist, ein Gemüt gelegt hat, und durch die nach den Forderungen des Geistes gebrauchten Kräfte der uns umgebenden Naturwesen unser Dasein forterhalten.
Wir gehen von der ganz einfachen Beobachtung aus, die jeder Mensch, der wahrhaft auf sich und sein Leben und auf das Leben und Wirken aller ihn Umgebenden achtet, gemacht hat und täglich und stündlich wiederholen kann: dass wir nur durch, nur aus Gott unser Leben haben, nur in Gott und durch Gott leben, weben und sind – und dass so auch alle Dinge nur aus Gott sind und nur in Gott Leben und Fortbestehen haben.
Auf diese ganz einfache Erfahrung – „Gott ist unser Vater" – die sich uns durch unser ganzes Leben bis ins reife Mannesalter bestätigt hat, gründet sich all unser Handeln, all unser Wirken.
Denn wir sehen dadurch, dass sich eine genaue Wechselwirkung, Wechselbeziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und den Geschöpfen während der ganzen Dauer der Geschöpfe, während der ganzen Dauer der Menschen hindurch erhält-und dass das recht vollkommene Bestehen, die recht vollkommene Dauer jedes Dinges vom rechten Leben in diesem immer fortbestehenden Wechselverhältnis zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und Geschöpfen abhängt.
Wir gehen nun weiter und sagen: Weil das Wechselverhältnis zwischen Gott und Menschen für den Menschen so wesentlich ist, so ist es für das Bestehen des Einzelnen, des Geschöpfes, des Menschen höchst wichtig, dass er jenes Verhältnis nicht störe, nicht verletze, wohl gar unterbreche und aufhebe.
Und nun sagen wir uns: Weil man nur das schonen und pflegen kann, was man kennt, so ist es für den Menschen höchst wichtig und wesentlich, jenes Verhältnis genau zu kennen – genau die Kräfte des menschlichen Geistes, ihren Gebrauch und ihre Anwendung, genau die Kraft der übrigen Natur und ihren Gebrauch, ihre Anwendung zu kennen. So ist es höchst wichtig, dass der Mensch seinen Körper zum Gebrauch für die Kräfte seines Geistes und zum Aneignen und Gebrauch der übrigen Kräfte der Naturkörper entwickele und ausbilde.
Ausbildung des Geistes und Körpers des Menschen – eine gründliche, für die verschiedenen Zwecke des Menschenlebens genügende Ausbildung des Geistes und Körpers des Menschen: Lehre, Unterricht, mit einem Wort – Erziehung ist es also, was der Mensch bedarf. Aber eine solche Erziehung, die sich auf das tätige Wechselverhältnis zwischen Gott und Menschen gründet und daraus als eine Notwendigkeit gleichsam hervorgewachsen ist.
Dieses tätige Wechselverhältnis zwischen Gott und Menschen, dessen er sich von Kindesbeinen an bewusst ist, ist dasjenige, was von jeher Religion genannt wird. Also: Eine auf lebendige Religion sich gründende, gleichsam durch sie hervorgerufene, aus ihr hervorgewachsene Erziehung ist es, welche wir als das Bedürfnis und die Forderung für uns alle, für alle Glieder unseres Volkes, für jeden Einzelnen wie für das Ganze erkennen.
Wenn wir diesem Bedürfnis, dieser Forderung recht durchgreifend Genüge leisten – und je länger, je vollständiger wir ihr Genüge leisten – umso mehr sehen und erkennen wir, wie väterlich Gott durch Gaben seines Geistes, durch die Anlagen des Körpers, welche er in den Menschen gelegt hat, durch die mannigfaltigen Kräfte und Eigenschaften, welche er in die uns umgebenden Dinge gepflanzt hat, für uns gesorgt hat. Wir erkennen – je länger, je mehr wir nach den Forderungen der Religion uns und andere erziehen und denselben getreu leben – dass Gott unser Vater ist.
Wir erkennen, wenn wir dieses unser Bewusstsein und unsere Überzeugung mit jenem vergleichen, was darüber ausgesprochen worden ist von dem, welcher Gott zuerst als Vater der Menschen erkannte, dass alles, was er sagt, sich vollkommen treu und wahr in einem tätigen und zugleich aufmerksam beachteten Leben bestätigt; dass seine Lehre, seine Aussprüche, seine Forderungen wirklich dem väterlichen Verhältnis Gottes zu den Menschen und dem kindlichen Verhältnis der Menschen zu Gott genügend entsprechen; dass er es ausschließlich ist, der dieses Verhältnis unter allen Menschen zuerst erkannt und demselben so vollkommen im Leben nachgelebt hat, wie kein späterer Mensch es getan hat und tun wird; dass Jesus sich in seiner Lehre, in seinem Leben – obgleich als Mensch geboren – doch als wahrhafter Gottessohn betätigt und bewiesen und sich von der Zeit seines Lebens bis in unser aller Leben herauf bewährt, bezeugt und bestätigt hat.
Wir sehen so, wir erfahren im eigenen Leben und durch dasselbe – durch das ruhige Beachten der Forderungen und Bedürfnisse desselben und durch das Bestreben, durch Arbeitsamkeit und Nachdenken den Forderungen zu genügen -, dass die Religion Jesu, die christliche Religion, es ist, auf welche sich eine genügende Menschenerziehung, auf welche sich unsere Erziehung gründen, auf welche sie sich stützen und aus welcher sie hervorgehen muss.
Die Religion Jesu, die christliche Religion, lehrt uns: Alle Dinge sind aus Gott hervorgegangen; alle Dinge hat Gott geschaffen. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, Gott ist der Erzeuger, der Vater der Menschen – die Menschen sind Gottes Kinder. Jedes Ding trägt aber in sich notwendig die Eigenschaften dessen, der es erzeugt hat. Das Kind trägt das Wesen, den Geist und die Eigenschaften der Eltern, des Vaters, an sich; also tragen die Menschen – Gottes Kinder – auch das Wesen ihres Schöpfers, ihres Vaters, an sich. Und so trägt der Mensch göttliches Wesen an sich, so ist der Mensch göttlichen Wesens.
Jedes Ding kann aber nur entwickeln, darstellen, ausbilden, was es in sich trägt. Und dieses Darstellen, diese Entwicklung erkennen wir als jedes Dinges einzige und ausschließliche Bestimmung. Dass also auch der Mensch nur die vom Schöpfer in ihn gelegte Natur, das in ihn gepflanzte göttliche Wesen, seine göttliche Natur entwickeln könne und solle, erkennen wir als des Menschen einzige und ausschließliche Bestimmung.
Das Samenkorn, der Kern, welcher aus seinem einfachen Wesen eine fast unzählige Menge von einzelnen Teilen und Gliedern – Stamm, Äste, Zweige, Blätter, Blüten und zuletzt wieder Früchte, Kerne – aus sich entfaltet; das einfache Ei, das aus sich ein Tier mit fast unzähligen Gliedern, Teilen und Mannigfaltigkeiten entwickelt, die alle untereinander und mit der Einheit in Übereinstimmung stehen, welche in ihrer Gesamtheit das Wesen der Einheit darstellen – ein Gesamtbild derselben, die Einheit in der Mannigfaltigkeit; der Vater, welcher die Vielseitigkeit seines einigen und einzigen Charakters in der Mannigfaltigkeit seiner Kinder sieht und erkennt und sich so gleichsam nach der Vielseitigkeit und doch Einfachheit seines Charakters vervielfältigt schaut; der einfache menschliche Geist, welcher eine große Mannigfaltigkeit von Gedanken bildet; das einfache Gemüt, aus welchem eine große Mannigfaltigkeit von Empfindungen hervorgeht, die alle den Grundcharakter der Einheit, das Grundwesen der Einheit vereinzelt in sich tragen – diese lehren und überzeugen uns, alles was uns umgibt, lehrt und überzeugt uns, dass das Grundgesetz aller Entwicklung sei: die Einheit an einer Mannigfaltigkeit von Einzelheiten, wovon jede das Wesen der Einheit in sich trage, hervortreten zu lassen.
Wir sehen und erkennen nun ferner, wenn wir uns selbst und jedes Ding um uns her aufmerksam betrachten (was auch jeder andere, wer er auch sei, an sich selbst und an den Dingen um sich her beachten und erkennen kann), dass der Mensch und jedes Ding sein Wesen, die in ihm liegende Mannigfaltigkeit in sich selbst, innerhalb der Grenze seiner selbst entwickeln und ausbilden kann, ohne es aus sich aus den Grenzen seiner selbst heraustreten zu lassen. Alle Entwicklung und Ausbildung bleibt hier innerhalb der Einheit des Gegenstandes, im Gegenstände selbst beschlossen.
Oder wir sehen: Der Mensch und jedes Ding kann die in ihm liegende Mannigfaltigkeit an einem einzelnen Ding außer sich und uneingeschränkt darstellen und ausbilden. Wir sehen und erkennen also (ein jeder, der sich und anderes aufmerksam beobachtet, kann es sehen und bemerken), wie der Mensch und jedes Ding es versucht, sein ganzes Wesen, alle Mannigfaltigkeit, die in seinem Wesen liegt, außer sich an einem Gegenstand, einer Einzelheit und durch einen Gegenstand, durch eine Einzelheit darzustellen.
Wir sehen und erkennen schließlich und zuletzt an uns und allem anderen um uns her (und jeder, der sich und andere um sich her beobachtet, kann es erkennen und bemerken): Der Mensch und jedes Ding kann sein Wesen, die Mannigfaltigkeit seines Wesens, in einer fortlaufenden und durch eine unbegrenzte Mannigfaltigkeit von Gegenständen außer sich darstellen.
So finden und erkennen wir (und jeder, der sich und anderes beobachtet, kann es finden und erkennen), dass der Mensch und jedes Ding sein einiges Wesen, die Mannigfaltigkeit seines einigen unzertrennten Wesens, auf eine dreifache Weise darstellt:
entweder in sich selbst, innerhalb der Grenzen seiner selbst,
oder an einer und durch eine Einzelheit außer sich,
oder an und durch eine unzählige, fortlaufende Mannigfaltigkeit von Gegenständen oder Dingen außer sich.
In dieser dreifachen Darstellung seines einigen Wesens finden wir nun die Darstellung der Mannigfaltigkeit, der Entwicklung der Mannigfaltigkeit jedes Wesens vollkommen und vollendet beschlossen. Anschauungen dafür geben wieder das Samenkorn, der menschliche Geist, der Vater und seine Kinder.
So kann das Samenkorn sich ausbilden in seiner Einheit innerhalb der Grenzen seines Wesens zu einer vollkommenen Pflanze. Es kann auch ganz und vollständig vollendet hervortreten in der Einzelheit, in einem einzigen Samenkorn, zu dem es sich wieder bildet, und ganz vollständig, aber ins Unbegrenzte fortgehend, in und an einer Mannigfaltigkeit von Samenkörnern, die es aus sich entwickelt. Ebenso kann der Vater sein Wesen, seinen Charakter vollkommen in sich, in der Einheit seiner Person darstellen und ausbilden. Der Charakter und das Wesen des Vaters tritt aber auch in einer Einzelheit – so vollkommen es nur immer möglich ist – in dem Sohn, welcher vorzüglich das Abbild des Vaters ist, hervor und bildet sich in demselben aus; aber am vollkommensten schaut der Vater die Vielseitigkeit seines Geistes und Wesens in der Gesamtheit seiner Söhne.
Wohl kann auch so der Geist sein Wesen in sich selbst, in seiner Einheit ausbilden; allein er wird streben, an einer Einzelheit – sei es ein Gedanke oder ein Werk – darzustellen; er wird streben, in dieser Einzelheit gleichsam den Gedanken, die Grundempfindung seines Wesens, das ganze Wesen seines Geistes auszudrücken und darzustellen. Doch erst in und durch die Entwicklung und Darstellung einer ununterbrochenen, fortlaufenden Reihe von Mannigfaltigkeiten der Gedanken und Empfindungen wird es ihm gelingen, sein Wesen vollkommen darzustellen. Und so wird er – wie jedes Ding – erkennen, dass erst durch diese dreifache Darstellung der Einheit seines Wesens die Darstellung seines Selbst beschlossen sei.
Dieses Gesetz der Entwicklung – der Einheit zur Mannigfaltigkeit oder der Mannigfaltigkeit aus der Einheit, in, durch eine und an einer Einheit, Einzelheit und Mannigfaltigkeit – erkennen wir auch als Grundgesetz aller menschlichen Entwicklung und Ausbildung.
Der Mensch soll also in aller Mannigfaltigkeit, Einzelheit seines Denkens und Tuns das Wesen seiner Einheit, sein göttliches Wesen in dieser dreifachen Weise (Einheit, Einzelheit und Mannigfaltigkeit) darstellen.
Der Mensch kann aber, wenn er dieser Forderung gemäß sich ausbildet und dabei sich selbst ruhig und still beachtet, sein Wesen in und außer sich wahrnehmen; er kann sich vernehmen und seiner selbst sich bewusst werden.
Wir sehen und erkennen also: Der Mensch ist zum Vernehmen, zur Vernunft, zum Bewusstwerden und endlich zum Bewusstsein des Entwicklungsganges seines Wesens und so zum Bewusstsein seines ganzen Wesens bestimmt.
Der Mensch ist bestimmt, mit Bewusstsein und Vernunft sein Wesen zu entwickeln, auszubilden und darzustellen.
Entwickeln kann sich jedes Wesen nur durch Tätigkeit, Tun, Arbeiten; vernehmen, bewusst werden kann sich ein Wesen nur durch Bemerken, Kennen, Erkennen, Berichtigen, Vergleichen seiner Tätigkeit, und nur bewusst durch Bewusstsein kann sich ein Wesen vernehmen; vernehmend, vernünftig kann aber nur ein Wesen – und so besonders der Mensch – nur durch Tun, Arbeiten und Denken werden.
So entwickelt sich uns des Menschen Bestimmung vor unseren Blicken immer klarer und bestimmter: dass der Mensch zum Bewusstwerden, zur Vernunft seines Wesens durch Tun und Denken, Darstellen und Erkennen nach dem Grundgesetz aller Entwicklung – der Entwicklung der Einheit zur Mannigfaltigkeit oder der Mannigfaltigkeit aus der Einheit durch und in der dreifachen Darstellung des einen, einigen Wesens in der Einheit, Einzelheit und Mannigfaltigkeit – kommen soll.
Dies ist uns das Grundgesetz aller menschlichen Erziehung, ist uns ausschließlich das Grundgesetz unserer Erziehung, wie wir sie an uns selbst und an unseren Pfleglingen, Zöglingen auszuführen und darzustellen streben – die Grundlage der Erziehung, welche wir seit vielen Jahren prüfend anwenden.
Ebenso ist es uns das Grundgesetz aller Entwicklung, die Grundform, nach welcher wir jedes, was als Lehrgegenstand von uns erkannt wird, behandeln – wodurch eben, weil dies ganz mit der Natur jedes Unterrichtsgegenstandes in Übereinstimmung ist, die Lehrgegenstände unter sich selbst wieder mit einer sich gegenseitig erklärenden Eintracht und Einklang hervortreten.
Und dieses Gesetz, die Anwendung dieses Gesetzes, ist es auch, wodurch es uns möglich wird, jeden Zögling selbst, jeden Pflegling seiner Eigenart ganz gemäß zu leiten und dieser getreu ihn zu entwickeln und auszubilden.
Auf diese Weise seiner Natur entsprechend zu dem, wozu Gott, Natur und das Leben ihn bestimmten, entwickelt, gekräftigt und ausgebildet, kann der Zögling aus der Fremderziehung heraus in den Beruf treten, den er als den seinen erkannt hat.
Und wir sehen, wir sind überzeugt und finden an uns und unseren Zöglingen bestätigt, dass der so erzogene Mensch seine Familienpflichten, seine Stammes-und Geschlechtspflichten, seine Bürger-, Volks- und Staatspflichten auf das Vollkommenste erfüllen kann und erfüllt. Denn er kommt so zum vollendetsten Bewusstsein seiner selbst, seines Seins und seines Könnens, seiner Bestimmung und der Mittel zur vollkommensten Erfüllung derselben – und so auch zum vollendetsten Bewusstsein aller Dinge um sich her, ihres Zwecks und ihrer Bestimmung. Daher auch zur vollkommensten Einsicht seiner Selbstpflichten, seiner Familien-, Geschlechts- und Stammespflichten, seiner Bürger-, Volks- und Staatspflichten – so zur vollendetsten Einsicht zunächst der gegenwärtigen Forderungen und Bedürfnisse seiner selbst, seiner Familie, seines Geschlechts, seines Volkes und Staates und des Grundes und der Bedeutung derselben.
Denn der so erzogene Mensch, schaut er um sich, sieht, dass alle Forderungen des Einzelnen als Einzelnen, dass alles das, was dem Einzelnen als Bedürfnisse und Pflichten erscheint, in Folgendem besteht: in Sicherstellung seiner selbst unter allen äußerlichen Verhältnissen und Wechseln – und daher in Geltendmachung seiner selbst, seines Wertes, seiner Wirksamkeit. Deshalb: Streben nach Darstellung seiner selbst, seines Wertes, seiner Wirksamkeit, seines Seins; in Anerkennung seiner selbst, seines Wertes, seiner Wirksamkeit, seines Seins.
Jeder strebt also nach Hervorhebung, Emporhebung seiner selbst, nach Hervorhaltung seiner selbst. Dies kann aber nur durch Geltendmachung von Vorzügen geschehen.
Jeder sucht sich daher Vorzüge vor den anderen zu erringen, Vorzüge vor den anderen anzueignen. Diese können und werden natürlich nur nach dem Maße dessen gemacht werden, was als „vorzüglich" genannt wird.
Ist es Ehre, wird Ehre gesucht und erstrebt werden; ist es Reichtum, Bequemlichkeit, Herrschaft, Freiheit – so wird sich jeder diese vor den anderen zu verschaffen suchen.
Weil aber alles Aneignen nur an Bedingungen gebunden ist – folglich auch die Aneignung der genannten Güter –, so sieht der so erzogene Mensch, wie jeder Einzelne sich den Besitz der Bedingungen zu verschaffen, sich dieselben anzueignen sucht, an welche jene Güter wirklich geknüpft sind oder an welche er sie wenigstens geknüpft meint.
Die Bedingungen aber, von welchen der Besitz eines Gutes abhängt, sind wieder zweifacher Art: Entweder führt ihre Erhaltung geradezu und unmittelbar zu dem Besitz des gewünschten Gutes – oder nur mittelbar.
Diejenigen Bedingungen, welche mittelbar zum Besitz, zur Erringung des gesuchten Gutes führen, sind zwar leichter anzueignen; allein der Erfolg ist doch immer in gewisser Hinsicht unsicher. Daher sieht er, wie sich jeder dasjenige anzueignen sucht und strebt, was er als Unmittelbares, was er geradezu als Mittel, als Bedingung erkennt, um sich unzweifelhaft diejenigen Güter zu verschaffen, welche ihm die wünschenswertesten sind.
Er sieht und erkennt, dass jeder – wer es auch sei, der Niedrigste wie der Höchste -diese unmittelbaren, unzweifelhaften Mittel in Belehrung, in Unterricht, kurz: in Bildung – so verschieden, in so verschiedenen Worten und Weisen er sich und anderen es auch aussprechen mag – findet und setzt.
Er sieht und hört als unwiderlegbar, dass jeder Einzelne als Einzelner nach Erziehung und Bildung strebt, soweit er sie selbst nur immer erkennt. Denn jeder sieht ein, dass er nur hierdurch zur Erkenntnis und Aneignung der Mittel gelangt, wodurch er sein Bestehen und seine Selbstständigkeit, sein freies, selbstständiges Bestehen sichern kann.
Er findet also: Die Forderung und das Bedürfnis jedes Einzelnen ist Lehre und Unterricht – Lehre und Unterricht geeint: Erziehung.
Er muss sehen, er kann nicht anders, dass auch alles und alles, was der Einzelne nur immer fordert (was und wie er sich darüber auch ausspreche und auf welchem Wege und durch welche Mittel er dafür handeln möge), zuletzt auf Erziehung seiner selbst hinausläuft und darin zusammentrifft – dass Erkennen und Darstellen, Wissen und Können auf seiner Stufe der Einsicht in ihm im Gleichgewicht stehen.
Da aber der Einzelne auch an sich wieder Forderungen gemacht sieht, da er als Einzelner wieder Forderungen an andere macht und machen muss, so fordert er Belehrung über seine Pflichten und Befähigung, seinen Pflichten gemäß und getreu handeln und wirken zu können; er fordert Befestigung und Befähigung seiner selbst, diesen mancherlei Pflichten stets Genüge leisten zu können.
Wenn der so erzogene Mensch nun all das Genannte – was jeder, auch in den mannigfaltigsten Formen, in Sicherstellung, in Geltendmachung, Anerkennung seiner selbst usw. zu erlangen, zu erreichen strebt – in seiner letzten Einheit anzuschauen und aufzufassen sucht, so ist es: Zutrauen.
Die Quellforderung, das Quellbedürfnis, aus welchem alles Übrige hervorfließt, ist Zutrauen – Zutrauen zu sich, Zutrauen zu anderen und Zutrauen anderer zu ihm. Er findet und erkennt, dass dieses dreifache Zutrauen, wonach jeder Einzelne als Einzelstehender strebt, jeder dadurch erringt, wenn er
Erstlich sich selbst, sein Wesen, seine Bestimmung so vollkommen wie möglich erkennt und sich selbst dieser Erkenntnis gemäß auszubilden strebt, sie an und in sich darzustellen sucht;
Zweitens sich selbst, seine Bestimmung, seinen Beruf so vollkommen wie möglich an und durch ein Einzelnes außer sich darzustellen und in demselben wieder zu erkennen und anzuschauen sucht;
Drittens sich selbst, seine Bestimmung, seinen Beruf so vollkommen wie möglich an und durch und in jedem Einzelnen, allem Einzelnen, was er schafft und tut, darzustellen und anzuschauen sucht – wenn er sich selbst, seine Bestimmung, seinen Beruf so vollkommen, so vollendet wie möglich in allem, was ihn äußerlich nur immer umgibt, zu erkennen und anzuschauen sucht.
Ja, und durch diese dreifache Erkenntnis, Anschauung und Darstellung seiner selbst findet und erkennt er das dreifache Zutrauen, wonach jeder strebt, unwandelbar begründet und vollendet erreicht.
Denn überall tritt ihm die Einheit und Einigkeit seines Wesens entgegen. Die dreifache Erkenntnis, die dreifache Anschauung, die dreifache Darstellung seiner selbst in, an und durch die Einheit, Einzelheit und Mannigfaltigkeit zeigt ihm immer nur die Einheit und Einigkeit seines Wesens.
Und so erkennt der so erzogene Mensch hierin alles Streben, Fordern und Bedürfen des Einzelnen als solchen beschlossen und abgeschlossen, vollendet.
Wie er sieht und findet, dass der Einzelne als Einzelner seine bestimmten Bedürfnisse und Forderungen hat, so sieht und findet er, dass auch Gesamtheiten als solche ihre bestimmten Forderungen haben.
Er findet und erkennt: Die Familie als solche fordert und bedarf
erstens (als Einzelnes betrachtet) alles dasjenige, was der Einzelne, das Einzelne fordert und bedarf – Bestehen, zu diesem Zweck Unterhalt, Haus, Hof etc. und alles das, was er und wie er es als Forderungen des Einzelnen erkennt.
Weiter fordert und bedarf aber eine Familie als eine Gesamtheit, als eine geeinte Mehrheit, dass
zweitens jeder, jedes Glied, jeder Teil der Familie
als solcher streng und treu seinen Pflichten nachlebe, dieselben erfülle, ihnen gehorsam sei. Die Familie fordert also
drittens von jedem Einzelnen ihrer Glieder Erkenntnis und Anerkennung seiner Pflichten und Aneignung der Mittel und der Kraft, ihnen nachleben, ihnen gehorsam sein zu können. Also forciert und bedarf auch die Familie als solche
viertens Lehre und Unterricht – Erziehung für jedes einzelne ihrer Glieder; die Familie fordert wieder innerhalb der Grenze ihrer selbst
fünftens als der Quelle, woraus alle ihre Forderungen und Bedürfnisse hervorgehen, worin sie aber auch alle zurückfließen und sich so selbst lösen – Zutrauen, höchstes, vollendetes, dreifaches Zutrauen.
Der Vater, die Mutter, die Eltern sollen dem Kind, dem Sohn, der Tochter trauen - als ihrem Kind, darum weil es ihr Kind, ihr Sohn, ihre Tochter ist.
Das Kind, der Sohn, die Tochter soll Zutrauen zu diesem Vater, dieser Mutter, diesen Eltern haben; denn es sind seine Eltern, deren gegenseitiger Liebe es sein Dasein verdankt.
Die Kinder, der Sohn, die Tochter sollen Zutrauen zueinander haben; denn sie sind Bruder, Schwester, Geschwister, sind alle Kinder dieses Vaters, dieser Mutter, dieser Eltern, verdanken der einen ungeteilten, treuen gegenseitigen Liebe und Sorgfalt ihr Dasein.
Dreifach findet und erkennt jeder Einzelne wieder das eine ungeteilte Zutrauen, das in Vater und Mutter lebte und beide zu Eltern verband. Jeder Einzelne sieht und findet es leben in sich – im Zutrauen zu sich selbst, im Zutrauen zu jedem Einzelnen und in seinem Zutrauen zum Ganzen und des Ganzen zu ihm, dem Einzelnen.
Somit sieht er wieder die Gesamtbedürfnisse und Forderungen der Familie als solche in dem dreifachen einigen Zutrauen und in der Darstellung desselben beschlossen.
Der so erzogene Mensch findet und erkennt: Das Geschlecht, der Stamm als solcher fordert
erstens (als Einzelnes betrachtet) alles dasjenige, was der Einzelne, das Einzelne als Einzelner, als Einzelnes bedarf – er fordert Bestehen als Einzelnes etc.
zweitens (als eine Gesamtheit betrachtet) fordert er wieder alles dasjenige, was die Familie als solche fordert und bedarf – er fordert Bestehen als Gesamtheit etc. Weiter bedarf aber ein Stamm, ein Geschlecht, als doppelt zusammengesetztes Ganzes, als ein schon aus Familien zusammengesetztes Ganzes
drittens Festhaltung des geistigen Bandes aller, Festhalten des Geschlechts- und Stammcharakters.
Aber festgehalten kann nicht werden, was nicht erkannt, was nicht geliebt wird; folglich fordert er Erkenntnis, Anerkennung und Aneignung desselben – also Lehre, Unterricht – Erziehung für denselben.
Als die Quelle aber schließlich, woraus alle Bedürfnisse und Forderungen des Stammes hervorgehen, worin sie alle wieder zurückfließen und worin sie sich auflösen, bedarf und fordert der Stamm
viertens Zutrauen: Zutrauen des Einzelnen zu sich selbst zur Darstellung und Festhaltung des als seiner würdig erkannten geschlechtlichen Charakters; Zutrauen zu jedem Einzelnen, dass jeder Einzelne, soweit es an ihm liegt, den gemeinschaftlichen Geschlechtscharakter entwickle und darstelle; Zutrauen zu dem ganzen Geschlecht und Stamm, dass derselbe die Vielgestaltigkeit seines Charakters in sich darstelle.
Er sieht hier wieder, dass die Forderungen und Bedürfnisse des Geschlechts, des Stammes, in dem dreifachen Zutrauen und dessen Darstellung beschlossen sind.