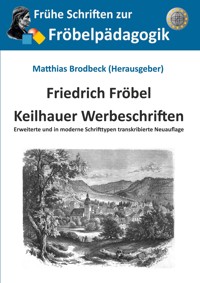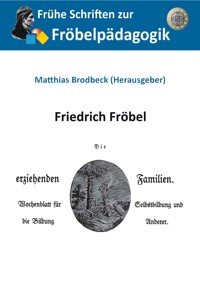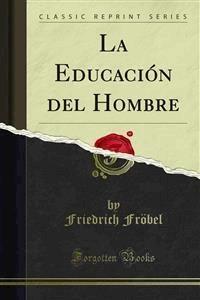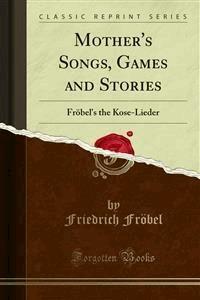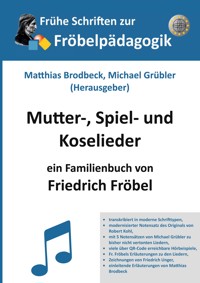
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
1841 begann Friedrich Fröbel mit einem neuen Projekt. Ihm war klar geworden, dass er auch für die kindliche Entwicklungsphase vor dem ersten Spielen mit dem Ball etwas schaffen müsse: Die 7 Mutter- und Koselieder und 50 Spiellieder wurden von Fröbel 1844, vier Jahre nach der Kindergartengründung, herausgegeben. Sie entstanden aufgrund der Erkenntnis, dass vor dem Einsetzen des Spieles mit der ersten Spielgabe, dem Ball, bereits wesentliche Entwicklungen erfolgen. Die Mutter- und Koselieder sollte dem Kind zugewandt gesungen werden. Die Spiellieder inspirieren und begleiten das sensumotorische Spiel des Kleinkindes mit den Gliedern seines Körpers und Gegenständen der Umwelt. Diese Lieder sollen begleitend zum Spielen und Tun des Kindes gesungen werden und das Kind zum Nachahmen von Bewegungen anregen. Manche Lieder erscheinen heute zum Teil als sehr schwärmerisch und romantisch, was die Frage aufwirft, ob sie noch zeitgemäß sind. Zeitgemäß, ja eigentlich zeitlos, ist die Notwendigkeit der intensiven, liebevollen Zuwendung zum Kind auch und gerade in den ersten Lebensmonaten. Die Stimmen der Eltern, der Körper- und Blickkontakt sind wesentliche Voraussetzungen für gelingende Bindungsentwicklung. In den 7 Mutter- und Koseliedern und in den erläuternden Texten Fröbels tritt dies deutlich hervor. Wer das Lied vom 'Taubenhaus' aus seiner eigenen Kindergartenzeit kennt, wird es vielleicht nicht als ein 'Arme, Hände und Finger übendes Spiel' (so Fröbels Untertitel) kennengelernt haben. Es gehört zu den Fröbelschen Liedern, die noch heute weit verbreitet gesungen und gespielt werden. Das vorliegende Buch enthält die Erläuterungen Fröbels für das sensumotorische Spiel des kleinen Kindes. Relativ breite Anwendung findet heute in diesem Zusammenhang auch das Lied vom 'Turmhähnchen' als, wie von Fröbel beschrieben, 'Handgelenk und Ellenbogenbewegungen übendes Spiel'. Aber auch dieses Lied führt weiter. Es lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Kraft des Windes und vielleicht darauf fußend auf andere Naturkräfte. Viele der anderen Spiellieder haben auch entsprechende (vielleicht heute neu zu entdeckende) Potenzen, die dem Kinde als Impuls für spielerisches Erfahren und damit Lernen dienen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit Randzeichnungen, erklärendem Texte und Singweisen.
Blankenburg bei Rudolstadt, 1844
die Anstalt zur Pflege des Beschäftigungstriebes der Kindheit und Jugend.
Transkription, Neuaufbau und Einführung
Matthias Brodbeck
Notensatz und Realisation von 5 neuen Liedern
Michael Grübler
Bad Liebenstein und Königsee, 2025
FRÜHE SCHRIFTEN ZUR FRÖBELPÄDAGOGIK–DAS HEIßT:
Der Erziehungswissenschaftler Michael Winkler sah sich 2010 zu der bemerkens-werten Feststellung veranlasst, dass Fröbel nicht zeitgemäß sei:
[...] nicht, weil er dem Denken und der Sprache des beginnenden 19. Jahrhunderts verhaftet blieb. [...] vielmehr [...], weil er unserem gegenwärtigen pädagogischen Denken voraus ist, [...] Was er erkannt und verstanden hat, vor allem: wie er versucht hat, für die Komplexität vorrangig der kindlichen [...] Entwicklung [...] eine angemessene theoretische Sprache, zureichende Begriffe und eine sinnvolle Praxis zu entwickeln, das geht kaum zusammen mit dem, was gegenwärtig als Pädagogik diskutiert wird. [....] Da geht es [...] um Steuerung, Messung und Bewertung, um Integration von Bildungslandschaften, um neue Institutionen, [...] um Choreographien des Unterrichts, vor allem jedoch überall um Schule und Instruktionspädagogiken [...]1
Allenthalben ist ein anwachsendes Interesse an Friedrich Fröbel, seinen Ideen und seinem Wirken zu spüren. Dies wurde sicherlich auch von Veröffentlichungen wie Norman Brostermans „Inventing Kindergarten" und Mitchel Resnicks „Lifelong Kindergarten" inspiriert.
Wir haben uns darum entschlossen, im Vorfeld des 175. Todestages Friedrich Fröbels (21.Juni 2027) sowie seines 250. Geburtstages (21.April 2032) den Interessenten von heute den Zugang zu Werken Fröbels, seiner Mitstreiter, Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfolger zu erleichtern, indem wir die nur noch schwer erhältlichen und noch dazu nur in Frakturschrift zugänglichen Werke der Fröbelzeit und der ersten Jahrzehnte danach in zeitgemäß rezipierbare Buchform bringen.
Die Transkription aus der Frakturschrift in zeitgemäßen Schriftsatz erfolgte im Fließtext unter weitestgehender Anpassung an die orthografischen Regeln, die zum Bearbeitungszeitpunkt Gültigkeit hatten. Ausnahmen bilden Archaismen sowie Friedrich Fröbel zuzuschreibende Wortschöpfungen. Der Satzbau blieb unverändert.
Matthias Brodbeck
1 Winkler, Michael: Der politische und sozialpädagogische Fröbel. In: Karl Neumann, Ulf Sauerbrey, Michael Winkler {Hrsg.): Fröbelpädagogik im Kontext der Moderne – Bildung, Erziehung und soziales Handeln – edition Paideia, Jena 2010, S. 28ff.
Inhaltsverzeichnis
Gedanken zur Einführung
Mutter- und Koselieder
Empfindungen der Mutter beim Anschauen ihres erstgeborenen Kindes
Die Mutter im Gefühl ihrer Lebenseinigung mit dem Kinde
Eingangslied – Die Mutter selig im Anschauen ihres Kindes
Die Mutter selig im Beschauen ihres Kindes
Die Mutter beim Spielen mit ihrem Kinde
Die Mutter im Anschauen ihres sich entwickelnden Kindes
Die Mutter und das Kind, wenn es auf ihrem Schoße steht und in ihren Armen ruht
Das Kind an der Mutter Brust
Spiellieder
Strampfelbein
Strampfelbein
Pautz! da fällt mein Kindchen nieder
Bautz! Da fällt mein Kindchen nieder
Das Turmhähnchen
Das Thurmhähnchen
'S ist all'=all'
'S ist all'-all'
Schmeckliedchen
Dza, dza! Schmeckliedchen
Tick, tack
Tick, Tack!
Grasmähen
Grasmachen
Hühnchenwinken
Täubchenwinken
Die Fischlein
Hühnchenwinken; Täubchenwinken; Fischlein im Bächlein
Längsweis – kreuzweis
Längsweis – kreuzweis
Patsche – Kuchen
Patsche Kuchen; Das Nestchen
Vogelnest
Blumenkörbchen
Das Körbchen; Das Taubenhaus
Das Taubenhaus
Das Däumchen ein Pfläumchen
Däumchen ein Pfläumchen
Däumchen neig' dich
Däumchen neig' dich; Grossmama
Die Großmama und Mutter lieb und gut
Mutter lieb und gut; Beim Däumchen sag' ich Eins
Beim Däumchen sag' ich Eins
Das Fingerklavier
Fingerklavier
Die Geschwister ohne Harm
Die Geschwister ohne Harm
Die lieben Geschwister (Michael Grübler)
Die Kinder auf dem Turme
Kletterliedchen (Michael Grübler)
Das Kind und der Mond
Du guter Mond (Michael Grübler)
Der anderthalbjährige Knabe und der Mond
Der kleine Knabe und der Mond (Michael Grübler)
Das kaum zweijährige Mädchen und die Sterne
Der Sterne Licht (Michael Grübler)
Lichtvöglein an der Wand
Lichtvögelein
Das Häschen
Das Häschen
Wolf und Schwein – 1. Wolf
Wolf und Schwein – 2. Schwein
Der Wolf
Das Schwein
Das Fensterlein; Das Fenster
Das Fenster; Das Fenster
Die Köhlerhütte
Köhlerhütte
Der Zimmermann
Der Zimmermann
Der Steg
Der Steg
Das Hoftor
Das Gartentor
Das Hoftor (Das Gartentor wird gesprochen)
Der kleine Gärtner oder das Gießkännchen
Der kleine Gärtner
Riechliedchen
Hätzi oder Riechliedchen
Der Wagner
Der Wagner
Der Tischler
Der Tischler
Die Reiter und das gute Kind
Die Reiter und das gute Kind
Die Reiter und das missgelaunte Kind
Die Reiter und das missgelaunte Kind
Kindchen verstecke Dich!
Kindchen verstecke Dich
Verstecken des Kindes
Versteckspiel
Guckguck!
Guckguck
Der Kaufmann und das Mädchen
Der Kaufmann und der Knabe
Kirchentür mit Fenster
Kirchfenster und Kirchthür
Der kleine Zeichner
Schluss – Lied
Schlussempfindungen
Unser Lied an Friedrich Fröbel
Friedrich Fröbel – Kinderfreund
GEDANKEN ZUR EINFÜHRUNG
Im Jahre 1841, ein Jahr nach der Kindergartengründung, begann Friedrich Fröbel mit einem neuen Projekt. Ihm war klar geworden, dass er auch für die kindliche Entwicklungsphase vor dem ersten Spielen mit dem Ball etwas schaffen müsse:
[...] es fehlte mir [...] noch ein wesentliches verbindendes Mittelglied zwischen dem eben erst erwachenden Leben des Kindes und dem sich beschäftigen mit dem Balle [...] Die Vermittlung [...] zwischen dem [...] Kinde [...] und dem ihm [...] gegebenen Balle sind aber die Glieder, die Sinne selbst, und so spielt das Kind zunächst mit und durch sich selbst, wo ihm seine eigenen Glieder: Ärmchen, Händchen, Finger, Füßchen, Fußzehen selbst sogar die Zunge Spielstoff und Darstellungsmaterial sind. 2
Die 7 Mutter- und Koselieder und 50 Spiellieder wurden von Fröbel ab 1841 entwickelt und 1844, vier Jahre nach der Kindergartengründung, herausgegeben. Sie entstanden aufgrund der Erkenntnis, dass vor dem Einsetzen des Spieles mit der ersten Spielgabe, dem Ball, bereits wesentliche Entwicklungen erfolgen. Die Mutter- und Koselieder sollte die Mutter dem Kind zugewandt singen. Der Blickkontakt und die Stimme der Mutter leisten einen nicht zu überschätzenden Beitrag zur Bindungsentwicklung.
Die Spiellieder inspirieren und begleiten das sensumotorische Spiel des Kleinkindes mit den Gliedern seines Körpers und Gegenständen der Umwelt. Die Mutter sollte diese Lieder begleitend zum Spielen und Tun des Kindes singen und das Kind zum Nachahmen von Bewegungen anregen. Auch diese Lieder dienen darüber hinaus der Entwicklung und Festigung von Bindung und sind damit – im Sinne Fröbels – ein erster Beitrag auf dem Weg der Entwicklung von „Lebenseinigung".
Die Vertonung der Lieder besorgte der seit 1839 in Keilhau tätige Musiklehrer Robert Kohl, die Zeichnungen im Buch gestaltete Friedrich Unger. Die Lieder erscheinen heute zum Teil als sehr schwärmerisch und romantisch, was die Frage aufwirft, ob sie noch zeitgemäß sind.
Zeitgemäß, ja eigentlich zeitlos, ist die Notwendigkeit der intensiven, liebevollen Zuwendung zum Kind auch und gerade in den ersten Lebensmonaten. Die Stimmen der Eltern, der Körper- und Blickkontakt sind wesentliche Voraussetzungen für gelingende Bindungsentwicklung. In den 7 Mutter- und Koseliedern und in den erläuternden Texten Fröbels tritt dies deutlich hervor.
Nehmen Sie die zugegebenermaßen mitunter sehr schwärmerisch wirkenden Texte Fröbels durchaus auch als Anregung, Ihre eigenen Worte und Melodien zu finden. Bei 6 der 7 Mutter- und Koselieder birgt das Fehlen einer Vertonung ja sogar die Aufforderung, nach eigenen Melodien zu suchen.
Sprechen oder singen Sie nach Ihren eigenen Melodien diese Lieder mit Ihrem Kind und freuen Sie sich gemeinsam an entstehender Resonanz und daran, dass Ihr Kind beginnt, zu seiner „eigenen Stimme" zu finden.
Wenn das Kind beginnt, Freude an den Bewegungen seines eigenen Körpers zu entwickeln, eigene Körperteile als Spielgegenstände entdeckt und kurze Zeit später erstes Interesse an Gegenständen seiner Umwelt zeigt, dann beginnt die Zeit der 50 Spiellieder – zumindest in der Bedeutung, die Fröbel ihnen ursprünglich zugedacht hatte. Sie waren für ihn vor allem Spiellieder zum Kennenlernen, Kräftigen und Entwickeln der einzelnen Glieder.
Wer das Lied vom „Taubenhaus" aus seiner eigenen Kindergartenzeit kennt, wird es vielleicht nicht als ein „Arme, Hände und Finger übendes Spiel" (so Fröbels Untertitel) kennengelernt haben. Eine der bedeutendsten Mitstreiterinnen und Fortsetzerinnen Fröbelscher Erziehungsideen, Bertha von Marenholtz-Bülow, sagte dazu:
„Sehen Sie, [...] da gibt es so manche Spiele, die im Kindergarten oft gespielt werden, welche sich mit der Zeit mit einer Menge neuer Züge bereicherten. [...] (D)as „Taubenhaus" [...] war ursprünglich nur als Fingerspiel [...] bestimmt, aber viele dieser Liedchen wurden nachher im Großen gespielt, so das „Fischchen" und das „Taubenhaus". Anfänglich flogen die Kinder aus, allmählich kam man darauf, dass man sie erzählen ließ, aber in einzelnen Kindergärten hat man das Spiel noch mehr erweitert, wenn die Kinder nicht rechtzeitig in das Haus fliegen, so kommt der Habicht und rupft sie, das macht viel Spaß.“3
Das vorliegende Buch enthält die Erläuterungen Fröbels für das sensumotorische Spiel des kleinen Kindes. Relativ breite Anwendung findet heute noch in diesem Zusammenhang das Lied vom „Turmhähnchen" als – wie von Fröbel beschrieben - „Handgelenk und Ellenbogenbewegungen übendes Spiel". Aber auch dieses Lied führt weiter: Es lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Kraft des Windes und vielleicht darauf fußend auf andere Naturkräfte. Viele der anderen Spiellieder haben auch entsprechende – vielleicht heute neu zu entdeckende – Potenzen, die dem Kinde als Impuls für spielerisches Erfahren und damit Lernen dienen können.
Einige Beispiele seien im Folgenden erwähnt:
Das Erfahren der eigenen Sinne am Beispiel „Schmeckliedchen"
Ei wie so süß, so süß es schmeckt!
Komm, Kindchen, nimm das Beerchen hell,
Das Beerchen vom Johannisstrauch. -
Wie rümpft mein Kind den Mund so schnell,
Doch nimmt es bald das zweite auch;
Das Saftige gar sehr erfrischt,
Obgleich zum Süß sich Sauer mischt.
Das erste Erfahren von Zahlen am Beispiel „Beim Däumchen sag ich Eins"
Beim Däumchen sag' ich Eins,
Beim Zeigefinger: Zwei,
Beim Mittelfinger: Drei,
Beim Ringfinger: Vier,
Beim kleinen Finger Fünf ich sage.
Hab' in 's Bettchen all' gelegt,
Schlafen, keines sich mehr regt;
Still, dass keins zu früh erwache.
Erstes „spielerisches" Erfahren menschlicher Arbeit, Achtung der Arbeit, ihrer Produkte und des arbeitenden Menschen an den Beispielen
Der Tischler
Zisch, zisch, zisch!
Der Tischler hobelt den Tisch.
Tischler, hoble den Tisch mir glatt,
Dass er keine Löcher hat:
Zisch, zisch, zisch!
Tischler, hoble den Tisch.
Lang, lang, lang!
Tischler, hoble die Bank;
Tischler, hoble sie recht blank,
Dass daran kein Span mehr hang';
Lang, lang, lang!
Tischler, hoble die Bank.
Die Köhlerhütte
Klein ist die Köhlerhütte, kaum
Nur für zwei Menschen hat sie Raum;
Doch wohnen d 'rinnen wohlgemut,
Der Köhler mit seinen Söhnen gut.
Sie holen das Holz, sie brennen's zu Kohlen;
Und diese die Schmiede auf Wagen abholen.
Wie könnte man Messer, Gabeln, Löffel sonst machen
Und noch die nützlichen anderen Sachen,
Wenn – brennte mit Kohle und Ruß im Gesicht,
Der Köhler mit Sorgfalt die Kohlen uns nicht. -
Komm, Kindchen, wollen den Köhler begrüßen,
Ohn 'n Löffel könnt' Kind ja kein Süppchen genießen;
Und ist er auch schwarz in seinem Gesicht,
So schadet dies seinem Herzen doch nicht.
Bewusste Begegnungen mit der Natur an den Beispielen
Das Vogelnest
In die Hecke, auf die Ästchen
Baut der Vogel sich ein Nestchen;
Legt hinein zwei Eierlein,
Brütet draus zwei Vögelein:
Rufen die Mutter: „piep, piep, piep!
Mütterchen, Du bist uns lieb! “
Das Kind und der Mond
Komm, Kindchen! Schau den Mond,
Der dort am Himmel wohnt.
„Komm Mond, komm doch geschwind
Hierher zum lieben Kind!"
„Wohl käm ich zu Dir gern,
Doch wohn ich gar zu fern,
Kann aus dem blauen Haus
Hier oben nicht heraus.
Weil ich kann kommen nicht,
Send ich mein helles Licht;
Um 's Kindchen zu erfreun,
Schick ich den milden Schein;
Und bin ich auch nicht nah,
Bin ich in Lieb' doch da.
Sei, Kindchen, nur recht fromm,
Von Zeit zu Zeit ich komm ',
Und freundlich ich dann schicke,
Dir meine Liebesblicke;
Wir grüßen uns dann beide,
Gemeinsam uns zur Freude."
„Leb wohl, leb wohl! mein Mond
Mit Liebe, Liebe lohnt." -
Die Erfahrung der Einbettung des Kindes in die Familie am Beispiel
Die Großmama und Mutter lieb und gut
Das ist die Großmama,
Das ist der Großpapa,
Das ist der Vater,
Das ist die Mutter;
Das ist 's kleine Kindchen ja;
Seht die ganze Familie da.
Das ist die Mutter, lieb und gut;
Das ist der Vater mit frohem Muth;
Das ist der Bruder, lang und groß;
Das ist die Schwester,
mit Püppchen im Schoß;
Und dies ist das Kindchen, noch klein und zart,
Und dies die Familie von guter Art,
Die mit sinn'ger, einträchtiger Kraft
Das Rechte und Gute in Freuden schafft.
Das Erleben des Gartens am Beispiel „Der kleine Gärtner"
Komm, wir wollen in den Garten,
All' die Pflänzchen dort zu warten:
Wollen sie gar schön begießen,
Dass die Knöspchen sich erschließen.
Die Knöspchen sich entfalten nun;
Sie grüßen Dich mit süßem Duft,
Womit sie durchwürzen die ganze Luft.
Belohnend ist es, wohlzutun!
Nicht zu übersehen ist an diesen Beispielen aus den 50 Spielliedern Fröbels, wie viel sich im Leben der Menschen und auch in der Sprache in den fast zwei Jahrhunderten seit dem Erscheinen der Fröbelschen Lieder verändert hat. Gleichermaßen wird aber deutlich, dass die aufgegriffenen Themen zumeist auch heute von Bedeutung sind.
Manches Lied – wie eben das Taubenhaus – mag heute noch unverändert sing- und spielbar sein. Aber auch die „alten Lieder" enthalten Potenzen für das spielerische Erfahren und Lernen mit dem Kind. Am Beispiel eines nicht von Fröbel stammenden Liedes soll gezeigt werden, was „alte Lieder" manchmal doch zu leisten vermögen, wie man mit ihnen „umgehen" kann:
Ei, ei, Herr Reiter („Der Steckenpferdreiter“)4
Musik: Gustav Heinrich Graben-Hoffmann (1820 – 1900)
Text: Robert Reinick (1805 – 1852)
Wer heute auf Reisen geht, wird wohl kaum noch zu Pferd unterwegs sein. Mit der Bahn, dem Bus oder dem Auto geht es bequemer und vor allem (zumeist) schneller. Wenn ein Fahrzeug neuen Treibstoff braucht, wird es aufgetankt und weiter geht es.
Ein Pferd dagegen braucht – wie wir Menschen auch – ab und zu Nahrung und entsprechende Ruhe. Viele Hunderte Kilometer an einem Stück, das war für Pferd und Reiter nicht drin.
Von der Reise eines Reiters und seines Pferdes handelt das folgende Lied, dass sich vielleicht auch als Hintergrund dafür eignet, mit den Kindern über das Reisen im Wandel der Zeiten, über Mensch und Haustier im Allgemeinen sowie Mensch und Pferd im Besonderen ins Gespräch zu kommen. Auch mögliche nachteilige Folgen mancher moderner Reiseformen – insbesondere für die Umwelt – können thematisiert werden.
Vielleicht haben Sie ja das Glück und es gibt im Umfeld Ihres Kindergartens noch Pferde, die Sie mit Ihren Kindern auch besuchen können. Doch Vorsicht, Pferde vertragen viele Dinge, die wir Menschen essen, nicht. Manches ist für Pferde sehr giftig! Das Füttern sollte man unbedingt den Besitzern bzw. Pflegern überlassen.
Inhalt des Spiels:
Mehrere Kinder bilden eine breite Straße. Für folgende Rollen werden Kinder ausgewählt:
Der Reiter
Wirt und Wirtin
Schmiede (Meister und 1-2 Gesellen)
Zwei Kinder, die das Tor bilden, dazu ein Zolleinnehmer mit einem Gehilfen
Die anderen Kinder können sein:
Andere Gäste des Wirtshauses
Knechte und Mägde
Die Familie, die zu Hause auf die Rückkehr des Reiters wartet (Mutter, Kinder, gegebenenfalls Großeltern)
Der Text des Liedes enthält Wörter, die den Kindern möglicherweise nicht geläufig sind. Diese müssen im Vorfeld geklärt werden. Das betrifft nicht nur Gegenstände, sondern auch Tätigkeiten, die heute nicht mehr zum Alltag der Kinder gehören, die ihnen aber möglicherweise hier und dort bereits in Märchen und Geschichten begegnet sind:
Reiter/ Reiten
Ross
Wirtshaus
Heu
Schmiede
Hufeisen
(Huf)-Nägel
Meister
Geselle
Stadttor
Groschen
Wache
Einkehren
Heu geben
Trunk nehmen
Pferd beschlagen
Dünken
Zoll
Melodie des Liedes
Als midi-Datei:
Als mp3-Datei:
Der Reiter kommt im Wirtshaus an. Wirt, Wirtin, andere Gäste, Knecht und Magd singen die erste Strophe. Die anderen Kinder summen die Melodie mit:
Ei, ei, Herr Reiter, sein Ross will ja nicht weiter,
Mich dünkt, es wird schon müde sein,
drum kehr' er hier im Wirtshaus ein.
Geb' er dem Rösslein frisches Heu,
nehm' er selbst einen Trunk dabei;
so, so, Herr Reiter, nun kann er wieder weiter,
so, so, Herr Reiter, nun kann er wieder weiter.
Der Reiter will am nächsten Morgen aufbrechen. Der Schmied und seine Gesellen machen ihn aber singend darauf aufmerksam, dass sein Pferd neu beschlagen werden muss. Die anderen Kinder summen wiederum die Melodie mit:
Ei, ei, Herr Reiter, sein Ross will ja nicht weiter!
Sein Ross, das will beschlagen sein,
hier ist die Schmiede, tret' er ein.
Drei Nägel werden nötig sein,
die schlage selbst der Meister ein.
So, so, Herr Reiter, nun kann er wieder weiter.
So, so, Herr Reiter, nun kann er wieder weiter.
Der Reiter ist ein Stück geritten, da kommt er an das (Stadt)-Tor. Der Zolleinnehmer, sein Gehilfe und auch die das Tor darstellenden Kinder singen die dritte Strophe, die anderen Kinder summen wieder die Melodie mit.
Halt, halt, Herr Reiter, sein Ross darf hier nicht weiter!
Hier ist die Stadt, hier ist das Tor,
da zahlt man seinen Zoll zuvor;
drei Groschen werden nötig sein,
sonst sperrt man in die Wach' ihn ein.
So, so, Herr Reiter, nun kann er wieder weiter.
So, so, Herr Reiter, nun kann er wieder weiter.
Endlich ist der Reiter wohlbehalten zu Hause angekommen. Er bindet sein Pferd an und betritt das Haus. Die Familie empfängt ihn – die vierte Strophe singend. Die anderen Kinder summen wieder die Melodie:
Ei, ei, Herr Reiter, sein Pferd zum Stall geleit' er!
Nun ist er heimgekehrt vom Ritt,
was bringt er seinen Kindern mit?
Jawohl, er hat daran gedacht
und uns was Schönes mitgebracht.
Dank, Dank, Herr Reiter, nun darf er nicht mehr weiter.
Dank, Dank, Herr Reiter, nun darf er nicht mehr weiter.
Vielleicht haben Sie zu dem einen oder anderen Lied ähnliche Ideen. Vielleicht wollen Sie aber auch noch aus anderen „Liedquellen" schöpfen. Wunderbare Lieder gibt es genug und man kann mit seinen Kindern ja auch selbst Lieder machen ...
Die Mutter-, Spiel- und Koselieder bringen uns in Erinnerung:
Die Frage ist, wie weit wir verwirklicht, ja wie weit wir überhaupt verstanden haben, was Fröbel gewollt hat [...] was es ist, was uns [...] gegenüber dem Fröbelschen Konzept fehlt? Niemand wird glauben, dass wir zurückkönnen, aber wenn wir erkennen, was es ist, was uns Fröbel gegenüber abhandengekommen ist, ist schon das gewonnen, was uns weiterbringen kann.“5
Zum Schluss noch einige Informationen:
Wenn Sie sich aus wissenschaftlicher Sicht für die Entstehung, die Hintergründe, die Wirkungsgeschichte und die Kritik der Fröbelschen Lieder interessieren, so finden Sie dazu einen Link
6
zu einer Dissertationsschrift von Christiane Konrad.
Am inhaltlichen Entstehen des Originals der Mutter-, Spiel- und Koselieder waren neben Friedrich Fröbel auch als Komponist der Theologe und Musiklehrer Robert Kohl sowie als Maler und Illustrator Friedrich Unger beteiligt. Christine Konrad verweist in oben genannter Dissertation auf die Möglichkeit, dass Fröbel darüber hinaus Unterstützung von weiteren Personen seines Umfeldes bekommen hat, was aber heute nicht mehr nachvollziehbar ist.
Neben dem Notensatz einiger Lieder finden Sie QR-Codes. Diese führen Sie jeweils zu mp3-Dateien von Liedern Friedrich Fröbels. Vielen Dank sagen wir den jungen und älteren Künstlern
7
, welche die vielfältigen Aufnahmen hier zur Verfügung gestellt haben.
Dieses Buch ist Bestandteil der Reihe „Frühe Schriften zur Fröbelpädagogik"
BESONDERS HERZLICHER DANK SEI HERRN MICHAEL GRÜBLER, MUSIKER, MUSIKPÄDAGOGE, AUTOR UND VERLEGER, GESAGT. ER STELLTE FREUNDLICHERWEISE DEN VON IHM NACH ORIGINALVORLAGE VON ROBERT KOHL ERSTELLTEN NOTENSATZ DER FRöBELSCHEN LIEDER FÜR DIESES BUCH ZUR VERFÜGUNG. IN SEINER BESCHÄFTIGUNG MIT DEN LIEDERN FRIEDRICH FRöBELS HAT GRÜBLER SICH EINIGER NICHT VERTONTER TEXTE ANGENOMMEN. DURCH ÄNDERUNGEN DES ORIGINALTEXTES BZW. DIE EINBETTUNG IN NEUE MELODIEN SOLL DER INHALT IN ZEITGEMÄBERE SINGAUFFASSUNG GESTELLT WERDEN. DAS KLETTERLIED (DIE KINDER AUF DEM THURME) HAT SICH ALS FINGERSPIEL ENTWICKELT, WÄHRENDDU GUTER MOND (DAS KIND UND DER MOND) UNDDER KLEINE KNABE UND DER MONDDURCH RUHIGES VOR- UND MITSINGEN EIN WENIG DEM HEKTISCHEN ALLTAG ENTGEGENWIRKEN SOLL. IN DEM LIEDDER STERNE LICHT (DAS KAUM ZWEIJÄHRIGE MÄDCHEN UND DIE STERNE) IST DER INHALT DURCH NEUE WORTE UND EINE MELODIE IN UNSERE HEUTIGE ZEIT GERÜCKT. VIEL FREUDE BEIM SINGEN.
Matthias Brodbeck, im März 2025
2 vgl.: Heiland, Helmut: Briefausgabe Friedrich Fröbel – Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung / Fröbel- Forschungsstelle der Universität Duisburg-Essen. – F. an Friederike Schmidt in Gera v. 21.3./22.3.1841 (Blankenburg). - http://opac.bbf.dipf.de/editionen/froebel/ft1841-03-21-01.html (29.07.2020)
3 Benfey, Rudolf: Erinnerungen an Friedrich Fröbel. Cöthen. Paul Schettlers Verlag 1880. S. 59f.
4 Vgl. auch Brodbeck, Matthias: Das Leben des Kindes ist Spiel. Fröbels Spielpädagogik heute für Kindergarten, Schule und Familie. Jugendsozialwerk Nordhausen e.V. Verlag Iffland. 2021. Teil 2. S. 322ff.
5 Bollnow, Otto Fr iedrich: Gedenkrede zu Friedrich Fröbels 200. Geburtstag. In: Festschrift zum 200. Ge.bu.rts.jahr von Friedrich Fröbel. Festveranstaltung und Fachtagung des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes e.V. am 16./17. September 1982 in Palmengarten, Frankfurt am M., hrsg. vom Pestalozzi-Fröbel-Verband e. V. Berlin 1983, S. 7-16.
6https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/start/0/rows/10/sortfield/score/sortorder/desc/ searchtype/simple/query/friedrich+unger/docId/1819
7 Christoph Michael Grübler; Martin Neumann Torsten Sterzik u.a. (vgl. https://www.froebelweb.de/index.php/froebels-schaffen/lieder);
Mutter- und Koselieder
Empfindungen der Mutter
beim Anschauen ihres erstgebornen Kindes.
Gott, mein Gott! wie Du mich Gattin hoch beglücktest,
Mir mit Himmelsfreuden Erdenleben schmücktest:
Hast zur höchsten Menschenwürde mich erkoren,
Durch Dich habe ich ein Engelskind geboren.
Gatte, Vater! Lass es Dir zum Segnen reichen,
Als der reinsten Liebe schönstes;
Denn in ihm sich einig Alles, Alles findet,
Was für Ewigkeiten Gattenherzen bindet.
Kindchen! zwar geboren unter Schmerzen,
Ruhe nun, geliebt, an Deiner Eltern Herzen;
Ja! die zartste Sorge wollen stets wir hegen,
In Dir unser Aller Leben zu treu zu pflegen.
Gott und Vater! Du des Lebens ew'ge Quelle,
Lass auch sie ihm fließen kräftig, rein und helle.
Alle sind ja Deine Kinder wir, – die Deinen,
Lass drum eine Liebe stets uns mit Dir einen.
Die Mutter
im Gefühl ihrer Lebenseinigung mit dem Kinde.
0 Kindchen, Du mein! so hold und so lieb,
Dem Herzen ganz leis die Kunde doch gib:
Was aus Dir so warm entgegen mir strahlet,
Gleich Frührot im Frühling in Dir sich mir malet? -
„Der Glaube ist's, der dem Auge entquillt: -
Was kann mir geschehen, Du, Mutter! bist Schild.
Die Liebe ist's, so im Lächelblick spricht: -
In Ein 'gung mit Dir umgibt mich nur Licht.
Und Hoffen ist's, das den Busen umschließt: -
Die Quelle des Lebens sich hier mir ergießt."
Komm Kindchen! so innig, und lass voll Vertraun
Uns Auge in Auge das Leben erschaun: -
Was immer Dein Herz von Muttertun ahnet,
Dazu stets die Mutter ihr Lieben sanft mahnet;
Einst sagend: sein Glauben, sein Hoffen, sein Lieben
Nicht ungepflegt ist 's im Kindchen geblieben;
Es war ihm im Glauben, im Lieben, im Hoffen
Beseligt als Kind, der Himmel schon offen.
Blick auf die Mutter, versunken im Anschauen ihres Kindes.
aus der „Erklärung der Randzeichnungen"
Was durchleuchtet und durchwärmt, was durchfließt wie eine sanfte Glut, teure Mutter, Dein ganzes Wesen beim Anblick Deines vor Dir ruhenden, lieblichen Kindes? -Was gibt der kleinsten Deiner Hilfeleistungen, die Du ihm reichst, solche Bedeutung und Wichtigkeit, was lehrt Dich die unangenehmsten Geschäfte, die man gern schleunigst den Sinnen entzieht, demnach mit der größten Sorglichkeit zu verrichten; was gibt Dir Ruhe, Besonnenheit, Ausdauer, Mut, Hingabe auch selbst bei Schmerz und Sorge erregenden Erscheinungen des Lebens Deines Kindleins? Es ist, dass Du das Kleinste, betreffe es Ordnung, Reinlichkeit, Nahrung, oder was es auch immer sei, in seinem Zusammenhange, in Einigung mit dem großen Ganzleben, in Rückwirkung auf dasselbe siehst; es ist, dass Du das Leben Deines Kindes, sei es auch in der dunkelsten Ahnung, als ein Ganzes überblickst, worin jedes Einzelne, und sei es das Kleinste, in entwickelnder Fortwirkung erscheint; es ist, dass Du im Gegenwärtigen schon das Künftige siehst. Also die Ahnung und Auffassung, die Erfassung und Anschauung des Lebens als eines Ganzen, worin jedes Einzelne an seiner richtigen Stelle und in seiner wahren Bedeutung erkannt wird: dies ist es, was Deinem Leben und Wirken all die oben genannten reichen Gaben und hohen Eigenschaften gibt.