
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Vom Aufwachsen in der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas. Mit unwiderstehlicher Kraft erzählt Stefanie de Velasco in ihrem zweiten Roman von einer unbekannten Welt und dem Emanzipationsprozess einer jungen Frau, der sämtliche Fundamente zum Einstürzen bringt. Ein ostdeutsches Dorf kurz nach der Wende. Die junge Esther wurde über Nacht aus ihrem bisherigen Leben gerissen, um hier, in der alten Heimat ihres Vaters, mit der Gemeinschaft einen neuen Königreichssaal zu bauen. Während die Eltern als Sonderpioniere der Wachtturmgesellschaft von Haus zu Haus ziehen, um im vom Mauerfall geprägten Osten zu missionieren, vermisst Esther ihre Freundin Sulamith schmerzlich. Mit Sulamith hat sie seit der Kindheit in der Siedlung am Rhein alles geteilt: die Fresspakete bei den Sommerkongressen, die Predigtdienstschule, erste große Gefühle und Geheimnisse. Doch Sulamith zweifelt zunehmend an dem Glaubenssystem, in dem die beiden Freundinnen aufgewachsen sind, was in den Tagen vor Esthers Umzug zu verhängnisvollen Entwicklungen führt. Während Esther noch herauszufinden versucht, was mit Sulamith geschehen ist, stößt sie auf einen Teil ihrer Familiengeschichte, der bislang stets vor ihr geheim gehalten wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Stefanie de Velasco
Kein Teil der Welt
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Stefanie de Velasco
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Stefanie de Velasco
Stefanie de Velasco, geboren 1978 im Rheinland, studierte Europäische Ethnologie und Politikwissenschaft. 2013 erschien ihr Debütroman »Tigermilch«, der in zahlreiche Sprachen übersetzt und für das Kino verfilmt wurde. »Kein Teil der Welt« (2019) ist ihr zweiter Roman. Sie wuchs selbst bei den Zeugen Jehovas auf und verließ die religiöse Gemeinschaft im Alter von 15 Jahren.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein ostdeutsches Dorf kurz nach der Wende. Die junge Esther wurde über Nacht aus ihrem bisherigen Leben gerissen, um hier, am anderen Ende der Republik, in der alten Heimat ihres Vaters, mit der Gemeinschaft einen neuen Königreichssaal zu bauen. Während die Eltern als Sonderpioniere der Wachtturmgesellschaft von Haus zu Haus ziehen, um im vom Mauerfall geprägten Osten zu missionieren, vermisst Esther ihre Freundin Sulamith schmerzlich. Mit Sulamith hat sie seit der Kindheit in der Siedlung am Rhein alles geteilt: die Fresspakete bei den Sommerkongressen, die Predigtdienstschule, erste große Gefühle und Geheimnisse. Doch Sulamith zweifelt zunehmend an dem Glaubenssystem, in dem die beiden Freundinnen aufgewachsen sind, was in den Tagen vor Esthers Umzug zu verhängnisvollen Entwicklungen führt. Während Esther noch herauszufinden versucht, was mit Sulamith geschehen ist, stößt sie auf einen Teil ihrer eigenen Familiengeschichte, der bislang stets vor ihr geheim gehalten wurde.
Poetisch, wortgewandt und mit unwiderstehlicher Kraft führt uns Stefanie de Velasco in ihrem neuen Roman in eine Welt, die mitten in der unsrigen existiert und dennoch kein Teil von ihr ist. Und stellt eine unvergessliche junge Frau ins Zentrum, die alles daransetzt, selbst darüber zu bestimmen, welche Erzählungen ihr Halt geben.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2019, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung und -motiv: © gray318
ISBN978-3-462-31731-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Werk
Motto
Könnt ihr das Salz riechen?
Genesis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Von Weitem sieht es aus …
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
An großen Tagen …
11. Kapitel
12. Kapitel
Exodus
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Im Hafen von Prisma
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Die Bilder von der hellen Zeit verblassen
21. Kapitel
22. Kapitel
Dank
Dieser Roman ist ein Werk der Fiktion, sämtliche Charaktere sind Kunstfiguren, die geschilderten Handlungen, Ereignisse und Situationen sind rein fiktiv.
Als damals sich die Hirten zankten
und ständig um die Plätze bangten,
da beschlossen die Verwandten
auszuziehen aus ihren Landen.
Nach Sodom kamen sie,
der Nachbarstadt Gomorrhas,
wo damals nur der Böse saß.
Ein Engel kam und sprach zu Lot:
»Haut ab aus diesem Land,
Jehova setzt alles in Brand!«
Auch sagte er: »Schaut nicht zurück,
sonst verliert ihr euer Glück.«
Stefanie de Velasco, Dienstwoche, 1990
Könnt ihr das Salz riechen? Das ist der Wind, er weht von Kara Gyson zu euch. Wenn ihr ihn riechen könnt, ist er hier schon lange über das Land geflogen, über die hohen Berge und ihre Gipfel, auf denen früher einmal Schnee lag und heute nur noch Salz. Der Wind, er ist über die Seen geflogen, die zwischen den Bergen in den Tälern liegen, und hat dort Salz gestreut. Wie Hühnerfutter hat er es auf das Wasser und ans Ufer gestreut, dahin, wo früher einmal Kinder geangelt haben. Heute angelt niemand mehr auf Kara Gyson, Kinder schon gar nicht. Auf Kara Gyson gibt es kaum noch Kinder, es ist zu salzig. Es gibt auch keine Fische mehr. Auf Kara Gyson herrscht die dunkle Zeit.
Wir haben alles über Salz gelesen, um besser zu verstehen. Jemand hat die Himmelsrichtungen geändert. Osten und Westen, keiner weiß mehr, wo was liegt. Sie haben an der großen Achse gedreht, die Transformstörung, sie hat die Pertosphäre gebracht, die Pertosphäre hat das Salz gebracht und mit dem Salz die dunkle Zeit. Von früher, von der hellen Zeit, gibt es noch Bilder, Malereien und Fotos, aber das Salz greift alles an. Deswegen malt man sich inzwischen alles auf die Haut, aber einmal, da wird auch alle Haut bemalt sein, da wird die helle Zeit nur noch in unseren Köpfen, in den Geschichten, den Erinnerungen sein. Deshalb muss jemand alles aufschreiben.
Wenn wir am Abend unten in den Hexensteinschächten liegen, klappen wir die alten Karten auf und nehmen uns die letzten Stifte. Dazu holen wir uns immer ein Glas Wasser, aus Respekt, weil Flüssigkeit das Kostbarste auf Kara Gyson ist. Wir zeichnen alles in die Karten, was wir noch nicht vergessen haben, die alten Wege, die Berge, die besten Badestellen. Wir schreiben unsere Wahrheiten auf, auch wenn sie nicht mehr gelten, wir schreiben auf, woran wir uns erinnern, zeichnen und schreiben, bis die Tränen kommen. Weinen geht nicht. Ein Mädchen auf Kara Gyson würde niemals weinen. Sie würde sich ihr Lederdirndl enger schnüren, sie würde eine Friedhofssuppe essen und gut. Davon wird man nicht satt, aber auf Kara Gyson wird man schon lange nicht mehr satt, darum geht es auch nicht. Am Leben zu bleiben, darum geht es.
Wir wissen, Kara Gyson ist verloren. Tränen können die helle Zeit nicht zurückbringen. Wir wissen, dass man uns aufgegeben hat und die Welt glauben soll, dass niemand mehr hier lebt. Wir sind nicht niemand. Niemand hat keine Augen, niemand hat kein Herz. Niemand weiß nicht, was ein Herz ist, diese rote Fleischkugel unter der Brust. Niemand weiß nicht, warum es schlägt. Das Herz schlägt, weil es von der Welt gekitzelt wird, das findet das Herz ohne Ende lustig, sagten wir früher. Heute nicht mehr. Das Salz hat alles überzogen, es hat die Sprache kristallisiert, es hat unsere alten Wörter und Wahrheiten versiegelt und seine eigenen Wörter und Wahrheiten mitgebracht.
Das Salz rieselt leise, es hat eine karge Seele und will von Natur aus viel für sich behalten. Wir haben gelernt, dem Salz zuzuhören, diesen winzigen Kristallen. Was man behalten will, vergisst man, und was man vergessen will, behält man, hat uns das Salz zugeflüstert. Deshalb muss jemand alles aufschreiben. Jemand muss alles aufschreiben, und das sind wir.
Genesis
1
»Esther!«, ruft Mutter.
Ganz hinten am Horizont steht dicker schwarzer Qualm. Es brennt, es brennt! Es brennt nicht. Es sind nur die Schornsteine. Rauchende, alte Zuckerhüte. Sie kommen demnächst weg.
»Man macht ja doch keine Feuerzangenbowle«, hat Vater gesagt, »und wenn, dann nicht aus denen da.«
Das Schild steht schon am Eingang, ich kann es von meinem Fenster aus sehen, strahlend weiß, als hätten Außerirdische es dort hingestellt: Hier entsteht in Kürze ein Globus-Gartencenter. Hinter dem Schild eine verrußte Backsteinfassade, ein verrostetes Tor. Niemand geht dort ein oder aus, trotzdem zieht sich um das gesamte Gelände ein Zaun.
Ein schmaler Fluss quetscht sich an der Fabrik vorbei, am Ufer sammelt sich cremefarbener Schlackeschaum, dick und steif wie Schlagsahne, allein vom Anblick wird einem schlecht. Am Fluss stehen Häuser, die Fassaden nicht grau, nicht braun. Ich muss noch einen Namen für diese Farbe finden. Grauen. Die Dächer sind fast alle zerstört, die Fensterscheiben zertrümmert, aus Wut, oder die Zeit hat sie totgeschlagen. Auch auf der Straße muss man aufpassen. Immer wieder fallen Fassadenbrocken herunter. Manche sind hart, manche weich und porös. Die Leute hier fegen die Brocken an den Sonntagen in die Hinterhöfe, dort entstehen immer größere Türme, jeder Hof ein kleines Babylon, das sich einfach nicht ergeben will.
Ich habe lange überlegt, woran mich diese Steine erinnern. Ich bin in die Hocke gegangen, habe sie in die Hand genommen, sie gewogen und sie zwischen den Fingern zerrieben, dann ist es mir wieder eingefallen. Wenn Hunde zu viel Knochen fressen, hinterlassen sie so etwas. Früher haben Sulamith und ich solche Brocken manchmal auf den Feldwegen neben unseren Himbeeren gefunden und mit Kreide verwechselt. Wir haben den Platz vor der Garageneinfahrt damit bemalt. Ich habe versucht, meinen Namen damit zu schreiben, das S in der Mitte falsch herum, weil ich es noch nicht besser wusste, weil ich noch gar nicht richtig schreiben konnte. Sulamith malte unser Haus, vor der Tür mich, in den Fenstern Mutter und Vater, ihre Köpfe Dreiecke mit spitzen Kinnen und ihre Nasen Striche und Kreise, riesige Nasenlöcher, richtig entstellt sahen sie aus mit diesen Nasen, bis Sulamith die Kreide plötzlich fallen ließ.
»Das ist Hundescheiße«, flüsterte sie.
Scheiße, ich kannte dieses Wort, aber ich hatte es noch nie jemanden laut sagen hören. Es zischte in meinen Ohren, als würde jemand Snickers braten.
Anders als Sulamith war ich nie eine gute Malerin. Aber wenn ich das da draußen alles malen müsste, den grauen Himmel, vom Rauch durchzogen, die Fabrik, den Fluss, ich würde alles mit diesen Steinen malen, ich würde mir die Steine aus den Hinterhöfen nehmen und würde malen, so lange, bis es keine Steine mehr gäbe, keine Häuser mehr, bis nichts von hier mehr übrig wäre.
»Esther!«, ruft Mutter wieder.
Draußen flattern Sulamiths Kleider. Ich habe sie vor mein Fenster gehängt, damit ich das alles nicht ständig sehen muss, die alten Schornsteine, die kaputten Häuser, den verdreckten Fluss: das rote Meer. So hat Mutter es gestern genannt, bei unserer ersten Zusammenkunft. Jeder hat von zu Hause Stühle mitgebracht, weil im neuen Königreichssaal noch keine stehen. Das Dach ist schon fertig, aber sonst sieht fast alles noch so aus, wie es in einem halb fertigen Gebäude eben aussieht. Die Wände sind unverputzt, es liegt kein Teppichboden. Wir werden hier in Peterswalde die Ersten sein, die eine Zentralheizung haben, aber noch ist die Anlage nicht montiert. Es war bitterkalt. Schwester Wolf humpelte auf mich zu, ihre künstliche Hüfte lässt sie wie auf schiefen Stelzen gehen.
»Du bist ja gar kein Kind mehr«, hat sie gesagt und mir in die kurzen Haare gegriffen, als wäre das ein Wunder, das Wachsen und Älterwerden.
»Wie deine Großmutter siehst du aus, nur die langen Zöpfe fehlen.«
Anton Wolf stand gleich hinter ihr.
»Die Luise«, sagte er und kam ganz nah an mich heran, »was hatte die für eine schöne Singstimme. Kannst du auch so schön singen?«
Sein Atem roch nach Plaque, in seinen uralten Augen brach sich das Deckenlicht, es sah aus wie ein römisches Mosaik.
Wir sind nur eine Handvoll Verkündiger hier. Bruder und Schwester Wolf, Familie Lehmann mit ihrer Kinderschar, Bruder und Schwester Radkau mit ihrem Sohn Gabriel, Vater, Mutter und ich. Wir studieren immer noch Der größte Mensch, der je lebte. Die Bücher aufgeschlagen, saß die ganze Versammlung auf den mitgebrachten Stühlen. Es roch nach Farbe, die Neonröhren an der Decke knackten wie alte, gebrechliche Knochen. Gabriel stand neben Vater auf der Bühne und las vor. Er ist so alt wie ich und hat sich auf dem letzten Sommerkongress taufen lassen. Genau wie Mutter und Vater sind Gabriels Eltern Sonderpioniere. Wie sie es im Untergrund geschafft haben, ohne theokratische Strukturen und trotz Verfolgung, einhundertzwanzig Stunden im Monat in den Predigtdienst zu gehen, ist mir ein Rätsel. Gabriel erinnert mich an Tobias aus unserer alten Versammlung in Geisrath. Dieser dunkelblonde Flaum über seiner Oberlippe, die abstehenden Schulterpolster seines Sakkos, in das er noch hineinwachsen muss, und dieser eigentümliche Geruch nach überreifen Bananen, den Jungen in der Pubertät verströmen, genauso hat Tobias auch immer gerochen. Knallrote Ohren hat Gabriel bekommen, als er da neben Vater gestanden hat und vorgelesen hat, als wäre die Stelle irgendwie versaut, dabei ging es nur darum, dass Jesus mit Petrus aufs Meer fährt. Ein starker Sturm kommt auf, Wasser schwappt ins Boot, es droht zu sinken. Petrus bekommt Angst und wirft sich Jesus vor die Füße, aber Jesus streicht ihm nur über den Kopf und sagt: »Ab heute wirst du Menschen fischen.«
Als Vater die erste Frage in die Runde stellte, meldete sich Mutter. Ihre schlanke Hand ging nach oben, die anderen betrachteten die manikürten Finger, sie starrten auf den bordeauxfarbenen Nagellack, auf die weiße Bluse mit dem schmalen Spitzenkragen und der dunkelblauen Borte, sie starrten auf den Bleistiftrock, der sich an Mutters Beine schmiegte, auf die feinen Lackschuhe und dann zu mir, so als wäre ich auch so etwas wie ein Spitzenkragen oder ein feiner Lackschuh, eins von Mutters Accessoires. Nur Schwester Lehmann ließ Mutters Aufzug kalt. Was wollt ihr eigentlich hier? Es stand ihr ins Gesicht geschrieben, diese Frage, sie schien sich nicht vorstellen zu können, dass jemand seine Heimat verlässt, um ausgerechnet an diesem Fleck Erde noch einmal ganz neu anzufangen, dabei ist das hier doch so etwas wie Heimat, wenn auch nur Vaters. Hier ist er groß geworden, so unvorstellbar es auch für mich ist, aber genau hier muss er laufen und Fahrrad fahren gelernt haben, auf diesen kaputten Straßen, hier muss er Freunde gehabt haben, in dieser Eiseskälte ist er mit ihnen vielleicht Schlitten gefahren. Erst als das Baby anfing zu schreien, blickte Schwester Lehmann weg, hob es aus dem Kinderwagen und legte es an die Brust. Ihr dunkles Oberteil war voller Milchflecken. Ob Mutter jemals Milchflecken auf ihrer Kleidung hatte?
»Genau aus diesem Grund sind wir hierher gesandt worden, um die letzten Menschen zu fischen, bevor die große Drangsal kommt, denn das ist unser Auftrag, egal ob Sonderpionier, Pionier, Hilfspionier, getaufter Verkündiger oder ungetaufter Verkündiger«, hat Mutter gesagt, als Vater sie schließlich drangenommen hat. »Hier! Hier liegt das rote Meer. Das rote Meer ist voller Fische. Jehova hat es geteilt, und dann hat er es wieder vereint. Jetzt kommen wir und fischen, so lange, bis kein Menschenfisch mehr übrig ist.«
Oben an der Decke flog eine winzige Motte gegen die Neonröhren, sie raste ins Licht, immer und immer wieder, prallte ab und fiel irgendwann tot auf uns herab.
»So müssen Luzifer und seine Dämonen ausgesehen haben, als sie aus dem Himmel geworfen worden sind«, hätte Sulamith gesagt.
Manchmal hat sie sich solche gottlosen Sätze ausgedacht, nicht aus Respektlosigkeit, einfach nur, um alles ein bisschen besser ertragen zu können. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, ich weiß nicht, ob wegen der Kälte oder weil es mir Angst gemacht hat, dass ich Sulamith so oft mit mir reden höre, dass sie so gut wie immer bei mir ist, neben mir auf einem dieser harten Klappstühle, die noch von Großmutter sein müssen. Sulamith kratzt sich am Hals, ribbelt sich ein Sockenbündchen auf. Sie starrt auf ihr Buch. Der größte Mensch, der je lebte, Jesus und Petrus im Boot. Sie nimmt einen Kuli und malt zwei Sprechblasen über die Köpfe. In die Sprechblase über Petrus schreibt sie Bald ist Spargelzeit!, in die über Jesus schreibt sie Sail away!, und Beck’s auf das Boot. Jesus sieht auf einmal wie ein Partylöwe aus und Petrus gar nicht mehr verzweifelt, sondern einfach nur wie jemand, der sich wie blöde auf den nächsten Spargel freut.
Ich habe ihre langen Haare auf meinem Unterarm gespürt, diese blonde undurchdringliche Matte, wie sie vor Lachen bebt, doch dann habe ich gesehen, dass da gar keine lange Matte ist, sondern nur Mutters Bluse, die meinen Arm berührt, Mutter mit ihrer Lady-Di-Frisur, und dann ist mir alles wieder eingefallen, es hat sich angefühlt, als hätte ich gerade eben erst davon erfahren. Sulamith ist nicht mehr da. Mitten in der Nacht haben sie mich geweckt und ins Auto gepackt. Ich habe geschrien, aber es hat nichts geholfen.
»Es ist doch nur zu deinem Besten«, hat Mutter gesagt, als wir am nächsten Morgen hier angekommen sind, »einmal wirst du uns dankbar dafür sein.«
Mutter, ich muss mich noch daran gewöhnen. Seit der Sache mit Sulamith kann ich nicht mehr Mama zu ihr sagen. Ich habe Mutter immer Mama genannt. Jetzt nenne ich sie gar nichts mehr. Situationen, in denen ich sie ansprechen müsste, gehe ich aus dem Weg. Mit Vater ist es ähnlich, aber einfacher. Es gibt nicht viele Gelegenheiten, Vater anzusprechen. Vater ist ständig unterwegs. Sobald der Saal hier fertig ist, wird Vater wieder für den treuen und verständigen Sklaven unterwegs sein, unsere leitende Körperschaft, denn auch wenn es hier in Peterswalde seit kurzer Zeit anders ist, gibt es noch immer genügend Orte auf der Welt, an denen wir entweder noch nicht bekannt oder schon verboten sind.
»Esther«, ruft Mutter, »komm endlich runter!«
Im ganzen Haus riecht es nach Linsensuppe. Allein vom Geruch wird mir übel. Vater sitzt am Esstisch im Wohnzimmer, die Ellbogen auf die Tischdecke gestützt, weiß mit blauer Borte. Es ist der gleiche Stoff, aus dem Mutter Sulamith und mir dieses Jahr die Kleider für den 14. Nisan genäht hat. Vater schaut sich um, als wäre er ein Gast in einem fremden Haus, dabei muss er genau an diesem Tisch unzählige Male gesessen und gegessen haben. Dieser Esstisch stand schon immer hier. Ansonsten erinnert nur noch wenig an Großmutter oder daran, dass Vater hier groß geworden ist. Vater. Groß geworden. Ich kann ihn mir beim besten Willen nicht als Kind vorstellen, aber die vielen Striche an der Wand gleich neben meinem Bett, kunterbunt übereinander gezogene Linien, der größte Abstand zwischen Gedächtnismahl 1956 und Tag der Befreiung 1957, sind der Beweis. Vater ist gewachsen, hier in diesem Haus, in meinem Zimmer ist er groß geworden, und von ihm müssen auch die selbst gezeichneten Landkarten stammen, die ich gefunden habe. Sie steckten unter den Einlegeböden vom Kleiderschrank, ich habe sie nur zufällig entdeckt.
Ich setze mich Vater gegenüber, er nestelt an seiner Serviette herum, weiß mit blauer Borte. Mutter und ich konnten früher nur selten nach Peterswalde kommen, zu groß war die Gefahr, an der Grenze mit Literatur erwischt zu werden, zu hoch das Risiko, die anderen Brüder und Schwestern durch unsere Anwesenheit zu verraten. Wann Vater Großmutter wohl das letzte Mal gesehen hat? Nicht einmal zu ihrer Bestattung durfte er uns begleiten, sie hätten ihn noch an der Grenze festgenommen. Jetzt sitzt er hier, schaut sich verstohlen um, so als könnte ihn jeden Moment jemand von hinten überfallen. Kurz überlege ich, ob ich ihn auf die Karten ansprechen soll, auf dieses Land in Herzform, das darauf zu sehen ist, die krakelige Kinderschrift daneben, die ich nicht lesen kann, doch da kommt Mutter mit einer dampfenden Schüssel herein. Mutter sind die Strapazen des Umzuges kein bisschen anzusehen. Sie hat sich hier schon vollkommen eingerichtet, selbst ihr neues Nähzimmer oben in der Mansarde sieht schon wieder genauso unordentlich aus wie ihr altes in Geisrath.
Lächelnd schöpft sie Eintopf auf unsere Teller.
»Nächste Woche werden im Saal die Bäder und die Heizung montiert«, sagt Vater.
»Danach wirst du hoffentlich wieder öfter zu Hause sein«, sagt Mutter und setzt sich.
Zu Hause, wie das klingt. Als ob das hier jemals unser Zuhause werden könnte, als ob Vater jemals länger als zwei Monate am Stück hier wäre. Er senkt den Kopf und faltet die Hände.
»Herr Jehova, der du thronst in den Himmeln, dein Name werde geheiligt. Wir danken dir für die Speise, die du heute auf unseren Tisch gebracht hast, und dass wir hier als Familie in Frieden zusammen essen können. Wir wollen dir danken dafür, dass wir an diesem Ort, der die Wahrheit und die gute Botschaft so lange nicht zu hören bekommen hat, eine Anbetungsstätte für dich errichten durften. Lass uns hier ankommen und gemeinsam mit unseren neuen Brüdern und Schwestern, die so lange standhaft waren, deine gute Botschaft verkünden. Amen.«
»Amen«, sagt Mutter.
»Amen«, murmele ich.
Ich tauche meinen Löffel in den braunen Linsensee. Mutter schiebt mir den Brotkorb hin und zeigt auf die Graubrotscheiben.
»Nein, danke«, sage ich.
»Willst du ein Glas Milch?«
»Nein, danke«, sage ich.
Vater schlägt das Heft mit den Tagestexten auf, es liegt neben seinem Teller, er blättert, bis er das heutige Datum gefunden hat.
»Darum harrt auf mich auf den Tag, an dem ich aufstehe zur Beute, denn meine richterliche Entscheidung ist, Nationen zu sammeln, dass ich Königreiche zusammenbringe, um meine Strafankündigung über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zorns.«[1]
Ich würge einen Löffel Linsen herunter.
»Denn dann werde ich die Sprache der Völker in eine reine Sprache umwandeln, damit sie alle den Namen Jehovas anrufen, um ihm Schulter an Schulter zu dienen.«[2]
Reine Sprache, das war auch das Motto unseres letzten großen Kongresses im Sommer. Kaum zwei Monate ist das her, und ich weiß nichts mehr davon, all die Stunden, die ich dort gesessen habe, wie übermalt mit schwarzer Farbe. Es war Sulamiths letzter Kongress.
»Kongo«, hat sie immer gesagt, und so hat sie die Kongresstage auch immer in ihrem Schülerkalender markiert, mit diesem einen Wort. Kongo, Kongo, Kongo, Kongo, so als müsste sie Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag in ein unbekanntes, gefährliches Land reisen.
»Esther?«
Mutter legt ihren Löffel beiseite.
»Ich habe dich etwas gefragt.«
»Entschuldige.«
Vater steht auf, kommt mit einer Kanne Tee zurück, gießt ein. Kongo, Kongo, Kongo, Kongo. Sulamith trug ein schwarzes Kleid, als ginge sie zu ihrer eigenen Beerdigung. Ihr verheultes Gesicht, wie Lidia sie in Vaters Auto zerrt, ihre Schreie, wie sie hinten auf der Rückbank ihre Nägel in Lidias Haut bohrt, der strenge Geruch nach Angstschweiß, der nach vorne strömt, Lidias schwerer Atem und neben mir Vater, der stur die Autobahn entlangprescht.
Mein Teller will einfach nicht leer werden. Auch Vater isst, als wäre es eine Pflicht. Manchmal liegt er abends auf der Couch und tut so, als ruhte er sich aus, aber in Wirklichkeit hat er Schmerzen, ich erkenne es an der Art, wie er die Hand auf den Bauch drückt, doch wenn Mutter ihn darauf anspricht, schüttelt er immer nur heftig den Kopf, als wäre es Verrat, hier in seiner alten Heimat Bauchweh zu bekommen. Ich tauche den Löffel in die Linsen und denke an jemanden aus der Bibel, den ich gerne aufessen würde. Den Apostel Paulus, Johannes den Täufer, die kleinen Propheten, König Salomo und König David, Hiob. Mutter isst wie immer mit großem Appetit. Sie taucht die Suppenkelle in die Schüssel und schöpft nach. Vater löffelt bedächtig. Mein Teller ist noch lange nicht leer, also nehme ich noch je einen Löffel für die zwölf Söhne Jakobs: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Ascher, Issachar, Sebulon. Noch vor Joseph und Benjamin ist der Teller endlich leer.
»Darf ich aufstehen?«
»Willst du denn keinen Nachtisch?«, fragt Mutter.
»Nein.«
»Wird Zeit, dass du wieder in die Schule gehst«, sagt Vater.
Mutter nickt.
»Freust du dich schon?«
»Nein.«
Oben vor meinem Fenster flattern noch immer Sulamiths Kleider im Wind. Eine Jeanshose, Socken, Unterwäsche, ein blauer Pulli und ein T-Shirt. Fruit of the Loom steht auf dem Pulli, darunter ist ein Obstkorb abgebildet. Das T-Shirt ist mit vielen kleinen Wassermelonen bedruckt. Sulamith hat Obst auf Kleidern geliebt. Ob man hier im Sommer Wassermelonen kaufen kann? In den letzten Tagen wurde die neue Straße fertig gebaut. Sie führt vom Bahnhof bis zu den Feldern. Am Ende der Straße haben sie einen Supermarkt gebaut, mitten auf eine Wiese. Sieht aus wie eine Playmobilschachtel, die in den Dreck gefallen ist. Ich war gestern dort. Ich wollte von meinem Taschengeld Perwoll kaufen, aber sie öffnen erst demnächst, also habe ich Sulamiths Sachen mit Mutters teurem Shampoo gewaschen. Ich habe alle Kleider einzeln im Waschbecken gewaschen, mit der Hand, als wären sie aus Seide. Zu Hause lagen immer Sachen von Sulamith in meinem Zimmer herum. Schulbücher, Kleider, Schmuck. Sie war oft bei uns, manchmal wochenlang, wenn Lidia mal wieder in die Klinik musste. Morgens haben wir zusammen gefrühstückt und den Tagestext gelesen. Mama hat uns abwechselnd abgefragt, und danach sind wir mit den Rädern zur Schule gefahren, die gleichen Trinkpäckchen im Ranzen, die gleichen Pausenbrote, gleich belegt.
Bevor am Abend der Kohlenstaub kommt, hole ich die Kleider rein. Sie werden dann nicht mehr nach Mutters teurem Shampoo riechen, aber das wäre auch nicht anders, wenn ich sie hier im Haus getrocknet hätte. Der Gestank von draußen dringt durch jede Ritze. Desinfektionsmittel, Benzin, Kohle – all das vermischt sich mit dem Geruch von wilden Tieren. An irgendetwas erinnert er mich, vielleicht an einen Zoo. Jedenfalls riecht es manchmal so, als würden nicht weit von hier entfernt Tiger und Kamele leben. Unten schimpft Mutter vor sich hin, wie so oft bekommt sie den Ofen in der Küche nicht an. Die Kohlenschaufel knallt auf die Küchenfliesen.
Mutter kommt die Treppe herauf und stößt die Tür zu meinem Zimmer auf.
»Hol die Wäsche ins Haus. Sie wird doch bei dem Wetter gar nicht richtig trocken. Was sind das überhaupt für Kleider? Das sind doch alles Sommersachen.«
»Von Sulamith«, sage ich.
Mutters Augen weiten sich.
»Was machen die hier?«
»Sie waren in einer der Umzugskisten.«
»Häng sie ab. Wir schicken sie zurück. Lidia will sie sicher haben.«
»Lidia hat Sulamiths Sachen alle weggegeben.«
»Weggegeben?«
»Ja.«
»Bring die Kleider ins Haus«, sagt Mutter, »und danach packst du endlich deine Umzugskisten aus.«
Ich laufe in den Garten, zupfe Sulamiths Kleider von der Leine und lege sie oben auf den Ofen. Meine Umzugskisten stapeln sich nun schon seit vier Wochen hier, ich habe sie kaum angerührt. Nur Sulamiths Sachen habe ich rausgeholt. Ich packe nicht aus. Es wäre, als würde ich mich ergeben, wenn ich anfinge, auszupacken. Vater und Mutter hätten dann gewonnen. Später, wenn die Kleider trocken sind, werde ich eine Kerze anzünden und Patschuli auf die Kleider tröpfeln, auf die kleinen Wassermelonen, dann werden sie nicht mehr nach Peterswalde riechen, sondern nach Sulamith, so wie früher. Früher. Es ist gar nicht lange her, es ist gar nicht her, jedenfalls nicht für mich. An manchen Tagen wache ich morgens auf und vergesse für kurze Zeit, wo ich bin. Ich höre Sulamith neben mir atmen. Ich mache die Augen auf, aber da ist niemand, und nirgendwo im Bett sind Sulamiths Haare, die mich früher immer so genervt haben, vor allem in der Dusche.
Ich stehe auf, ich laufe zum Fenster, aber da ist kein weicher Teppichboden, nur diese kalten Dielen, auf denen man sich Splitter in die nackten Fußsohlen rammt, und wenn ich rausschaue, sind da keine grünen Auen, keine Flussmündung, kein blauer Himmel, keine Sonne, die auf ein Meer aus reifen Himbeeren scheint, da sind nur diese Aschehäuser, umgeben von gefrorenen Feldern, da sind nur die Schornsteine, die Fabrik, die leeren Straßen, die Steine in den Hinterhöfen. Da huschen alte Frauen mit Kopftüchern und Einkaufsnetzen vorbei, so als herrschte Ausgangssperre, als würden jeden Moment Bomben fallen wie im Nahen Osten. Im nahen Osten, sind wir da nicht, genau genommen?
2
Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass es Unglück bringe, eine Geschichte mit dem Wetter zu beginnen, aber erstens darf ich an so was wie Glück und Unglück nicht glauben, zweitens ist ein Erdbeben genau genommen gar kein Wetter und drittens bin ich mir nicht einmal sicher, ob alles wirklich mit dem Erdbeben angefangen hat. Die vom Hochwasser immergrünen Wiesen, die sich vom Himbeerhang bis zum Fluss erstreckten, das Ufer der Sieg, an dem wir nach der Schule spielten, wenn wir nicht in den Dienst gingen, der Grund des Flusses, auf dem Glasscherben lagen, die wie Schätze aussahen, weil sie das Licht der Sonne reflektierten, überall dort unten, unerreichbar, könnte der Anfang liegen.
Schon letztes Jahr hat Sulamith die frischen Himbeeren anders gegessen als zuvor. Sie kuschelte die Himbeeren nicht mehr wie Stofftiere an ihre Lippen, sondern küsste sie und flüsterte jeder einzelnen etwas zu, das niemand hören sollte, nicht einmal ich. Vielleicht hat sie den Himbeeren Worte mitgegeben, die sie selbst gerne von jemandem gehört hätte, wie das Versprechen einer liebevollen Mutter, die ihren Kindern etwas Zuversicht mit auf einen ungewissen Weg gibt.
Ich kann mich kaum an einen Tag in meinem Leben erinnern, den ich ohne Sulamith verbracht habe. Sie war schon da, bevor die Welt zu der wurde, die sie heute ist. Wir gingen zusammen in den Kindergarten und in die Schule, wir fuhren zusammen in den Urlaub und standen jeden Samstag gemeinsam auf dem Marktplatz vor dem Kaufhof im Straßendienst. Zu Menschen aus der Welt hatten wir nur sehr wenig Kontakt. Manche von uns Kindern aus der Wahrheit gingen auf dieselben Schulen, aber wir fuhren nicht auf Klassenfahrten und nahmen auch nicht an Krippenspielen, Karnevalspartys oder Martinsumzügen teil. Unsere Eltern gingen weltlichen Arbeiten nach, aber sie wählten nicht und bekleideten auch keine weltlichen Ämter. Unser Platz war nicht in dieser Welt. Wir hofften auf das Ende des Systems der Dinge, auf die Zeit, in der wir auf der Erde ein Paradies errichten würden und Gott regierte.
Nach dem großen Sommerkongress nahm Papa sich die Sommerferien meistens frei, um mit uns und den anderen Brüdern nach Soulac-sur-Mer zu fahren. Der Bus von Silas Reisen holte uns vom Kongressgelände ab, er gehörte Mischas Eltern, Bruder und Schwester Reinhardt. Mit Silas Reisen fuhren nur Glaubensbrüder in den Urlaub. So hatten wir Kinder auch in den Ferien immer jemanden zum Spielen. Oft saßen wir nach den Zusammenkünften, die wir in dem Reisebus abhielten, gemeinsam auf dem Campingplatz um das Lagerfeuer, sangen Königreichslieder und Bruder Reinhardt begleitete uns auf dem Akkordeon.
Alle Kinder aus unserer Versammlung liebten das Meer, nur Sulamith und ich nicht. Während Rebekka, Tabea und die anderen am Wasser mit ihren Förmchen spielten, machten uns die wilden Wellen Angst. Wir glaubten, dass sie uns mit ihren lauten, gurgelnden Stimmen ins Meer locken wollten. Mama und Lidia wunderten sich, und wenn Sulamith und ich Hand in Hand den Strand entlangspazierten, versuchten sie uns immer wieder zu versichern, dass die Wellen uns nichts Böses wollten, doch wir glaubten ihnen nicht.
Als ich älter wurde, fürchtete ich mich nur noch, wenn am Strand die rote Fahne wehte und die starke Strömung an meinen Fersen zog, doch Sulamith verlor die Angst vor dem Atlantik nie. Zusammen mit Mischa, der seit jeher in sie verliebt war, baute Sulamith jeden Sommer meterhohe Sandburgen. Tobias zog Mischa damit auf, aber Mischa war das egal. Er wusste, irgendwann würde er Sulamith und ihn in Ruhe lassen, um Rebekka, Tabea und seine kleine Schwester Damaris weiter über den Strand zu jagen. Schweigend errichtete Sulamith neben den Klippen hohe Mauern aus Sand, die uns alle beschützen sollten, falls die Flut einmal unerwartet käme. Nicht einmal den Gezeiten traute sie.
Zu Hause, wenn die Tage im Winter kürzer wurden und wir schon früh im Bett lagen, las Mama uns vor dem Schlafengehen aus Mein Buch mit biblischen Geschichten vor. Vor allem die frühen Geschichten beeindruckten uns. Brüder schlugen sich tot, Engel wurden zu Dämonen und verbrüderten sich mit Satan, bis Jehova sie allesamt aus dem Himmel verbannte und auf die Erde schleuderte. Auf der Erde nahmen die Dämonen dann Menschengestalt an und legten sich zu den sterblichen Frauen, die Riesen gebaren. Die Riesen wurden Nephillim genannt, sie knechteten die Menschen, bis Jehova die Sintflut schickte und die Nephillim vernichtete. Die Dämonen waren damit jedoch nicht aus der Welt. Dämonen waren wie Unkraut, unvergänglich. Wenn wir abends im Bett lagen und das Licht der vorbeifahrenden Autos durch die schmalen Spalten der Rollläden drang, glaubten wir, dass dieses scharfe Licht, das anscheinend genau wusste, wohin es wollte, die Spur war, die die Dämonen hinterließen, wenn sie nachts herauskamen. So wie die Schnecken im Gemüsebeet auf dem Salat Schleimspuren hinterließen, hinterließen die Dämonen Spuren aus Licht im Dunkeln. Wir glaubten, die Dämonen kämen nachts heraus, während wir schliefen, um sich in uns einzunisten, weil sie tagsüber, wenn wir wach waren, keine Gelegenheit dazu hatten.
Wir trauten uns nicht, Mama oder Lidia von dem Licht zu erzählen. Mama sagte oft, dass unser Haus, bevor wir dort eingezogen waren, voll von Dingen gewesen sei, die Dämonen anzogen. Mama und Papa hatten alles verbrannt, aber wer weiß, vielleicht ließen Dämonen sich gar nicht vertreiben, nur weil die Sachen, die sie mochten, nicht mehr da waren. Also lagen wir starr im Bett und trauten uns nicht aufzustehen, nicht mal auf die Toilette trauten wir uns, die Dämonen hätten uns auf dem Weg dahin fangen können. Oft schliefen wir erst ein, wenn auch die Dämonen schlafen gegangen waren. Die Angst vor den Lichtern verloren wir mit der Zeit. Sie fiel uns aus, genau wie unsere Milchzähne. Die Angst vor den Dämonen blieb, sie wuchs und wuchs, egal wie sehr wir uns bemühten, gegen sie anzukommen. Mit den Jahren wurde sie sogar größer, bis sie uns wie ein Kokon umgab, ganzjährig, ein Kokon ohne Saison, durch den wir die Welt wie hinter einem Schleier sahen.
Auf den grauen Garagenplätzen zwischen dem Himbeerhang und der Blumensiedlung brachte Papa uns das Fahrradfahren bei, ein Jahr später wurden wir eingeschult. Sulamith und ich lernten nebeneinander lesen, schreiben und rechnen. Nach der Schule machten wir zusammen Hausaufgaben, entweder bei uns oder bei Lidia, und dreimal die Woche sahen wir uns abends im Königreichssaal bei den Zusammenkünften. Meistens kam Sulamith an den Freitagen nach der Theokratischen Predigtdienstschule mit zu uns und blieb auch über Nacht. An manchen Samstagen, vor allem, wenn Lidia mal wieder in der Klinik war, durften wir in unseren Schlafanzügen neben Mama und Papa auf der Couch sitzen und Wetten dass ..? sehen. Wie alle Kinder liebten wir das Fernsehen, aber viele Sendungen durften wir nicht schauen. Schwester Albertz war nicht so streng wie Mama und Papa. Rebekka und Tabea durften Pumuckl sehen, Tobias durfte sogar Alf schauen und den Räuber Hotzenplotz, obwohl sein Vater Ältester war und seine Mutter Pionierin. Wir nicht. In Mamas Augen war der Pumuckl ein Kobold und könnte Dämonen anziehen. Alf war ein Außerirdischer, Gott und seine irdische Schöpfung würden durch jemanden wie ihn verhöhnt, der Räuber Hotzenplotz war ein Verbrecher, und Die kleine Hexe war, wie der Name bereits sagte, eine Hexe. Anderen Eltern vorzuschreiben, was ihre Kinder sehen durften und was nicht, traute Mama sich jedoch nicht. Der treue und verständige Sklave, unsere leitende Körperschaft, ließ es nicht zu, dass Frauen andere zurechtweisen, schon gar keine Männer. Das Haupt jeden Mannes ist Christus, das Haupt jeder Frau aber ist ihr Mann, so steht es geschrieben. Die Kassetten von Benjamin Blümchen, die Sulamith manchmal aus der Stadtbücherei auslieh, erlaubte Mama uns zu hören. Ein sprechender Elefant war in ihren Augen kein Problem.
In der Schule sahen Sulamith und ich einmal Ronja Räubertochter. Die ersten beiden Stunden fielen aus und wir wurden zu einer anderen Klasse in die Aula gesetzt. Verteilt auf Sofasäcken hockten wir zwischen den Weltkindern. Hätte Mama das gewusst, sie hätte es niemals erlaubt. Mama erkundigte sich regelmäßig bei den Lehrern nach dem Lehrplan, nach Klassenausflügen oder Projektwochen. Wenn es nur irgend ging, ließ sie uns davon befreien. Stumm starrten wir auf die Leinwand. Da lief ein Mädchen durchs Gebirge und ärgerte sich über Rumpelwichte, ging nackt mit einem Jungen schwimmen und unterhielt sich mit Graugnomen. Am Himmel flogen Wilddruden, menschenfressende Greifvögel, sie hatten Zitzen am Bauch und schrien.
»Menschenkinder, Menschenkinder!«
Sulamith krallte sich an mir fest.
»Busenvögel«, flüsterte sie.
Es war das erste Mal, dass wir nackte Brüste sahen, auch wenn es nur die von Fantasievögeln waren.
Bei Wetten dass ..? gab es keine Wilddruden und Rumpelwichte. Überhaupt war Frank Elstner in den Augen von Mama und Papa ein anständiger Mann, auch wenn er nicht in der Wahrheit wandelte. Mama und Papa wiesen uns immer darauf hin, dass niemand wissen könne, wen Jehova in der Schlacht von Harmagedon vernichten würde und wen nicht. Ich glaube, heimlich hofften sie, dass Frank Elstner es schaffen und seine Show im Paradies mit Jehovas Segen fortsetzen würde.
Einmal traten zwei Frauen auf, die wetteten, sich nur mit ihren Augen verständigen zu können. Frank Elstner schrieb kurze Sätze auf Papier, die er einer der beiden hinhielt. Abwechselnd rollten und verdrehten die beiden Frauen die Augen. Sie sahen aus wie Lidia, wenn sie einen Anfall bekam, aber den Frauen fehlte nichts, sie redeten tatsächlich miteinander. Ich sehe die beiden noch heute dort stehen, ihre Blusen in einer Farbe, als hätte man sie durch schwarzen Tee gezogen, ihre ernsten Gesichter, so als ginge es nicht um Unterhaltung, sondern um Leben und Tod, darunter die grelle Nummer, die man anrufen konnte, um sie zu Wettköniginnen zu machen, und daneben der fröhliche Frank Elstner mit seinen Karteikarten in der Hand.
Eine ganze Weile versuchten Sulamith und ich, es diesen Frauen nachzutun. Wir wollten auch miteinander reden, ohne dass man uns verstand, doch wir bekamen Kopfschmerzen vom vielen Augenrollen, außerdem klappte es bei uns einfach nicht. Stattdessen fingen wir mit den Daycahiers an. Die Daycahiers waren normale Schulhefte. Wir kauften sie bei Gretchens Teestübchen, wo wir all unsere Schulsachen kauften. Einen Tag nahm Sulamith das Daycahier mit heim, am nächsten Tag gab sie es mir, und ich schrieb hinein.
»Was haben sich zwei Mädchen, die den ganzen Tag zusammen sind, denn noch zu schreiben?«, fragte Papa manchmal, wenn er eine von uns mit dem Heft sah, doch über die Jahre füllten wir unzählige Daycahiers, bis sie am Ende alle in dem kleinen Raum vom Königreichssaal landeten, der sonst für die Theokratische Predigtdienstschule genutzt wurde, aufgestapelt vor Papa und Bruder Schuster bei Sulamiths Rechtskomitee. An jenem Abend betrat Sulamith den Saal zum letzten Mal. Lidia schluchzte so laut, dass ich es bis zur Auffahrt hören konnte, wo ich heimlich auf Sulamith wartete. Als ich Lidia weinen hörte, wusste ich, dass es vorbei war. Ich erinnere mich an das fiebrige Gefühl, an die Schwüle und an den Moment, in dem Sulamith mit den Daycahiers im Arm um die Ecke bog. Die Luft war feucht und erfüllt vom Duft der Hagebuttensträucher neben der Auffahrt, er mischte sich mit dem Duft nach Patschuli, den Sulamith verströmte, und hinten in meinem Rachen hing der schwere Geschmack überreifer Himbeeren fest.
Sulamith war fünf, als Lidia mit ihr nach Deutschland floh. Hunderte von Kilometern liefen sie vom Banat in Rumänien aus in Richtung Westen. Lidia hatte sich mit Vaseline eingecremt und schwamm in einem viel zu dünnen Kleid mit Sulamith auf dem Rücken durch die Donau. Tagelang versteckten sie sich im Dickicht neben der Straße, die nach Westen führte, bis jemand sie mitnahm. Über die Details ihrer Flucht sprach Lidia nicht, nur eines sagte sie immer wieder:
»Niemand kann eine Flucht ohne die Hilfe Gottes überleben. Wenn du fliehst und unversehrt dein Ziel erreichst, spätestens dann glaubst du an einen Gott, daran, dass er dich auserwählt hat. Denkt nur an die Israeliten und ihren Auszug aus Ägypten, wie oft Jehova ihnen half. Die Wolken- und die Feuersäulen, die Teilung des Meeres, das Manna und das Wasser, das aus dem Felsen sprudelte, als sie monatelang durch die Wüste marschierten und fast verhungert und verdurstet wären. Auch für mich hat Jehova das Meer geteilt, die Donau war so seicht und sanft wie nie. Jehova hat die Donau sanft gemacht. Ich weiß, ich sollte leben, damit ich Jehova dienen kann.«
Als Lidia und Sulamith die deutsche Grenze erreicht hatten, wurden sie in eine der Notunterkünfte gebracht, die damals für die Flüchtlinge aus den Ostblockstaaten bereitstanden. Dutzende Menschen warteten vor den niedrigen Baracken, müde und gleichzeitig erleichtert, dazwischen die Brüder in ihren sauberen Anzügen und die Schwestern in knielangen Röcken, sie boten unsere Zeitschriften an und redeten mit den Neuankömmlingen über die Verheißungen der Bibel. Auch Mama fuhr regelmäßig dorthin und nahm mich immer mit. Ich weiß noch, wie Mama auf Lidia zuging, ich erinnere mich daran, wie ich Lidia zum ersten Mal etwas sagen hörte, an den seltsamen Singsang ihres Akzents, wie von einer Märchenkassette. Statt Mütze sagte Lidia Mitze, statt Vögel sagte sie Veegel. Mama zeigte auf das Kreuz an Lidias Hals, sie holte ihre schöne Bibel mit dem Goldschnitt heraus und las daraus vor. Lidia lächelte dankbar. Mama packte die Bibel wieder weg, holte eine Zeitschrift aus ihrer Diensttasche und hielt sie Lidia hin. Erwachet!, Lidia schaute Mama an, als wäre sie tatsächlich gerade aufgewacht. Sulamith stand die ganze Zeit neben Lidia. Sie klammerte sich an den Saum ihrer Jacke und starrte mich neugierig an. Mama ging in die Hocke, sie holte eine Tüte Haribo Colorado heraus und füllte unsere kleinen Hände damit. Fruchtgummi, Lakritz, Gelee-Himbeeren und Konfekt. Lidia hielt die Zeitschrift in der Hand, mit Tränen in den Augen.
»Danke, liebe Dame. Danke.«
Als Lidia einige Wochen später zum ersten Mal in die Versammlung kam, trug Sulamith Spitzensöckchen und Ballerinas. Ihre langen blonden Haare hatte sie zu zwei Zöpfen geflochten, und um den Hals trug sie eine silberne Kette mit einem Mariensymbol. Mama umarmte Lidia und hockte sich wieder neben Sulamith, doch diesmal gab es keine Süßigkeiten.
»Von Jehova machen wir uns kein Bildnis«, sagte Mama und zeigte auf Sulamiths Kette.
»Das ist die Mutter Gottes«, sagte Sulamith.
»Jehova hat keine Mutter«, sagte Mama.
»Jeder hat eine Mutter«, sagte Sulamith.
»Jehova nicht«, sagte Mama, »er ist der Schöpfer der Welt. Er hat uns zehn Gebote gegeben, und eins davon verbietet uns, so etwas zu tragen.«
Sulamith schaute Mama mit großen Augen an.
»Aber die ist von meinem Vati«, flüsterte sie.
»Es ist egal, von wem sie ist«, sagte Mama, »Jehova will es nicht.«
Zur nächsten Zusammenkunft trug Sulamith keine Kette mehr. Von da an gingen sie jeden Sonntag in den Königreichssaal, und es dauerte nicht lange, da kamen Lidia und Sulamith auch freitags zur Theokratischen Predigtdienstschule. Oft besuchten wir die beiden im Flüchtlingsheim. Das Zimmer war winzig und die Heizung funktionierte nicht. Sulamith saß auf dem Boden und spielte. Sie hatte zwei ausgespülte Joghurtbecher an einen Kleiderbügel gebunden, der ihr als Waage für ihren Kaufmannsladen diente. Die Kerne von Oliven, Pflaumen und Aprikosen gab es dort zu kaufen. Lidia lag meist im unteren Stockbett, blass und müde. Wenn sie aufstand, verlor sie oft das Gleichgewicht. Ich weiß, wie mich schon damals das Gefühl beschlich, dass etwas mit Lidia nicht stimmte.
Nur wenig später bekam ich zum ersten Mal mit, wie Lidia einen Anfall erlitt. Es war an einem Sonntag nach dem Wachtturmstudium. Lidia und Mama standen im Saal neben unseren Plätzen. Ich hörte Lidia noch lachen, ich blickte zu ihr, ich wollte wissen, was so lustig war, doch mitten im Gelächter begann Lidia zu zittern, als würde jemand Strom durch ihren Körper jagen. Ihre Augen verdrehten sich, ihre Lippen zuckten wie bei einer Qualle, die vor einem Jäger flieht. Schaum lief ihr aus dem Mund, dann fiel sie zwischen den Stühlen auf den Boden. Noch heute kann ich die Stille spüren, die plötzlich herrschte, gefolgt von einem aufgeregten Durcheinander. Ich schrie und konnte nicht mehr aufhören. Nichts passte besser in mein Bild von Lidia als dieser gurgelnde, zuckende Körper vor mir auf dem Teppichboden. Dieser ängstliche Abstand, den ich bisher zu Lidia gehalten hatte, wenn sie sich nach dem Essen hinter ihrer Serviette versteckte und Kuckuck mit uns spielen wollte, der kleine Plastikbeutel mit Innereien, den Mama aus dem Brathähnchen gezogen hatte, als Lidia einmal in der Gemeinschaftsküche des Flüchtlingsheims für uns gekocht hatte, einmal und nie wieder, und ihre hohe Stimme, die immer gepresst klang, als müsste sie ständig gegen einen bösen Geist ankämpfen – all das ergab plötzlich Sinn.
Mama hatte keine Angst vor Lidia. Sie legte ihren Blazer zusammen und stopfte ihn unter Lidias Kopf. Sie hielt ihr den Kiefer auseinander, damit sie sich nicht auf die Zunge biss. Papa nahm die weinende Sulamith auf den Arm. Jemand rief einen Krankenwagen. Es war das erste Mal, dass ich Sanitäter aus der Nähe sah. Breitschultrige Männer in greller Kleidung, sie kamen mit ihren schweren Stiefeln in unseren Saal gestampft und beachteten uns kaum. Nicht einer von ihnen schaute sich anerkennend um, weder der goldene Jahrestext an der Wand, noch dass wir alle so gut angezogen waren, schien Eindruck auf sie zu machen. Sie stellten Mama ein paar Fragen und packten Lidia auf eine Trage. Ich verstand es nicht: Konnten sie die Anwesenheit Gottes in diesem Saal nicht spüren? Offenbar nicht. Scham stieg in mir hoch. In ihren Augen waren wir keine Auserwählten, sondern bloß ein paar Verrückte, genau wie für alle Weltmenschen.
Lidia musste für viele Wochen in die Klinik. Ihre Anfälle waren nicht heilbar, nur für längere Phasen in den Griff zu bekommen. Mama tröstete Lidia mit dem Paradies. Dort würde es keine Krankheiten und Leiden mehr geben. In dieser Welt jedoch geschah es immer wieder nach dem gleichen Muster: Ohne Vorwarnung zuckte Lidias Gesicht, ihr ganzer Körper, sie verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Der Krankenwagen kam, die Männer packten sie auf eine Trage. Sulamiths Tränen, die Schweigsamkeit, die folgte, bis sie dann langsam wieder fröhlicher wurde und am Ende sogar fast traurig war, wenn Lidia aus der Klinik entlassen wurde und sie wieder nach Hause musste.
Solange Lidia in der Klinik war, blieb Sulamith bei uns, denn einen Vater hatte sie nicht. Das stimmte natürlich nicht, Sulamith hatte einen Vater, er war nur nicht da. Über ihn wurde nicht geredet. Ich wusste bloß, dass er Lidia sitzen gelassen hatte, nachdem sie schwanger geworden war, und dass er in Rumänien mit einer neuen Frau lebte. Als Kind wunderten mich solche Geschichten nicht. Bei den Weltfamilien gab es Scheidungen, Betrug und Gewalt. In unseren Familien nicht, wir hielten uns an die Gebote Gottes. In unserer Versammlung gab es nur wenige geteilte Familien. Rebekkas und Tabeas Vater war ein Weltmensch, doch Herr Albertz hatte nichts gegen Jehova und den treuen und verständigen Sklaven. Er kam sogar jedes Jahr mit zum Gedächtnismahl, er legte keinen Wert auf Weihnachten oder Geburtstag und glaubte auch an einen Gott. Nur das Rauchen wollte er nicht lassen. Herr Albertz war die Ausnahme. Normalerweise gab es in geteilten Familien viele Probleme. Satan hatte dort leichtes Spiel, er konnte dort besonders gut Unheil stiften, er hatte einen viel besseren Zugang zu den Gerechten, die in der Wahrheit wandelten, aber Ungläubige liebten.
»Selbst die Liebe«, sagte Papa, »selbst Gottes kostbarstes Geschenk an uns Menschen ist draußen in der Welt beschmutzt. Draußen in der Welt hat Liebe viel mit Dunkelheit zu tun.«
Ich habe nie mit Sulamith über ihren Vater geredet, erst ganz am Ende, kurz vor ihrem Rechtskomitee, schrieb sie in die Daycahiers, dass es vielleicht gar nicht stimme, was Lidia über ihren Vater erzählte, und dass sie ihn suchen wolle. Die Mauer war weg, die Grenzen nach Rumänien offen, und Daniel hatte Sulamith versprochen, ihr bei der Suche zu helfen.
Daniel meint, wir finden ihn auf jeden Fall. Sein Vater kennt Leute vom Auswärtigen Amt, die uns helfen könnten. Zur Not fahren wir in den Sommerferien einfach in den Banat. Wer weiß, hat Daniel gesagt, vielleicht hat er auch schon versucht, dich zu finden, du bist doch schließlich seine Tochter. Tochter, ich habe das Wort gestern bestimmt hundertmal vor mich hin geflüstert, dabei bin ich ja auch Mamuschs Tochter, aber wenn ich mir dabei einen Vater denke, klingt es ganz anders. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Nein, das war mir nicht aufgefallen. Aber wie Daniel klang, das war mir aufgefallen. Ein Name wie Balsam: drei weiche Konsonanten und dazwischen drei zarte Vokale, die hinteren beiden wie zwei Noten in einem Lied zusammengezogen.
Ich höre sein Skateboard über das gebohnerte Linoleum rollen, durch die Gänge der Schule, ich sehe sein blondes Haar, das unter seiner Baskenmütze hervorschaut, die an den Knien gerissene Jeans und den Aufnäher auf seinem Rucksack: eine Faust und daneben eine Hundepfote. Es ist noch nicht einmal Frühling, vor der hohen Glasfront an den Chemieräumen bauen die Blaumeisen ihre Nester. Daniel rollt mit seinem Skateboard an uns vorbei. Als er lächelt, verengen sich seine dunklen Augen zu zwei schmalen Kohlestrichen. Sulamith schaut ihm mit offenem Mund hinterher, bis er durch die Tür in Richtung Raucherecke verschwindet.
»Die Liebe ist unendlich«, wie oft habe ich das einen Ältesten auf der Bühne sagen hören, »die Liebe ist so großzügig und gütig, dass es in der Bibel sogar mehr als ein Wort für Liebe gibt.«
Agape, so heißt die Liebe zu Gott, die anderen hat man uns nicht gelehrt. Man hat uns gelehrt, dass die Liebe in der Welt so etwas wie ein Liter Milch ist. Sie wird schnell leer, viel eher, als man denkt. Sie wird schnell schlecht, man muss sie zügig aufbrauchen. Die Liebe, hat man uns gelehrt, ist in der Welt wie eine Infektion. Sie macht krank, und wenn man sie nicht früh genug behandelt, bringt sie einen um. Diese Liebe, vielleicht ist das der Anfang.
3
Draußen friert es, die Öfen sind über Nacht eiskalt geworden. Unten in der Küche schimpft Mutter vor sich hin. Sie kriegt den Kohleofen nicht an, dabei hat Bruder Lehmann es uns genau erklärt, mehrmals sogar: zuerst Altpapier anzünden, dann Anmachholz drauf, oben die Klappe aufmachen, damit Luft drankommt, Kohlen auflegen und eine halbe Stunde warten. Trotzdem, sie brennen bei uns einfach nicht richtig. Mutter ist es nicht gewohnt, und genau wie ich wird sie sich vermutlich nie daran gewöhnen, auf diese Art und Weise Wärme zu erzeugen, an den Dreck, der dabei entsteht, und an den schwarzen Staub, der am Morgen Abdrücke im Toilettenpapier hinterlässt, wenn man sich damit die Nase schnäuzt.
An Großmutter erinnert hier im Haus kaum noch etwas, vielleicht, weil sie in den letzten Jahren nicht mehr hier gelebt hat. Außerdem müssen die Brüder hier vor unserem Umzug Ordnung gemacht haben. Der Keller ist leer, bis auf ein paar Einmachgläser steht dort nichts mehr. Im Gartenschuppen liegen nur noch eine Kiste Werkzeug, ein Karton mit Schuhpflegemittel und ein paar Putzlappen. Hier oben auf dem Dachboden gab es wohl kaum etwas aufzuräumen. Die Dielen knarzen bei jedem Schritt, das Geräusch hallt lange nach zwischen den schrägen Wänden. Unter den Fenstern liegt eine leere Schnapsflasche, daneben eine alte Matratze. Ich trete mit dem Fuß darauf, Staub wirbelt auf. Ob hier jemand gewohnt hat, vielleicht ein Landstreicher? Kann eigentlich nicht sein. Landstreicher, das ist doch nur ein schöneres Wort für einen Obdachlosen, und Obdachlose gebe es hier nicht, hat Gabriel erzählt, was ich mir kaum vorstellen kann. Ich drehe den Deckel der Flasche auf und rieche daran. Ein Hauch von Alkohol kommt mir entgegen. In der Ecke, im Schatten der Schräge hinter einem Holzbalken, steht ein Weidenkorb. Vorsichtig öffne ich ihn, schwarze Kleider kommen zum Vorschein, unten am Saum zackig zurechtgeschnitten und am Rücken der Oberteile sind so etwas wie Flügel befestigt. Mindestens fünf dieser Kostüme zähle ich. Karneval feiern sie hier nicht, auch das hat Gabriel mir erzählt. Ich schaue hoch zur Decke, kurz vermute ich dort Fledermäuse, die von oben still dabei zusehen, wie ich in ihrer Wäsche wühle. Die Matratze, die Schnapsflasche, die Fledermausfetzen, ich kann mir keinen Reim darauf machen, genauso wenig wie auf die Landkarten im Kleiderschrank. Jemand steigt die Treppen hoch, ich stopfe die Kostüme zurück in den Korb. Die Tür geht auf.
»Hier bist du«, sagt Mutter, »ich habe dich schon überall gesucht.«
Ihr starrer Katzenblick gleitet einmal durch den Raum – die kahlen Wände, die Matratze, die Schnapsflasche und der Verschluss, den ich vergessen habe, wieder zuzuschrauben.
»Komm runter, ich will dir mein neues Gebiet zeigen«, sagt sie.
»Ich bin müde.«
»Hast du nicht gut geschlafen?«
»Nein. Ich wollte mich noch etwas hinlegen.«
»Wenn du dich jetzt wieder hinlegst, schläfst du später schlecht«, sagt Mutter, »so etwas nennt man Teufelskreis. Bis du wieder in die Schule gehst, machst du dich nützlich und kommst mit mir in den Dienst. Zieh dich anbetungswürdig an, ich warte unten auf dich.«
Anbetungswürdig heißt, ich soll einen Rock oder ein Kleid anziehen. Ich hasse Röcke, ich hasse Kleider. Wenn meine Sachen wenigstens nicht alle von C&A wären. Mutter würde niemals etwas von C&A tragen, aber ich bin angeblich zu jung für teure Sachen, ich wachse noch viel zu schnell.
Mutter sitzt schon unten im Wagen und spielt mit dem Gas, wie ein Mädchen, das mit ihrem Hengst am Halfter herumstolziert. Angeberin. Wie kann man ausgerechnet hier einen nagelneuen BMW fahren? Ein unauffälliges Auto würde viel besser passen. Im Gegenteil, finden Vater und Mutter. Wer an den richtigen Gott glaubt, der fährt auch das richtige Auto. Mutter und Vater wollen, dass die Weltmenschen von unserem Auto auf den treuen und verständigen Sklaven schließen und davon ausgehen, zwischen Jehova und teuren Autos bestünde eine besondere Verbindung.
Ich setze mich auf die Beifahrerseite und schnalle mich an. Das Auto gleitet über die neue Straße. Draußen sind abgeerntete Felder zu sehen, verfallene Höfe. Hinter den Mauerskeletten wachsen Birken. Mutter biegt ab. Sie streckt den Arm aus und zeigt auf den Horizont. Hochhäuser. Grau-weiß türmen sie sich nebeneinander auf.
»Mein neues Gebiet«, sagt Mutter, »dort ist noch nie jemand von Haus zu Haus gegangen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist wie unberührter Schnee.«
»Haben die Brüder hier nicht gepredigt?«
»Nicht in Mehrfamiliensiedlungen«, sagt Mutter, »nur in Gebieten mit Einfamilienhäusern. Hier wäre es zu gefährlich gewesen.«
»Wieso?«
»Bei Mehrfamilienhäusern konnten sie nicht unbeobachtet von Tür zu Tür gehen. Die Brüder hier hatten eine Strategie. Sie haben im Predigtdienst eine Hausnummer ausgewählt und in jeder Straße nur dort geklingelt. Am nächsten Tag haben sie sich eine neue Hausnummer gesucht und haben in allen Straßen dort geklingelt. Und so weiter. So fiel es nicht auf.«
Mutter atmet auf.
»Jetzt ist alles anders«, sagt sie, »jetzt steht hier ein Saal, und er sieht fast genauso aus wie unser alter Saal in Geisrath, findest du nicht? Niemals hätte ich das geglaubt.«
Mutter parkt das Auto vor der Hochhaussiedlung. Ich schaue an der Fassade hoch und zähle die Stockwerke. Mutter holt ein Ringbuch aus ihrer Diensttasche hervor, darin liegt ihre Gebietskarte. Auf einer Ringbucheinlage trägt sie den Straßennamen und die Hausnummer ein.
»Wer ist das?«, frage ich.
»Wer?«, fragt Mutter.
»Die Frau, nach der diese Straße benannt wurde.«
»War. Politikerin. Wollte die Welt verändern. Man hat sie ermordet.«
Mutter schließt die Augen und faltet die Hände.
»Herr Jehova, der du thronst in den Himmeln. Wir stehen nun zum ersten Mal vor diesen Häusern, denen so lange die frohe Botschaft vorenthalten wurde. Die Schafe haben sicher Hunger, sie haben sicher Durst, sie suchen einen Hirten. Und dass du uns hierher gesandt hast, dass wir das Vorrecht haben, deine Wahrheit zu verkünden, dafür danken wir dir. Bitte lass deine Botschaft vom Königreich auf fruchtbaren Boden fallen, auf dass die Menschen ein offenes Ohr für die Wahrheit haben. Gib uns die Kraft, diese Menschen ins Licht zu führen, auf den schmalen Pfad der Gerechten. Amen.«
»Amen«, murmele ich.
Mutter schaut auf die vielen Klingelschilder. Klingelschilder sind für Mutter das, was für andere Leute Pralinen sind. Sie gleitet mit den Fingern darüber, als könnte sie sich nicht entscheiden, welches sie als Erstes verschlingen soll. Die Glastür ist beschmiert. Hausieren verboten, steht dort, daneben ein sonderbares Zeichen, das ich noch nie gesehen haben, eine Art durchkreuzter Kreis. Mutter drückt auf eine Klingel, die zu einer Wohnung im Erdgeschoss gehört. Nichts. Noch einmal. Nichts. Mutter überträgt den Namen, der auf dem Klingelschild steht, in ihr Ringbuch und schreibt ND daneben. Nicht da.
Mutter drückt auf die nächste Klingel. Nichts. Mutter klingelt wieder. Nichts. Sie überträgt die Namen in ihr Ringbuch. ND. Neben dem sonderbaren Zeichen an der Tür klebt ein Fahndungsplakat. Ich habe es schon öfters gesehen. Der Mann auf dem Bild ist offenbar auf der Flucht, die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung, aber ich bekomme jedes Mal, wenn ich dieses Plakat sehe, gute Laune, denn der Mann darauf sieht Vater ähnlich, und jedes Mal, wenn ich das Bild sehe, stelle ich mir vor, Vater wäre ein gesuchter Verbrecher.
»Das kann doch nicht sein«, sagt Mutter und schaut an der Fassade hoch.
»Was?«
»Dass niemand da ist.«
»Wieso? Es ist doch mitten am Tag.«
»Die meisten haben doch keine Arbeit mehr«, sagt Mutter.
Die Sprechanlage knackt.
»Ja?«
Mutter räuspert sich.
»Guten Tag, mein Name ist Elisabeth Joellenbeck, und ich bin heute mit meiner Tochter in Ihrer Gegend unterwegs. Können Sie uns bitte die Tür öffnen? Wir möchten gern mit Ihnen über die Bibel und ihre Verheißungen für die Zukunft sprechen.«
»Ich glaube nicht an Gott.«
»Ich verstehe. Es ist nicht einfach in diesen Zeiten, den Glauben an ein höheres Wesen, das uns lenkt und beschützt, zu bewahren. Wissen Sie, dass die Bibel uns ein wunderbares Paradies auf Erden verspricht?«
Die Stimme aus der Sprechanlage lacht.
»Hat man uns hier auch versprochen.«
»Haben Sie schon einmal mit einem unserer Glaubensbrüder über die Verheißungen der Bibel gesprochen?«, fragt Mutter.
»Nicht dass ich wüsste.«
»Ich verstehe. Wenn man die Weltlage betrachtet, fällt es schwer, auf die Bibel oder auf Gott zu vertrauen. Trotzdem lohnt es sich, gerade weil die Weltregierungen uns im Stich lassen. Auch Sie sollten auf Gott vertrauen.«
»Leider keine Zeit gerade.«
Mutter rückt näher an den Lautsprecher.
»Kein Problem, wir können gern ein andermal wiederkommen.«
»Nein, danke. Kein Interesse.«
Die Sprechanlage knackt. Mutter schreibt den Namen auf und daneben KI. Kein Interesse. Im Erdgeschoss zuckt eine Gardine. Ein Fenster geht auf. Eine alte Frau schaut heraus, sie trägt ein Kopftuch, in der Hand hält sie einen Putzlappen.
»Was wollen Sie hier?«, ruft sie.
Mutter lächelt freundlich.
»Guten Tag! Wir sind heute hier, um die frohe Botschaft vom Königreich zu verkünden. Möchten Sie nicht auch ewig leben?«
»Haben Sie das Schild an der Tür nicht gesehen?«
»Doch. Wir hausieren nicht. Wir verkünden die Botschaft der Bibel.«
»Verschwinden Sie«, sagt die Frau, »sonst hole ich die Polizei.«
»Uns steht es frei, von Haus zu Haus zu gehen und unseren Glauben zu verbreiten«, antwortet Mutter.
Es gibt Leute, die reiben sich im Winter mit Schnee ein. Mutter ist so jemand. Sie reibt sich nicht wirklich mit Schnee ein, aber sie fühlt sich lebendig bei solchen Auseinandersetzungen. Ich hasse so etwas. Das Geschrei, die Demütigungen. Mutter nicht. Mutter genießt die Wut und den Hass, den die Frau ihr entgegenschleudert, so lange, bis sie müde wird, das Fenster wieder schließt und stumm hinter der Scheibe weiterschimpft. Mutter drückt auf die nächste Klingel und lächelt ihr Gewinnerinnenlächeln.
»Jesus hat vorausgesagt, dass die Welt uns hassen wird für unser Predigtwerk.«
»Weiß ich.«
»Das wird uns hier noch oft passieren«, sagt Mutter, »wir sind hier nicht in Geisrath, die Menschen hier sind viel misstrauischer.«
»In Geisrath sind wir auch ständig beschimpft worden.« Mutter schüttelt den Kopf.
»Hier ist das etwas anderes. Man hat den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen. Nichts davon ist in Erfüllung gegangen.«
»Immerhin dürfen wir jetzt von Haus zu Haus gehen«, antworte ich.
»Wer weiß, wie lange noch«, sagt Mutter und atmet tief durch, »vielleicht sperren sie uns auch bald ein, wie deine Großmutter.«
Noch immer ist die Stelle nicht richtig verheilt, selbst durch den dicken Wintermantel hindurch kann ich ihn spüren, diesen blauen Kranz, den Mutter mir mit ihrem harten Griff einmal rund um den Oberarm gestempelt hat, obwohl es jetzt schon eine Weile her ist. Auf dem Weg von Geisrath nach Peterswalde, als sie vor der Gedenkstätte hielt, mich aus dem Auto zerrte und unter dem Torbogen hindurch auf den leeren Platz schubste. Die vielen kleinen Namen auf dem Mahnmal, ich konnte sie kaum lesen, so dicht waren die Sterne, die vor meinen Augen tanzten.
Die Sprechanlage knackt.
»Ja?«, meldet sich eine Frauenstimme.
»Guten Tag«, sagt Mutter, »wir möchten gern über etwas mit Ihnen sprechen, was Ihre Zukunft maßgeblich beeinflussen wird.«
»Sind Sie der Gerichtsvollzieher?«, fragt die Frau.
Mutter schweigt. Die Tür wird aufgedrückt. Wir gehen zum Aufzug und fahren in den obersten Stock.
»Sprich du sie an«, sagt Mutter und zwinkert mir aufmunternd zu.
Ich taste in meiner Diensttasche nach den Zeitschriften. Die Aufzugtür öffnet sich. Der Geruch von ausgekochten Markknochen schlägt uns entgegen. Am anderen Ende des Flurs steht eine Frau. Sie trägt ein T-Shirt mit einem Herz darauf und lehnt im Türrahmen. Zigarettenrauch steigt bläulich an ihr hoch.
»Sind Sie der Gerichtsvollzieher?«, ruft die Frau wieder.
»Guten Tag«, sage ich.
»Sind Sie es oder nicht?«, fragt sie.
»Was?«
»Der Gerichtsvollzieher.«
Mutter hebt die Augenbrauen, als würde auch sie wissen wollen, ob ich der Gerichtsvollzieher bin.
»Nein«, sage ich. »Es gibt einen Grund für Sie, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Darüber möchten wir mit Ihnen reden.«



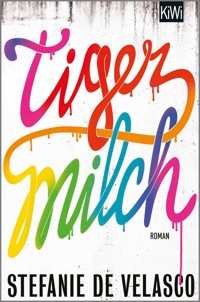














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










