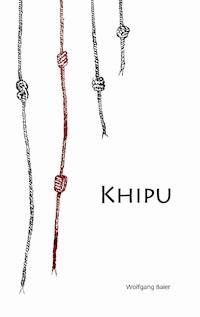
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jorge und Roberto sind Halbwaisen und leben in einem Elendsviertel einer Küstenstadt im Süden Perus. Als eine Cholera-Epidemie ausbricht, stirbt ihre Mutter. Auf sich alleine gestellt, versuchen sie, über die Runden zu kommen. Bald erkennen sie, dass es ohne kleine Diebstähle nicht geht. Sie werden von der Polizei festgenommen und tagelang verhört. Zu ihrem Erstaunen bietet ihnen der Polizeichef ein Tauschgeschäft an: Sie kommen frei, wenn sie für ihn auf den alten Inka-Friedhöfen nach Gold, Silber und wertvoller Keramik graben. In ihrer Not gehen sie auf einen nicht ungefährlichen Handel ein und geben ihrem Leben damit eine gefährliche Wendung...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Noah und Bastian
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
1
Coco war müde, hundemüde. Die Stimme von Señor Ortíz, seinem Geschichtslehrer, drang nur schwach an sein Ohr, als habe sie eine dicke Bretterwand durchdringen müssen. Coco war erschöpft. Er mochte Geschichte, Geschichte war sogar sein Lieblingsfach. Noch eine Stunde, dachte er erleichtert, dann ist es neun Uhr abends und die Abendschicht zu Ende. Dann könne er nach Hause gehen.
Was Señor Ortiz an die Tafel schrieb, konnte man von Cocos Platz aus kaum lesen. Die Tafel war zu glatt, die Kreide zu hart, als dass sie sichtbare Schriftspuren auch für die hinteren Tischreihen hinterlassen hätte. Nur eine von drei Neonröhren funktionierte. Die beiden anderen brummten vor sich hin, grell zuckend. Und selbst wenn man etwas hätte lesen können, so wäre das Schreiben zum nächsten Problem geworden. Zu dicht saßen die Schüler.
Als er in die Sekundarstufe eingetreten war, hatte man ihn für die Abendschicht der Nationalschule ‚Miguel Grau‘ eingeteilt. Die Stadt Camaná besaß nicht genug Schulen für alle Kinder. So blieb nichts anderes übrig, als morgens, nachmittags und abends in den Klassenzimmern zu unterrichten. Wer nachmittags zur Schule ging, war arm, wer abends zur Schule gehen musste, war bettelarm. Am Vormittag und Nachmittag lebten Coco und sein Bruder Roberto, der in die siebente Klasse ging, auf den Märkten. Sie putzten Schuhe und trugen gut gekleideten Damen die Körbe und Einkaufstaschen zu ihren Autos. Damit ernährten sie mehr schlecht als recht die Familie. Einen Vater gab es schon lange nicht mehr und die Mutter lag schwer krank darnieder.
Als die Brüder nach dem Unterricht in der Dunkelheit schweigend über die staubigen Straßen des Armenviertels ‚28 de Julio‘ nach Hause gingen, wussten sie, was sie erwartete. Ihre Mutter lag schweißgebadet in ihrem Bett und starrte in die Dunkelheit. Die Augen glänzten fiebrig im spärlichen Schein einer Glühbirne, die an zwei Drähten von einem Balken herabhing. Frau Perea und andere Nachbarinnen wechselten sich seit Tagen am Krankenbett bei der Pflege ab, während Coco und Roberto in der Schule oder beim Arbeiten waren.
„Mama, wie geht es dir?“, flüsterte Coco besorgt.
Statt einer Antwort schüttelte sie mit Mühe den Kopf, ohne den Blick von der Decke zu lösen.
Vor zwei Wochen hatte es mit Bauchschmerzen und Fieber begonnen, dann übergab sie sich, und wässrige Durchfälle fesselten sie an die Kloake, welche nicht mehr war als ein Winkel aus Strohmatten hinter dem Haus, mit einem Loch im Boden. Eine Krankenschwester der Sanitätsstation in ‚28 de Julio‘ hatte nüchtern festgestellt, dass Frau Ninataype an Cholera erkrankt sei, und ihr deshalb Infusionen angelegt. Danach war sie mit Medikamenten nach Hause geschickt worden. Besonders viel müsse sie nun trinken, vor allem sogenannte Elektrolyte, hatte man ihr geraten.
Seit Monaten grassierte an der Küste Perus die Cholera. Die Krankenhäuser quollen über, auf den Friedhöfen kamen sie mit den Bestattungen kaum nach. An eine Aufnahme in das einzige Krankenhaus der Stadt war gar nicht zu denken. Sie hatten weder eine Krankenversicherung noch das Geld, um sich ein Krankenbett zu ‚kaufen‘.
Acht Tage später waren Coco und Roberto Waisen.
2
Coco und Roberto hatten noch drei Schwestern. Sie lebten in Lima und arbeiteten als Hausmädchen bei wohlhabenden Familien. Sie wohnten auch dort, meist neben der Küche in Zimmerchen, welche gerade mal Platz für ein Bett und einen Stuhl boten, auf dem gewöhnlich ein alter, winziger Fernseher stand, zur Unterhaltung während der spärlich bemessenen Freizeit. „Wenn ihr in Lima auftaucht, können wir am selben Tag unsere Sachen packen!“, warnten die drei ihre Brüder. „Wir sind froh, dass wir überhaupt Arbeit haben und nicht hungern müssen und ein bisschen Geld verdienen. Und sogar bei der Sozialversicherung haben sie uns angemeldet.“ Damit waren die anfänglichen Pläne von Coco und Roberto, zu den Schwestern in die Hauptstadt zu ziehen, vom Tisch.
Hätten sich die Nachbarn nicht solidarisch gezeigt, ein Schicksal als Straßenkind wäre den beiden sicher gewesen. Obwohl alle Bewohner des Pueblo Joven ‚28 de Julio‘ arme Leute waren und Hunger litten, hatten sie für die Verstorbene einen einfachen Sarg besorgt und eine schlichte Beerdigung in der Wüste am Rande der Siedlung auf einem sogenannten ‚wilden Friedhof‘ organisiert. Nun wollten sie sich gemeinsam der Jungen annehmen. Eine einfache Hütte aus Blech und Holz und Pappe mit einem löchrigen Dach besaßen sie immerhin.
Als sie eine Woche nach der Beerdigung wieder in der Schule auftauchten, erzählte Herr Ortiz gerade vom Inkareich, dem Tahuantin-suyo und sei-nen vier Teilreichen Conde-suyo, Chinchay-suyo, Colla-suyo und Anti-suyo. Das Mitgefühl der Klassenkameraden war herzlich gewesen, aber am Ende des Tages war der Existenzkampf weitergegangen. Jeder trug hier irgendeine Last. Hier war das Leben hart, eben ein Kampf.
Coco und Roberto hatten beschlossen, dort weiterzumachen, wo der Tod der Mutter ihr Leben für einen Moment angehalten hatte. Am nächsten Morgen wollten sie wieder Geld verdienen gehen. Als sie jedoch an ihre angestammten Parkbänke kamen, mussten sie feststellen, dass diese schon besetzt waren. Andere Jungen putzten eifrig schwarze und braune Lederschuhe, welche ältere Herren in Schlips und Anzug auf die Schuhputzkästchen setzten. Das Kästchen war das Kennzeichen ihrer Zunft und barg Arbeitsmaterialien und Werkzeug: Wasserfläschchen, Blechdöschen für schwarze, braune und farblose Schuhcreme, Bürsten mit groben und feinen Borsten und Lappen.
„Heh ihr da, das ist unser Platz! Haut ab!“, protestierten Coco und Roberto.
„Das könnte euch so passen! Die ganze Woche schuften wir hier schon, wir haben euch nirgendwo gesehen.“
„Wir mussten unsere Mutter begraben, deshalb konnten wir nicht arbeiten.“
„Klar, natürlich, ihre Mutter ist gestorben! Habt ihr schon mal eine blödere Ausrede gehört?“, fragten sie ihre Kumpel mit großspuriger Stimme, die den aufkeimenden Konflikt aus der Ferne beobachtet hatten und zur Unterstützung angerückt waren. Der Kunde, ein älterer Herr, hatte sich den Wortwechsel eine Weile wortlos angehört. „Ich glaube, ihr tragt zuerst euren Streit aus!“, sagte er ernst, „und dann könnt ihr wieder ans Geschäft denken.“ Er stand auf, drückte dem Schuhputzer einen 500-Soles-Schein in die Hand und ging.
„Das habt ihr jetzt davon! Fast fertig, und nicht für die Hälfte hat er bezahlt, euretwegen! Verpisst euch, ihr Idioten!“, schrie er wütend.
Coco und Roberto spürten, dass sie in der schwächeren Position waren.
„Roberto, lass es uns auf dem Markt versuchen. Vielleicht finden wir ein paar Frauen mit schweren Einkaufstaschen.“
Auf dem Weg zur Schule machten sie eine Pause an einem winzigen Verkaufsstand, an dem eine Frau Suppe anbot. Immerhin reichten die Einnahmen für einen Teller warmer Gemüsesuppe, den sie sich teilten.
Seit dem einen Brötchen am Morgen und einem Becher Tee, den sie sich bei Frau Perea hatten abholen dürfen, hatten sie den ganzen Tag über nichts gegessen.
„Wie sollen wir denn den Unterricht überstehen?“, fragte Roberto niedergeschlagen. „Mir knurrt jetzt schon wieder der Magen.“
„Wir packen das! Keine Sorge! Wir fangen doch gerade erst wieder an, du wirst schon sehen“, beruhigte Coco seinen Bruder. Robertos Miene blieb bedrückt. Oft presste er heimlich die Faust unter dem Rippenbogen gegen seinen Bauch, um das Stechen zu bekämpfen, das ihm fast den Atem nahm. Mit Mühe überstanden sie die Stunden in der Schule. Auf dem Heimweg schwiegen sie.
3
Cocos Zuversicht war auch nach Wochen nur Zuversicht geblieben, nicht mehr. Die Geschäfte liefen miserabel. Ihre guten Plätze waren und blieben besetzt. Sie spürten, dass auch die Bereitschaft der Nachbarn, sie durchzufüttern, erschlaffte. Es gab nur noch Tee, aber keine Brötchen, nur noch dünne Suppe, aber ohne Gemüse. Es fiel zunehmend schwerer, im Unterricht aufmerksam zu sein.
Andrés, ein Klassenkamerad von Coco, war aufgefallen, dass Coco jeden Abend wie geistesabwesend auf seinem Stuhl saß und auf den Tisch stierte.
„Mensch Coco, was ist los mit dir? Du bist ja wie weggetreten. Jeden Tag dasselbe.“
„Wir haben Hunger, Hunger, Hunger! Wir haben kaum Geld, um uns etwas zu kaufen. Dort, wo wir jetzt auf Kundschaft warten, ist nicht viel los. Von der Plaza haben sie uns vertrieben. Gäbe es die Señoras in der Nachbarschaft nicht, wir wären schon verhungert. Oft füllen wir uns den Bauch mit Wasser, um wenigstens in der Schule dieses Grimmen im Bauch nicht zu spüren.“
„Habt ihr es mal mit Schnüffeln von Klebstoff versucht? Ich sag dir, du spürst keinen Hunger mehr, du brauchst ganz wenig Essen. Das Zeug ist billig, da kannst du dich für 10.000 Soles monatelang zudröhnen.“
In der Pause kam Andrés mit einer Plastikflasche daher, in der eine braune schmierige Masse klebte.
„Coco, versuch es! Du wirst sehen, wie es dir gleich besser geht. Ich hab mich dran gewöhnt.“
Coco setzte die Flasche an die Nase und nahm einen tiefen Zug. Süßsäuerliche Dämpfe füllten die Lungenflügel bis in die Spitzen, schienen die Lungenbläschen zu verätzen. Coco wurde schwindlig und ein Hustenkrampf schüttelte ihn. Dann würgte es ihn und er spie einen Mund voll grünbrauner Galle in den Staub.
Andrés lachte. „Das passiert nur am Anfang. Sobald du es gewöhnt bist, bringt es echt Erleichterung“, beruhigte er.
Coco und Roberto hatten davon gehört, dass es bei den Banden von Straßenkindern üblich war, sich damit zu benebeln und den Hunger zu töten. Aber dass es einem zuerst so übel geht, schockte ihn.
„Ich mach das nicht“, versicherte er energisch Roberto gegenüber. „Und du machst das auch nicht. Wir müssen anders an Essen kommen. Hast du mich verstanden?“
„Aber wie denn?“, fragte Roberto verzweifelt.
„Morgens gehst du wie immer Schuhe putzen. Ich trage den ganzen Tag auf dem Markt Taschen. Und in den Abfällen finde ich sicher was Essbares. Wenn alles nicht hilft, bettle oder klaue ich. Abends gehen wir ganz normal in die Schule.“
Als sie an diesem Tag von der Schule kamen, wartete Frau Perea schon auf sie. Es tue ihr schrecklich leid, aber wie bisher könne es nicht weitergehen. Die Zeiten seien im Pueblo für alle noch schwieriger geworden. Allein der Preis für die Gallone Trinkwasser sei gewaltig gestiegen. Sie dürften immer zu ihnen kommen, wenn sie Probleme hätten, allerdings müssten sie ab jetzt für sich selbst sorgen.
Coco hatte sich schon lange innerlich auf diesen Moment vorbereitet. Woher sollten denn die Familien das Geld für sie nehmen? Viele Väter waren arbeitslos oder Tagelöhner, die Mütter verkauften an der Straße irgendwo Krimskrams oder Süßigkeiten oder bettelten. Und außerdem wurden die Familien immer noch größer. Coco und Roberto waren ja dankbar, dass Frau Perea sie in der Schule als Erziehungsberechtigte sozusagen vertrat.
Wie verabredet, teilten sie sich die Arbeit. Abends trafen sie sich in der Schule. Was sie dann an Lohn aus ihren Hosentaschen zogen, füllte kaum eine Hand. Für Wasser würde es reichen und für Petroleum zum Teekochen und für ein Brötchen. An guten Tagen könnte sogar ein Teller Suppe einer Garküche am Straßenrand herausspringen. Das Obst besorgte Coco an Marktständen auf seine Weise. Der Strom für die einzige Glühbirne in der Hütte kam umsonst aus der Hauptleitung. Ganz umsonst war er eigentlich auch nicht. Ihr Vater hatte ihn mit dem Leben bezahlt, als er damals verbotenerweise die Straßenbeleuchtung angezapft hatte. Inmitten eines Funkenregens war er zu Boden gestürzt und tot. Sie waren damals noch klein. Aber an den Lichterbogen aus silbernen Sternchen konnten sie sich noch erinnern. Und an den markerschütternden Schrei der Mutter.
Sie schöpften Hoffnung, als nach einigen Wochen ihre ‚Überlebensplanung‘ nach und nach Früchte trug. Zwar hatte sich auch Roberto mit einem Teil seiner Arbeitszeit zu unehrlicher Arbeit entschlossen, aber das Gefühl, mit wenig oder gar keinem Hunger im Unterricht zu sitzen, ließ ein schlechtes Gewissen keine Sekunde lang aufkommen.
Wenige Tage später zerstob diese Hoffnung durch einen derben Griff in den Nacken und den Worten:
„Endlich haben wir euch Früchtchen erwischt! Nun ist Schluss mit der Klauerei!“
4
Wie lange sie schon in der Zelle gesessen hatten, wussten sie nicht. Es musste schon ziemlich spät sein. Gegenseitige Vorwürfe gab es nicht. So war es abgemacht. Es war die letzte Rettung gewesen. Immerhin hatten sie herrliche Wochen ohne Hunger erlebt. Wie würde es jetzt wohl weitergehen?

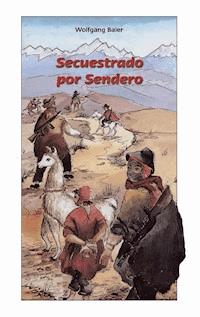














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












