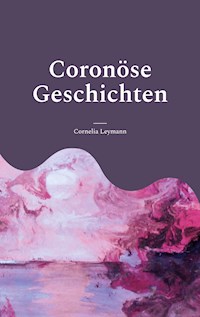9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein ironisch-herzlicher Krimi über eine tödliche Kleinfamilie. Ellen hat alles, was man für ein gelungenes Leben braucht: einen harmlosen Gatten, zwei reizende Kinder, eine großzügige Schwiegermutter. Es hätte alles so schön sein können, wenn nicht dieser Unfall gewesen wäre, der Ellens Familie gehörig aus dem moralischen Takt bringt. Oder war es vielleicht gar nicht der Unfall selbst, der die kriminelle Ader der Beteiligten freilegte? In der Haut von Kommissar Janssen möchte man jedenfalls nicht stecken, der jetzt all die Toten einsammeln und den jeweiligen Mördern zuordnen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cornelia Leymann, geboren 1951 in Hannover, hat dort erst Pädagogik und dann Verkehrsingenieurwesen studiert und ist nach einigen Umwegen in Kiel hängen geblieben, wo sie als EDV-Spezi in Kieler Großbetrieben arbeitete. Heute widmet sie sich neben ihrer großen Liebe Bridge nur noch dem Schreiben und Malen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Robin Vandenabeele/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-935-8
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Ellen
Man muss es einfach mal ganz deutlich sagen: Kiel ist nicht wirklich berühmt für eine raffinierte Verkehrsführung. Da ist noch jede Menge Luft nach oben.
Na, das ist nun richtig gemein von mir. Kiel hat selbstverständlich ganz viele wundervolle Straßen, von denen mir so auf die Schnelle allerdings grad keine einfällt. Und vom Stadtrand aus ist man zum Beispiel in knapp einer Viertelstunde am Hauptbahnhof. Welche Landeshauptstadt kann das schon von sich sagen?
Alle unsere Straßen sind befahrbar.
Nicht immer natürlich und nicht überall, aber meistens oder zumindest ziemlich oft. Nun sagst du vielleicht, »befahrbar« zu sein sei das Mindeste, was man von einer Straße erwarten kann. Aber du musst bedenken: Es kann auch schon mal ein bisschen regnen, oder es sind vielleicht noch andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße und man hat obendrein das Radio an, ist also etwas abgelenkt – selbst dann sollte eine Straße noch befahrbar sein.
Siehst du. Da liegt die Latte schon etwas höher.
Zum Beispiel die Eckernförder Straße Kreuzung Olof-Palme-Damm. Du pirschst dich von der Stadt kommend einspurig ran und willst einfach nur geradeaus weiter. Nicht ganz simpel. Die verwirrende Vielfalt von Fahrspuren, die sich plötzlich und unvermutet vor dir auftut, lässt bei dem einen oder anderen schon mal den Blutdruck steigen. Eh du dich’s versiehst, bist du rechts abgebogen und auf dem Never-come-back-Olof-Palme-Damm gelandet.
Schöne Scheiße.
Das nächste Mal bist du natürlich mächtig auf der Hut. Nützt aber nichts. Schon bist du wieder bei Olof auf der Palme, nur diesmal in der anderen Richtung. Es bedarf einiger Versuche, bis du endlich den Bogen raushast: drei, vier geschickte Spurwechsel mitten auf der Kreuzung, und schon hat dich die Eckernförder Straße wieder. Das meine ich mit »nicht befahrbar«.
Ellen steht an einer Kreuzung der Eckernförder Straße, die sogar ganz wunderbar befahrbar ist. So was gibt es nämlich auch in Kiel. Aber sie fährt nicht mit dem Auto. Sie wartet auf den Bus.
Jetzt müsste er eigentlich gleich kommen. Ellen sieht auf die Uhr. Noch zwei Minuten. Sie tritt aus dem Wartehäuschen und sieht die Straße hinab. »Ransehen« hat ihre Mutter das immer genannt. »Komm, meine Kleine, wir sehen sie mal ran«, hatte sie gesagt, war mit ihr vor die Tür gegangen und hatte in die Richtung geschaut, aus der die Großeltern, die Tante, die Straßenbahn oder auf was sie gerade warteten, auftauchen mussten. »Dann geht es schneller.«
Dadurch ging es natürlich nicht schneller. Doch das Warten war schneller vorbei, wenn man die »Rangesehenen« bereits hinten um die Ecke kommen sah.
Neben Ellen stehen jede Menge Mitwarter. Alles Nicht-Ranseher. Das Jungvolk heutzutage hat andere Möglichkeiten, sich das Warten zu verkürzen. Den einen hängen Strippen aus den Ohren, andere starren gebannt auf ihr Handy und tippen hektisch mit den Daumen auf der blanken Oberfläche herum. Die beiden Mädchen hinten in der Ecke haben sich um die Schultern gefasst, lächeln das Smartphone an, das die eine weit von sich gestreckt hält, und dann beugen sich beide kichernd über das nun in die andere Richtung lächelnde Ergebnis. Sie alle wollen die Zeit verkürzen, bis der Bus kommt.
Das ist natürlich Quatsch. Zeit kann man nicht verkürzen, sie bleibt immer gleich. Es lässt sich von der Uhr ablesen, wie gleich sie bleibt. Und doch schleicht sie manchmal dahin und kommt kaum vom Fleck, nur um wenig später davonzugaloppieren.
Wer wüsste das besser als Ellen. Die Zeit rast vor ihr her durch den Supermarkt, sodass sie kaum hinterherkommt und ihre Einkäufe hektisch in den Einkaufswagen wirft, um dann an der Käsetheke endlos zu warten, nur weil der Mann vor ihr sich nicht entscheiden kann, ob er lieber den jungen Gouda oder den alten Amsterdamer nehmen soll. In aller Seelenruhe klaubt er jeweils ein Scheibchen von der hingehaltenen Forke der Käsefachverkäuferin, speichelt die Probierstücke gut ein und entscheidet sich dann nach einigem Zögern doch für zwei Scheiben von dem dahinten. »Von dem?« – »Nein, der weiter rechts.« – »Der?« – »Nein, von Ihnen aus links.«
Ellen könnte wahnsinnig werden. Sie hat keine Zeit, das Essen muss auf den Tisch. Das wird jede halbwegs einsichtige Nicht-Rabenmutter verstehen. Kinder brauchen mittags was Warmes. Aber muss es immer was Großartiges sein? Spaghetti mit Tomatensoße sind schließlich auch warm. Bevor man sich total unter Stress setzt und harmlosen käseverkostenden Männern die Pest an den Hals wünscht, könnte man ja zweimal die Woche auf vollwertige Ernährung verzichten. Müsste doch möglich sein!
Ist es aber nicht. Für die Kinder schon. Da könnte sie sich das erlauben. Und wenn Dr. Oetker dann noch seinen Ruckzuck-Pudding hinterherschiebt, wird es für die lieben Kleinen ein Festessen, das es gar nicht oft genug geben könnte. Aber Omi kann diese weißen »Wabbeldinger«, die sich Spaghetti nennen, nicht leiden. So alt ist sie denn nun doch nicht. Schließlich erfreut sie sich noch aller zweiunddreißig Zähne. Durch und durch solide und bissfest sind die. Und immerhin noch Marke Eigenbau. Und von dieser roten Matschepampe, die beim Drehen der Nudeln durch die Gegend spritzt und den Kindern die Münder verunstaltet, dass man gar nicht hinschauen mag, davon will sie schon gar nichts wissen. Schließlich ist Ellen in erster Linie Hausfrau und Mutter, da kann man schon ein wenig Kochkunst erwarten. Muss ja nicht jeden Tag Entenbraten sein. Aber ein paar nette Kleinigkeiten, hübsch dekoriert mit einem Salatblatt unter der geringelten Tomate, dazu etwas frische Petersilie über die Kartoffeln, das ist doch nicht zu viel verlangt. So hat sie es doch auch immer gemacht, damals, als der arme Kurt noch lebte, Gott hab ihn selig. Aber die jungen Frauen haben ja heutzutage Wichtigeres zu tun, und der arme Horst muss darunter leiden.
Ellen sieht auf die Uhr. Jetzt müsste der Bus aber wirklich jeden Augenblick kommen. Erneut tritt sie aus dem kleinen Kabäuschen und sieht ihn ran.
Nichts.
Na ja, nichts ist stark untertrieben. Hinter der Kreuzung stehen Autos in Zweierreihen an der roten Ampel. Ellen erblickt im Prickeln ihrer Scheinwerferaugen die Bereitschaft, beim leisesten Anflug von Gelb loszupreschen. Da sollte sich die Frau auf dieser Seite der Kreuzung, die gerade mit ihrem kleinen Terrier an der Leine über die Fahrbahn zockelt, vielleicht ein wenig beeilen.
Doch die Alte schleicht in aller Gemütsruhe weiter. Auf dem Mittelstreifen wird sie anhalten müssen, denn dahinter stehen die Autos der Gegenrichtung in den Startlöchern. Es ist abzusehen, dass das kleine grüne Männchen mit dem roten tauschen wird, bevor sie die vier Fahrspuren überquert hat. Dann muss sie – gefangen von dem um sie herumbrausenden Verkehr – auf der kleinen Insel des grünen Männchens harren. Das wird Herrn Terrier nicht sehr schmecken. Vielleicht lässt sie die Leine etwas weiter raus, damit er am Gras des Grünstreifens schnuppern kann und sein Geschäft erledigt. Dann hat Frauchen das schon mal hinter sich, zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen.
Für das Erschlagen von zwei Fliegen mit einer Klappe hat Ellen eine Art siebten Sinn entwickelt. Sonst schafft sie es einfach nicht mehr. Das geht gleich morgens los: Rick und Lea müssen »schulfein« gemacht werden, wie sie das nennt. Also: die Kinder aus den Betten jagen, die Kaffeemaschine anwerfen, durchs Badezimmer hetzen, Pausenbrote schmieren, »Trödel nicht mit dem Essen«, »Spiel nicht in dem Müsli rum«, »Hast du dein Sportzeug eingepackt?«, »Fährst du heute die Kinder?« (Letzteres an den Gatten gerichtet) – das ganze Programm. Und alles, während Horst gedankenvoll dem Toaster beim Toasten zusieht und sich darüber beschwert, dass Ellen sich beim Einräumen der Teller in die Spülmaschine unwirsch von ihm befreit, wenn er sie umarmen und küssen will, weil der Gute-Morgen-Kuss im Schlafzimmer für seine Begriffe etwas zu spärlich ausgefallen ist. »Meine Güte, Horst, du stehst im Weg. Ich muss die Maschine noch bestücken und anstellen. Die soll arbeiten, sonst müssen wir heute Mittag von Papptellern essen.«
»Du weißt aber schon, dass es Omi stört, wenn die Leitung gluckert. Obendrein grad um diese Zeit, wenn sie unten im Bad bei der Morgentoilette ist.« Dazu kullert er lustig mit den Augen und formt mit seinen Händen kleine Schallmuscheln, die er sich hinter die Ohren hält, damit er auch kleinste Geräusche besser einfangen kann. Ja, die Omi kann sehr feinhörig sein, wenn sie etwas stören soll.
Das sind dann die Momente, in denen Ellen lachen muss und deswegen die Teller lieber auf die Anrichte stellt. Die Gefahr wäre sonst einfach zu groß, dass sie ihr aus der Hand rutschen. Wie sehr es Omi stören würde, wenn im Stockwerk über ihr vier Teller samt Besteck auf die Küchenfliesen knallen, möchte man sich gar nicht ausmalen. Es gibt überhaupt einen Haufen Dinge, die Omi nur schwer ertragen kann, wohingegen Ellen nur eins stört – und das ist Omi. Aber jetzt, wo sie die Hände schon mal grad frei hat, kann sie ihren Horst auch mal umarmen und ihm einen dicken Kuss auf seine süßen Hamsterbäckchen drücken.
Ellen lächelt, als ihr die morgendliche Szene hier an der Bushaltestelle wieder einfällt. Dann kehrt sie schnell in das Wartehäuschen zurück, weil es anfängt zu nieseln. Dafür hat sie nicht eine halbe Stunde ihrer ohnehin viel zu knappen Zeit beim Friseur verbracht, um sich gleich wieder alles ruinieren zu lassen.
Sie sieht erneut auf ihre Uhr und dann wieder hoch zu dem Geschehen auf der Straße. Auch von hier im Wartehäuschen hat sie Hund und Dame gut im Blick und kann beiden zusehen, wie sie der grünen Insel zwischen den Fahrbahnen entgegenstreben. Hochaufgerichteten Schwanzes an stramm gespannter Leine erreicht der Terrier sie als Erster. Jetzt muss erst mal Stopp sein, und er könnte sein Schwänzchen eigentlich sinken lassen. Doch der Kleine marschiert munter weiter. Macht nichts, denn noch haben die Autos Rot. Jetzt sollte Frauchen ihn aber wirklich langsam mal an der Leine zurückziehen. Doch sie tuffelt, ohne das grimmige rote Ampelmännchen eines Blickes zu würdigen, gemächlich hinter ihrem Terrier her.
Als sie den wuchtigen Van passiert und damit die Hälfte der Strecke zum rettenden Ufer geschafft hat, springt die Ampel für die Autos auf Gelb. Ein Motor röhrt auf, und ein schwarzer Sportwagen hechtet aus dem Sichtschatten des Vans auf das Mütterchen zu. Ellen hört ein dumpfes Plopp. Der Terrier fliegt zur Seite.
Und die Zeit bleibt stehen.
Der Terrier steht waagerecht in der Luft, die Ampel starrt mit ihrem gelben Auge böse auf die wartenden Autos, während das rote Männchen die Fußgänger im Zaum zu halten versucht, und der Sportwagen hält wie ein Panther auf der Jagd das Mütterchen unter seiner linken Vorderpranke gefangen. Der Van hat aus der geöffneten Fahrertür einen dicken Mann auf die Fahrbahn entlassen, die Füße schweben noch in der Luft. Ellens Mitwarter im Wartehäuschen stieren in sich gekehrt ins Leere.
Es dauert schier endlos, bis die Zeit wieder weitergeht. Der Terrier landet auf der Straße und bleibt winselnd liegen. Die Ampel lächelt mit ihrem freundlichsten Grün die Autofahrer an, während das rote Männchen weiter auf die Fußgängerinsel stiert. Der Sportwagen schiebt nun auch das hintere Rad auf das Mütterchen, bevor er mit einem Ruck zum Stehen kommt. Der dicke Mann landet mit beiden Füßen auf der Fahrbahn und umrundet langsam die Fahrertür. Die Mitwarter kehren gelangweilt den Blick aus sich heraus und blicken blöde auf die Straße.
Entsetzt starrt Ellen auf das Mütterchen, auf den schwarzen Wagen und auf die Tatsache, dass die alte Dame wahrscheinlich gerade das letzte Mal über eine rote Ampel gegangen ist. So verquer, wie sie unter den Rädern liegt, wird sie schwerlich wieder auf die Füße kommen.
Ein Hupkonzert beginnt, denn die Ampel zeigt Grün, und nichts tut sich da vorne. Stattdessen halten ein Van und ein schwarzer Porsche den ganzen Verkehr auf. Da darf man schon mal empört auf die Hupe drücken, wovon die ganze Schlange hinter den beiden auch regen Gebrauch macht.
Das Jungvolk neben Ellen nimmt die Strippen aus den Ohren. Was soll das Gehupe? Sie brauchen eine ganze Weile, bis sie das Geschehen erfassen und sich auch auf ihren Gesichtern Entsetzen ausbreitet.
»Ey, krass«, sagt der Junge neben Ellen und starrt in Richtung der Kreuzung. »Was’n da passiert?«, fragt ein anderer. Die beiden Mädchen, die eben noch kichernd über ihre Smartphones gewischt haben, fangen an zu kreischen, und der einzige andere Erwachsene im Wartehäuschen lässt ein tiefes Brummen hören.
Ellen sieht sich um. Ihre Mitwarter haben offensichtlich alle erst etwas von dem Unfall bemerkt, als er schon passiert war. Die übrigen Passanten auf der Kreuzung scheinen ebenso ahnungslos zu sein. Zumindest stehen sie nur dröge rum und glotzen. Die Autos, die in der Gegenrichtung vor der roten Ampel auf der Lauer lagen, preschen jetzt an ihr vorbei und haben augenscheinlich nur ihre freie Fahrt für freie Bürger im Sinn. Einzig der Fahrer des Vans könnte Genaueres mitgekriegt haben. Er ist inzwischen so weit um sein Auto herumgegangen, dass er einen unverstellten Blick auf die Hinterachse des Sportwagens einschließlich des Mütterchens darunter hat. Er kratzt sich am Kopf. Das ist nicht die Geste eines Mannes, der einer herbeigerufenen Polizei umfänglich bezeugen kann, wer wann wie bei welcher Ampelphase wo gegangen oder gefahren ist.
Der Porschefahrer sitzt wie versteinert in seinem Auto. Dann kehrt das Leben in ihn zurück, und er tritt aufs Gas. Niemand, nicht einmal der Fahrer des Vans, scheint Notiz von ihm zu nehmen, als er mit quietschenden Reifen um die nächste Ecke biegt.
Ellens Blick dreht eine zweite Runde. Sie kann auf Anhieb mindestens fünf Handys erkennen, aber keins scheint dazu benutzt zu werden, Krankenwagen und Polizei zu rufen. Ihr wird klar, dass sie die Einzige ist, die den Unfall genau gesehen hat und weiß, was jetzt getan werden muss.
Da kommt der Bus.
Das rote Ungetüm hält vor ihr an, schnauft, bevor es die Tür öffnet – und sie steigt ein.
»Ich hab zum ersten Mal im Leben gedacht, es trifft immer die Falschen«, flüstert Ellen, als sie in dieser Nacht neben ihrem Horst im Bett liegt.
Jetzt mal ehrlich: Was denkst du, wenn eine Frau im Bett flüstert? Dass die Situation entweder total erotisch ist oder verboten. Etwas Verbotenes kann ich mir bei einem Ehepaar im eigenen Ehebett allerdings nicht vorstellen, und offen gesagt: etwas total Erotisches nach fünfzehn Ehejahren auch nicht mehr. Bliebe noch die Möglichkeit, dass die Wände nur als Sichtschutz dienen und dünn wie Papier sind. Doch Omis Haus ist solide gebaut.
Trotzdem hat Ellen sich angewöhnt, auch dann möglichst leise zu sprechen, wenn sie mit Horst allein ist. Erstens schlafen die Kinder gleich nebenan, und sie möchte auf gar keinen Fall, dass die Kinder aufwachen und irgendwas davon mitkriegen, dass ihre Mutter nicht jede Sekunde vor Glück Purzelbäume schlägt, weil sie alle kostenlos bei der Omi in ihrem herrlichen Haus wohnen können.
Ihr Hauptgrund für das Flüstern aber ist ihr Verdacht, dass Omi mehr hört, als sie zugibt. Woher sonst soll sie wissen, was Ellen mit Horst unter vier Augen besprochen hat? Wenn Omi will, hört sie blendend, das ist Ellens Überzeugung. Und wenn sie etwas nicht mitkriegen soll, will sie ganz besonders. Doch mit ihrer Schwerhörigkeit versucht sie, es zu verschleiern: »Ach, Ellen, sprich doch etwas lauter, man versteht ja kein Wort« und: »Die Kinder nuscheln ja furchtbar. Lernen Kinder heutzutage denn keine artikulierte Sprechweise mehr? Also wirklich, Ellen, dass du ihnen das durchgehen lässt …« Ihre fortwährenden Klagen nimmt Ellen ihr nicht so ganz ab. Omis Hörgerät ist ein Hightech-Teil, das sie per Fernbedienung unbemerkt aus der Rocktasche steuern kann.
Manchmal könnte Ellen schon etwas fuchsig werden. Omi hat den Mercedes unter den Hörgeräten und stellt trotzdem den Fernseher laut, zumindest deutlich lauter, als es Ellen zumutbar erscheint. »Kannst du den Fernseher etwas leiser stellen?« – »Was? Dann höre ich ja gar nichts mehr. Also wirklich, Ellen, er steht doch nur auf zweiunddreißig. Das sollte auch für dich eine erträgliche Lautstärke sein.«
Ja, ich muss zugeben, es kommt deswegen bisweilen zu kleinen Misshelligkeiten zwischen den Eheleuten, denn Ellen ist das Geschrei aus dem Fernseher wirklich unangenehm. Dabei müsste Omi nur ihren Mercedes etwas feiner tunen, und schon wäre die achtundzwanzig auch für sie prima verständlich. »Setz dir doch Kopfhörer auf«, hatte sie einmal angeregt. Na, also da war was los. »So weit kommt es noch«, hatte Omi in höchster Entrüstung gepoltert. Im eigenen Haus! Vor ihrem eigenen Fernseher! In ihren eigenen vier Wänden könne sie schließlich machen, was sie wolle – womit sie Ellen mal wieder klargemacht hatte, dass sie, Ellen, nicht über den Luxus eigener vier Wände verfügt.
Als ob das nötig wäre.
Horst steht ihr in Sachen Lautstärke nicht zur Seite. »Lass sie doch. Stopf dir Watte in die Ohren. Sie ist doch schon alt. Immer dieses Gehampel mit euch beiden! Das versaut uns nur wieder den gemütlichen Abend.« Aber Ellen ärgert das, und am meisten ärgert es sie, dass sie sich Watte in die Ohren stopfen soll. Keine eigenen vier Wände, dafür Watte in den Ohren. Na bravo.
Wenn es darum geht, wie der Abend verbracht wird, hat Horst seinen eigenen Kopf. Schließlich ist Omis Fernseher breit wie ein Kleiderschrank. Beim Fußballspiel muss er den Kopf hin- und herdrehen, um alles mitzukriegen. Gegen Omis Flachbildschirm ist ihr eigener Fernseher mehr so eine bessere Briefmarke. Wenn den Fußballern der Angst- oder sonstiger Schweiß auf der Stirn steht und man das in Originalgröße zu sehen kriegt – was gibt es Herrlicheres?
Ellen könnte sich etliches Herrlicheres vorstellen.
Weil Omi gern zusätzlich zum Angstschweiß auch noch die Angstschreie mitkriegt und dank Lautstärke zweiunddreißig bei jedem bejubelten Tor der Kronleuchter bebt, geht Ellen dann manchmal nach oben, lässt Mutter und Sohn in trauter Zweisamkeit zurück und zieht sich bei einer Lautstärke von fünfundzwanzig ein wenig grimmig die dritte Wiederholung eines Tatorts rein – auf Briefmarkengröße.
Nun gibt es durchaus Tage, an denen keine Live-Übertragung eines Fußballspiels gesendet wird. Doch auch dann ist Horst am liebsten unten, um bei einem kleinen Bierchen die Idylle einer Familienserie zu genießen. »So einen Quatsch kann ich nicht ertragen«, sagt Ellen. »Selbst bei Lautstärke achtundzwanzig nicht. Und bei zweiunddreißig erst recht nicht.« – »Ach, nun sei doch nicht so«, antwortet er dann. »Ist doch immer so nett. Ihr beiden Mädels trinkt ein schönes Glas Wein, wir sehen den … wie heißt er noch, der Schauspieler, den du so gern magst? Und die Omi freut sich doch so, wenn wir abends bei ihr sind.«
Wenn du bei ihr bist, denkt Ellen, aber sie ist klug genug, es nicht zu sagen. Auch dass es ihr gewaltig auf die Nerven geht, dass Biere immer klein und Weingläser immer schön sind, sagt sie nicht. Und auf sein betrübtes »Wer weiß, wie lange wir die Omi noch haben« entgegnet sie nichts, obwohl sie sicher ist, dass die Omi sie alle überlebt. Bis auf Lea vielleicht.
Doch »Es trifft immer die Falschen« zu sagen, das hat sie sich heute getraut, wenn auch nur flüsternd.
»Warum bist du denn nicht dageblieben? Du wärst doch ein erstklassiger Zeuge gewesen. Und wenn du den Krankenwagen gerufen hättest … Vielleicht hätte man die Frau noch retten können.«
»Klar, alles ganz toll, und dann hätte ich mir den ganzen Nachmittag Omis Gemecker anhören dürfen, dass das Essen nicht rechtzeitig fertig ist.«
»Na, nun übertreibst du aber«, sagt Horst grantig. Gleich darauf lächelt er: »Ist schon was dran. Sie hat nun mal gern einen geregelten Tagesablauf, die Gute. Gegessen wird um eins und damit basta. Das gehört sich einfach so.« Er lacht und knabbert zärtlich an Ellens Ohr.
»Lass das«, sagt Ellen und stößt ihn weg. Leicht gekränkt verzieht sich Horst auf seinen Teil der Matratze.
»Sag mal«, sagt er – die Stimmung ist nach ihrem Schubser ohnehin verdorben, da kommt es nicht mehr drauf an –, »was machst du eigentlich immer nach dem Dienst? Omi hat erzählt, dass du oft erst nach eins kommst. Im Büro ist doch um zwölf für dich Schluss.«
»Zwischen zwölf und eins befriedige ich meine beiden Liebhaber, das braucht halt seine Zeit«, sagt Ellen.
»Ach so, na dann …« Horst dreht sich auf die Seite, und schon ist er weggepennt.
***
Du wirst es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber es gab Zeiten, da hatte ein Mann schon gewonnen, wenn er dem Objekt seiner Begierde sagen konnte: Ich habe ein Auto. Später konnte man Frauen dann nur noch mit einem Achtzylinder ins Bett locken, und heute hat sich die Welt so weit gedreht, dass vor allem die Männer top sind, die sagen: Ich habe kein Auto, ich nehme das Rad. In Zeiten bewusster Körperlichkeit zählen Muckis eben mehr als PS. Auto kann schließlich jeder. Sogar mehrfach. Ich kenne ein kinderloses Ehepaar, das hat drei Autos.
Doch das sind Ausnahmen. Bei Horst ist alles ganz so, wie es sich gehört: für ein Ehepaar, zwei Kinder und eine Omi nur ein einziges Auto. Von Düsternbrook zu seiner Arbeit im Ministerium braucht er etwa fünf Minuten. Mit dem Auto. Der Weg zu Ellens Arbeitsstelle ist deutlich länger, aber die Busverbindungen sind wirklich ideal. Deshalb nimmt er das Auto und sie den Bus. Dann kann sie auch in der Holtenauer Straße noch mal kurz aussteigen und was einkaufen, sagt er. Mit dem Auto schier unmöglich. Zwar gibt es in der Holtenauer rauf wie runter massig Parkplätze und es ist auch immer mal wieder einer frei, aber nicht dann und dort, wo man’s braucht. Natürlich könnte Ellen seit Einführung der Brötchentaste im Parkhaus, wo immer was frei ist, eine halbe Stunde umsonst parken, um schnell ein paar Besorgungen zu machen, aber inzwischen hat es sich eingebürgert, dass Horst das Auto nimmt. Ist auch besser so, denn wenn Ellen was wirklich Leckeres kocht, ruft Omi ihn kurz an, und er kann mittags mal eben rasch vorbeihuschen und muss nicht immer den Kantinenfraß im Landeshaus essen. Ohne Auto wäre das gar nicht möglich.
Ganz vorsichtig hatte Ellen einmal angedeutet, dass ein Fahrrad im Keller steht. Damit könnte er es sogar in drei Minuten schaffen. Ja, Ellen kann bisweilen richtig sarkastisch sein. Aber nicht bei Omi. »Runter«, kontert Omi, »runter vielleicht. Aber bergauf? Soll er einen Herzinfarkt kriegen, wenn er gegen das Düsternbrooker Gehölz antreten muss?«
Insgeheim denkt Ellen zwar, dass es wahrscheinlicher ist, dass er einen Herzinfarkt kriegt, wenn er nicht das Düsternbrooker Gehölz hochfährt, aber gegen Omis Fürsorge ihrem einzigen Sohn gegenüber ist sie machtlos, egal wie falsch sie ist. Also die Fürsorge, nicht die Omi. Oder vielleicht doch auch die Omi. Oder … ach was!
Rick und Lea
»Na, meine Kleine«, sagt Omi und zieht Lea liebevoll zu sich heran. Sie sitzt auf ihrem Lieblingsplatz auf der Terrasse, im Liegestuhl, Kopf im Schatten, Beine in der Sonne. Sie kann ihre Beine noch zeigen und zeigt sie am liebsten braun. »Jetzt erzählt die kleine Leonora der Großmutter mal, was sie heute gelernt hat.«
»Fu«, sagt Lea.
»Gott, Kind«, sagt Omi leicht verwirrt, »sprich in ganzen Sätzen. Was heißt Fu?«
»Du musst mit mir einen Fu basteln«, erklärt Lea.
An den schleswig-holsteinischen Grundschulen hilft ein roter Strickstrumpf mit Puschel auf dem Kopf, genannt Fu, den Grundschulkindern durchs Alphabet. So eine Art Ernie aus der Sesamstraße, nur eben in Rot und meist auch nicht sonderlich humorvoll, wie man an dem inhaltsschwangeren Satz »Fu ruft tut« auf Anhieb merkt. Aber so haben die lieben Kleinen nach kurzer Zeit das U schon mal im Sack und können sich frisch gestärkt dem A von Fara, der Gespielin von Fu, zuwenden. Fara wird meist nicht mehr gestrickt, weil die Mütter noch von Fu die Nase voll haben und weil es doch etwas schwer vermittelbar ist, was deutsche Grundschüler mit dem persischen Kaiserhaus zu schaffen haben. Zudem ist Fu langsam im Umbruch. Schließlich müssen immer mal wieder neue Unterrichtsbücher her. Von den Arbeitsheften, die jeder Schüler frisch erwerben muss, weil der Vorgänger alles vollgekritzelt hat, können Klett, Schrödel und wie sie alle heißen nicht leben. Die Ständige Konferenz der Kultusminister schickt jetzt das »ABC der Tiere« ins Rennen, feiert mit Uhu große Erfolge (die Kinder heben die Arme hoch zu einem U), hat sich aber leider mit dem Affen Ali (die Kinder strecken die Arme zum A gespreizt nach unten) etwas vergaloppiert. Ali ist ein persischer Heiliger, und unsere islamischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sehen es mit Missfallen, dass ihre Angebeteten als Äffchen verunglimpft werden. Tja, wie ein ständiger Kultusminister es auch macht, er macht es falsch.
»Was meinst du mit Fu?«, fragt Omi.
»Na, eben Fu. Er muss bis nächste Woche fertig sein«, antwortet Lea.
»Äl-len«, ruft Omi hinüber zur Küche, in der Ellen gerade Wasser für Omis Nachmittagstee aufsetzt, »Ellen, komm doch mal raus. Ich versteh dein Kind nicht.«
Ellen kommt mit einem Tablett aus der Küche, verteilt die Tassen auf dem kleinen Tischchen und stellt Lea ein Glas Saft hin. »Geht es um den Fu? Vielleicht habe ich den von Rittschi noch irgendwo«, sagt sie.
»Nenn den Jungen nicht Richy«, sagt Omi. »Einen schönen Namen wie Richard so zu verunstalten! Grässlich.«
Ich weiß wirklich nicht, welcher Teufel Ellen immer reitet. Normalerweise nennt sie ihren Sohn Rick. Aber wenn Omi dabei ist, sagt sie Richy – wie seine Freunde übrigens auch. Aus Gedankenlosigkeit wahrscheinlich. Oder auch nicht. Aus dem geplanten Lennart hat Horst, als sie hilflos im Wochenbett lag, einen Richard gemacht, und Ellen musste nicht raten, um zu wissen, dass er Omis Einflüsterungen erlegen ist.
»Er wird natürlich nach seinem Großvater heißen«, hatte Omi gesagt, als Ellens Bauch sich wölbte. »Alle von Weinsteins nennen ihre Erstgeborenen nach dem Großvater.«
»Und warum heißt Horst dann Horst?«
»Gott, Kind, es war Krieg.«
Was der Krieg mit der Namensgebung für einen zwanzig Jahre später geborenen Sohn zu tun haben sollte, erschloss sich Ellen nicht, und auch Horsts damaliger Antwort auf ihre Nachfrage war nichts Sinnvolles zu entnehmen: »Lass doch, Ellen. Mutter ist über siebzig, da baut man geistig schon etwas ab.«
Wer will es Ellen da verdenken, wenn sie ein wenig grantig darüber ist, dass ihr Sohn seinen Namen seiner geistig abgebauten Großmutter und nicht den glücklichen Eltern zu verdanken hat. Aber mal ehrlich: Er hätte es schlechter treffen können. Mit Rick respektive Richy ist Richard – im Nachhinein gesehen – ganz gut bedient. Außerdem gibt der Name Ellen die Möglichkeit, der Omi immer wieder mal einen kleinen Nadelstich zu versetzen. Obwohl ich nicht glaube, dass Ellen sich dessen bewusst ist, so herzensgut, wie sie ist.
»Vielleicht klärst du mich jetzt endlich mal darüber auf, was Fu bedeuten soll«, sagt Omi zu Ellen.
»Mach du das, Lea«, sagt Ellen, »ich schau mal, ob ich den von Rittschi irgendwo finde.«
Sie hat gekocht, aufgedeckt, abgedeckt, das dreckige Geschirr in die Spülmaschine geräumt, Omis Frühstückskrümel vom Küchenboden gefegt und Tee für Omi gekocht. Damit, findet Ellen, hat sie ihren Job fürs Erste mehr als gemacht. Für Omi-Bespaßung ist Lea zuständig. Sie muss schließlich irgendwann auch mal ihre eigene Wohnung aufräumen, Staub wischen, und die Fenster hat sie auch vor ewigen Zeiten das letzte Mal geputzt.
»Der macht immer so lustige Grimassen«, erklärt Lea. Sie ergreift und schaukelt mit den Händen ihre Rattenschwänzchen, verzieht die Mundwinkel und beginnt zu schielen: »So macht er das. Schau doch mal, Omi.«
»Leonora«, sagt Omi streng, »lass das. Das sieht ja grässlich aus. Und sag bitte Großmutter zu mir. Omi hört sich so furchtbar vulgär an.«
»Okay, Omi«, sagt Lea, hopst im Schlusssprung von Steinplatte zu Steinplatte und probiert dabei das neue Wort aus: wull – hops – gär – wull – hops – gär.
Am Ende der Terrasse angekommen, schlägt sie zwei Räder beziehungsweise das, was sie dafür hält, und verschwindet hinter den Johannisbeersträuchern.
***
Rick wacht um sechs Uhr auf. Auf seiner Bettdecke sitzt der Geburtstagshase aus Plüsch und starrt ihn mit seinen Glasaugen an. Na bitte, die dreizehn wäre geschafft. Bis gestern war er unsicher gewesen, ob nicht doch noch was dazwischenkäme und er am Ende ewig zwölf bleiben müsste. Die Omi hatte einen Haufen Gründe gewusst, warum Jungen wie er nie dreizehn würden. Das fing bei nicht leer gegessenen Tellern an und hörte bei schlampig gebundenen Schnürsenkeln auf. »Wenn du so weitermachst, wirst du nie dreizehn«, hatte sie gesagt. Das Szenario, das sie ausmalte, war so ein bisschen wie eine Ehrenrunde in der Schule. Wer vorm Besuch im Kino nicht noch mal aufs Klo ging oder ständig sein Sportzeug vergaß, der war eben noch nicht reif für die dreizehn und musste noch ein Jahr länger zwölf bleiben. Wenn das überhaupt reichte! Ja, so war das. Aber er hatte es geschafft! Der Hase sitzt auf der Bettdecke, also ist er dreizehn. Für ein weiteres zwölftes Lebensjahr würde der bestimmt nicht da hocken.
Rick nimmt sich vor, bei seinem nächsten Geburtstag auf den Hasen zu scheißen, denn mit vierzehn ist er zu alt für so’n Quatsch. Aber für dieses Mal ist es dann doch noch ganz tröstlich. Er kickt das Teil von der Decke, springt aus dem Bett, schaut auf seinen Wecker und springt wieder ins Bett. Sechs Uhr, genau genommen fünf Uhr dreiundfünfzig, das ist keine gute Zeit, um aus dem Bett zu springen. Mutti ist wahnsinnig hellhörig. Auch wenn er jetzt noch so leise ins Bad schliche, würde sie trotzdem wach werden und sofort mit dem Geburtstagskind-Mutterding anfangen. Ihn fragen, was er geträumt hätte, und ihm einzureden versuchen, dass das in Erfüllung ginge, ihn zu der Wand zerren, wo sein und Leas Wachstum dokumentiert wird, und so weiter und so fort. Was natürlich alles zu ertragen wäre, aber sicherer noch als Muttis Wachwerden ist Omis Wachwerden.
Sehr ungern erinnert er sich an seinen zwölften Geburtstag. Da war er um halb sechs aufgewacht, aus dem Bett gesprungen und hatte den Fehler gemacht, nicht schnellstens wieder hineinzuspringen. Mutti hatte das ganze Geburtstagsprogramm losgetreten, und sie hatten auch schon mal an der Geburtstagstorte rumprobiert. Dann waren Lea und Papa dazugekommen, und es war ganz lustig gewesen – bis sie schließlich alle vier im Gänsemarsch zum Frühstücken runter zur Omi getrabt waren.
Na, und da war was los!
Omi hatte in einer Mischung aus erbost und beleidigt im Sessel gehockt und Reden geschwungen: Ob sie wohl gar nichts von Richards Geburtstag haben sollte? Oben würde gefeiert, und sie dürfe hier unten dumm rumsitzen. Sie sei ja wohl nur dazu gut, alles zu bezahlen. Aber da hätten sie sich geschnitten. Und ob Richard ein Geburtstagsgeschenk von ihr bekäme, sei mehr als zweifelhaft.
Rick kann sich nicht mehr genau erinnern, was eigentlich das Schlimmste daran gewesen war. Die Sache mit dem Geschenk hatte ihn in dem Augenblick schon sehr bedrückt, denn es sollte das ersehnte neue Rad sein, sündhaft teuer, mit ungefähr viertausend Gängen und allem Schnick und Schnack. Aber er denkt trotzdem, dass Papas Verhalten ihm noch unangenehmer war, weil er fand, sein Vater solle sich vor einem anderen Menschen nicht so kleinmachen, und wenn es zehnmal seine Mutter war. Dann meint er sich zu erinnern, dass das tatsächlich schrecklichste Verhalten das von Mami war. Ihre roten Augen, dieses Schlucken, das leichte Zittern, ein Bild der Angst. Und doch war auch etwas in ihren Augen, das er bis dahin nicht darin gesehen hatte.
Nun, wie auch immer, er will das nicht noch einmal erleben und verkriecht sich lieber zurück ins Bett, steht dann aber doch noch mal auf, um sein Handy zu holen. Am liebsten hätte er das Radio angemacht, aber das geht natürlich überhaupt nicht.
Also spielt er das Game »HELL’O’WEEN«, bis es Zeit ist, zu erwachen und im Kreise der Familie – er merkt, wie ihm bei dem Gedanken ein ganz klein wenig übel wird – seinen Geburtstag zu zelebrieren.
***
Geburtstage sind so ein bisschen wie die Weihnachtstage. Man denkt, man hat ewig Zeit, bis sie kommen, doch dann stehen sie ganz plötzlich unvermutet vor der Tür, und man kann froh sein, wenn man sich bereits im Herbst mit den entsprechenden Geschenken aufmunitioniert hat. Wer wüsste das besser als Ellen. Diesmal hatte sie es geschafft, sich perfekt auf Ricks großen Tag vorzubereiten, wie du an dem Geburtstagshasen sicher schon gemerkt hast. Und wenn ich dir sage, dass sie außerdem noch rechtzeitig die lang ersehnten Kopfhörer gekauft und geschenkpapierlich eingewickelt hat, dann denkst du vielleicht, dass sie geburtstagstechnisch über den Berg ist.
Was allerdings leider nicht der Fall ist.