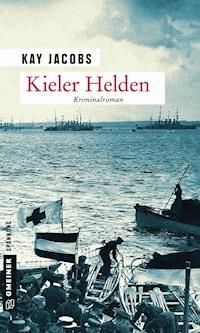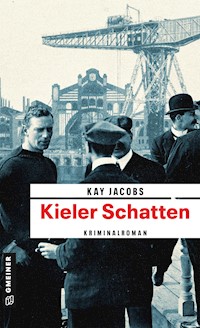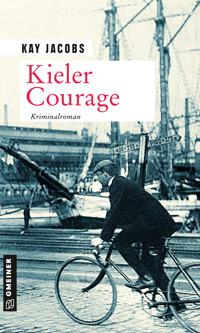Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalobersekretär Josef Rosenbaum
- Sprache: Deutsch
Kiel, Anfang November 1918. Kurz vor dem Ende des Weltkrieges weigern sich deutsche Matrosen, ihr Leben in einer aussichtslosen letzten Schlacht zu opfern. Der Staat versucht, seine Ordnung aufrechtzuerhalten. Als in einem Waldstück am Kaiser-Wilhelm-Kanal die Leichen von drei Werftarbeitern gefunden werden, übernimmt Kommissar Rosenbaum den Fall. Handelt es sich bei den Toten um politische Aufrührer? Und warum behindern die Politische Polizei und das Militär Rosenbaum bei seiner Arbeit?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kay Jacobs
Kieler Morgenrot
Kriminalroman
Zum Buch
Kriegsmüde Der Krieg verroht die Menschen nicht nur an der Front, zum Schluss auch in der Heimat. Grausame Nachrichten vom Kriegsgeschehen können über Jahre zu einer Gewöhnung führen, die die Vorstellung vom Wert eines Menschenlebens allmählich aufzehrt. Und doch, die Hoffnung auf Frieden ist nicht tot, sie schläft nur und irgendwann wacht sie auf. Im Herbst 1918 wird für jedermann offensichtlich, dass der Weltkrieg militärisch nicht mehr zu gewinnen ist. Große Teile der in Kiel stationierten Marinesoldaten verweigern den Befehl, Werftarbeiter schließen sich ihnen an und treten in den Ausstand. Schnell wird der Militärführung klar, dass es den Menschen nicht mehr nur um eine verbesserte Versorgungslage oder den nackten Frieden geht, sondern um einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Wenn in dieser Situation drei getötete Arbeiter gefunden werden, könnte ihr Tod der Vorbote einer Revolution sein – oder die Nachwehe der Verrohung. Wird es Kommissar Rosenbaum und seiner Assistentin Hedi gelingen, die Morde aufzuklären?
Kay Jacobs, Jahrgang 1961, studierte Jura, Philosophie und Volkswirtschaft in Tübingen und Kiel. Er promovierte über Unternehmensmitbestimmung und war anschließend viele Jahre in unterschiedlichen Kanzleien als Rechtsanwalt tätig. Heute lebt er mit seiner Familie in Norddeutschland und schreibt über all das, was er als Anwalt erlebt hat oder hätte erlebt haben können. Für »Kieler Helden« wurde er mit dem Silbernen Homer ausgezeichnet. Näheres unter: www.kayjacobs.de
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
ISBN 978-3-8392-5638-1
Zitat
Wir alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen?
Friedrich Nietzsche
I
Schorsch Bade konnte nicht sehen und nicht sprechen. Er hätte hören können, wenn es etwas zu hören gegeben hätte. Doch die Kälte gefror jedes Geräusch. Ein paar Minuten vorher hatte er sich noch in einer Hütte befunden, gefesselt, geknebelt, die Augen verbunden, am Boden liegend. Neben ihm Marke und Lampe, die eigentlich Klaus Marquort und Reinhard Lampke hießen – jedenfalls glaubte Schorsch, dass sie neben ihm gelegen hatten. Wahrscheinlich befanden sie sich auch jetzt wieder an seiner Seite, nur nicht mehr in der Hütte, sondern davor, im Schnee.
Den spürte er deutlich: in den Stiefeln, wie er an den Hosenbeinen taute und vor allem wie er seine Hände allmählich taub und steif werden ließ. Er lag auf dem Rücken, die Hände unter dem Körper aneinandergefesselt. Sie schmerzten. Schorsch kannte dieses Gefühl, der Schmerz würde erst bis an die Grenze des Erträglichen zunehmen und dann abebben. Das würde er überstehen, er war kein Zärtling. Trotzdem war die Lage ernst. Schorsch wusste nur nicht, warum.
Wegen des Streiks? Der Versammlung? Alle streikten – wieso befanden sich jetzt ausgerechnet er und seine beiden Freunde in dieser Lage? Sie arbeiteten bei der Kaiserlichen Torpedowerkstatt in Friedrichsort. Heute war der 28. Januar 1918 und seit einigen Tagen wurde die Werkstatt bestreikt. Alle streikten. Die Werksleitung hatte verkündet, dass nur Dreiviertel der Belegschaft die Arbeit niedergelegt hätte. Aber das stimmte nicht, alle streikten. Als ihre Vertrauensleute plötzlich und ohne jede Vorwarnung zur Armee eingezogen werden sollten, reagierten spontan alle Kameraden. Alle. Selbst die Genossen von den Werften hatten sich ihnen angeschlossen, zuerst die von der Germaniawerft – die waren schon immer ziemlich aktiv gewesen –, später auch viele von der Kaiserlichen Werft und von Howaldt. Die Kieler Rüstungsbetriebe standen seit Tagen still. Und, kaum zu glauben, heute traten sogar die Berliner Rüstungsarbeiter in den Ausstand.
Am Abend war Schorsch mit Marke und Lampe ins Gewerkschaftshaus in der Fährstraße gefahren. Die Streikleitung hatte die Arbeiter zu einer Versammlung gerufen, weil die Vertrauensleute nun doch nicht eingezogen werden sollten. Der Protest hatte Erfolg gehabt, die Arbeit hätte wieder aufgenommen werden können. Doch jetzt waren die Berliner im Ausstand.
»Wir müssen uns solidarisch verhalten!«, forderte ein Redner.
»Die streiken doch gar nicht wegen uns!«, rief jemand dazwischen. »Die wissen gar nichts von uns! Die streiken wegen der Revolution!«
»Welche Revolution?«, fragte Schorsch leise.
»Die Oktoberrevolution«, antwortete Marke kopfschüttelnd und, als Schorsch ihn begriffsstutzig anschaute, ergänzte er: »Die Weltrevolution, Mann!«
Vor ein paar Monaten hatte in Russland die Oktoberrevolution stattgefunden, zuerst die Februarrevolution, dann die Oktoberrevolution. Leo Trotzki hatte die anschließenden Friedensverhandlungen mit Deutschland als Bühne genutzt, den Völkern der Welt die Grundsätze der proletarischen Revolution zu erklären. Plötzlich taumelten sämtliche Marxisten Europas in hoffnungsfroher Erwartung durch die Straßen, und die deutschen Spartakisten planten eine Januarrevolution, zuerst den Januarstreik, der würde zur Januarrevolution werden – und den ersten Schritt dazu hatten sie heute gemacht. In England, Frankreich und überall würden März-, April-, Mai- und Et-cetera-Revolutionen folgen, die Weltrevolution eben.
»Ich will eigentlich nur Frieden«, murmelte Lampe. »Und Essen.«
»Brot, Frieden und Revolution, das gehört zusammen. Sagt Trotzki«, belehrte ihn Marke.
Die Versammlung konnte sich nur verhalten für die Weltrevolution begeistern. Revolutionen hatten es in Kiel ohnehin schwer. Natürlich wählten die Arbeiter SPD, was sonst? Aber gemäßigt, die Mehrheits-SPD. Die Unabhängigen Sozialdemokraten nicht so sehr. Und die Spartakisten, also den revolutionären Flügel der USPD, erst recht nicht. So endete die Sitzung mit dem Beschluss, den Streik vorläufig weiterzuführen und in den nächsten Tagen neu zu beraten.
Kalt und dunkel war es, als Schorsch und seine beiden Freunde ihre Fahrräder bestiegen und den Heimweg antraten, einen weiten Weg, mindestens eine halbe Stunde bei Eis und Schnee, einen Weg, den sie aber abrupt abbrechen mussten. Gerade hatten sie sich mühsam die Bergstraße hinaufgetreten, da sprang ein Trupp Marinesoldaten aus dem Pissoir am Dreiecksplatz heraus und nahm sie mit vorgehaltenem Gewehr fest. Sie wurden in Handschellen gelegt und in ein Automobil gezerrt. Marke empörte sich und Schorsch fragte, was das solle. Eine Antwort erhielt er nicht. Sie fuhren die Holtenauer Straße entlang, hielten nach einiger Zeit an und bekamen Augenbinden und Knebel verpasst. Dann fuhren sie weiter, kamen in einem Waldstück an und hielten schließlich vor der Hütte. Niemand redete mit ihnen, sie wussten nicht, warum sie dort hingebracht wurden. Aber dass es eine Hütte in einem Waldstück war und nicht etwa eine Arrestanstalt in der Stadt, das stand fest. Die Stille im Wald war anders als die Stille in der Stadt, auch der Schnee war anders und die Luft. Die drei Freunde waren nicht verhaftet worden, man hatte sie verschleppt.
Angst befiel Schorsch. Nicht dass er misshandelt worden wäre. Hier und da ein fester Griff, fester vielleicht als nötig, aber zugleich eine Behandlung mit behütender Sorgfalt, Zärtlichkeiten fast, Wohlwollen möglicherweise. Als er aus dem Auto aussteigen musste, spürte er an seinem Kopf eine Hand, die ihn leitete und vor dem Türrahmen schützte. Er dachte an die Hand seiner Mutter, wenn sie ihn tröstend umschlungen hatte, und an die Hand des Pastors, wenn er ihn gesegnet hatte. Solche Hände würden nicht foltern oder töten, er konnte beruhigt sein. Und doch befiel ihn Angst.
In der Hütte setzte man Schorsch zunächst auf einen Stuhl, später legte man ihn auf den Boden, die beiden anderen vermutlich auch. Die Soldaten dürften um sie herumgestanden haben, noch immer sprach niemand. Nach einer Weile hörte er, wie sich die Tür öffnete und zwei, vielleicht drei Männer den Raum betraten. Die Soldaten machten hektische Geräusche, wahrscheinlich waren die Ankömmlinge Offiziere und die Soldaten standen stramm. Jetzt wurde zwar geredet, aber über nichts, was Aufschluss über die Situation hätte geben können.
»Wir übernehmen. Treten Sie weg«, sagte einer der Offiziere und bekam ein »Jawohl!« als Antwort.
Als die Soldaten die Hütte verlassen hatten, wurde wieder geschwiegen. Schorsch hoffte, dass ein Verhör folgen würde. Wegen des Streiks, der Versammlung. Der Völkerkrieg tobte seit dreieinhalb Jahren, und die Torpedowerkstatt gehörte zu den wichtigsten Rüstungsbetrieben. Da konnte eine nervöse Reaktion des Militärs nicht verwunderlich sein, da musste man mit Verhaftungen und Verhören rechnen. Einige Streikführer waren gestern oder vorgestern verhaftet worden, das wusste Schorsch. Er hoffte inständig, dass er jetzt wegen des Streiks verhört werden würde. Aber es gab kein Verhör. Die Offiziere wollten von ihm nichts wissen, von den beiden anderen auch nicht. Sie fragten sie nichts, auch untereinander sprachen sie nicht. Offenbar wussten sie genau, was zu tun war, sie brauchten sich nicht zu verständigen. Und was zu tun war, musste etwas anderes sein als ein Verhör. Die Offiziere öffneten die Tür, packten Schorsch beim Kragen, zerrten ihn hinaus und warfen ihn in den Schnee. Dann hörte er Geräusche, die ihn vermuten ließen, dass auch die beiden anderen herausgeholt worden waren. Und jetzt lag er im Schnee, wusste nicht warum und befürchtete das Schlimmste.
Wahrscheinlich waren die Soldaten keine richtigen Soldaten gewesen und die Offiziere keine richtigen Offiziere. Er war verschleppt worden, er und die beiden Freunde. Mit dem Streik hatte es nichts zu tun, es gab kein Verhör – Schorsch konnte sich aus dem Geschehen keinen Reim machen, es sei denn, es hatte mit den Leuten zu tun, mit denen sie sich eingelassen hatten.
Sie hatten sich mit den falschen Leuten eingelassen. Mit Leuten, denen sie nicht gewachsen waren und die keinen Spaß verstanden. Marke hatte ihn gewarnt, auch Lampe war skeptisch gewesen, aber Schorsch hatte es natürlich besser gewusst und schließlich die beiden anderen überzeugt. Zuerst hatten sie durchaus Vorteile daraus gezogen und es hatte keine Anzeichen gegeben, dass sich daran etwas ändern würde. Nichts, was diese Leute hätte verärgern und gegen sie aufbringen können, war passiert. Jedenfalls wusste Schorsch von nichts. Und doch, irgendetwas hatte passiert sein müssen.
Schorsch begann zu zittern. Er hätte nicht sagen können, ob vor Kälte oder Angst. Die Hände schmerzten. Wäre er nicht geknebelt gewesen, hätte er fragen können, was man von ihm wollte, was er falsch gemacht hatte, er und die beiden anderen, wie sie es wiedergutmachen konnten. Er hätte Reue zeigen oder vielleicht auch nur ein Missverständnis ausräumen oder eine Verwechselung aufklären können. Aber so? Er hörte, dass jemand ganz nahe neben ihm stand. Es waren keine Geräusche, er konnte die Nähe hören. Dann spürte er einen Stich am Hals, ein Ziehen, das sich von links knapp über dem Kehlkopf nach rechts zog und für einen kurzen Moment eine fast angenehme Wärme über seinen Hals ergoss. Er wusste, dass dies das Letzte sein würde, was er in seinem Leben spüren sollte.
II
Reformationstag 1918. Es war düster geworden in Deutschland. Zu früheren Zeiten hätte man den bevorstehenden November mit seinem notorisch trüben Wetter und seinen Trauertagen dafür verantwortlich gemacht. In diesen Jahren war es aber der Krieg, der sich auf die Seelen der Menschen legte. Sie hungerten, litten, starben und trauerten an der Front und in der Heimat. Je länger der Krieg dauerte, desto größer wurde das Leid. Aber auch die Gewöhnung. Hatte ein Todesfall in der Nachbarschaft vor einigen Jahren noch zu großer Bestürzung geführt, löste er inzwischen oft nicht einmal Betroffenheit aus. So wenig der Tod die Menschen mittlerweile schockierte, der Anblick von Leichen berührte sie doch, wenn auch nicht im Sinne von Trauer, sondern im Sinne von Ekel.
Auch Josef Rosenbaum ging es so. Seit 23 Jahren war er im Polizeidienst, zuerst in Berlin bei der Mordkommission A, dann in Kiel als Leiter des Ersten Kommissariats, zuständig für Mord und Totschlag. Er hatte schon viele Leichen gesehen, in allen denkbaren Zuständen, gewöhnt hatte er sich daran nie. Tatortbegehungen gehörten zu den unangenehmsten Aufgaben, die er zu bewältigen hatte. Natürlich gab er es nicht zu, außer einmal Hedi gegenüber, seiner schönen Assistentin, vielleicht aus Versehen, vielleicht aus Vertrautheit, genau wusste er es selbst nicht.
Jetzt war es wieder so weit, mittags um zwölf im Projensdorfer Gehölz zwischen der Kieler Stadtgrenze und dem Kaiser-Wilhelm-Kanal. Rosenbaum und Hedi standen vor einer Leiche. Der Kommissar kniete nieder, um den Toten genauer betrachten zu können, aber auch um den Anschein zu vermeiden, dass er sich ekeln würde. Je näher er der Leiche kam, desto stärker wurde sein Widerwille, vor allem wegen des Gestanks. Wie von verdorbenem Schweinebraten, den jemand in eine Mülltonne geworfen hatte – wenn man nichts ahnend den Deckel öffnete, ein Gewimmel von kleinen weißen Tierchen erblickte und der bestialische Gestank einen ansprang. Rosenbaum wusste, dass von Verwesungsgeruch keine gesundheitlichen Gefahren ausgingen, und doch konnte er das Gefühl, einem Miasma ausgeliefert zu sein, nicht vollständig besiegen. Er hatte an diesem Tag nicht gefrühstückt und es könnte einige Stunden dauern, bis er wieder in der Lage sein würde, etwas zu essen. Dabei hielt sich der Gestank heute durchaus in Grenzen. Die Verwesung war weit fortgeschritten, ein Großteil ihrer Geruchsstoffe verflogen. Auch der Anblick war halbwegs erträglich. Die Haut der Leiche sah aus wie eine zerrissene Lederjacke, die lange Zeit im Regen gelegen hatte. Die Augäpfel fehlten, der rechte Unterarm lag abgetrennt neben dem Torso, die übrigen Extremitäten wurden von der Kleidung zusammengehalten.
»Wissen wir, wer das ist?«, fragte Rosenbaum den Oberwachtmeister, der den polizeilichen Einsatz bisher geleitet hatte. Als der Kommissar und seine Assistentin mit ihrem Dienstwagen vor einer 20 Meter entfernt liegenden Forsthütte eingetroffen waren, hatte er sie in Empfang genommen, sich geduldig Rosenbaums Geschimpfe angehört – dass zwar die Hütte, nicht aber der Weg dorthin in seinem Straßenplan eingezeichnet sei – und sie durch das Unterholz zum Fundort geführt. Jetzt stand er ihnen assistierend zur Seite.
»Nein, Herr Kommissar, keine Ausweispapiere. Der Kleidung nach zu urteilen wahrscheinlich Werftarbeiter«, antwortete er in eifrigem, förmlichem und leicht devotem Ton.
Die Leiche war in graublaue Arbeiterkluft gekleidet. Neben ihr lag eine Ballonmütze, wie sie zwar in der gesamten Arbeiterschicht vorkam, bei den Werftarbeitern aber am häufigsten anzutreffen war.
»Was gibt es zur Auffindesituation zu sagen?«
»Dort vergraben«, antwortete der Oberwachtmeister und zeigte auf eine Grube, um die zehn Polizeianwärter mit Hacken und Spaten herumstanden und sich von harter körperlicher Arbeit erholten. »Etwa 60 Zentimeter tief. Hund des Försters hatte Arm ausgegraben.« Jetzt zeigte der Wachtmeister auf die Hütte, neben der sie gerade geparkt hatten. Auf ihrer Eingangsstufe saß ein Mann in grüner Uniform und vor ihm sein Hund. Sie schienen miteinander zu sprechen. Natürlich taten sie das nicht wirklich. Der Mann redete und der Hund hörte zu. Aber auf die Entfernung sah es so aus, als antwortete der Hund, wenn auch nur einsilbig.
»Saß die Mütze auf dem Kopf der Leiche?«
»Nein, Herr Kommissar. Lag daneben.«
Rosenbaum schaute den Wachtmeister an und nickte, während Hedi schmunzelte. Es kam selten vor, dass ein uniformierter Kollege normal mit ihm redete. Die Worte ›Jawohl‹ und ›Herr Kommissar‹ fielen überdurchschnittlich oft. Attribute, Artikel und Verben fehlten hingegen vielfach und ein ›Ich‹ hatte Rosenbaum von einem Wachtmeister fast nie gehört. Dieses autoritätsgläubige Verhalten war ihm zuwider und er erinnerte sich nicht, jemals Veranlassung dazu gegeben zu haben, jedenfalls nicht absichtlich. Er hatte aber auch nie etwas dagegen getan. Im Gegenteil, seine Abneigung ließ ihn unfreundlicher werden und die Uniformierten noch ein wenig unterwürfiger.
»Gehörte sie denn dem Opfer?«
»Jawohl, Herr Kommissar. Also …«
Eine nachdenkliche Pause entstand, die Rosenbaum dazu nutzte, die Mütze über den Schädel der Leiche zu ziehen. Sie war zu groß.
»Lassen Sie nach einer weiteren Leiche graben. Und die Männer sollen dabei vorsichtig vorgehen«, ordnete Rosenbaum an.
»Jawohl!« Der Oberwachtmeister lief auf seine Leute zu und trieb sie mit hektischen Bewegungen an, ganz so, als dürfe man einen Kriminalkommissar nicht warten lassen.
»Ich befrage mal den Förster«, sagte Hedi, als Rosenbaum die Ballonmütze zurücklegte.
»Ich befrage den Förster und Sie können mitkommen«, sagte Rosenbaum.
Die Hütte war nicht groß, vielleicht 20 Quadratmeter. Sie wirkte nicht sehr solide, ein mit Brettern verhauenes Holzgerüst, das nicht gepflegt wurde.
»Sie haben die Leiche gefunden?«, rief Rosenbaum dem grünen Mann zu, als sie noch zehn Meter entfernt waren. Nachdem Hedi vor drei Jahren seine Assistentin geworden war, hatte er sich angewöhnt, das Gespräch möglichst früh zu eröffnen. Sonst würde Hedi zu plappern beginnen und dann hörte sie so schnell nicht wieder auf. Unzählige Male hatte er ihr schon gesagt, dass sie still zu sein habe, wenn er mit Zeugen sprach – geholfen hatte es nicht.
Der grüne Mann stand so hastig auf, dass sein Hund erschrocken zusammenzuckte.
»Jawohl!«, antwortete er, machte einen Diener und stellte sich vor: »Forstmeister Sachs.«
Rosenbaum hatte noch nie einen Forstmeister kennengelernt, aber offenbar wiesen sie gegenüber Kommissaren dieselbe Unterwürfigkeit auf wie Wachtmeister.
»Josef Rosenbaum«, sagte der Kommissar, lächelte und streckte Sachs die Hand zur Begrüßung entgegen. Während des Handschlags wedelte der Hund mit dem Schwanz, er wollte auch begrüßt werden.
»Einen hübschen Hund haben Sie da«, sagte Hedi und hielt ihre Hand vor die Hundeschnauze.
»Danke. Er heißt Bodo.«
Nachdem Hedis Hand ausgiebig und ausgesprochen feucht beschnüffelt worden war, strich sie dem Hund über den Kopf und hatte wieder eine trockenere, aber etwas klebrige und ausgesprochen haarige Hand.
»Noch ziemlich jung, nicht wahr?«, fragte Rosenbaum.
»Zehn Monate. Ich musste lange darauf warten. Den alten hat das Heer requiriert. Sobald Bodo vollständig ausgebildet ist, werden sie auch ihn holen.«
Rosenbaum hatte davon gehört, dass das Militär neuerdings Spürhunde einsetzte. Dass sie vorher den Jägern weggenommen wurden, wusste er nicht.
»Vielleicht wird er ja gar nicht vollständig ausgebildet«, sagte er. Erst im Nachhinein wurde ihm klar, dass seine Äußerung als Anstiftung zu kriegsschädlichem Verhalten aufgefasst werden konnte. Dann wurde ihm klar, dass er es auch so gemeint hatte.
»Und Bodo hat die Leiche gefunden?«, fragte Hedi und erntete von Rosenbaum einen missbilligenden Blick.
»Ja, das hat er.«
»So ein unerwarteter Fund muss sehr schockierend sein, nicht wahr?«, beeilte sich der Kommissar, das Wort wieder an sich zu reißen.
»Ich bin noch ganz außer mir«, seufzte der Förster. »Das war wirklich ein Schock.« Seine Stimme wurde weicher, seine Bewegungen auch, und er hatte mehrmals ›Ich‹ gesagt. Leutseligkeit wirkte.
Sachs berichtete, dass im Projensdorfer Gehölz Wildschweine gesichtet worden seien, obwohl sie in dieser Gegend seit Langem als ausgerottet galten. »Eines dieser Tiere muss die Leiche freigelegt haben. Bodo fand die Stelle und apportierte einen Arm.« Lobend kraulte der Förster seinen Hund hinterm Ohr. Der Hund bedankte sich mit einem kurzen Bellen.
»Die Leiche dürfte bereits einige Zeit dort vergraben gewesen sein. Wie kommt es, dass Bodo sie nicht schon früher gefunden hatte?«, wollte Rosenbaum wissen.
»Ich hab ihn ja noch nicht so lange. Und er hatte keinen Auftrag, nach vergrabenen Leichen zu suchen. Und wir sind auch nicht oft hier.«
»Ach, ist das nicht Ihr Forsthaus?«
»Das ist doch kein Forsthaus. Das ist Folklore, bestenfalls.« Der Forstmeister schüttelte lächelnd den Kopf. »Die ganze Ecke hier war ursprünglich Kanalgebiet. Als die Burschen vom Reichskanalamt sich nicht mehr darum kümmern wollten, pflanzten sie Setzlinge ein und bauten die Hütte, und zwar so, wie sich Wasserleute ein Forsthaus vorstellen – Folklore eben. Dann sagten sie: Das ist jetzt ein Forst. Und nun sollten wir uns darum kümmern. Der damalige Oberförster lachte sich einen Ast, als er den Verhau sah.«
Rosenbaum versuchte, durch die geschlossenen Fensterläden in die Hütte zu schauen. Alles dunkel, er konnte nichts erkennen.
»Können wir reingehen?«
»Klar.«
Sachs zog ein Schlüsselbund aus der Jackentasche. Die Tür quietschte, als er sie öffnete, und die Dielen knarrten, als Rosenbaum sie betrat. Müdes Tageslicht dämmerte in einen schlafenden Raum. Rechts ein Spülstein, daneben ein Schränkchen mit Blechgeschirr, in der Ecke ein Kanonenofen, gegenüber ein Fenster, links ein Regal und eine Holzbank, in der Mitte mehrere Stühle, ein Tisch. Alles alt, grobschlächtig, staubig, muffig. Rosenbaum kam sich vor wie Howard Carter.
»Ist offenbar längere Zeit nicht genutzt worden«, sagte Hedi.
»Wir stellen höchstens mal Gerätschaften hier ab. Früher haben in der Hütte manchmal Waldarbeiter übernachtet, wenn sie in der Nähe zu tun hatten. Aber jetzt gibt es keine Waldarbeiter mehr.«
»Alle an der Front?«, fragte Rosenbaum.
Sachs nickte.
Der Kommissar kniete nieder und inspizierte die Bodendielen in der Hoffnung, Spuren von Blut zu entdecken, fand aber nur Staub. Der Hund bummelte auf ihn zu. Für den Boden interessierte er sich nicht, lediglich für Rosenbaums Haare. Kurz beschnüffelte er sie und widmete sich danach ausgiebig einigen Spaten und Forken, die neben dem Regal an der Wand lehnten.
»Bodo! Komm her!«, befahl der Förster.
Der Hund brauchte zwei weitere Aufforderungen, bevor er widerwillig zu seinem Herrchen trottete.
Rosenbaum griff nach einem der frisch beschnüffelten Spaten und betrachtete ihn genau. »Wäre Bodo denn in der Lage, eine Leiche in 60 Zentimeter Tiefe zu finden?«
»Selbstverständlich, er ist ein Schweißhund. Das ist quasi sein Beruf. Also, wenn er mit der Lehre fertig ist. Deshalb ist das Militär ja scharf auf ihn.«
Als Rosenbaum seine Hand nach Bodo ausstreckte, kam der Hund ein paar Schritte auf ihn zu und bot sein Ohr zum Kraulen an.
»Vielleicht könnten Sie uns helfen«, sagte der Kommissar.
Eine halbe Stunde später waren zwei weitere Leichen ausgraben. Bodo hatte an der Ballonmütze geschnuppert, war in die Grube gesprungen, hatte an zwei, drei Stellen gestöbert, prompt den passenden Schädel freigelegt und – wo er gerade in Fahrt war – gleich daneben noch einen weiteren. Das hatte insgesamt eine Minute gedauert. 29 Minuten hatten anschließend die Polizeianwärter gebraucht, bis die leblosen Körper geborgen waren.
Jetzt lagen die Leichen nebeneinander aufgereiht auf dem Waldboden. Die Polizeianwärter standen dahinter, Rosenbaum, Hedi, der Oberwachtmeister, der Förster und der Hund davor.
Sachs beugte sich zu seinem aufgeregt hechelnden Hund hinunter. »Na, möchtest du gerne weitersuchen?« Bodo jaulte, der Förster nickte und wandte sich Rosenbaum zu. »Er hat noch nicht genug.«
»Wo drei Leichen sind, können auch vier sein«, sagte Rosenbaum. »Dann mal los.« Er schaute in die Gesichter der Polizeianwärter, die vor Erschöpfung wahrscheinlich glaubten, vier Leichen wären unmöglich. Aber sie trauten sich nicht, das auszusprechen.
Sachs ließ den Hund von der Leine, und Bodo sprang erneut in die Grube, dann wieder hinaus, lief von Baum zu Baum, dann zu einem Strauch und wieder zurück, schnupperte hier und dort und schlug schließlich an. Eine Viertelstunde später brachten die Polizeianwärter das Skelett eines Eichhörnchens zum Vorschein. Der Vorgang wiederholte sich in ähnlicher Weise dreimal, bis Sachs seinen Hund entschuldigte – »Er ist noch jung« – und Rosenbaum die weitere Suche einstellen und die Fundstücke zur Kieler Gerichtsmedizin in der Hospitalstraße bringen ließ.
Rosenbaum und Hedi begleiteten den Transport. Außer den Leichen und der Mütze hatten sie keine Spuren, und Rosenbaum hoffte, dass wenigstens der Gerichtsarzt ein paar schnelle Tipps würde geben können.
Leiter des Instituts für Gerichtliche Medizin war Professor Ernst Ziemke, ein vornehmer und gebildeter Mann, einerseits preußisch, andererseits mitfühlend, zurückhaltend, von fröhlicher Natur und – wie Hedi immer wieder anmerkte – mit schönen Augen.
»Meine Patienten haben mich gern«, sagte der Professor zur Begrüßung, als Rosenbaum und Hedi die Treppe ins Kellergeschoss hinunterstiegen und die Polizeianwärter ihr Transportgut in den Sektionssaal trugen. »Sobald ich hier bin, kommen sie mich besuchen.« Ziemke war nicht nur Gerichtsarzt in Kiel, sondern auch Chefarzt des in Belgien stationierten Reservefeldlazaretts 54. Während er anfangs in Wochenabstand pendelte, verbrachte er allmählich immer mehr Zeit in Belgien. Doch Leichentransporte zur Gerichtsmedizin fielen meist nur an, wenn Ziemke sich gerade in Kiel aufhielt.
»Vielleicht wäre es für die Kriminalitätsrate von Vorteil, wenn Sie ganz in Belgien blieben«, schlug Rosenbaum vor.
Ziemke schüttelte die Hände seiner Besucher. Gemeinsam gingen sie in den Sektionssaal mit seinem hellen Steinfußboden, den gelben Wandkacheln und fünf Sektionstischen aus Granit, auf die die Polizeianwärter gerade die Leichen gehievt hatten. Zwei Sektionshelfer entkleideten die weitgehend verwesten Körper und Ziemke betrachtete sie eingehend, während Rosenbaum erzählte, was er von dem Fund wusste.
»Alle drei etwa Mitte 30, mesomorpher Körperbau, vermutlich Arbeiter«, sagte der Professor, als der Kommissar mit seinem Bericht fertig war. »Dann machen wir mal als Erstes ein paar Erinnerungsfotos. Oder sind bereits welche angefertigt worden?«
Hedi verneinte. Einen Polizeifotografen gab es in Kiel seit über einem Jahr nicht mehr. Der letzte war kurz vor dem Waffenstillstand an der Ostfront zum Militär eingezogen und nach Brest-Litowsk geschickt worden, weil sich die Militärführung historisch bedeutsame Fotografien erhofft hatte. Indes, es war eben noch vor dem Waffenstillstand gewesen, und der Fotograf war zu einem der letzten Gefallenen der Ostfront geworden, als er dort seine ersten Fotos hatte schießen wollen. Seither begnügte sich die Kieler Polizei wie im letzten Jahrhundert mit Tatortskizzen. Allein die Gerichtsmedizin besaß noch einen Fotoapparat, genau genommen: Ziemke besaß einen – er war Hobbyfotograf und wohlhabend genug, sich eines dieser sündhaft teuren Geräte leisten zu können.
Auf ein Zeichen schafften die Sektionshelfer Kamera, Stativ und Blitzvorrichtung heran, bauten alles routiniert auf und lichteten jede Leiche mehrfach ab, ein eingespieltes Team.
»Machen Sie Großaufnahmen vom Gebiss. Daran wird man die Männer noch am ehesten identifizieren können«, wies Ziemke seine Helfer an und wandte sich dann Rosenbaum zu. »Lag dieser auf dem Bauch, dieser auf der rechten Seite und dieser auf dem Rücken?«, fragte er und deutete nacheinander auf die drei Opfer.
Rosenbaum bejahte.
»Dann war der Fundort vermutlich auch der Tatort. Die drei sind wahrscheinlich verblutet, und zwar nachdem ihnen die Halsschlagadern durchtrennt worden waren.«
»Aha«, sagte Rosenbaum staunend. Er trat an eine Leiche heran und beugte sich hinunter. Ja, ein Schnitt über den Hals, das könnte sein, dachte er. Obwohl nicht mehr viel zu erkennen war.
Ziemke holte zwei Pinzetten von einem Rollwagen und zog damit die Schnittkanten auseinander. »Hier, die Arteria carotis«, sagte er, »ein sauberer Schnitt mit einem scharfen Messer. Im Gehirn fällt augenblicklich der Blutdruck ab, man wird sofort bewusstlos, oft kommt es zu einem reflektorischen Herzstillstand. In jedem Fall tritt nach kurzer Zeit der Tod ein. Eine sichere, schnelle, halbwegs saubere und nahezu schmerzfreie Sache. Würde sich gut als Hinrichtungsmethode eignen, wird nach meiner Kenntnis aber nirgendwo offiziell angewandt.«
Die beiden traten zurück, um die Sektionshelfer bei ihrer Arbeit nicht unnötig zu stören, und die Ermittler warteten gespannt auf Ziemkes weitere Ausführungen.
»Sehen Sie die Verfärbungen? Dieser Mann hat sie am Rücken, dieser am Bauch und dieser an der Flanke.«
Nur mit Mühe konnte Rosenbaum bei dem, was einmal Haut gewesen war, dezente farbliche Nuancen zwischen Umbra, Oliv und Schwarz ausmachen.
»Das sind Leichenflecken. Sie entstehen eine halbe Stunde nach Kreislaufstillstand an der Körperunterseite, weil das Blut sich dort ansammelt. Wird der Körper danach bewegt, verändern sie sich. Das ist bei diesen Opfern nicht der Fall. Die Männer sind spätestens 30 Minuten nach ihrem Tod in ihre endgültige Position gebracht worden.«
»Respekt«, sagte Hedi leise, und ›Respekt‹, dachte auch Rosenbaum bei so viel Erkenntnis nach so wenigen Blicken. Ziemke war eben ein Meister seines Faches. »Und wie lange ist die Tat her?«
Jetzt zögerte der Gerichtsarzt. »Im Projensdorfer Gehölz in 60 Zentimeter Tiefe vergraben?«
Rosenbaum nickte.
»Wo war der Fundort denn genau?«, fragte Ziemke nach.
Als Hedi stutzte und der Kommissar noch nachdachte, wie die Frage gemeint sein könnte, präzisierte der Professor: »In einer Senke? Auf einer Anhöhe? Unter Bäumen? Auf einer Lichtung?«
»Was ist daran so wichtig?«, fragte Hedi.
»Feuchtigkeit und Sauerstoff. Das sind neben der Temperatur die maßgeblichen Faktoren für die Verwesungsgeschwindigkeit. Am schattigen Rand eines Moores kann ein auf dem Boden liegender Körper innerhalb von zwei Wochen verwest sein. Ein Meter tiefer hält er sich vielleicht Jahrhunderte. Es kommt entscheidend auf die Bedingungen am Fundort an«, dozierte der Professor. »Das Projensdorfer Gehölz ist ein noch relativ neues Areal. Als der Kaiser-Wilhelm-Kanal fertig war, schob man den Aushub zusammen und pflanzte Buchen und Fichten darauf. Das ist über 20 Jahre her. Inzwischen haben sich dort sehr unterschiedliche Habitate gebildet, von sandig-trockenen Hügeln bis zu Feuchtbrachen.«
»Ganz normal im Wald. Unter Bäumen.« Besser konnte Rosenbaum es nicht beschreiben.
»Sechs bis 18 Monate«, lautete Ziemkes Einschätzung.
Das war auch Rosenbaums Gefühl: Einen Sommer dürften die Leichen hinter sich haben, vielleicht auch zwei. Rosenbaum hatte sich eine genauere Festlegung des Fachmanns erhofft.
»Präziser kann ich es nicht sagen«, entschuldigte sich dieser. »Die Verwesungsgeschwindigkeit ist wissenschaftlich nicht sehr gut erforscht. In den letzten Jahren konnten wir zwar einiges hinzulernen – an der Front ergibt sich manchmal die Gelegenheit, Gefallene zu untersuchen, die teilweise mehrere Monate im Niemandsland gelegen haben, bevor sie geborgen werden können. Aber im Grunde haben wir dabei nur gesehen, dass alles sehr unterschiedlich sein kann.«
»Wurden die Opfer misshandelt? Waren sie gefesselt? Gab es vielleicht einen Kampf?«, fragte Rosenbaum in der Hoffnung, dass sich das magere Ergebnis von Ziemkes Leichenschau aufbessern ließe.
»Der Linke hat auffällige Male an den Handgelenken, er könnte gefesselt gewesen sein. Bei diesem Verwesungsgrad kann man das aber nicht sicher sagen. Vielleicht finden wir noch Fasern von einem Seil. Wir machen die drei gleich mal auf.«
Dann stutzte der Professor. Er beugte sich über eine der Leichen und musterte ihren linken Unterarm.
»Eine Tätowierung«, murmelte er, holte aus einem Wandschrank einen Tupfer, tränkte ihn in einer stark riechenden Flüssigkeit und strich damit sachte über den Arm der Leiche. »Ein Anker und eine Meerjungfrau.«
Mit seiner Pinzette fuhr er die Umrisse der Tätowierung nach, sodass die Ermittler sie auch erkannten.
»Ja, stimmt«, sagte Hedi, und Rosenbaum grunzte zustimmend. Der Geruch der Flüssigkeit stieg in seine Nase. Im Vergleich zu den üblicherweise in diesen Räumen herrschenden Gerüchen war es fast ein Duft.
Bei den beiden anderen Leichen fand Ziemke identische Tätowierungen, jeweils am linken Unterarm.
»Blutsbrüder oder so was«, sagte Hedi und Rosenbaum grunzte.
Auf einem Foto würden die schwachen Farbunterschiede kaum zu erkennen sein. Also zog Hedi Bleistift und Notizblock aus ihrer Tasche und begann, Anker und Meerjungfrau detailgetreu abzumalen.
Ziemke schaute auf einen Regulator, der neben der Eingangstür hing und dessen üppiger Jugendstil einen aussichtslosen Kampf gegen die kühle Funktionalität der übrigen Einrichtung führte. »Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ich muss den letzten Zug nach Berlin erwischen. Morgen früh wird dort über eine nationale Erhebung beraten.«
Nationale Erhebung? Rosenbaum und Hedi sahen sich an, als glaubten sie nicht, was sie gehört hatten. Rosenbaum hätte jetzt lieber nicht über Politik gesprochen, aber Hedi fragte nach: »Nationale Erhebung?«
Ziemke sah Hedi verdutzt an, bis er sich zu vergegenwärtigen schien, dass sie eine Frau war und von Politik natürlich nichts verstand. »Die Oberste Heeresleitung ist zurückgetreten und hat die Staatsführung einem unbedarften Aristokraten überlassen, der offenbar einen Unterwerfungsfrieden auf der Grundlage des Wilson-Papiers ansteuert. Die Briten marschieren durch Flandern. Die Volksgemeinschaft ist in Auflösung begriffen, Defätismus greift um sich. Da kann man nicht einfach zusehen, da muss man etwas tun.«
Das waren unerwartete Worte aus dem Mund des Professors. Wie konnte man sie sich erklären? Drei Wochen zuvor war eine unerhörte Nachricht durch die Zeitungen galoppiert: Die militärische Lage sei aussichtslos und der Krieg praktisch verloren. Das traf die Menschen wie ein Blitzschlag aus wolkenlosem Himmel. Sie waren zwar schon seit Jahren kriegsmüde, und die Forderung nach einem Verständigungsfrieden wurde laut. Sogar der Reichstag hatte im Sommer 1917 eine Friedensresolution verabschiedet, wonach deutsche Kriegsziele bei Friedensverhandlungen zur Disposition gestellt werden sollten. Der Separatfriede mit Sowjetrussland setzte dann aber Kräfte frei, die ab März an die Westfront geworfen und Quell neuer Siegeszuversicht wurden. Das war bis vor drei Wochen der Kenntnisstand der Bevölkerung gewesen. Die neuen Informationen riefen zunächst eher Unglauben hervor, immerhin standen die deutschen Truppen nach wie vor tief in Feindesland. Allmählich keimte aber Hysterie auf. Die einen verlangten nach der weißen Fahne, die anderen forderten, die einen zu bekämpfen. Die Hysterie griff um sich und hatte offenbar auch Ziemke erfasst.
»Die Nation soll sich erheben?«, bohrte Hedi abermals nach.
»Bevor wir von homosexuellen, jüdischen und sozialdemokratischen Volksfeinden regiert werden, müssen wir uns erheben!«
Rosenbaum war Jude. Ziemke wusste das, hatte ihm gegenüber aber nie antisemitische Tendenzen erkennen lassen. Seit zwei Jahren war Rosenbaum auch eingetragenes Mitglied der SPD, hatte es aber nicht an die große Glocke gehängt. Homosexuell – oder etwas Ähnliches – war er auch, hielt dies jedoch geheim. Er stellte in Reinform dar, was Ziemke offenbar verabscheute. Er war entsetzt, nicht so sehr über die Anschauungen des Professors, das zwar auch, aber mehr noch darüber, dass er ihn all die Jahre, die sie sich kannten, vollkommen anders eingeschätzt hatte. Konservativ mochte er sein, ja sicher: konservativ, preußisch, pflichtbewusst, tugendhaft. Auch wenn Rosenbaum diese Weltsicht nicht teilte, man konnte dagegen nichts sagen. Die Briten waren auch konservative Monarchisten und hatten doch eine der liberalsten Gesellschaften der zivilisierten Welt hervorgebracht. Und so hätte Rosenbaum Ziemke eingeschätzt: Wäre er kein Preuße gewesen, hätte er gut ein Brite sein können. Über Politik hatten sie nie geredet, aber über Menschen, über soziale Missstände, über tragische Schicksale, mit denen sie beruflich gemeinsam zu tun hatten. Dabei hatten sie sich immer gut verstanden. Eine kleingeistige, deutschnationale, völkische Gesinnung hatte er Ziemke nie zugetraut.
Bevor Hedi erwidern konnte – und sie stand kurz vor einem Ausbruch von donnernder Empörung –, bat Rosenbaum um Übersendung der Fotografien und einen kurzen Telefonanruf, sobald die weitere Leichenschau beendet sein würde. Dann verabschiedete er sich eilig und zog Hedi mit sich aus dem Saal. Obwohl ihre Skizze noch nicht ganz fertig war, protestierte sie nicht.
Eine halbe Stunde später saßen die beiden Kriminalisten in ihrem Büro in der Blume, dem Kieler Polizeipräsidium, rauchten eine Zigarette und tranken Ersatzkaffee. Seit dem Friedensschluss mit Russland konnte man wieder zu annehmbaren Preisen an türkische Zigaretten kommen. Bei Kaffee sah es anders aus. Aber die Menschen waren nicht mehr so anspruchsvoll wie früher. Viele waren vollkommen mittellos und mussten sich von den Armenküchen vor dem Hungertod retten lassen. Und diejenigen, die sich den Einkauf von Lebensmitteln noch leisten konnten, wurden von dem unausweichlichen Anblick riesiger Menschenschlangen vor den Küchen zur Genügsamkeit ermahnt. Da wurde in Ermangelung von Butter auch schon mal das Fett aus dem Haar der Hausfrau gekämmt und zum Braten verwendet. Und statt Kaffeebohnen verarbeitete man Malz, Gerste, Roggen, Mais, Dinkel, Hagebutten oder Zuckerrüben. Der Kantinenwirt der Blume brühte seit Kurzem halbwegs schmackhaften Ersatzkaffee aus Löwenzahnwurzeln, und davon tranken der Kommissar und seine Assistentin jetzt, ohne Milch, aber mit viel Zucker – den gab es im Überfluss. Früher hatte Rosenbaum seinen Kaffee ohne Zucker getrunken. Das war aber zu Zeiten gewesen, als Kaffee noch nach Kaffee geschmeckt hatte.
Rosenbaum saß hinter seinem Schreibtisch, lehnte sich zurück und schaute auf die gegenüberliegende Wand, wo ein weißer Fleck an ein Porträt des Kaisers erinnerte und daneben eine Schiefertafel hing, auf die er mit Kreide drei Fragezeichen gemalt hatte. Hedi saß auf dem Besucherstuhl vor dem Schreibtisch und blickte aus dem Fenster. Sie sagten nichts. Rosenbaum wollte sich auf seinen Fall konzentrieren, musste aber immer wieder an Ziemke denken. Er hatte sich für einen Spezialisten des menschlichen Seelenlebens gehalten, doch bei Ziemke hatte er sich radikal geirrt.
»Es sieht jedenfalls nicht nach Ehestreit aus, auch nicht nach Raubüberfall«, sagte Hedi in die Stille und führte damit ihren Chef zum Fall zurück. »Eher nach einer Hinrichtung, nach einer inoffiziellen Hinrichtung. Ein Bandenkrieg oder ein politischer Hintergrund.«
»Heutzutage sind Schmugglerringe die einzigen aktiven Banden und für die sind die PP oder die Feldgendarmerie zuständig, wir nicht«, entgegnete Rosenbaum.
»Also Meldung an die PP und Akte schließen?«
»Ganz sicher nicht«, sagte der Kommissar schnell und bestimmt.
›PP‹ stand für ›Preußische Geheime Politische Polizei‹, eine Abteilung der Berliner Polizei, die erst vor wenigen Jahren einen Ableger in die Kieler Stadtpolizei implantiert hatte. Ihr offizieller Titel lautete ›Zentralstelle für Auswertungs- und Informationstätigkeit‹, was viel zu modern klang, niemand sagte das. Ihre Tätigkeit war geheim, intrigant, rücksichtslos und niederträchtig, und genau das gehörte zum Anforderungsprofil eines Beamten, wenn er sich dorthin bewerben wollte. Offiziell belegte die PP in der Blume nur fünf Souterrainräume, aber es hieß, dass sie irgendwo in der Stadt insgeheim über ein ganzes Gebäude verfügte – Rosenbaum würde sich nicht wundern, wenn dort gefoltert wurde. Als örtlicher Leiter der PP fungierte Iago Schulz, und er war der Grund, weshalb Rosenbaum die PP noch weniger leiden konnte als irgendein anderer Kollege. Schulz verkörperte nicht nur alle widerlichen Eigenschaften eines Geheimpolizisten, sondern führte auch einen Privatkrieg gegen Rosenbaum, seit er vor neun Jahren nach Kiel versetzt worden war. Über seinen Beweggrund konnte Rosenbaum nur spekulieren. Es gab Rivalität und Neid – Rosenbaum leitete von Beginn an die prestigeträchtige Mordkommission, obwohl er zunächst nur Kriminalobersekretär gewesen war und Schulz, damals schon Kriminalkommissar, sich mit Vermögensdelikten hatte abgeben müssen. Aber das allein konnte Schulz’ Verhalten nicht erklären. Hinzu kam sein Antisemitismus. Er machte keinen Hehl daraus, dass Juden für ihn minderwertig und schädlich waren, Ungeziefer, dem man Herr werden musste. Und wahrscheinlich war er auch davon überzeugt, dass das Weltjudentum die sich abzeichnende Niederlage Deutschlands im Völkerkrieg geplant hatte. Rosenbaum war Jude, aber was das Weltjudentum war, das wusste er nicht. Das wusste auch kein anderer Jude, den er kannte. Das wussten wohl nur die Antisemiten.
»Ganz sicher nicht«, wiederholte Rosenbaum, obwohl es immer heikel war, wenn einer seiner Mordfälle Berührungspunkte mit der PP hatte. Denn Schulz würde nie mit ihm zusammenarbeiten oder auch nur Auskünfte erteilen. Da wäre das Leben für Rosenbaum schon einfacher gewesen, wenn er einen solchen Fall ganz an die PP abgab. Freiwillig würde er so etwas aber nie tun.
»In einem Punkt hat Ziemke recht: Die staatliche Ordnung löst sich allmählich auf, da wittern viele ihre Chance, die Gesellschaft zu verändern«, überlegte Rosenbaum laut und dachte an seinen alten Freund Karl Liebknecht, der in jeder Hinsicht das Gegenteil von Schulz darstellte: integer, aufrichtig, mitfühlend. In mancher Hinsicht war er aber auch unnachgiebig, rücksichtslos sogar, also doch nicht das vollkommene Gegenteil von Schulz. Wenn zwei solche Kontrahenten mit ausreichender Machtfülle aufeinanderstoßen, entstehen Kriege. Vielleicht entstehen Kriege nur auf diese Weise, dachte Rosenbaum. Nein, damit tat er seinem Freund Unrecht. Liebknecht war entschieden gegen den Krieg eingestellt, er kämpfte dagegen. Vor zwei Jahren war er zu Zuchthaus verurteilt worden, weil er gegen Militarismus und Krieg eingetreten war. Als er vor gerade mal einer Woche freigelassen worden war, hatte er seinen Kampf sofort wieder aufgenommen. Für Rosenbaum hatte er nur einen kurzen Telefonanruf übrig gehabt. Liebknecht war gegen den Krieg, dachte Rosenbaum. Dann dachte er an Mephisto, der stets das eine wollte und doch das andere schuf.
»Und?«, fragte Hedi. Rosenbaums Denkpause dauerte ihr offenbar zu lange.
»Denken wir mal nach, Hedi: Welche besonderen politischen Ereignisse gab es zwischen Sommer 1917 und Sommer 1918 in Kiel?«
»Da war doch letztes Jahr diese Matrosenrebellion auf dem Kaiser-Wilhelm-Kanal«, antwortete Hedi. »Und unsere drei Toten wurden 200 Meter südlich des Kanals gefunden.«
Rosenbaum erinnerte sich: Es war im Sommer 1917 gewesen, die ›Prinzregent Luitpold‹, eines der größten und modernsten Großlinienschiffe der Kaiserlichen Marine, kam wegen Befehlsverweigerung mitten im Kanal zum Stehen und blockierte die gesamte Fahrrinne. Die Kieler Polizei war von einem hilflosen Deckoffizier, der keinem Marinesoldaten mehr getraut hatte, alarmiert worden, obwohl sie für den Kanal gar nicht zuständig war und für die Marine erst recht nicht.
»Was ist aus der Sache eigentlich geworden?«, fragte Rosenbaum.
»Ich weiß nicht. In der Zeitung stand darüber nichts. Natürlich nicht«, antwortete Hedi. »Aber: auf Meuterei steht Todesstrafe.«
»Und Sie denken, die sind kurz mal an Land gegangen, haben ein Urteil gesprochen und gleich vollstreckt?« Rosenbaum legte die Stirn in Falten.
»Kurzer Prozess, so was macht man doch gern in Kriegszeiten. Wer weiß, was dort genau geschehen ist.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das herausbekommen werden. Das ist Militärangelegenheit.«
Hedi grinste. »Also Meldung an die Marinepolizei und Akte schließen?«
»Wenn unsere Toten mit der Matrosenrebellion zu tun haben: ja. Aber dafür gibt es keine ausreichenden Anhaltspunkte. Im Gegenteil, die drei waren Arbeiter und keine Matrosen.«
»Na gut, was haben wir noch?«, fragte Hedi und lieferte gleich die Antwort: »Den Streik im Januar. Und den haben die Werftarbeiter geführt. Passt.«
»Vielleicht«, sagte Rosenbaum. »Vielleicht auch nicht. Wir forschen mal nach, wo gleichzeitig drei Arbeiter verschwunden sind. Das dürfte ja nicht jeden Tag passiert sein. Sie stöbern die Vermisstenkartei durch und ich frage bei den Werften nach.«
III
»Fahrgast Müller, moin, Herr Kaleu. Ich soll Sie unverzüglich zum Stationskommando bringen.«
›Kaleu‹ war in der Kaiserlichen Marine die inoffizielle, aber übliche Anrede für einen Kapitänleutnant. Als ›Gasten‹ wurden rangniedere Marinesoldaten bezeichnet, und ›Fahrgasten‹ waren Gasten im Landfahrdienst der Marine – eine Wortschöpfung, die bei Zivilisten regelmäßig zu Verwirrungen führte. Anders als die Polizei konnte sich die Marine, des Kaisers liebstes Spielzeug, noch Chauffeure leisten.
Kapitänleutnant Klaas Ravens stand im eilig übergeworfenen Schlafrock vor dem Gast und unterdrückte ein Gähnen. Es war kurz vor sieben, in wenigen Minuten würde der Wecker ohnehin klingeln, die Hetzerei wäre nicht nötig gewesen. Aber es schien wichtig zu sein: Vor dem Haus stand ein Mercedes Doppelphaeton mit sechs Zylindern und unfassbaren zehn Liter Hubraum, das Dienstfahrzeug des Gouverneurs. Während der Gast vor der Tür wartete, zog Ravens hastig seine Uniform an. Die Morgentoilette reduzierte er auf das Nötigste, für ein Frühstück blieb keine Zeit.
Der Kopf war noch schwer von der letzten Nacht. Zu Ehren des neuen Gouverneurs war ein Fest gegeben worden, mit üppigen Speisen und noch üppigeren Alkoholika. Die Marine hatte den gesamten Krieg über nicht viel zu tun. Die Hochseeflotte war der britischen Grand Fleet unterlegen und versteckte sich meist in ihren Häfen, lediglich die U-Boote gingen in größerem Umfang auf Feindfahrt. Ansonsten besprach man immer wieder die Lage, übte ab und an einige Manöver und ließ die Decks schrubben. Sonst gab es nichts zu tun. Außer feiern eben. Und dafür standen den Offizieren genügend Vorräte an Speisen, Getränken, Zigarren und Frauen zur Verfügung. Selbstredend nur den Offizieren – die Mannschaften hatten sich mit Kartenspiel und Zigaretten in gesundheitlich unbedenklichen Rationen zu begnügen. Ravens machte sich allerdings nicht viel aus solchen Festivitäten. Für ihn waren es Pflichtveranstaltungen, die er entweder möglichst bald verließ oder sich mit mehreren Litern Rotwein erträglich trank. Dieses Mal hatte er die zweite Variante gewählt.
Der Tag war noch nicht angebrochen, als der Fahrgast den Mercedes nach kurzer Wegstrecke an der Ecke Adolfstraße Lornsenstraße zum Stehen brachte und seinem Fahrgast – nein, ein besseres Wort fiel auch der Marine nicht ein – die Fahrzeugtür öffnete. Vor ihnen lag der Haupteingang eines selbstbewussten, historistischen Verwaltungsgebäudes mit reichlich Erkern, Spitzgiebeln, großen Fenstern und bunten Wappen und Emblemen an der Fassade, der Sitz der Marinestation Ostsee, einer der beiden obersten Kommandobehörden der Kaiserlichen Marine am Land. Fast alle Räume, sogar das große Sitzungszimmer über dem Eingangsportal, strahlten hell erleuchtet und ließen das Gebäude wie ein Weihnachtsbaum aussehen.