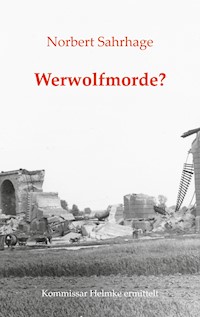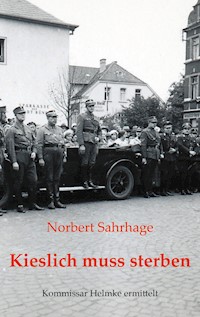
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Februar 1949: Der ehemalige Bünder SS-Obersturmführer Paul Kieslich muss sich vor einem Bielefelder Geschworenengericht wegen seiner Beteiligung am Novemberpogrom 1938 verantworten. Unmittelbar nach seinem Freispruch wird Kieslich in einer Bielefelder Gaststätte ermordet. Kriminalkommissar Walter Helmke stellt sehr rasch fest, dass Kieslich durch Falschaussagen vor Gericht entlastet worden war. Der Kommissar fragt sich zunächst, ob es sich bei dem Mord um die Tat eines vom Prozessverlauf enttäuschten NS-Opfers handelt. Er gelangt aber nach einem weiteren Mord zu der Erkenntnis, dass mehr dahinterstecken muss. Bei seinen Ermittlungen trifft Helmke sowohl auf Opfer, aber auch auf Täter aus der Zeit des "Dritten Reiches". Mit historischer Genauigkeit beschreibt Norbert Sahrhage die langen Schatten der NS-Vergangenheit am Vorabend der Gründung der Bundesrepublik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Sahrhage wurde 1951 in Spenge geboren. Er studierte an der Universität Bielefeld Geschichte, Sozialwissenschaften und Sport. Von 1979 bis 2015 arbeitete er als Lehrer an einem Gymnasium. Promotion 2004.
Weitere Titel des Autors:
Der tote Hitlerjunge (2010)
Blutiges Zeitspiel (2012)
Lehrermord (2014)
Der Mordfall Franziska Spiegel (2016)
Werwolfmorde? (2021)
Die Hauptpersonen
Walter Helmke
Kriminalkommissar
Maximilian Bach
Kriminalassistent
Konstantin Mähler
Kriminalrat
Harald Coring
Kriminalbeamter
Reinhard Drewes
Ortspolizist
Bruno Witte
Ortspolizist
Wilhelm Worms
Opfer des NS-Regimes
Erna Worms
Opfer des NS-Regimes
Paul Kieslich
SS-Obersturmführer
Ursula Kieslich
Ehefrau
Stefan Barner,
Rolf Kotte,
Horst Langemeier
SS-Männer
Erwin Weichert
ehemaliger Landrat
Dr. Joh. Huisken
Richter
Konrad Wering
Staatsanwalt
Franz Büssing
Rechtsanwalt
Doro Wolters
Gastwirtin
Emil Kraiker
Mitglied der VVN
Bernhard Kraiker,
Fritz Sewekow,
Manfred Schroeter,
Karl Bloss
Opfer des NS-Regimes
Gabi Bongert
Kriegerwitwe
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
1. Kapitel
Donnerstag, 10. November 1938
Die große Schaufensterscheibe des Ladenlokals zerbarst mit einem lauten Klirren, der Pflasterstein flog weit in den Raum hinein und prallte krachend gegen den dunkelbraunen Verkaufstresen. Die beiden Frauen und das zwölfjährige Mädchen, die in der Küche nebenan gesessen und sich unterhalten hatten, schraken auf. Entsetzen stand in ihren Gesichtern.
Erna und Martha Worms, die beiden Schwägerinnen, deren Ehemänner gemeinsam das Geschäft betrieben, hatten von den nächtlichen Ereignissen in Bielefeld und Herford gehört, ihre Männer waren zudem am frühen Vormittag von der Polizei abgeholt und auf die örtliche Wache gebracht worden. In der Stadt Bünde war es in der vergangenen Nacht aber ruhig geblieben, so dass die Frauen gehofft hatten, dass sie von Übergriffen verschont bleiben würden.
Jetzt, am Nachmittag, als die Gefahr vorüber zu sein schien, drängten plötzlich SS- und SA-Männer in Uniform durch die zerstörte Schaufensterscheibe in den Laden und dann weiter in die Küche.
„Sitzenbleiben“, schnauzte ein SS-Mann, ein mittelgroßer dunkelhaariger Mann mit einem Oberlippenbart, der an den von ihm verehrten „Führer“ erinnerte, die Frauen an, während sich andere Männer daran machten, die Wohnungseinrichtung zu demolieren. Sie rissen den Küchenschrank auf und warfen Porzellanteller und Gläser auf den Boden, zerstreuten die in einem weiteren Schrank untergebrachten Küchentücher und Servietten im Raum und trampelten darauf herum. Ein großer SA-Mann, der seine Mütze in den Nacken geschoben hatte, urinierte unter dem Gegröle seiner Kameraden in den geöffneten Backofen.
Aus dem Ladenlokal drangen laute Geräusche in die Küche. Offenbar wurden Regale umgeworfen und Schubkästen geleert. Der laute Knall, den die Frauen jetzt hörten, stammte wohl von der Registrierkasse, die auf den Boden geworfen wurde.
Die flehentlichen Bitten der Frauen, mit den Zerstörungen aufzuhören, beantworteten die SS-Männer mit einem höhnischen Grinsen. „Das ist die Quittung für euren feigen Mord an Ernst vom Rath“, sagte einer der Männer, den Martha Worms kannte, da er ihr gelegentlich auf der Straße begegnete. Er schien ganz in der Nähe zu wohnen. Vom Rath war, wie Martha Worms gehört hatte, ein Sekretär, der in der deutschen Botschaft in Paris gearbeitet hatte. Er war vor ein paar Tagen von einem jungen Juden angeschossen und schwer verletzt worden, so hatte man es in den Zeitungen lesen können. Jetzt war dieser Mann offenbar seinen Verletzungen erlegen.
Nach weniger als einer Viertelstunde hatten die SS- und SA-Männer ihr Zerstörungswerk auch in den übrigen Räumen beendet und versammelten sich im Laden, wohin jetzt man auch die beiden Frauen und das Mädchen brachte. Das Ladenlokal sah ebenfalls schlimm aus. Der Inhalt der Regale lag auf dem Boden, die SS-Männer hatten mehrere Regale aus ihrer Verankerung gerissen und dann kaputtgetreten. Der große Spiegel, in dem sich die Kunden in ihrer neuen Kleidung betrachten konnten, war zersplittert. Nur einzelne Scherben hingen noch im Rahmen.
Der SS-Obersturmführer hielt eine kurze Ansprache, in der er sich bei seinen Männern für ihr diszipliniertes Verhalten bedankte. Dann gab er die Anweisung, die beiden Frauen und das Mädchen in das Haus des jüdischen Zigarrenfabrikanten Michelson zu bringen, wo sie zunächst bleiben sollten. „Wir wollen Sie damit vor dem Zorn der Bünder Bevölkerung schützen“, erklärte er grinsend, an die Frauen gewandt. „Wir erwarten dafür nicht Ihren Dank“, schob er nach, als die Gesichter der beiden Frauen versteinert blieben. Die SS- und SA-Männer lachten.
Inzwischen waren zwei Polizisten eingetroffen, die nicht etwa versuchten, die beiden Frauen und das Mädchen vor den SS- und SA-Männern zu schützen, sondern die Aufgabe übernahmen, Erna Worms, ihre Tochter und ihre Schwägerin zum Haus der Familie Michelson zu geleiten. Die Vertreter der Staatsmacht hatten sich ohne zu zögern dem Führer der SS unterstellt.
Während sie das Haus durch den Ladeneingang verließen, sahen die beiden Frauen, dass auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig zahlreiche Menschen standen, die die Aktion der SS und SA beobachtet hatten. In den Gesichtern der meisten Menschen stand Neugier, in einigen war Zustimmung zu lesen, nur wenige Zuschauer wandten ihre Gesichter beschämt ab, als Martha Worms, ihre Tochter Lotte und ihre Schwägerin an ihnen vorbeigeführt wurden, um zur Villa der Familie Michelson eskortiert zu werden.
Als sie sich umwandten, sahen die beiden Frauen, dass die SS-Männer nicht nur die große Schaufensterscheibe, sondern auch weitere Scheiben eingeschlagen hatten, zum Teil hatten sie sogar die hölzernen Fensterläden aus ihren Angeln gerissen. Es würde einiges Geld kosten, die Schäden beseitigen zu lassen.
Die Villa des Fabrikanten Michelson lag mehrere hundert Meter von dem Geschäft der Familie Worms entfernt. Noch bevor die von den beiden Polizisten angeführte Gruppe, der sich auch zwei SS-Männer angeschlossen hatten, die Villa erreichte, bemerkten die Frauen, dass auch das Haus der Michelsons der Zerstörungswut von SS- oder SA-Männern zum Opfer gefallen war. Auch hier waren Fensterscheiben eingeschlagen worden. Als die beiden Frauen und das Mädchen das Haus betraten, sahen sie, dass die geschwungene Treppe, die in das Obergeschoss des Hauses führte, mit Porzellanscherben übersäht war. An eine Wand in der Diele war mit roter Farbe ein Judenstern gepinselt worden.
Carl und Auguste Michelson, ein bereits älteres Ehepaar, saßen auf der Treppe und blickten die Eintretenden stumm an. Carl Michelson war ein erfolgreicher Unternehmer, dessen geschmackvoll eingerichtetes Haus bis zur „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten häufig Veranstaltungsort größerer Feste gewesen war, bei denen sich der Hausherr als überaus großzügiger und liebenswerter Gastgeber erwiesen hatte. Jetzt schien Michelson plötzlich um Jahre gealtert. Seine Frau saß still neben ihm und schüttelte immer wieder den Kopf. Die Übergriffe der letzten Stunden waren für sie offensichtlich unfassbar.
Die Polizisten blieben stehen. Einer der beiden zeigte auf die beiden Frauen und das Kind. Ohne die Michelsons anzusprechen verkündete er: „Die bleiben vorerst hier.“ Dann drehte er auf dem Absatz um und verließ gemeinsam mit seinem Kollegen und den beiden SS-Männern das Haus.
Es dauerte eine Weile, bis Carl Michelson sich zu rühren vermochte. Er kannte die beiden Frauen aus der Synagoge; engeren gesellschaftlichen Kontakt hatten die Familien Michelson und Worms aber nicht gehabt. Carl Michelson stand etwas ungelenk auf und zeigte auf die Treppe hinter sich. „Ihr könnt ein Zimmer im oberen Stockwerk haben“, sagte er.
***
In dem ihnen zugewiesenen Zimmer fanden die beiden Frauen neben einem Tisch und zwei Stühlen auch ein Ehebett vor, das für sie und das Mädchen zum Schlafen wohl ausreichen würde. Das Zimmer hatte ein Fenster, das einen Blick auf den Marktplatz ermöglichte, der im Süden an die Villa grenzte. Erna Worms hoffte, dass die Einquartierung nur eine Übergangsregelung war, dass sie bald in ihr eigenes Haus würden zurückkehren können, und sei es auch nur, um Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs zu holen.
Die Gespräche der beiden Frauen kreisten um ihre inhaftierten Ehemänner und um ihr verlassenes Haus, bis sie von Auguste Michelson zum Abendessen geholt wurden. Die beiden Michelsons hatten noch unzerstörtes Porzellan gefunden, so dass sie den Tisch in gewohnter Weise decken konnten.
Als sie ihre Plätze eingenommen hatten, sprach Carl Michelson das Tischgebet: „Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du regierst die Welt. Du lässt die Erde Brot hervorbringen.“
Es gab nur ein wenig Brot, Butter und Marmelade, dazu schwarzen Tee.
„Wir haben die Entwicklung hier in Deutschland falsch eingeschätzt“, sagte Carl Michelson. „Die Weinbergs haben es richtig gemacht, die sind rechtzeitig ausgewandert. Die haben zwar viel verloren, haben ihr Leben aber gerettet und noch genug für einen Neuanfang in Amerika.“
Erna Worms schüttelte den Kopf. „Mein Willy hat im Weltkrieg sein Leben eingesetzt, hat sogar ein Bein verloren. Ich glaube nicht, dass unser Leben bedroht ist. So undankbar kann doch keine Regierung sein.“
Carl Michelson lächelte dünn. „Blicken Sie sich doch einmal im Hause um“, sagte er. „Ich vermute, in Ihrem Haus wird es nicht viel anders aussehen – oder?“
Erna Worms nickte. „Das ist doch nur die Wut über den Tod dieses Botschaftsangehörigen in Paris. Das wird sich nach ein paar Tagen wieder legen.“
Auguste Michelson holte tief Luft und atmete hörbar aus. „Wir werden sehen, Frau Worms. Ihren Optimismus möchte ich haben. Hoffentlich werden Sie nicht furchtbar enttäuscht.“
Martha Worms schwieg bei dem Gespräch. Sie war eine ängstliche Frau. Ohne ihre Schwägerin hätte sie sich in der jetzigen Situation wohl kaum zurecht gefunden.
Nach Einbruch der Dämmerung wurde es draußen plötzlich laut. Erna und Martha Worms, die sich wieder in ihrem Zimmer befanden, sahen, dass sich auf dem Marktplatz Menschen versammelten. SA-Männer und halbwüchsige Hitlerjungen schleppten Sachen heran, die in der Mitte des Platzes auf einen Haufen geworfen wurden. Größere Gegenstände, offenbar Bänke oder Stühle, wurden zertrümmert und landeten ebenfalls auf dem Haufen, der dadurch weiter anwuchs. Immer mehr Menschen kamen zusammen.
Die beiden Frauen hatten das Zimmerlicht gelöscht und standen schräg hinter dem Fenster, so dass man sie von draußen nicht sehen konnte.
„Das sind Dinge aus der Synagoge“, sagte Erna Worms, an ihre Schwägerin gewandt. „Die Menschen kommen zumindest aus Richtung der Synagoge.“ Die beiden Frauen konnten aber nicht genau erkennen, welche Gegenstände da herangeschleppt wurden.
Dann sahen sie, wie ein SA-Mann den Inhalt eines Kanisters über den Haufen goss. Wenige Sekunden später schlugen mächtige Flammen empor.
Im Feuerschein des Scheiterhaufens stieg ein Mann auf einen Stuhl, der vermutlich ebenfalls aus der Synagoge stammte. Martha Worms erkannte in ihm den NSDAP-Ortsgruppenleiter Hermann Hillberg. Was Hillberg sagte, konnten die beiden Frauen nicht verstehen, seine gestenreiche Ansprache, während der er auch mehrfach auf die Villa Michelson zeigte, schien aber den Beifall der Umstehenden zu finden. Die Menge applaudierte.
Nach der Rede zerstreute sich die Ansammlung, einige wenige Fanatiker stellten sich vor der Villa auf und skandierten laut „Juda verrecke!“ Als aus dem Haus keine Reaktion erfolgte, verschwanden auch diese Schreier. Offenbar trauten sie sich nicht – oder es war ihnen verboten worden – in das Haus einzudringen.
Das Feuer, von einigen SA-Männern bewacht, brannte noch eine geraume Zeit, dann erloschen die Flammen. Nur gelegentlich, durch Windstöße angefacht, flackerten sie noch einmal kurz auf. Die beiden Frauen konnten beobachten, wie die SA-Männer nun das schwelende Feuer verließen und abzogen.
***
Mitten in der Nacht wurde an die Zimmertür geklopft. Carl Michelson stand vor der Tür und bat die beiden Frauen, die die Tür einen Spalt weit geöffnet hatten, mit leiser Stimme auf den Flur. „Ich muss Ihnen etwas zeigen“, flüsterte er und zog Erna und Martha Worms hinter sich her. Am Ende des Flures deutete er auf ein Fenster, das den Blick nach Nordosten ermöglichte. Die beiden Frauen sahen einen hellen Feuerschein. „Da brennt etwas“, sagte Martha Worms noch schlaftrunken, bevor ihr bewusst wurde, was da in Flammen stand.
„Erna, das ist unser Haus.“ Martha Worms umklammerte ihre Schwägerin. „Das ist unser Haus“, wiederholte sie.
Carl Michelson nickte. „Ich fürchte, Sie haben Recht“, sagte er leise. „Die Nazis haben Ihr Haus angezündet.“
„Ich muss zu unserem Haus.“ Erna Worms entwand sich dem Griff ihrer Schwägerin, die sie gar nicht loslassen wollte.
Carl Michelson schüttelte heftig den Kopf. „Das können Sie nicht. Haben Sie gestern Abend nicht gesehen, wie die Leute hier reagieren? Wenn Sie das Haus verlassen, setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel!“
Auch Martha Worms protestierte, aber ihre Schwägerin ließ sich nicht beirren. „Ich gehe durch den Hintereingang raus. Draußen ist es dunkel. Ich bin vorsichtig, niemand wird mich erkennen.“
Carl Michelson, der eingesehen hatte, dass er die Frau nicht von ihrem Vorhaben abbringen konnte, führte Erna Worms, nachdem sie sich angekleidet hatte, in die Kelleretage seines Hauses und öffnete ihr die Tür, durch die man über eine Außentreppe in den Garten gelangte. Draußen war es – abgesehen von der Feuerwehrsirene, die noch immer heulte – ruhig.
Über die Gartenstraße, die die Nazis in Hindenburgstraße umgetauft hatten, und am Stadtgarten mit seinem großen Saal vorbei, in dem die NSDAP zu Zeiten der Weimarer Republik ihre Propagandaveranstaltungen abgehalten hatte, erreichte Erna Worms schließlich den Goetheplatz, an dem das Wohn- und Geschäftshaus ihrer Familie lag. Je näher sie dem Goetheplatz kam, desto deutlicher stieg ihr der Brandgeruch in die Nase. Die Flammen, die aus dem Hausdach züngelten, wurden durch einzelne Baulücken sichtbar. Erna Worms musste einen Augenblick stehenbleiben. Ihr Haus, alles, was sie und ihr Ehemann sich zusammen mit seinem Bruder und dessen Frau aufgebaut hatten, wurde in diesem Augenblick zerstört, ihre bürgerliche Existenz wurde gerade vernichtet.
Am Goetheplatz angekommen, sah sie, dass nicht mehr viel zu retten war. Uniformierte SA- und SS-Männer standen vor dem Haus, Schaulustige drängten sich auf dem Bürgersteig der gegenüberliegenden Straßenseite. Nur die große Hitze und die Anwesenheit der SS und der SA hielten sie davon ab, sich noch weiter dem Haus zu nähern.
Der SS-Obersturmführer gab gerade die Anweisung, die offenbar zuvor aus dem Ladengeschäft geretteten Stoffballen wieder in das Feuer zu werfen. „Wir brauchen diesen Judendreck nicht“, hörte Erna Worms ihn brüllen. „Weg damit!“
Der SA-Sturmführer schien mit dieser Anordnung nicht einverstanden zu sein, er schüttelte den Kopf. Zwischen den Führern der beiden NS-Verbände entspann sich ein kurzer Wortwechsel, wie Erna Worms an der Gestik der beiden erkennen konnte. Schließlich ging der SA-Führer weg. Auf einen Wink des SS-Führers, der Erna Worms als Studienrat Kieslich bekannt war, der am örtlichen Gymnasium unterrichtete, griffen seine Männer nach den Stoffballen und warfen sie zurück in das Feuer. Eine ältere Frau, die sich neben Erna Worms in einen nahegelegenen Hauseingang gestellt hatte, schüttelte den Kopf und murmelte: „Was für ein Verbrechen! Das sind doch wertvolle Stoffe. Da fordern uns die Nazis ständig dazu auf, bei den Sammlungen zu spenden und jetzt vernichten sie Neuwaren.“
Als die ältere Frau, erschrocken über ihre eigenen unbedachten Worte, zu der neben ihr stehenden Frau blickte und Erna Worms erkannte, drückte sie ihr mehrere Sekunden lang mitfühlend die Hand und entfernte sich dann rasch.
Die Freiwillige Feuerwehr, die bereits eingetroffen war und sich anschickte, den Brand zu löschen, wurde, wie die Umstehenden sehen konnten, von der SS bei den Arbeiten zunächst behindert. Offenbar wollte die SS damit erreichen, dass das Haus vollständig abbrannte. Erst als der Dachstuhl einstürzte, ließ die SS die Feuerwehrleute gewähren, die sich nun mit aller Kraft daran machten, ihre Arbeit zu erledigen.
Erna Worms hatte genug gesehen. Ihre Hoffnung war geschwunden, irgendetwas von ihren Besitztümern retten zu können. Während das Haus immer mehr in sich zusammenfiel, wandte sie sich ab und schlich, auf dem gleichen Weg, den sie zuvor genommen hatte, zurück zur Villa der Michelsons.
2. Kapitel
Mittwoch, 26. Januar – Freitag, 28. Januar 1949
Bereits eine Viertelstunde vor Prozessbeginn waren die Zuhörerbänke im Saal 2 des Bielefelder Landgerichts gut besetzt. Einige der Anwesenden waren aus der Stadt Bünde nach Bielefeld gekommen, um mitzuerleben, wie über die Geschehnisse am Tag nach der sogenannten Reichskristallnacht in ihrer Heimatstadt geurteilt wurde.
Der Prozess vor dem Schwurgericht begann mit der Vernehmung der beiden Angeklagten Landrat Weichert und SS-Obersturmführer Kieslich, denen vorgeworfen wurde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Am Richtertisch saßen der Vorsitzende des Schwurgerichts, Landgerichtsdirektor Dr. Huisken und die beisitzenden Richter Ambusch und Wesemann sowie sechs Geschworene, drei an der linken und drei an der rechten Seite des Richtertisches. Staatsanwalt Wering konfrontierte die beiden Angeklagten eingangs mit den ihnen zur Last gelegten Verbrechen. Weichert und Kieslich erklärten sich – flankiert von ihren Rechtsanwälten – für nicht schuldig.
Dann wurden die Zeugen hereingeführt, die zur wahrheitsgemäßen Aussage ermahnt und über die Bedeutung des Eides sowie über die strafrechtlichen Folgen einer uneidlichen unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt wurden. Die Zeugen hatten danach den Gerichtssaal wieder zu verlassen, damit sie nacheinander, in Abwesenheit der nach ihnen noch zu Befragenden, vernommen werden konnten.
Dem Staatsanwalt ging es zunächst darum, den Ablauf des 10. November 1938 in der Stadt Bünde genau zu rekonstruieren, wobei er ein besonderes Augenmerk auf das Handeln der beiden Angeklagten an diesem Tage legte. Während sich die Täterschaft von Landrat Weichert durch die Zeugenaussagen sehr rasch zu bestätigen schien, tat sich Staatsanwalt Wering schwer damit, Kieslich eine Tatbeteiligung an dem Brand des Hauses der Familie Worms nachzuweisen.
***
Erna Worms war die Hauptbelastungszeugin des Staatsanwaltes. Als sie den Gerichtssaal betrat, wirkte sie wegen der großen Zahl der Zuhörer etwas eingeschüchtert, fasste sich aber schnell.
Staatsanwalt Wering erhob sich, setzte seine Brille ab und lächelte freundlich. „Frau Worms, schildern Sie dem Gericht bitte einmal die Geschehnisse am 10. November 1938!“
Erna Worms nickte, so als wollte sie sich damit noch einmal selbst vergewissern, die richtigen Aussagen zu machen. „Am Morgen des 10. November erschienen bei uns zwei Polizisten und haben meinen Mann und seinen Bruder verhaftet und mit auf die Polizeiwache genommen. Am Nachmittag saß ich zusammen mit meiner Schwägerin in der Küche, als plötzlich SS- und SA-Männer hereinkamen und damit anfingen die Wohnräume zu durchsuchen. Sie forderten uns auf, alle Waffen herauszugeben.“ Sie schüttelte den Kopf, offenbar um die Unsinnigkeit dieser Forderung zu unterstreichen. „Dabei besaßen wir überhaupt keine Waffen. Mein Schwager hatte nur eine alte Vogelflinte, mit der manchmal auf Spatzen schoss. Die haben die SS-Leute mitgenommen, nachdem sie die Wohnung demoliert hatten.“
Der Staatsanwalt unterbrach sie: „Haben Sie auch Herrn Kieslich gesehen? War er in Ihrer Wohnung?“
Erna Worms nickte. „Ja, er stand in unserem Flur und befehligte die Männer bei der Verwüstung des Hauses. Ich habe ihn gebeten, damit aufzuhören, er hat mich aber nicht beachtet.“
Wering ließ seinen Blick über die Geschworenen streifen, um sich zu vergewissern, dass sie die letzten Worte von Erna Worms zur Kenntnis genommen hatten. Dann fragte er seine Zeugin: „Wie ging es an diesem Tag weiter?“
„Nach der Durchsuchung unseres Hauses erschienen abermals Polizeibeamte. Meine Schwägerin, meine Tochter und ich mussten sie begleiten und sie brachten uns in die Villa der Familie Michelson, wo wir dauerhaft bleiben sollten. Hier hörten wir auch davon, dass unsere Synagoge zerstört worden war.“ Erna Worms machte eine kurze Pause, die folgenden Ausführungen schienen ihr nur schwer über die Lippen zu kommen. „In der Nacht wurde ich dann von Herrn Michelson geweckt, weil unser Haus brannte. Ich habe mich heimlich zu unserem Haus geschlichen und auch dort habe ich Herrn Kieslich gesehen. Nach meinem Eindruck hat er versucht, die Löscharbeiten zu behindern. Er schien auch Streit mit dem SA-Führer Teiling zu haben, der ebenfalls vor unserem brennenden Haus stand.“
Rechtsanwalt Büssing, Kieslichs Verteidiger, wandte sich an Richter Huisken: „Darf ich der Zeugin eine Frage stellen?“
Richter Huisken blickte zum Tisch des Staatsanwalts: „Herr Staatsanwalt, sind Sie damit einverstanden?“
„Ja, ich bin ohnehin mit meinen Fragen durch.“
Büssing stand auf. Er blickte Erna Worms freundlich an. „Frau Worms, gibt es Zeugen dafür, dass Herr Kieslich in Ihrem Haus war?“
Erna Worms nickte. „Ja, meine Schwägerin war dabei, als ich mit ihm gesprochen habe. Sie und ihr Mann sind aber im Konzentrationslager Stutthof ermordet worden.“
Büssing lächelte jetzt provozierend. „Der SA-Führer Teiling ist ja inzwischen auch verstorben. Sehr seltsam, dass Ihre Gewährsleute alle nicht mehr leben.“
Staatsanwalt Wering sprang auf. „Was wollen Sie damit sagen?“, fragte er etwas lauter als nötig.
„Na ja, Herr Kollege“, sagte Büssing etwas süffisant, „weitere Zeugen für die Aussagen der Frau Worms scheinen ja nicht mehr da zu sein. Das erscheint doch etwas sehr dünn.“
Wering zwang sich zur Ruhe. „Das sollten Sie erst einmal abwarten.“
Büssing wandte sich wieder an Erna Worms. „Frau Worms, wo wohnen Sie?“, fragte er.
„In Bünde, in der Winkelstraße.“
„In Ihrem Haus?“, fragte Büssing weiter.
„Nein, Sie wissen doch, dass unser Haus in der Kristallnacht niedergebrannt wurde.“
Büssing nickte jetzt. „Ja, richtig. Wem gehört das Haus, in dem Sie zur Zeit mit Ihrem Mann wohnen?“
„Dem SS-Obersturmführer.“ Erna Worms zeigte auf die Anklagebank.
Ein feines Lächeln umspielte die Lippen Büssings, als er sich an Staatsanwalt Wering wandte: „Ich gebe zu bedenken, dass Ihre Hauptzeugin ein großes Interesse an der Verurteilung meines Mandanten haben könnte, da sie mit ihrem Ehemann das Haus meines Mandanten bewohnt.“
Man konnte Erna Worms ansehen, dass sie am liebsten aufgesprungen und dem Rechtsanwalt an die Gurgel gegangen wäre. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten, in ihren Augen standen Tränen der Wut.
***
Ein weiterer wichtiger Zeuge für Staatsanwalt Wering war Josef Hunkemeier, ein älterer Rentner, der sich am 10. November 1938 in Sichtweite des brennenden Hauses der Familie Worms aufgehalten hatte.
„Herr Hunkemeier, erzählen Sie dem Gericht, was Sie am Abend des 10. November 1938 gesehen haben“, forderte Wering den Rentner auf.
Hunkemeier, dessen Alter man ziemlich genau an seiner gebeugten Körperhaltung ablesen konnte, räusperte sich und begann dann etwas unsicher zu sprechen. Vor so vielen Menschen zu reden, war ganz offenkundig nicht seine Sache.
„Ich wohne in der Eschstraße, nur etwa 150 Meter vom abgebrannten Haus der Familie Worms entfernt. Ich hatte am 10. November abends bereits im Bett gelegen, als ich die Sirenen der Feuerwehr hörte.“ Hunkemeier blickte den Staatsanwalt an. Als der ihm zunickte, fuhr er fort: „Ich bin noch einmal aufgestanden, weil ich auch einen Feuerschein sah. Da ich nicht wusste, was passiert war, habe ich mich angezogen und bin nach draußen auf die Straße gegangen. Meine Frau ist in der Wohnung geblieben. Da habe ich das brennende Haus der Familie Worms gesehen.“
„Wie war Ihr Verhältnis zu der Familie Worms?“
„Wir kennen uns gut, wir sind ja fast noch Nachbarn ... Wir haben unsere Einkäufe immer in dem Laden von Wilhelm und Otto Worms gemacht.“
Der Staatsanwalt nickte. „Erzählen Sie weiter. Haben Sie an dem Abend Personen erkannt, die sich in der Nähe des brennenden Hauses befanden?“
„Ja, da waren der SA-Führer Teiling und der SS-Führer Kieslich, ich hatte den Eindruck, dass sie sich stritten. Jedenfalls habe ich das ihren Armbewegungen entnommen. Feuerwehrleute waren auch da. Ich habe auch den inzwischen verstorbenen Feuerwehrhauptmann Pöttering erkannt. Er hat die Löscharbeiten geleitet.“
„Damit dürfte klar sein“, wandte sich Wering an die am Richtertisch sitzenden Personen, „dass der SS-Obersturmführer Kieslich an den Geschehnissen in der Nacht von 10. auf den 11. November 1938 maßgeblich beteiligt war.“
Rechtsanwalt Büssing schüttelte den Kopf und meldete sich zu Wort. „Ich habe noch ein paar Fragen an den Zeugen.“
Richter Huiskens nickte und forderte ihn auf, seine Fragen zu stellen.
„Herr Hunkemeier, wie alt sind Sie?“
„Ich bin letztes Jahr im Dezember 80 Jahre alt geworden.“
„Dann waren Sie zum Zeitpunkt des Brandes etwa 70 Jahre alt. Stimmt das?“
Hunkemeier nickte. „Ja.“
„Können Sie uns einmal auf dieser Skizze zeigen, wo Sie standen, als das Geschäft der Familie Worms brannte?“ Büssing deutete auf den DIN-A-2 großen Plan, der rechts vom Richtertisch an einem Gestell befestigt war und den oberen Teil der Eschstraße abbildete.
Hunkemeier ging langsam zu dem Gestell, wo er einige Zeit benötigte, um sich zu orientieren. Dann zeigte er auf eine Stelle. „Etwa hier.“
Büssing nickte. „Das war, wenn ich den Maßstab der Karte richtig lese, etwa 200 Meter von dem brennenden Haus entfernt.“
Hunkemeier wiegte seinen Kopf hin und her: „Da haben Sie aber großzügig gerechnet.“
Büssing ging darauf nicht ein, er stellte stattdessen seine nächste Frage: „Herr Hunkemeier, Sie tragen eine Brille?“
„Ja.“
„Schon lange? Auch schon im Jahre 1938?“
„Ja, seit meiner Jugend.“
Büssing blickte daraufhin zum Richtertisch und sprach die Geschworenen an: „Machen Sie sich ein eigenes Bild: Herr Hunkemeier ist mit der Familie Worms gut bekannt, vielleicht sogar befreundet. Er war früher langjähriger Kunde des Geschäftes. Er war zum Zeitpunkt des Brandes 70 Jahre alt, er war und ist Brillenträger. Sein Sehvermögen ist also schwach. Er befand sich etwa 200 Meter vom brennenden Haus entfernt und will Herrn Kieslich in der Nähe des Hauses gesehen haben. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass es dunkel war und die Sichtverhältnisse durch Qualm und Feuerschein sicherlich beeinträchtigt waren.“ Er machte eine kurze Pause, um seine Sätze wirken zu lassen. „Kann sich Herr Hunkemeier nicht getäuscht haben?“, fragte er dann. „Kann er Herrn Kieslich nicht mit dem – und dieser Mann war unstrittig dort – am Brandort anwesenden und inzwischen verstorbenen Marine-SA-Führer Fischer verwechselt haben? Die Uniformen der SS und die der Marine-SA sehen ja sehr ähnlich aus.“ Büssing machte eine erneute Pause. Er blickte die drei hauptamtlichen Richter an: „Wir sollten auf die Vereidigung des Zeugen Hunkemeier verzichten, um ihn nicht in Schwierigkeiten zu bringen.“
***
Kieslichs Verteidiger hatte als Zeugen unter anderem den ehemaligen SS-Mann Stefan Barner benannt. Die Befragung Barners durch den Rechtsanwalt des Angeklagten war nur kurz gewesen. Barner hatte vor allem Kieslichs Ehrlichkeit, Gerechtigkeitssinn und Patriotismus hervorgehoben.
Daraufhin übernahm Staatsanwalt Wering die Befragung Barners. Einleitend fragte er: „Herr Barner, in welchem Verhältnis standen Sie zu dem Angeklagten Kieslich?“
„Herr Kieslich war Führer des Bünder SS-Sturms, dem ich auch angehört habe.“
„Seit wann waren Sie Mitglied der SS?“
Barner überlegte kurz. „Seit September 1936“, sagte er dann. „Ich bin kurz nach den Olympischen Spielen in die SS eingetreten.“
„Herr Barner, können Sie sich an den 10. November des Jahres 1938 erinnern?“
Barner nickte. „Ja, das kann ich.“
„Ist der SS-Sturm, wie uns andere Zeugen berichtet haben, am Nachmittag des 10. November vom SS-Heim aus in geschlossener Formation zum Geschäft Worms in der Eschstraße marschiert?“
„Ja.“
„Waren Sie dabei?“
„Ja.“
Wering beugte sich vor. „Was wollte der SS-Sturm in dem Geschäft der Familie Worms?“
„Wir hatten den Befehl, das Haus nach Waffen zu durchsuchen. In Paris war ein Mitglied der deutschen Botschaft von einem Juden erschossen worden. Es gab Gerüchte, Juden planten auch in Deutschland Attentate. Das sollte verhindert werden.“
Wering schüttelte den Kopf. „Dieses Gerücht entbehrte ja wohl jeglicher Grundlage – oder?“
Barner schwieg und ließ damit die Frage unbeantwortet. Er hob lediglich seine Schultern.
Nachdem Wering eine Weile gewartet hatte, wandte er sich erneut an Barner: „Wurde der SS-Sturm an diesem Tage von Obersturmführer Kieslich befehligt?“
Barner schüttelte den Kopf. „Nein, Obersturmführer Kieslich war nicht anwesend. Ich habe Herrn Kieslich an diesem Tag nicht gesehen. Soweit mir bekannt ist, war er an diesem Tag überhaupt nicht in Bünde.“
Staatsanwalt Wering blickte Barner prüfend an: „Sie sind sich ganz sicher, dass der Angeklagte an diesem Tag nicht in Bünde war?“
„Ja.“
Wering wandte sich daraufhin an Richter Huisken: „Ich beantrage, den Zeugen Barner zu vereidigen.“ Zu Barner sagte er: „Herr Barner, sind Sie darüber belehrt worden, dass auf Meineid eine hohe Strafe steht?“
Barner nickte.
Barner wurde von Richter Huisken vereidigt, dann folgte der frühere SS-Mann Rolf Kotte als nächster Zeuge der Verteidigung. Nachdem Kotte Angaben zu seiner Person gemacht hatte, wurde er von Rechtsanwalt Büssing befragt.
„Herr Kotte, sind Sie am Nachmittag des 10. November 1938 auch mit den anderen SS-Männern zum Haus der Familie Worms marschiert?“
„Nein.“
„Weshalb nicht? Hat Sie der Befehl nicht erreicht?“
Kotte schüttelte den Kopf. „Nein, ich war an diesem Tag überhaupt nicht in Bünde.“
„Wo waren Sie?“
„Ich war mit Herrn Kieslich, mit dem ich auch persönlich befreundet war und bin, für drei Tage in der Reichshauptstadt.“
Büssing warf einen raschen Blick zum Richtertisch, bevor er sich wieder Kotte zuwandte: „Was war der Anlass Ihrer Reise?“
Kotte schaute jetzt zur Anklagebank und suchte den Blickkontakt mit Kieslich. „Herrn Kieslichs Mutter hatte nach dem Tod ihres Mannes noch einmal geheiratet und lebte zu der Zeit mit ihrem zweiten Mann in Berlin“, sagte er dann. „Sie war sehr krank. Es war zu befürchten, dass sie bald sterben würde. Herr Kieslich hatte Sonderurlaub beantragt und wollte seine Mutter noch einmal sehen. Da ich ein Auto besitze, hatte er mich gefragt, ob ich mit ihm nach Berlin fahren könnte. Ich habe natürlich zugesagt und wir sind dann am Morgen des 9. November losgefahren. Am Nachmittag des 11. November waren wir wieder zurück in Bünde.“
Büssing nahm Platz. Staatsanwalt Wering wirkte überrascht, er brauchte ein paar Sekunden, bis er seine Fragen formulieren konnte: „Herr Kotte, haben Sie noch eine Hotelquittung oder andere Belege, die beweisen können, dass Sie an diesen Tagen in Berlin waren?“
Kotte schüttelte den Kopf. „Nein, wir haben bei einem Berliner SS-Kameraden von Herrn Kieslich gewohnt.“
Rechtsanwalt Büssing schaltete sich noch einmal ein. „Wir haben versucht, von dem Kameraden, einem Herrn Hans Wisskopp, eine schriftliche Bestätigung über den Aufenthalt zu bekommen, aber Herr Wisskopp wohnt im Osten der Stadt, in Köpenick, und Sie wissen ja selbst, wie schwierig das zur Zeit ist …. Herr Kieslich weiß zudem nicht, ob Herr Wisskopp heil durch den Krieg gekommen ist.“
Wering wandte sich wieder an Kotte. „Woher wissen Sie eigentlich so genau, dass Sie gerade am 9. November nach Berlin gefahren sind und nicht einen oder zwei Tage später?“