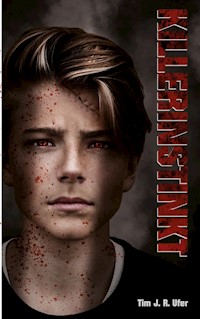
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als Sam und sein bester Freund Jacob von einem seltsamen Vorfall im nahegelegenen Lenox Hill Hospital erfahren, ahnen sie nicht, wie dieses Ereignis binnen weniger Stunden das komplette Leben in New York City auf den Kopf stellen wird. Ein neuartiges Virus breitet sich rasant in der Metropole aus und verwandelt seine Wirte in kaltblütige Mörder. Schon bald müssen sich die Freunde gemeinsam in einer Stadt behaupten, die von Zombies und Outlaws regiert wird. Dabei treffen die beiden nicht nur auf Sams heimlichen Schwarm Amy, sondern geraten auch mit dessen langjährigen Erzfeind Jackson aneinander, der in dem Chaos seine Chance wittert, Sam und Jacob ein für alle Mal eins auszuwischen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Tim Ufer ist Hobby-Autor und schreibt bereits seit seinem 12.
Lebensjahr leidenschaftlich Fantasy- und Science-Fiction-Romane, sowie Kurzgeschichten.
Aktuell lebt er mit seiner Pflanze Lotti und seinen zwei E-Gitarren in Heidelberg, wo er sich dem Studium der Physik widmet.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Party
Das Geheimversteck
Die Apokalypse beginnt
Rebellion
Panik
Flucht
Vorräte
Mutation
Nächtlicher Angriff
Hinterhalt
Die Versammlung
Todesfalle
Wiedergeburt
Geheimtreffen
Neue Verbündete
Auf der Lauer
Der Plan
Eine Shoppingtour durch die Apokalypse
Auf Zombiejagd
Gefangen
Alte Feindschaft
Familientreffen
Der Generator
Betriebsausflug
Am Boden
Militär
Rückkehr
Meuterei
Aus dem Grab
Zeichen des Himmels
Gestrandet
Neues Zeitalter
Nachtwanderung
Kriegserklärung
Im Weißen Haus
Die Landung
Der Tempel
Monster
Das letzte Gefecht
Massaker
Das Heilmittel
Am Boden
Die Entscheidung
Ein Neues Leben
Prolog
Endu betrat den großen Saal. Es war ein schneeweißer Raum, etwa so groß, dass ein alcorisches Kriegsschiff problemlos hineingepasst hätte. Der Großteil des Saales war mit Stühlen ausgefüllt. In ihrer Mitte zog sich ein gigantischer, glatt polierter Tisch durch den ganzen Raum. Ganz hinten offenbarte eine riesige Glasscheibe einen atemberaubenden Blick auf die unendlichen Weiten des Alls. Und auf einen einsamen blauen Planeten inmitten dieser endlosen Schwärze.
Eslaray hielt gerade seine Rede. Hastig schlich sich Endu an seinen Platz am Ende des Tisches und ließ sich auf seinen Stuhl gleiten. Zum Glück waren die anderen Crewmitglieder viel zu aufgebracht, um ihn zu beachten. Andernfalls hätten ihm jetzt vermutlich zwei Monate Küchendienst geblüht. Unpünktlichkeit galt als absolut schlechtes Benehmen und wurde bei den Alcori oft aufs Höchste bestraft.
Allerdings war Pünktlichkeit nie eine von Endus Stärken gewesen. Eine Schande, wie seine Mutter ihn immer erinnert hatte. Doch seine Mutter war nicht hier. Sie war zusammen mit den meisten Angehörigen seiner Familie auf Triadis geblieben. Nur eine Gruppe der 200 besten und erfahrensten Männer und Frauen auf allen Gebieten der Forschung waren in den Weltraum gereist, um das erste Mal in ihrer Geschichte eine andere intelligente Lebensform aufzuspüren.
»Es ist eine Frechheit! Seit 150 Jahren reisen wir durch sämtliche Sonnensysteme und Galaxien. Nun ist es uns endlich gelungen, eine andere Lebensform zu finden und jetzt verbietest ausgerechnet du, dass wir auf ihrem Planeten landen und uns ihnen zeigen!«, donnerte Nira gerade. Ihr Gesicht schimmerte silbern vor Wut und ihre Augen funkelten den Kapitän herausfordernd an.
Nicht weniger wütend brüllte Eslaray zurück: »Ich bin hier noch immer der Kapitän und wie mein Berater mir mehrfach versichert hat, ist es nicht ratsam, uns diesen Menschen-«, er spukte das Wort aus wie eine Beleidigung, »-zu zeigen!«
Endu schüttelte fassungslos den Kopf. Schon wieder diese Diskussion. Jetzt hatten sie endlich ihr Ziel erreicht und eine andere, ähnlich intelligente, doch längst nicht so fortschrittliche Lebensform gefunden und nun wusste keiner, wie es weitergehen sollte. Manche, doch mit Abstand der kleinste Teil der Besatzung, waren der Meinung, sie sollten sich ihnen einfach zeigen und es darauf ankommen lassen, wie die Menschen auf sie reagierten. Sie argumentierten damit, dass die Menschen – zumindest was ihr Aussehen betraf – große Ähnlichkeiten mit den Alcori hatten. Auch die Menschen gingen aufrecht, hatten zwei Arme und zwei Beine und auch sonst schien ihr Organismus von außen ähnlich zu denen der Alcori zu funktionieren. Einige Mitglieder der Besatzung schlossen daraus, dass ihre beiden Spezies vielleicht gar nicht so verschieden waren, wenngleich ihre Heimatplaneten durch Lichtjahre getrennt waren.
Andere Crewmitglieder hingegen, den Kapitän eingeschlossen, vertraten die Ansicht, es sei zu gefährlich, den Menschen zu vertrauen. Sie wären zu unberechenbar, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Im Grunde war ein Großteil der Mannschaft einfach mit der Gesamtsituation völlig überfordert.
Also hatte man einen Rat aus den bedeutendsten Mitgliedern der Crew einberufen, um über die Zukunft ihrer Mission zu diskutieren. Endu, der nach dem Tod seines Vaters die Rolle des Steuermanns der Kaytan übernommen hatte, blickte sich nervös um. Er fühlte sich fehl am Platze zwischen all den hochrangigen Offizieren, Wissenschaftlern und sonstigen hohen Tieren der Crew. Er selbst war zwar maßgeblich dafür verantwortlich, dass sie es in ihrem Raumschiff überhaupt bis zur Erde geschafft hatten, doch ihm war schleierhaft, welcher Beitrag von ihm in dieser wichtigen Diskussion erwartet wurde.
»Wenn Sie so viel von ihrem Berater halten, warum kommt er dann nicht selbst und weiht uns in seine Gedanken ein?«, forderte Queson gerade, Niras großer Bruder. Er war Leiter der Lebensmittelforschung und sehr beliebt bei der Besatzung. Zustimmendes Gemurmel erhob sich.
»Keine Sorge«, antwortete Eslaray, »Er sollte jeden Moment hier eintreffen.«
Wie auf Kommando öffnete sich die große Flügeltür am Ende des Saales und ein alter Mann schlurfte herein. Seine Augen lagen tief in seinen Augen und sein Rücken war von der Last der Jahre gebeugt. Endu wusste, dass der Alte früher einmal der Berater des Königs persönlich gewesen, bevor er für diese Reise auserwählt wurde. Er hatte dies jedoch nicht als Ehre empfunden, so wie die meisten anderen hier an Bord, sondern als Bestrafung. Die letzten 150 Jahre hatten in ihm eine Verbitterung heranwachsen lassen, die sich in jeder einzelnen Falte seines Gesichts widerspiegelte.
»Sag ihnen, was du auch mir gesagt hast, Ekron«, forderte Eslaray und nahm Platz. Ekron wandte sich mit düsterer Miene dem Rat zu. Seine eiskalten, durchdringend blauen Augen starrten entschlossen in die Runde.
Dann sprach er, fester, als man es von einem alten und gebrechlichen Mann erwartet hätte: »Diese Menschen sind keine Gefahr für uns, geehrter Rat. Oh nein! Sie sind eine Gefahr für sich selbst. Seht nur, was sie mit ihrem Planeten angefangen haben! Von hier könnt ihr nur blaues Wasser und grüne Flächen sehen, ich weiß. Doch wenn man näher herangeht …« Er schaltete ein Hologramm inmitten des Tisches an, welches ein Abbild des blauen Planeten zeigte. Schnell drückte Ekron einige Knöpfe auf einer Fernbedienung und kurze Zeit später bot sich ihnen ein Blick auf riesige Fabriken aus Beton und auf stählernen Bauten mit gigantischen Kaminschloten. Aus ihnen drang dunkler, pechschwarzer Rauch zum Himmel empor. Daneben fuhren seltsame Fahrzeuge auf völlig überfüllten Straßen umher. Die Menschen, die nicht in einem der Fahrzeuge saßen, trugen weiße Masken über Mund und Nase und wuselten gehetzt umher. Keiner von ihnen blieb stehen, um sich zu unterhalten oder auch nur, um sich eine kurze Verschnaufpause in der ganzen Hektik zu gönnen.
Ein nachdenkliches Gemurmel erhob sich im Saal. Endu musste unwillkürlich an die endlos grünen Wiesen und Wälder auf seinem eigenen Planeten denken. Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, übermannte ihn ein plötzlicher Anflug von tiefer Trauer. Flüchtig blinzelte er seine Tränen weg, bevor es jemand bemerkte.
Er war erst fünf gewesen, als er von Zuhause weggerissen wurde. Sein Vater hatte ihn mitgenommen, als seinen Nachfolger an Bord der Kaytan, um nach seinem Tod dem Kapitän auf dieser ehrwürdigen Mission als Maschinenbauer zu dienen. Er war bereits kurz nach Antritt der Reise verstorben. Jetzt, 150 Jahre später, kam Endu das alles nur noch wie ein blasser Traum vor.
»Ihr seht also, was die Menschen mit ihrem Planeten bereits angestellt haben. Wenn wir Kontakt zu ihnen aufnehmen, wer weiß? Vielleicht versuchen diese Verrückten, uns umzubringen oder sie erkennen, dass sie keine Chance gegen uns haben und wollen unseren Planeten besuchen. Wenn wir das zulassen, werden sie das gleiche Chaos auch über unsere geliebte Heimat bringen!«, donnerte Ekron.
Stille legte sich wie eine schwere Decke über den Saal. Die Worte des Beraters erfüllten ihren Zweck. Alle lauschten angespannt, warteten darauf, dass Ekron weitersprach. Aber dieser ließ sich Zeit.
Endu war sich nicht sicher, was er denken oder glauben sollte. Einerseits hatte er immer davon geträumt, einmal auf einem anderen Planeten zu sein und die Kulturen anderer Lebensformen zu erforschen, doch nun, nachdem er diese schrecklichen Bilder gesehen hatte, wusste er nicht mehr, was er eigentlich wollte.
Schließlich ergriff Nira das Wort: »Ich gebe zu, dass diese Menschen gerade einen großen Fehler machen. Doch warum sollte es nicht auch bessere von ihrer Sorte geben? Wenn wir ihnen zeigen, wie sie effektiver leben und viel einfacher Energie gewinnen können, könnten wir ihnen zu demselben Fortschritt verhelfen, wie wir ihn besitzen. Wir könnten uns mit ihnen verbünden, ihr wisst schon, gegen die Gefahren, die in unserem eigenen Sonnensystem lauern.« Einige der Anwesenden zuckten bei dieser Anspielung auf die Ta'rhak zusammen. Ta'rhak waren die natürlichen Feinde der Alcori auf deren Heimatplaneten. Riesige, furchteinflößende Kreaturen, denen die Alcori trotz ihrer hohen Intelligenz und fortschrittlichen Technologie oft unterlegen waren.
»Verbünden?«, rief Ekron laut und brach kurz darauf in schallendes Gelächter aus. Niemand lachte mit.
Er stoppte mit dem Lachen ebenso abrupt, wie er angefangen hatte und drückte auf seine Fernbedienung. Das Bild wechselte und zeigte nun eine riesige Sandfläche, gesprenkelt mit schwarzen Punkten. Das Hologramm zoomte näher heran und nun konnte man hunderte bewaffnete Menschen und riesige stählerne Maschinen sehen. Überall war Feuer. Leichen pflasterten den Boden und färbten den weißen Sand rot.
»Mit denen wollt ihr euch verbünden?«, fragte Ekron herausfordernd, »Mit einer Horde Barbaren, die sich noch immer selbst bekriegen?«
Zustimmendes Gemurmel wurde laut.
»Wir müssen ihnen eine Chance geben!«, rief Endu. Noch während die letzten Worte seinen Mund verließen, schlug er sich mit der Hand auf den Mund.
Alle Blicke wandten sich ihm zu. Warum hatte er das gesagt? Am liebsten wäre er auf der Stelle im Boden versunken.
»Eine Chance sagst du?«, fragte der Kapitän, »Du willst ihnen eine Chance geben?«
»Äh … Ich meine … Ja, Sir«, antwortete Endu so leise, dass er selbst sich kaum hörte.
»Wie bitte?«, fragte der Kapitän laut.
»Ja, Sir!«, erwiderte Endu fester und wich den bohrenden Blicken aus, die nun auf ihm lasteten.
»Gut, dass du dieses Thema ansprichst«, meinte der Berater nach einer Weile und Endu musste ihn nicht ansehen, um zu wissen, dass seine Gesichtszüge zu einem kalten Lächeln einfroren.
»Zum Glück sind der Kapitän und ich auch schon auf diese Idee gekommen und haben uns etwas für diese jämmerlichen Kreaturen ausgedacht. Wir werden sehen, ob diese Menschen tatsächlich so intelligent sind, wie einige von euch behaupten oder ob sie doch nur primitive Wilde sind, die mit der Zeit effizientere Methoden gefunden haben, gegeneinander Krieg zu führen«, fuhr Ekron mit schneidender Stimme fort. Wie gerufen, betrat in diesem Moment einer der Wissenschaftler den Saal. In seiner Hand hielt er ein Reagenzglas, gefüllt mit einer klaren Flüssigkeit. Etwas bewegte sich darin, doch Endu konnte auf diese Distanz nicht erkennen, was es war.
»Was ist das?«, sprach Queson misstrauisch den Gedanken aus, der jedem der Anwesenden in diesem Moment durch den Kopf ging.
»Das, meine lieben Ratsmitglieder«, verkündete Ekron und blickte mit einem breiten Lächeln in die Runde, »ist die Chance, die sich die Menschen verdient haben.«
Die Party
Sam lag in seinem Bett und starrte an die graue Decke. Es war Sonntag. Die Fenster waren geschlossen, die Rollläden halb heruntergelassen, sodass nur ein dünner Sonnenstrahl ins Zimmer drang. Er lag im fünften Stock in einem Hochhaus in Manhattan.
»Diese Hitze«, murmelte Sam gedankenverloren und streckte sich in seinem Bett. Es war Hochsommer. Schon seit Tagen sank die Flüssigkeit im Thermometer nicht mehr unter die dreißig Grad Marke. Sam hortete Kühlpacks in seinem Zimmer, die er gleich neben den drei billigen Ventilatoren, die er sich notgedrungen in einem Supermarkt gekauft hatte, auf dem Schreibtisch lagerte.
Sams Blick wanderte auf die Uhr gleich über seiner Zimmertür. Es war halb acht. Seufzend erhob er sich und schlenderte zu seinen Ventilatoren. Dabei kickte er zwei gebrauchte Unterhosen zur Seite und brabbelte unverständliche Worte vor sich her. Als er bemerkte, was er da tat, fasste er sich an die Stirn und schüttelte den Kopf.
»Ich werde schon verrückt. Ein Glück, dass ich heute mal rauskomme«, sprach er wieder mit sich selbst und schaltete die Ventilatoren aus.
Dann verließ er das abgedunkelte Zimmer und fand sich in einem gleißend hellen Flur wieder. Sam rieb sich die Augen, überprüfte noch einmal, ob er alles dabeihatte, was er benötigte und lief dann zum Büro seines Vaters.
Er klopfte an die angelehnte Tür und trat einen Schritt ins Zimmer. Sein Vater saß an seinem Computer und telefonierte lautstark über ein Headset. Aufgrund seines Tonfalls schloss Sam, dass das Gespräch nicht ganz so verlief, wie Mr. White sich das vorstellte. Gedankenverloren ließ Sam seinen Blick durch den Raum schweifen, während er darauf wartete, dass sein Vater das Telefonat beendete. An den Wänden des Büros hingen hunderte kleine und große Papierzettel mit Inseraten von Wohnungen und Grundstücken im Umkreis von Manhattan. Sams Vater war Immobilienmakler, doch musste man dazu sagen, dass er zurzeit nicht sonderlich erfolgreich war. Niemand wollte aktuell völlig überteuerte Wohnungen in der Großstadt kaufen.
Angesichts dessen hing es aktuell fast ausschließlich an Sams Mutter, in ihrem Job als Krankenschwester die Familie einigermaßen über Wasser zu halten. Wegen all den Überstunden, die sie machte, war sie im Moment praktisch nie daheim.
Sams Vater drehte sich in seinem Stuhl zu seinem Sohn und tippte mit dem Zeigefinger gegen das Headset an seinem Ohr. Ein Zeichen, dass das Telefonat noch eine Weile dauern würde. Sam nickte und verabschiedete sich durch Zeichensprache. Sein Vater formte mit seinen Lippen die Worte: Komm nicht zu spät nach Hause. Doch Sam verdrehte nur die Augen und verließ das Büro. Mit zunehmend guter Laune durchquerte er den Flur, schnappte sich lässig seinen Schlüssel vom Haken neben der Wohnungstür und öffnete diese. Draußen im Treppengeschoss war es angenehm kühl.
Mit der Treppe überwand Sam die fünf Stockwerke, die zwischen ihm und dem Erdboden lagen und schon bald trat er unten aus dem Hochhaus. Sofort wünschte er sich, er wäre in seinem Zimmer geblieben. Die Luft war schwül und stickig und die Sonne begann bereits nach wenigen Sekunden, ihm Kopfschmerzen zu bereiten.
Aber heute Abend war nun mal die Geburtstagsparty von James. Das allein hätte Sam eigentlich nicht aus seinem Zimmer gelockt, genau genommen kannte er James kaum, doch sein bester Freund Jacob hatte ihn zum Kommen überredet. Außerdem würde Amy auch dort sein. Sam spürte, wie ihm bei diesem Gedanken eine Gänsehaut über seinen Rücken jagte. Seufzend setzte er seine Sonnenbrille auf und lief die Straßen entlang in Richtung Downtown.
Bald erreichte er die kleine Wohnung von James Eltern. Er klingelte, blickte dabei nach oben und begann die einzelnen Stockwerke zu zählen, bis endlich das vertraute Summen ertönte, mit dem sich die Tür öffnen ließ. Die Wohnung von James Eltern lag direkt im Erdgeschoss, was den großen Vorteil hatte, dass von lautem Getrampel niemand unter der Wohnung belästigt wurde. Die Tür zur Wohnung stand bereits offen und daraus grinste ihn sein Kumpel mit frisch gestylten Haaren an. Hinter ihm, die Arme um James Hals geschlungen, stand seine Freundin Jules und grinste ebenfalls. Es war nicht zu übersehen, dass sie beide bereits ordentlich angetrunken waren. Aus der Wohnung hinter ihnen dröhnte laute, elektronische Musik.
»Hey, Sam! Komm rein«, grölte James, »Jacob ist schon seit einer halben Stunde da!« Sam schüttelte James die Hand, gratulierte ihm und betrat danach die Wohnung. Das Wohnzimmer war vollgepackt mit lachenden und trinkenden Leuten, die sich lautstark über die Musik hinweg unterhielten. Auf einem langen Tisch am Rande des Zimmers stapelten sich angebrochene Chipstüten, zahlreiche Bierdosen und einige Spirituosen in braunen Papiertüten. Für einen 16. Geburtstag war auf jeden Fall eindeutig zu viel Alkohol im Haus. Doch mit etwas Glück würden es James Eltern nie erfahren. Sie waren über das Wochenende bei Verwandten in Philadelphia und würden erst am Sonntagabend wiederkehren.
In diesem Moment drängte sich Sams bester Freund Jacob durch die Menge auf ihn zu. Er trug eine ziemlich zerfetzte Jeans und ein schwarzes Muskelshirt, das seine starken Oberarme betonte. Jacob war größer als Sam und hatte kurzes braunes Haar, welches er an diesem Abend nach oben gestylt hatte. Außerdem zierten Jacobs Kinn bereits einige unregelmäßige Bartstoppeln, die ihn deutlich älter wirken ließen als die anderen Kids im Raum.
»Da bist du ja endlich, Alter!«, rief Jacob und ein Grinsen zog sich über sein kantiges Gesicht. Auch Sam musste lächeln.
»Klar, ich kann dich doch nicht einfach hängen lassen«, erwiderte Sam und ließ dabei seinen Blick unauffällig durch den Raum schweifen. Amy konnte er bisher nirgends entdecken.
Sein bester Freund durchschaute ihn sofort: »Sie ist drüben in der Küche mit den anderen Mädels. Ich glaube, die mischen sich gerade so einen exotischen Cocktail.«
Sam merkte, wie er rot im Gesicht wurde. In einem verzweifelten Versuch, seine Tarnung aufrechtzuerhalten, erwiderte er: »Von wem sprichst du?«
Doch Jacob schüttelte nur grinsend den Kopf und zwinkerte ihm zu. »Ganz ehrlich, Bro? Du solltest sie einfach ansprechen. Was ist schon dabei?«
Sam wollte Jacob gerade erklären, was da alles dabei war, als ihm plötzlich das Wort abgeschnitten wurde.
»Na, sieh mal einer an, wer da ist!« Drei Jungs schälten sich aus der Menge vor ihnen und bauten sich vor Sam auf. Er erkannte sie sofort.
Es war Jackson mit seinen Freunden Brandon und Robert. Der Duftfahne nach zu urteilen, hatten sie sich bereits ausgiebig an den Biervorräten bedient. Robert grunzte belustigt, als er Sams wütenden Gesichtsausdruck entdeckte.
»Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass der auch zu der Party kommt!«, murmelte Sam hinter zusammengebissenen Zähnen zu Jacob und wandte sich dann an Jackson.
»Gibt es ein Problem?«, zischte er gereizt.
»Oh ja«, entgegnete Jackson grinsend, jedoch mit einem drohenden Unterton. Bis jetzt beachtete sie noch niemand im Raum.
»Ich will dein hässliches Gesicht heute Abend nicht in meiner Nähe haben!«
»Dann hältst du dich wohl besser fern von uns«, mischte sich jetzt Jacob ein und trat vor Sam. Er war einen guten halben Kopf größer als Jackson und um einiges muskulöser. Zwar waren Brand und Robert immer noch hinter ihm, doch scheinbar wollte Jackson es nicht drauf ankommen lassen, denn im nächsten Moment funkelte er Sam ein letztes Mal wütend an und mischte sich dann zusammen mit seinen Freunden wieder unter die Menge.
»Na, das wird ja ein lustiger Abend«, grummelte Sam. Ihm war jetzt schon wieder alle Lust vergangen. Er hasste es, ständig von Jackson angegangen zu werden und dann auf Jacobs Hilfe angewiesen zu sein.
»Du wirst dir doch wohl von diesem Idioten nicht den Abend verderben lassen«, erwiderte Jacob aufmunternd und klopfte Sam freundschaftlich auf die Schulter, »der will dich doch nur ein bisschen aufziehen. Komm, wir schauen mal, was die Mädels drüben so treiben.«
Mit diesen Worten zwinkerte Jacob seinem Kumpel verschwörerisch zu und schleifte ihn durch die lachende und tanzende Menschenmenge in Richtung Küche.
»Jetzt warte doch mal«, meinte Sam plötzlich, als die beiden Jungs nur noch wenige Meter von der Küche entfernt waren. Jacob drehte sich zu ihm um und sah ihn fragend an. Währenddessen suchte Sam in seinem Kopf fieberhaft nach einer glaubwürdigen Ausrede, warum er auf gar keinen Fall in diese Küche gehen konnte. Doch sein Gehirn war wie leer gefegt.
»Ich, ähm …«, begann Sam, um sich ein wenig Zeit zu erkaufen, »Ich … muss unbedingt aufs Klo!«
Bevor Jacob etwas entgegnen konnte, hatte Sam sich bereits hastig umgedreht und marschierte zügigen Schrittes in die exakt entgegengesetzte Richtung davon. Er hatte das Badezimmer fast erreicht und wollte schon seine Hand auf die Klinke legen, als ihm die Tür plötzlich schwungvoll entgegenkam. Sam konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit voller Wucht gegen die Tür. Ein erstickter Schrei verriet ihm, dass die Person auf der anderen Seite der Tür ebenfalls einen Schlag abbekommen hatte.
Benommen taumelte Sam ein paar Schritte rückwärts und wollte gerade eine Entschuldigung murmeln, als sein Herz plötzlich einen Satz machte. Aus der geöffneten Badtür heraus blickte ihn ein bildhübsches Mädchen mit langem nussbraunen Haar und ebenso herrlich braunen Augen an. Auf ihren rosafarbenen Lippen glänzte eine dünne Schicht Lippenstift. Sam starrte das Mädchen einige peinliche Sekunden lang einfach nur an, bis er endlich seine Sprache wiederfand.
»Oh, äh … das … das tut mir leid, äh …«, stotterte er verlegen, »das mit der Tür.«
»Ist schon okay«, meinte Amy schnell. Einige peinliche Sekunden der Stille vergingen. Schließlich huschte Amy, verlegen lächelnd, aber ohne ihn direkt anzusehen, an Sam vorbei und verschwand in der feiernden Menschenmenge. Benommen starrte Sam ihr hinterher, unfähig sich zu bewegen.
»Wurdest wohl gerade abserviert, was?«, rief in diesem Moment eine verächtliche Stimme. Wütend wirbelte Sam herum. Jackson und seine beiden Kumpels standen nur wenige Meter von ihm entfernt und feixten. Ein weiteres Mal an diesem Abend spürte Sam, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Dieses Mal allerdings nicht aus Scham, sondern aus blankem Zorn.
»Verpiss dich, Jackson!«, zischte Sam, etwas lauter als geplant, und ballte die Fäuste. Aus dem Augenwinkel konnte er sehen, wie einige Leute neugierig zu ihnen herüberblickten. Jackson schien den Moment in jeder Hinsicht zu genießen.
»Sieh es ein, Sam. Du bist einfach zu dumm und hässlich für Amy. Ihr spielt nicht in der gleichen Liga«, meinte Jackson ernst und scherte sich dabei nicht darum, seine Stimme zu senken. Erste Zuschauer bildeten einen interessierten Ring um Sam und seinen Rivalen.
»Halt deine Klappe oder ich stopfe sie dir!«, drohte Sam zornig. Seine Fäuste zitterten vor Wut.
»Ohooh!«, grölte Jackson und breitete die Arme aus, während er ins Publikum blickte, »Da will jemand eine Abreibung!«
Ein aufgeregtes Murmeln ging durch die versammelten Teenager. Gespannte Augenpaare blickten zu Sam herüber. Dieser ließ seinen Blick kurz über die ihm zugewandten Gesichter schweifen. Keine Spur von Jacob. Jackson schien auf denselben Gedanken gekommen zu sein.
»Komm schon, Sam! Greif mich doch an!«, forderte er Sam grinsend heraus und ließ angriffslustig seine Fingerknöchel knacken, »Oder hast du zu viel Angst ohne deinen Bodyguard?«
Das war zu viel für Sam. Blind vor Wut stürzte er sich auf seinen Rivalen. Im nächsten Moment krachte eine Faust aus dem Nichts gegen seine rechte Schläfe. Sternchen explodierte vor Sams Augen. Benommen stolperte er zu Boden und konnte sich gerade noch mit seinen Händen abfangen. Die Menge johlte auf.
Bevor Sam sich aufrappeln konnte, war Jackson bereits über ihm. Ein brennender Schmerz jagte durch seinen Körper, als ihn ein heftiger Fußtritt in die Rippen auf die Seite warf. Tränen brannten ihm auf dem Gesicht und machten ihn fast blind. Trotzdem schaffte er es irgendwie, zurück auf die Beine zu kommen. Jackson, Brandon und Robert sahen ihm belustigt zu.
»Das wirst du bereuen!«, presste Sam unter Schmerzen hervor. Ohne nachzudenken, sprang er auf Jackson zu. Dieser hatte wieder zu einem Haken ausgeholt, doch dieses Mal war Sam vorbereitet. Er duckte sich unter dem Schlag weg und rammte seinen Rivalen mit voller Wucht. Gemeinsam stürzten sie zu Boden, wo sofort ein verbissener Ringkampf entflammte.
»Hey! Hört sofort auf damit!«, drang plötzlich eine aufgebrachte Stimme durch das Gejohle der Menge. Wenige Sekunden später wurde Sam von zwei Händen grob an den Schultern gepackt und von Jackson heruntergerissen. Dieser rappelte sich sofort wieder auf und funkelte Sam angriffslustig an. James jedoch ließ Sam nun los und trat zwischen die beiden.
»Was ist hier los?«, wollte er wissen.
»Es ist Jackson, er hat es schon die ganze Zeit auf Sam abgesehen«, erwiderte Jacob, der endlich aus der Menge aufgetaucht war und deutete wütend auf Jackson. James schüttelte fassungslos den Kopf.
»Ich dachte, du wärst in Ordnung«, meinte er an Jackson gewandt, »aber ich habe mich wohl getäuscht. Du und deine Kumpels verschwindet jetzt besser!«
Jackson, der über diese Wendung des Geschehens überhaupt nicht glücklich zu sein schien, starrte James zornig an.
»Bist du noch ganz dicht?«, brüllte er und bevor James etwas sagen konnte, war Jackson bereits vorgestürmt und hatte James seine Faust in den Magen gerammt. Dieser sackte überrascht in sich zusammen und schlug unsanft mit dem Gesicht voran auf dem Fliesenboden auf. Aus seiner Nase ergoss sich ein Schwall Blut. Die aufgeregten Rufe der Menge um sie herum erstarben plötzlich. Nur die eintönige Musik schallte nach wie vor hämmernd aus den Boxen, während alle Augen im Raum auf Jackson und den am Boden liegenden James gerichtet waren.
»Will sich sonst noch jemand mit mir anlegen?«, knurrte Jackson heiser und sein Blick wanderte herausfordernd über die umstehenden Gesichter. Bis er schließlich bei Sam verharrte. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Komm her, Sam White! Los!«, brüllte er.
Sam spürte, wie sich in ihm alles zusammenzog. Frisches Adrenalin schoss durch seine Adern und er spürte, wie sein Puls sich erneut beschleunigte. Alle Augen waren auf ihn und Jackson gerichtet. Hinter Sams Rivalen standen Brandon und Robert, doch sie schienen kein großes Interesse daran zu haben, ihrem betrunkenen Freund im Kampf beizustehen. Selbst in ihren Augen war er gerade einen entscheidenden Schritt zu weit gegangen.
»Geh weg! Das ist nur eine Sache zwischen Sam und mir!«, grölte Jackson an Jacob gewandt, der jedoch keinerlei Anstalten machte, sich zu rühren. Jackson, dem langsam aufging, dass niemand mehr auf seiner Seite stand, schnaubte verächtlich. Dann, ohne Vorwarnung, stürzte er sich erneut auf Sam. Sam trat schnell zur Seite und Jackson krachte geradewegs in die Menschenmenge, wobei er zwei erschrockene Mädchen von den Beinen riss. Das schien ihn jedoch nicht im Geringsten zu kümmern. Blitzschnell war er wieder auf den Beinen und drehte sich fuchsteufelswild zu Sam um. Er hatte ihn gerade anvisiert, als eine Faust mit der Wucht eines Presslufthammers ihn gegen die Brust traf und ihn nach hinten katapultierte. Jackson stürzte gegen eine Kommode und die Vasen darauf kippten herunter und landeten auf dem Fliesenboden, wo sie zerbrachen. Er stand nicht wieder auf. Jacob starrte wütend auf ihn herunter.
In diesem Moment klingelte es an der Tür. Niemand rührte sich.
Es klingelte erneut. Diesmal wurde an die Tür geklopft und eine Männerstimme rief: »Hier ist die Polizei! Öffnen sie sofort die Wohnungstür!«
Jemand schaltete endlich die dröhnende Musikanlage aus und es wurde ganz still im Raum.
»Shit!«, fluchte Jacob schließlich und durchbrach damit die Stille, »Öffne mal jemand die Tür, verdammt noch mal!«
Kurze Zeit später war die Wohnung wie ausgestorben. Nur noch die beiden Polizisten, Jacob, James und Sam standen in dem vollständig verwüsteten Wohnzimmer.
Jackson hatte man in das Polizeiauto geschafft, damit er auf die Wache gefahren und dort von seinen Eltern abgeholt werden konnte.
James schien am Rande eines Nervenzusammenbruches zu stehen. Die Polizisten hatten bereits seine Eltern angerufen und Sam konnte sich vorstellen, dass James diese Nacht wohl noch einiges an Ärger bevorstand.
Jacob und Sam mussten unterdessen den Polizisten noch einige Fragen beantworten. Nachdem klar war, dass sie keine Schuld traf, halfen sie dabei, wieder etwas Ordnung in das Chaos der Wohnung zu bringen.
»Ich wollte doch nur, dass es eine coole Party wird«, meinte James traurig, als er die Scherben der Vasen vom Boden aufkehrte.
»Man sollte eben nicht die falschen Leute einladen«, erwiderte Sam trocken, während er leere Bierdosen vom Boden aufsammelte. Dabei presste er immer wieder eine Plastiktüte voller Eiswürfel gegen seine pochende Schläfe. Jetzt, da das Adrenalin in seinem Körper langsam seine Wirkung verloren hatte, setzten bei ihm heftige Kopfschmerzen ein.
»Oh Mann, was soll ich bloß meinem Vater sagen?«, murmelte Jacob, der Sam dabei half, die umgestürzte Kommode wieder aufzurichten. Daran hatte Sam gar nicht gedacht. Jacobs Vater arbeitete beim NYPD. Sicherlich würde er über seine Kollegen von dem Vorfall Wind bekommen.
Sam seufzte. »Es wird schon nicht so schlimm werden. Immerhin hast du nur deinen besten Freund verteidigt, oder?«
Jacob nickte gedankenverloren.
»Danke übrigens«, fügte Sam ernst hinzu, »der Typ ist völlig durchgedreht. Keine Ahnung, wie die Sache ohne deine Hilfe ausgegangen wäre.«
Jetzt stahl sich ein Lächeln auf Jacobs Lippen. »Glaub mir, ich hab’ ohnehin die ganze Zeit schon nach einem Grund gesucht, diesem Idioten mal ordentlich eins zu verpassen.«
Nachdem die Wohnung wenige Zeit später einigermaßen wiederhergestellt war, verabschiedeten sich Jacob und Sam von James und verließen das Gebäude. Als sie endlich draußen waren, atmete Sam tief durch und beobachtete eine Weile die vorbeiziehenden Autos, während die kühle Nachtluft sanft um seine Nase wehte.
»Dann bis morgen früh«, meinte Sam und hob seine Hand.
»Falls mein Vater mich bis dahin am Leben lässt«, erwiderte Jacob grinsend und schlug ein.
Das Geheimversteck
Als der Wecker klingelte, vergrub sich Sam so tief es ging unter seinem dünnen Bettlaken und zog sich das Kissen über die Ohren. Erst nach einigen Sekunden streckte er grummelnd seine Hand aus seinem Versteck hervor und tastete so lange seinen Nachtisch entlang, bis seine Finger sein Handy ertasteten. Er zog das Gerät zu sich und schaltete den auf Schlummern. Sam fiel zurück auf seine Matratze und genoss für ein paar Momente die herrliche Stille. Sein Körper fühlte sich bleischwer an und sein Kissen viel zu weich, um sich davon zu lösen.
Kurz darauf ertönte der Wecker erneut. Schlaftrunken hämmerte Sam mit dem Zeigefinger auf sein Handy ein, bis dieses endlich Ruhe gab. Er stöhnte, nahm all seine Willenskraft zusammen und zwang sich aus dem Bett. Benommen rieb er sich die Augen. Dann streckte er sich, gähnte und zog sich um.
Zehn Minuten später verließ Sam sein Zimmer und rannte fast in seine Mutter hinein, die schon auf dem Weg zur Wohnungstür war. Sie hatte ein eilig belegtes Toastsandwich zwischen den Zähnen und trug ihre Handtasche an der Seite.
Schnell biss sie ein Stück von ihrem Sandwich ab, nahm es in die Hand und sagte zu Sam: »Morgen, mein Schatz. Ich muss heute schon früher zur Arbeit.«
Sie umarmte ihren Sohn, gab ihm einen Kuss auf die Wange und schon war sie verschwunden. Sams Vater, der in seinem Pyjama und mit großen Ringen unter den Augen mindestens genauso fertig aussah wie Sam, blickte ihn mit einem gezwungenen Lächeln an.
»Dann liegt es wohl jetzt an uns, ein bezauberndes Frühstück herzurichten«, meinte er und zwinkerte seinem Sohn zu.
Sam nickte nur. Er war viel zu müde, um etwas zu sagen. Wortlos stellten sie ein paar Toasts, Nougatcreme, Honig und Marmelade auf den Tisch. Gemeinsam vernichteten Sam und sein Vater eine ganze Kanne Kaffee, um sich den Schlaf aus den Gliedern zu spülen. Die Wirkung des heißen Getränks setzte bald ein und Sams Laune besserte sich merklich mit dem steigenden Koffeinspiegel in seinem Blut.
Nach dem Frühstück putzte sich Sam hastig die Zähne und schulterte seinen Schulranzen. Er war spät dran, deshalb drückte er seinen Vater nur kurz und verließ dann eilig die Wohnung. Draußen vor der Tür herrschten bereits unchristliche Temperaturen und Sams Schläfe begann erneut zu schmerzen.
Seufzend rückte der Junge seine schwere Schultasche zurecht und lief in schnellem Schritt los. Schon bald erreichte er seine Highschool. Er trat durch die breite Flügeltür ein und traf kurze Zeit später Jacob in ihrem Klassenzimmer. Sam setzte sich auf den Platz neben seinen Freund, murmelte eine Begrüßung und sah sich verschlafen um. Dabei fiel sein Blick auf Amy, die zwei Reihen vor ihnen saß und sich tuschelnd mit ein paar anderen Mädchen unterhielt. Einige Zeit beobachtete er sie gedankenverloren.
Auf einmal drehte sich Amy herum, scheinbar um einen Blick auf die Uhr im hinteren Teil des Klassenzimmers zu werfen. Für einen kurzen, äußerst peinlichen Augenblick trafen sich ihre Blicke. Hastig wandte Sam sein Gesicht ab und drehte sich zu Jacob, als wären sie gerade mitten im Gespräch vertieft.
»Ich versteh’ echt nicht, wo dein Problem ist, Alter«, meinte Jacob kopfschüttelnd, »Im Ernst, Mann. Wenn du dich nicht bald mal traust, wird dir noch jemand zuvorkommen.« Er zwinkerte Sam grinsend zu.
»Nein, das würdest du nicht …«, begann Sam, doch Jacob unterbrach ihn. »Natürlich würde ich das nicht, wofür hältst du mich denn«, entgegnete er entrüstet, »aber du kannst nicht erwarten, dass eine 10 von 10 wie Amy für immer Single bleiben wird.«
Obwohl Sam wusste, dass sein bester Freund es nur gut mit ihm meinte, setzte er eine düstere Miene auf. Für eine gepfefferte Antwort reichte die Zeit allerdings nicht mehr, denn in diesem Moment betrat die Lehrerin das Klassenzimmer.
»Guten Morgen, meine Lieben!«, begrüßte Mrs. Oakwood ihre Klasse mit einem adretten Lächeln auf den Lippen. Dann ließ sie sich auf ihren Stuhl am Lehrerpult sinken und blickte fröhlich in die Runde.
»Morgen«, murmelte die Klasse verschlafen im Chor.
Mrs. Oakwood seufzte. »Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Bevor wir heute mit dem Unterricht beginnen, möchte ich noch mal auf das Wissenschaftsprojekt hinweisen, welches diese Woche stattfindet. Der Fokus liegt, wie ihr wisst, auf Humanmedizin. Erfreulicherweise hat sich das Lenox Hill Hospital dazu einverstanden erklärt, ein paar von euch für diese Woche aufzunehmen und ihnen einige wertvolle Einblicke ins Krankenhaus zu ermöglichen.«
Auf einmal war Sam hellwach. Das Wissenschaftsprojekt. Das hatte er ganz vergessen! Ursprünglich hatte er gar keine Lust darauf gehabt. Immerhin bekam er durch seine Mutter schon mehr Einblicke ins Krankenhaus, als ihm lieb waren. Aber er hatte seinen Namen letztlich doch mit auf die Liste gesetzt. Gleich unter den Namen von …
»… Und Amy Clark. Bitte findet euch heute Nachmittag um 14 Uhr in der Eingangshalle vom Lenox Hill ein. Eure Betreuer werden dort auf euch warten und euch den weiteren Ablauf erklären. Für alle anderen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe«, sagte Mrs. Oakwood und ihr Blick ruhte für einen kurzen Moment auf Sam, »Es tut mir leid, aber ihr müsst euch wohl bis zum nächsten Jahr gedulden. Die Plätze sind leider sehr begrenzt.«
Sams Herz rutschte ihm in Hose. Schnell wandte er sich an Jacob: »Sie hat meinen Namen nicht genannt, oder?«
Dieser sah ihn nur verdutzt an. »Du hast dich auf die Liste eingetragen? Arbeitet deine Mutter nicht ohnehin in diesem Krankenhaus?«
»Ach, vergiss es«, entgegnete Sam und sah wieder vor zu seiner Lehrerin. Er wollte nicht zugeben, dass er sich nur auf die Liste eingetragen hatte, weil Amy auch dort sein würde. Außerdem war es jetzt sowieso gleichgültig.
»Haben wir Hausaufgaben aufbekommen?«, fragte Sam wenige Stunden später und kniff die Augen zusammen, als sie in das pralle Licht der Sonne vor dem Schulgebäude traten. Er hatte den größten Teil der letzten Schulstunde im Dämmerzustand verbracht. Um ihn und Jacob herum strömten die Schüler nach draußen und verließen plappernd das Schulgelände.
»Ja, leider«, erwiderte Jacob und rollte mit den Augen, »einen zweiseitigen Aufsatz über den Drogenhandel an der mexikanischen Grenze. Der kann aber noch ein wenig warten, was meinst du? Es ist eine ganze Weile her, seitdem wir das letzte Mal in unserem Unterschlupf vorbeigeschaut haben.«
»Du hast recht«, pflichtete Sam ihm bei und seine Miene hellte sich auf, »Du musst mir sowieso noch erzählen, wie die Sache mit deinem Vater gestern Abend ausgegangen ist.« Jacob grunzte etwas Unverständliches und seine Miene verdüsterte sich.
»Ach, komm. So schlimm kann es gar nicht sein, du lebst doch noch!«, meinte Sam und lachte. Jacob versuchte stur, seinen finsteren Gesichtsausdruck zu bewahren, scheiterte jedoch schon nach wenigen Augenblicken kläglich. Gemeinsam überquerten sie lachend den Schulhof und machten sich auf den Weg zum Rande der Stadt.
Dort, nahe dem East River gab es einige leer stehende Häuserblocks, die einem großen Investor gehörten. Er hatte sie vor vielen Jahren gekauft, offenbar, um sie zu renovieren und dann teuer weiterzuverkaufen. Doch dann war die Wirtschaft in den Keller gegangen und niemand wollte die Wohnungen haben. Darum standen sie nun schon seit Jahren leer.
Mittlerweile waren meisten der Wohnungen ziemlich heruntergekommen, aber es gab immer noch einige Zimmer, die sich perfekt als kleines Geheimversteck eigneten. Sam erinnerte sich noch gut an die Zeit, als Jacob und er Kinder gewesen waren und diese Wohnungen entdeckt hatten. Damals war es immer ein Nervenkitzel gewesen, die Wohnung durch ein kaputtes Fenster zu betreten. Sie hatten sich früher immer vorgestellt, dass grauenhafte Ungeheuer in den alten Häusern wohnten. Doch mittlerweile war Sam hier schon so oft gewesen, dass es für ihn fast wie ein zweites Zuhause geworden war.
Wie gewohnt kletterten die zwei Freunde über den wackeligen Müllcontainer vor einem der Gebäude auf ein Fenstersims und von dort in die Wohnung, welche sie als ihr Versteck nutzten. Die beiden Freunde hatten vor einiger Zeit einen kleinen Kühlschrank hineingeschleppt, sodass sie nun auch einen Vorrat an kühlen Getränken beherbergen konnten.
»Lust auf eine Erfrischung?«, fragte Jacob fröhlich und öffnete den Kühlschrank. Sofort kullerten einige Dosen Cola, sowie einige Schokoriegel aus dem Kühlfach.
Jeder nahm sich eine Dose und sie machten es sich auf einer alten, verstaubten Matratze bequem. Genüsslich verspeisten sie zwei der Schokoladenriegel, tranken ihre Cola und dösten vor sich hin.
Irgendwann unterbrach Jacob die Stille. »Es war übrigens Amy.«
»Hm?«, machte Sam irritiert. Er war mit den Gedanken ganz woanders gewesen.
»Gestern auf der Party. Amy hat die Polizei gerufen. Mein Vater hat es mir erzählt, nachdem er mich eine Stunde lang zusammengeschissen hat«, meinte Jacob.
Sam runzelte die Stirn. »Warum sollte Amy das tun? Ich dachte, sie ist ganz gut mit James befreundet. Sicher, dass dein Vater sich nicht irrt? Er kennt Amy doch gar nicht.«
Jacob schüttelte den Kopf. »Nein, mein Vater ist sich sicher. Ihr Name steht im Protokoll.«
»Na schön«, Sam seufzte, »aber warum?«
Jetzt grinste Jacob verschwörerisch. »Na ja, du stecktest gestern Abend ganz schön in der Klemme. Jackson ist wie ein Irrer auf dich losgegangen.«
Sam wurde rot. »Wahrscheinlich wollte sie nicht, dass jemand ernsthaft zu Schaden kommt.«
Jacob rollte mit den Augen. »Sie wollte nicht, dass jemand ganz bestimmtes zu Schaden kommt«, betonte er.
Sam schüttelte heftig den Kopf. »Halt die Klappe, Amy hat die Bullen ganz sicher nicht meinetwegen gerufen. Um ehrlich zu sein …«, er holte tief Luft, »Ich glaube, ich habe mich gestern komplett vor ihr blamiert.« Er erzählte sein kurzes Zusammentreffen mit Amy vor dem Badezimmer.
Jacob zuckte mit den Schultern. »Klingt für mich nicht danach, als ob du dich krass blamiert hättest.«
»Du warst nicht dabei«, erwiderte Sam störrisch, »Ich war …«
In diesem Moment vernahmen die beiden Freunde plötzlich Stimmen von draußen. Eigentlich waren Stimmen in New York City nichts Besonderes, doch in diesem Viertel schon. Normalerweise ließ sich hier nie jemand blicken. Interessiert schlichen die beiden Freunde sich zum offenen Fenster und spähten vorsichtig hinaus. Vor dem Eingang des Hauses standen drei Anzugträger und begutachteten gerade das Gebäude.
»Das wird eine Heidenarbeit«, meinte der eine und hob eine ziemlich verrostete Türklinke aus dem Staub, die vor einigen Jahren mal an der Tür befestigt gewesen war.
»Meinst du, das lohnt sich?«, fragte ein anderer zweifelnd, »Wir müssten alles abreißen und neu aufbauen.«
»Natürlich! Immobilien sind hier eine Goldgrube«, erwiderte der Dritte und sein Blick wanderte etwas höher die Stockwerke hoch. Sofort duckten sich Jacob und Sam unter dem Fenster und pressten sich an die Wand.
»Was wollen die hier?«, flüsterte Jacob panisch. Sams Herz klopfte wie wild. »Offenbar sind das neue Investoren«, erwiderte er flüsternd. Auf einmal machte sich ein flaues Gefühl in seinem Magen breit. Sam wollte nicht, dass diese Wohnungen abgerissen wurden. Sie waren zu einem zweiten Zuhause für ihn geworden. Zu einem Ort, an dem er allein sein oder einfach ein paar entspannte Stunden mit seinem besten Kumpel verbringen konnte. Und jetzt sah es ganz so aus, als würden diese Männer hier alles in kürzester Zeit plattmachen wollen.
»Am besten, wir sehen uns zunächst um, ob drinnen noch etwas Brauchbares rumsteht. Man weiß nie, was die Leute so in ihren Wohnungen zurücklassen«, meinte einer der Männer mit einem gierigen Funkeln in den Augen.
»Also ich geh’ da nicht rein!«, erwiderte der zweite Anzugträger, »Für mich sieht das ziemlich nach Einsturzgefahr aus.«
»Ach«, meinte der Dritte, »diese Gebäude stehen hier schon seit Ewigkeiten. Wenn sie bis jetzt noch nicht eingestürzt sind, werden sie diesen Tag auch überleben.«
Sam traute sich noch einmal, einen vorsichtigen Blick aus dem Fenster zu erhaschen. Plötzlich stieg Angst in ihm hoch. Was, wenn die drei hier hochkamen und Jacob und ihn entdeckten? Falls diese Gebäude nicht mehr Sams Vater gehörten, dann begingen sie gerade Hausfriedensbruch. Einer der Männer machte nun Anstalten, das Haus zu betreten. Sam starrte wie gebannt auf ihn herab.
Plötzlich blickte der zweite Mann wieder nach oben. Seine Augen trafen die von Sam. Vor Schreck wie angewurzelt, rührte sich Sam nicht von der Stelle. Einen Augenblick sahen sie sich verdutzt an. Dann rief der Mann: »Hey! Du da!« Endlich riss Jacob seinen Freund vom Fenster weg.
»Na toll! Was machen wir jetzt?«, fragte er aufgeregt, mit einem Anflug von Panik in der Stimme.
»Abhauen!«, erwiderte Sam.
Unter ihnen hörten sie bereits, wie die drei Männer geräuschvoll versuchten, die eingefallenen Treppenstufen zu erklimmen. Schnell stieß Jacob das Fenster auf, schnappte seinen Schulranzen und schwang sich auf das Fenstersims.
»Komm schon, Sam. Wir müssen springen!«, rief er und im nächsten Moment landete er auch schon krachend eine Etage tiefer auf dem Container. Sam war wie festgewachsen. Fassungslos starrte er auf seinen Kumpel herab, der sich gerade stöhnend aus dem Container befreite und sich auf den Asphalt plumpsen ließ. In diesem Moment erreichten die drei Männer das erste Stockwerk. Kurz sahen sie sich um. Dann stürmten sie geradewegs auf Sam zu.
Dieser erwachte endlich aus seiner Schockstarre. Hastig griff Sam nach seiner Schultasche und hechtete aus dem Fenster. Für einen sehr kurzen Moment fühlte er sich schwerelos. Dann sank er dumpf in einen Berg von Müllsäcken. Atemlos starrte er nach oben, von wo aus drei wutverzerrte Gesichter auf ihn herabblickten.
»Komm schon!«, rief Jacob und gestikulierte wild mit seinen Händen. Sam rollte sich mühsam aus dem Container und landete in der Hocke auf der Straße. Die drei Anzugträger blickten den beiden Jungs noch immer verärgert, und ein wenig verdutzt hinterher. Schließlich fanden sie ihre Stimme wieder und brüllten: »Bleibt stehen! Ihr sollt sofort stehen bleiben!«
Doch Sam und Jacob hatten ihnen bereits die Rücken zugekehrt und waren Hals über Kopf geflüchtet.
Sie rannten noch einige Zeit, bis sie an eine belebte Hauptstraße kamen. Als sie endlich von der Menschenmenge umschlossen waren, die sich auf dem Bürgersteig tummelte, hielten sie an und stemmten ihre Hände auf die Knie.
»Das war’s dann wohl mit unserem Versteck«, sagte Sam verbittert, als er wieder einigermaßen zu Atem gekommen war.
»Und mit unseren Vorräten«, fügte Jacob missmutig hinzu, »wir hätten wenigstens noch ein paar Dosen Cola mitnehmen sollen.«
»Ist jetzt auch egal«, meinte Sam traurig und lehnte sich erschöpft an eine Hauswand.
»Naja«, seufzte Jacob, »mit etwas Glück stürzt den Idioten die Decke auf den Kopf. Selbst schuld, wenn sie ein einsturzgefährdetes Haus betreten.« Beide Jungs mussten kichern.
Anschließend schaute Sam auf die Uhr. Es war erst viertel vor drei. Jacob, der ebenfalls einen Blick auf die Uhr erhascht hatte, meinte: »Wir könnten noch eine Weile zu mir nach Hause gehen, wenn du willst.«
»Geht klar«, meinte Sam, der jetzt überhaupt keine Lust mehr auf nervige Schulaufgaben hatte. Also schulterten sie ihre Schultaschen erneut und machten sich auf den Weg zu Jacobs Wohnung.
Es klingelte an der Wohnungstür. Die beiden Jungs, die es sich mit einem kühlen Orangensaft und ein paar Keksen in Jacobs Zimmer gemütlich gemacht hatten und jetzt einen Shooter zockten, sahen für einen Moment von ihrem Videospiel auf.
»Meine Mutter macht schon auf«, schmatzte Jacob mit vollem Mund, als er Sams fragenden Blick sah. Tatsächlich hörten sie kurze Zeit später, wie die Wohnungstür geöffnet wurde und gedämpfte Stimmen aufgeregt miteinander sprachen.
»Das ist mein Vater«, sagte Jacob stirnrunzelnd und pausierte das Spiel, »normalerweise kommt er nie so früh von der Arbeit. Ich schau’ mal nach, was los ist.«
Jacob erhob sich und ging zur Zimmertür. Er öffnete sie und spähte hinaus in den Wohnungsflur. Die Stimmen waren nun auch für Sam deutlich zu verstehen.
»Wir wissen nicht, was mit ihm los ist! Es war schrecklich. Bestimmt drei Tote. Ist Jacob zu Hause?«, hörte Sam Jacobs Vater eindringlich flüstern.
»Was ist denn los, Dad?«, fragte Jacob laut und trat auf den Flur.
»Jacob! Ein Glück, dass du schon daheim bist. Geht es dir gut?«, fragte sein Vater und drückte seinen Sohn kurz an sich. Anschließend musterte er ihn von oben bis unten, als erwarte er irgendwie, dass Jacob über Nacht ein zweiter Kopf gewachsen sei.
Dieser war einige Augenblicke zu verdutzt, um etwas zu erwidern. Bevor er seine Stimme wiederfand, entdeckte Mr. Stone auch Sam, der unsicher im Türrahmen zu Jacobs Zimmer gewartet hatte.
»Hallo, Sam. Du solltest dringend deine Eltern anrufen und ihnen mitteilen, dass es dir gut geht«, sagte er eindringlich.
Nun runzelte auch Sam die Stirn. »Weshalb?«
»Gerade gab es einen Amoklauf auf der 3rd Avenue. Der Täter ist noch am Leben, wurde aber inzwischen gefasst. Soweit ich weiß, liegt er gerade im Lenox Hill. Offenbar ist der Mann total durchgedreht. Hat drei Menschen mit einem Messer so übel zugerichtet, dass sie nur noch anhand ihrer Personalausweise identifiziert werden konnten«, erzählte Jacobs Vater kopfschüttelnd.
»Lenox Hill?«, murmelte Jacob leise, »Das ist doch das Krankenhaus, in dem deine Mutter arbeitet, oder?«
Sam nickte. Ein seltsames Gefühl breitete sich in seiner Magengrube aus.
»In diesem Fall solltest du sie am besten zuerst anrufen. Ich will dir keine Angst machen, mein Junge, aber dieser Mann ist gefährlich!«, meinte Jacobs Vater ernst, »Neben den drei Menschen, die er ermordet hat, liegt ein Vierter mit ihm im Krankenhaus. Zum Glück konnten wir den Mistkerl stoppen, bevor es noch schlimmer kommen konnte.«
Mr. Stone schien endlich zu bemerken, dass er noch immer auf der Türschwelle stand und trat in die Wohnung. Er zog die Jacke seiner Uniform aus und wischte sich mit dem Handrücken über die schweißnasse Stirn.
»Jetzt ruhst du dich erst mal aus, Robert«, meinte Jacobs Mutter beschwichtigend, drückte ihrem Mann ein kühles Getränk in die Hand und geleitete ihn zum Sofa. Sam und Jacob blieben noch einige Augenblicke sprachlos stehen und schauten sich an.
»Ich denke, ich sollte wirklich meine Mum anrufen«, meinte Sam schließlich. Genau wie aufs Stichwort klingelte das Telefon.
Die Apokalypse beginnt
Lara White erinnerte sich nicht mehr daran, wann sie ihren Job einmal gern gemacht hatte. Jeden Tag gebrochene Beine, blutige Wunden und Schmerzensschreie. Warum hatte sie sich zur Krankenschwester ausbilden lassen? Vermutlich, weil sie nach der Schule den dringenden Wunsch verspürt hatte, anderen Menschen helfen zu wollen, erinnerte sie sich. Von diesem Verlangen war über die Jahre nicht viel übrig geblieben. Die vielen Überstunden, der Stress und die ständig wechselnden Patienten schienen über die Zeit irgendetwas in ihr ausgelöscht zu haben. Klar war allerdings auch, dass sie jetzt nichts anderes tun konnte, als ihren Job weiterzumachen. Die Rechnungen bezahlten sich nicht von allein und ihr Mann war nicht gerade eine große Hilfe. Er klammerte sich ängstlich an seinen bescheuerten alten Beruf, anstatt einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Dieser sture Esel! Und sie musste am Ende alles ausbaden!
Krach!
Der Aufprall riss Lara aus ihren Gedanken und erst jetzt bemerkte sie, dass sie mit dem Krankenbett ihres Patienten genau gegen einen Türrahmen gefahren war. Zum Glück war dieser noch in Vollnarkose.
Patienten, Krankenschwestern und Besucher blickten Lara kopfschüttelnd an. Peinlich berührt schob sie das Bett durch die Tür und versuchte ihr gerötetes Gesicht zu verbergen. Als sie den Patienten endlich auf sein Zimmer gebracht hatte, schaute sie auf die Uhr.
»Zeit für eine Mittagspause«, dachte sie laut und verließ das Patientenzimmer. Sie schlenderte den Flur entlang, grüßte im Vorbeigehen einige Kollegen, und steuerte die Kantine an. Sie war tief in Gedanken versunken, als sie auf einmal aufgeregte Stimmen hörte und das Rollen zweier eilig geschobener Krankenbetten. Einige Sekunden später bog eine Kolonne aus zwei Polizisten, dem Chefarzt und fünf aufgebrachten Krankenschwestern um die Ecke.
Vor sich schoben sie zwei Betten, auf denen jeweils ein bewusstloser Patient lag. Bevor Lara auch nur den Mund aufmachen konnte, war die Gruppe auch schon in den nächstgelegenen Op-Saal abgebogen.
Neugierig folgte Lara der Kolonne in das Zimmer und erhaschte einige flüchtige Blicke auf die Polizisten, die eilige damit begannen, einen der Patienten mit Händen und Füßen ans Bett zu fesseln.
»Was hat er? Kann ich behilflich sein?«, fragte Lara, deren Neugierde nun übermächtig geworden war und trat in den Raum.
»Ah, Mrs. White. Gut, dass sie hier sind«, antwortete der Chefarzt, »Ich kann jede helfende Hand gut gebrauchen. Besonders jede mit Erfahrung. Dieser Mann hat gerade drei Menschen getötet.« Der Arzt deutete auf den Mann, der gerade gefesselt wurde.
»Der andere Patient wurde von ihm verletzt und leidet gerade an seltsamen Zuckungen. Nach dem, was vorgefallen ist, ist das nicht weiter verwunderlich, aber da ist noch eine andere Sache …«, er hielt kurz inne.
»Sehen sie einfach selbst«, meinte er schließlich und machte Lara Platz, damit sie sich den Patienten genauer ansehen konnte.
Zuerst konnte sie nichts Besonderes erkennen. Bis auf den großen Schnitt, der sich quer über seine Brust zog, sah er auf den ersten Blick ganz normal aus. Doch plötzlich fielen Lara die Hände des Mannes auf.
Aus beiden Handgelenken ragten zwei kleine Spitzen auf. Frisches Blut klebte an den Handflächen. Aber eine Sache machte das Ganze so außergewöhnlich: Die beiden Spitzen waren nicht von außen in die Hände des Mannes geschlagen worden. Vielmehr schienen sie sich von Innen aus dem Fleisch zu graben.
Nun sah sich Lara die Hände des Mörders aus der Entfernung an. Sie schlug sich vor Entsetzten mit der Hand auf den Mund. Bei ihm ragten zwei etwa fünfzehn Zentimeter lange Stachel aus den Handflächen. Frisches Blut tropfte von ihnen herab, vermischt mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Vermutlich Eiter.
»Wissen Sie, was das ist?«, fragte Lara erschüttert und wich unwillkürlich von den zwei Patienten zurück.
Der Arzt runzelte nur die Stirn und erwiderte: »Ich habe so etwas noch nie gesehen. Zuerst dachten wir, er stünde unter Drogen, aber seine Blutwerte sind normal. Und dann haben wir die Stacheln entdeckt.«
Nachdem Lara ihren ersten Schock überwunden hatte, untersuchte sie die zwei kleinen Spitzen an den Handgelenken des Patienten genauer. Währenddessen wurde der Mörder an sämtliche Geräte gehängt und immer mehr Ärzte und Krankenschwestern strömten in den Op-Saal, nur um dort von dem Chefarzt wieder nach draußen geschickt zu werden. Die Sache durfte auf keinen Fall zu viel Aufmerksamkeit erregen, bevor nicht geklärt war, was hier eigentlich vor sich ging.
Bei der genaueren Untersuchung des Opfers fiel Lara auf, dass die seltsamen Dornen zu wachsen schienen. Und zwar mit enormem Tempo! Schon nach wenigen Minuten waren die Stacheln fast genauso groß ausgeprägt wie die des Mörders. Sie bestanden aus einem seltsamen, schwarzen Material, welches aussah wie Knochen, jedoch deutlich härter und stabiler erschien. Für mehr Informationen würde sie wohl eine Probe ins Labor schicken müssen. Das war ja so aufregend!
Lara interessierte sich sofort für den Fall. Sie wollte unbedingt herausfinden, was mit den beiden Männern geschehen war und plötzlich war sie über ihre heutigen Überstunden gar nicht mehr so unglücklich.
Aufgeregt wandte sie sich zum Chefarzt und meinte: »Ich würde mich gern persönlich um die zwei Patienten kümmern. Natürlich nicht allein, aber es wäre mir eine Ehre, bei der Sache helfen zu können. Habe ich Ihre Erlaubnis dazu?«
Der Arzt kratzte sich an seinem Bart und schien zu überlegen. Dann musterte er Mrs. White eingehend, als suche er in ihrem Gesicht nach einer Antwort.
»Ich denke«, er machte eine kurze Pause. Lara schaute ihm gespannt in die Augen. Er lächelte und öffnete den Mund, wie um noch etwas hinzuzufügen, als plötzlich das blanke Chaos ausbrach.
Im ersten Moment merkte Lara nur, dass sie von den vielen Menschen im Raum, die auf einmal panisch von den beiden Krankenbetten zurückwichen, nach hinten gedrückt wurde und das Gleichgewicht verlor. Sie stolperte und fiel zu Boden.
Gleichzeitig gab es irgendwo vor ihr einen lauten Knall und das Geräusch von reißenden Seilen, gefolgt von dem spitzen Schrei einer Krankenschwester. Viele der Ärzte und Schwestern, die noch vor der Tür gewartet hatten, als der Chefarzt sie hinausgeschickt hatte, kamen jetzt herein, um nach dem Rechten zu sehen und machten dadurch alles noch viel schlimmer.
Lara konnte nicht aufstehen. Verzweifelt verschränkte sie schützend die Arme über ihrem Kopf. Glas splitterte. Dann ertönte erneut ein lang gezogener Schmerzensschrei.
Ich muss hier raus!, dachte Lara und zog sich verzweifelt an der ihr am nächsten stehenden Person hoch. Kurz riskierte sie einen flüchtigen Blick auf die Krankenbetten. Sie waren leer. An der Seite des einen Bettes baumelten lose die gerissenen Fesseln, welche wenige Sekunden zuvor noch den Täter gehalten hatten.
Wie in Zeitlupe wanderte Laras Blick nach unten. Der weiße Fliesenboden war glitschig und blutrot. Eine Krankenschwester lag reglos am Boden. Über ihr kniete der Mörder und versenkte seine Stacheln in ihrem Brustkorb. Der andere Patient sprang gerade nach vorn und packte einen Arzt am Kittel. Mit einem Faustschlag, so stark, dass Lara Knochen brechen hören konnte, streckte er sein Opfer nieder und rammte gleich darauf den Dorn seiner rechten Hand tief in den Brustkorb des Mannes. Dabei fauchte er animalisch. Die Ärzte und Schwestern, die den zwei verrückten Mördern am nächsten standen, versuchten nun, so schnell wie möglich den Raum zu verlassen. Doch in dem kleinen Zimmer drängten sich mittlerweile so viele panische Leute dicht aufeinander, dass es beinahe unmöglich war, zu entkommen.
Lara schrie. Sie konnte es gar nicht verhindern. Ohne noch einen Blick den Mordschauplatz hinter ihr zu verschwenden, kämpfte sie sich den Weg zur Tür frei und schaffte es endlich, sich gleichzeitig mit zwei anderen Flüchtenden hindurchzuzwängen.
Lara wusste nicht, was hier vor sich ging, doch sie verstand, dass sie sich in Lebensgefahr befand. Ohne zu zögern, sprintete sie den Flur des Krankenhauses entlang. Fort von diesem grauenhaften Schauplatz. Hinter sich hörte sie ein lautes Krachen, gefolgt von einem erstickten Schrei. Endlich erreichte sie eine Ecke, bog ab und presste sich schwer atmend an die Wand.
»Verfluchte Scheiße, was ist hier los?«, stöhnte Lara, während sie sich auf ihre Knie stützte, stoßweise atmete und versuchte ihren Schock zu überwinden.
In diesem Moment stürzte eine ihrer Kolleginnen um die Ecke, bekam allerdings nicht richtig die Kurve und wurde genau vor Lara von ihrem eigenen Schwung an die Wand geschleudert. Lara wollte schon aufstehen und der Schwester helfen, da trat der mittlerweile durch und durch mit Blut verschmierte Patient ebenfalls in ihr Blickfeld. Mit Leichtigkeit heftete er die hilflose Frau mit einem Arm an die Wand, als wäre sie aus Schaumstoff. Laras Herz schlug ihr bis zum Hals. Dicke Schweißperlen kullerten ihr über die Stirn und brannten in ihren Augen.
Der Patient packte die Krankenschwester am Genick, schleuderte sie brutal zu Boden und schlitzte ihr mit seinen Knochendornen den Rücken auf, bis sie keinen Laut mehr von sich gab.
Dann blickte der Mann langsam auf. Alles geschah wie in Zeitlupe. Laras Atem stand still. Verzweifelt presste sie sich an die Wand und hoffte inständig, der Mann würde sie übersehen. Doch er sah sie. Er sah ihr direkt in die Augen und seine Pupillen waren blutrot gefärbt.
»Mist«, murmelte Lara. Dann rannte sie um ihr Leben.
Rebellion
Im Speisesaal der Kaytan herrschte geschäftiges Stimmengewirr. Endu setzte sich wie jeden Abend an den für ihn vorgesehenen Platz und beäugte sein Abendessen.
Die Teller wurden stets für alle Crewmitglieder mit einem einheitlichen Gericht gefüllt. Nachschläge gab es nicht. Extrawünsche gab es nicht. So war das Leben auf einem Raumschiff.
Heute stand Orisfleisch auf dem Speiseplan. Allerdings handelte es sich dabei im Grunde gar nicht um Fleisch. Oris war eine Pflanze, welche in den Lebensmittellabors des Raumschiffes hergestellt wurde und deren Früchte ungefähr die Konsistenz von Fleisch hatten. Der Pflanze wurden zusätzliche Vitamine und Eiweiße angezüchtet. Den guten Geschmack allerdings hatten die Wissenschaftler bei der Züchtung wohl vergessen.
Eigentlich gab es so gut wie jeden Tag Orisfleisch. Außer an besonderen Feiertagen wie dem jährlichen Aufbruchstag, an dem sie vor 150 Jahren von ihrer Heimat aus losgeflogen waren oder dem Geburtstag des Königs.
Zu diesen Festtagen gab es dann eingefrorenes, echtes Fleisch aus der Heimat, sowie heimisches Gemüse, welches nun seit anderthalb Jahrhunderten in riesigen Kühltruhen lagerte und immer noch so schmeckte, wie frisch geerntet. Jedenfalls redeten sie sich das ein. Eigentlich wusste keiner an Bord mehr, wie frisch geerntetes Gemüse schmeckte.
Mit einem Seufzer machte sich Endu über sein Essen her, als ihn plötzlich eine Stimme aufschreckte.
»Hey!« Neben Endu hatte Nira Platz genommen. Sie wirkte angespannt und ließ ihren Blick umherschweifen, bevor sie Endu direkt ansah. Neben sie setzte sich ihr Bruder Queson an den Tisch. Auch er schien unruhiger zu sein als sonst.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














