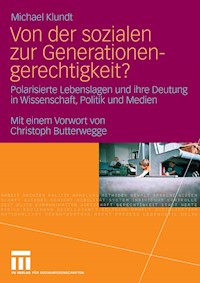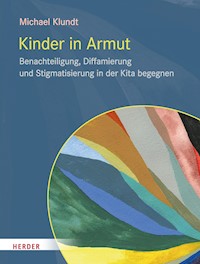
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Pädagogische Fachkräfte können die gesellschaftspolitisch verursachte Entstehung von Kinderarmut kaum beeinflussen. Doch die Frage, wie sie mit ihr umgehen, ist von allergrößter Relevanz: Reproduzieren ihre Haltungen und Handlungen einfach nur die vorhandene soziale Ungleichheit oder verstärken sie sie sogar? Oder gelingt es ihnen, Armutswirkungen zu lindern und zu vermindern und Ressourcen, Resilienz und solidarische Beziehungen zu stärken? Dafür benötigen sie fundiertes Fachwissen über das Ausmaß, die Folgen, die Ursachen und wirksame Gegenmaßnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie in den jeweiligen Bildungseinrichtungen. Hier verschafft das Buch Übersicht, Klarheit und gibt starke Impulse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Klundt
Kinder in Armut
Michael Klundt
Kinder in Armut
Benachteiligung, Diffamierung und Stigmatisierung begegnen
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: beastfromeast / GettyImages
Fotos im Innenteil, Seiten 15: © nine_far - GettyImages; 35: © vladm - GettyImages; 59: © Denise Hasse - GettyImages; 83: © Pahis - GettyImages; 101: © Buecherwurm_65 / pixabay - poverty; 121: © rollover - GettyImages
E-Book-Konvertierung: Röser MEDIA GmbH & Co. KG
ISBN Print 978-3-451-39233-7
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-82922-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-82923-9
Inhalt
Einleitung
1 Ausmaß und Erscheinungsformen von Kinderarmut
1.1 Wahrnehmung von und Haltung zu Armut sowie Ungleichheit
1.2 Empirischer Umfang ungleicher Sozialverhältnisse
1.3 Politische, mediale und wissenschaftliche Verharmlosungs-Versuche
2 Psychosoziale Ungleichheits- und Armuts-Folgen
2.1 Auswirkungen armutsbestimmter Lebenslagen
2.2 Bildungsungleichheit und Armutsfolgen
2.3 Konsequenzen der Corona-Krise für (arme) Kinder
2.4 Kinderrechte in der Corona-Krise
3 Debatten und Diskurse als Polarisierungsprodukte und -produzenten
3.1 Ungleichheits-Diskurse und Debatten im politischen Raum
3.2 Bildungsdiskurse und Bildungsarmut
3.3 Generationen-Diskurse über Krisen-Konsequenzen: zwischen Solidarpotenzialen und Spaltungsprozessen
3.4 Dogmen pandemiegemäßer Alternativlosigkeit auf dem Prüfstand
3.5 Fazit: Vergessene Kinder?
4 Ursachen und Zusammenhänge von Kinderarmut und sozialer Ungleichheit
4.1 Zwischen Anlässen und Ursachen
4.2 Regierungs-Maßnahmen als „Meilensteine“ oder „Mit-Verursacher“?
4.3 Ungleichheits-Produktion unterbindet Armuts-Reduktion
4.4 Armuts-Ursachen im Corona-Kontext
5 Alternativen und Gegenmaßnahmen
5.1 Regierungsperspektiven und -Konsequenzen
5.2 Zwischen-Fazit
5.3 Notwendige Maßnahmen im Einzelnen
5.4 Gegenmaßnahmen im Allgemeinen
6 Fazit
Literatur
Danksagung
Über den Autor
Einleitung
Wie ist das möglich? Obwohl wir allen Kindern die gleichen Bildungschancen geben wollen, resultieren aus unseren Strukturen und Handlungen immer wieder ungleiche Bildungschancen. Meist werden privilegierte Kinder im Bildungssystem noch bevorteilt und in Armut lebende Kinder vom Bildungssystem, von familienpolitischen Leistungen sowie steuerlichen Regelungen zusätzlich benachteiligt.
Dieses Buch führt die Erscheinungsformen und Folgen von Kinderarmut vor Augen, geht auf die Ursachen und Zusammenhänge ein. Woran scheitert das wirksame Ändern der Verhältnisse bislang? Wie lauten Lösungswege? Welche kinderrechtsorientierten Maßnahmen würden Abhilfe schaffen? Wie gelingt es Kitas, sich dem Thema bewusst und sensibel zu stellen?
Pädagogische Fachkräfte können die gesellschaftspolitisch verursachte Entstehung von Kinderarmut sicherlich kaum beeinflussen. Doch die Frage, wie Bildungsinstitutionen und Professionelle mit sozialer Benachteiligung, Armut und deren Folgen umgehen, ist tatsächlich von hoher Relevanz. Reproduzieren ihre Haltungen und Handlungen einfach nur die vorhandene soziale Ungleichheit oder verstärken sie diese sogar? Oder gelingt es ihnen – gemeinsam mit anderen Fachkräften, mit Kindern und Familien – zumindest Armutswirkungen zu lindern und zu vermindern und dadurch – bei allen sozialen Widrigkeiten – Kinder, Eltern, Fachkräfte und das Gemeinwesen in ihrer Handlungsfähigkeit, ihren Ressourcen, ihrer Resilienz und in ihren solidarischen Beziehungen zu stärken?
Dafür benötigen pädagogische Fachkräfte fundiertes Fachwissen über das Ausmaß, die Folgen und relevante öffentliche Debatten sowie evidenzbasierte Informationen zu den Ursachen und wirksamen Gegenmaßnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, wie auch in den jeweiligen Bildungseinrichtungen. Das ist das Anliegen dieses Buches.
Indessen ist nicht mehr zu übersehen, dass sich die Lebensbedingungen vieler Millionen Menschen in Deutschland seit dem Frühjahr 2020 und noch einmal seit dem Frühjahr 2022 zum Teil drastisch verschlechtert haben. Wie der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge zeigt, lässt sich dies darauf zurückführen, dass sich verschiedene gesellschaftliche Krisen häuften und gleichzeitig verschärften. Demnach setzten schon mit der Covid-19-Pandemie und dem ersten bundesweiten Lockdown inflationäre Tendenzen ein. Diese verschärften sich mit dem Ukraine-Krieg und den westlichen Sanktionen gegenüber Russland als Reaktion darauf seit dem Frühjahr 2022, wobei ihr Höhepunkt womöglich noch gar nicht erreicht sei. Zwar seien davon besonders einkommensarme und armutsgefährdete Personengruppen betroffen, da sie im Unterschied zu wohlhabenden Bevölkerungskreisen über geringe bis gar keine finanziellen Rücklagen verfügten. Doch inzwischen habe sich die Angst vor der Verarmung auch in weiten Teilen der Mittelschicht verbreitet, sodass von einer stärkeren Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auszugehen sei (vgl. Butterwegge 2022). Gerade Kinder in Armutslagen sind von diesen Bedingungen in besonderer Weise betroffen.
Es ist feststellbar, dass sich die Literaturlage zum Thema „Kinderarmut und Kitas“ in den letzten Jahrzehnten herausragend entwickelt hat (vgl. Poppe 2019; Rahn/Chassé 2020). Zwar sind die Forschungserkenntnisse zu Kinderarmut in der Corona-Krise trotz aller Anstrengungen noch recht lückenhaft, da das vorhandene Datenmaterial überwiegend mit Methoden ermittelt wurde, die – pandemiebedingt – digitale Ausrüstung und z.T. Unterstützung anderer Familienmitglieder voraussetzen und darüber sozial benachteiligte Kinder tendenziell eher ausschließen. Kurz gesagt: Wer Befragungen mit Kindern, Jugendlichen und Familien über digitale Medien durchführt und feststellen muss, dass über 80 oder gar 90 Prozent der Befragten über einen eigenen Garten verfügen, muss sich bewusst sein, dass sozial benachteiligte Menschen damit nicht ausreichend erfasst wurden. Doch was die grundsätzlichen Erkenntnisse zur Materie betrifft, können inzwischen über elektronische Fachportale wie Erzieherin.de, die Homepage des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung NIFBE.de, die „Impulse“-Fachjournale und Forschungsberichte des Deutschen Jugendinstituts auf DJI.de oder regelmäßige AWO-ISS-Studien (von 2000 bis 2022) oder durch die Kolleg(inn)en Gerda Holz (2000/2014/2019/2022), Antje Richter-Kornweitz (2000/2020), Sabine Poppe (2019), Karl August Chassé, Margherita Zander, Konstanze Rasch (2010), Christoph Butterwegge (2000/2008/2022), Carolin Butterwegge (2022) und andere ein Literatur- und ein Forschungsstand garantiert werden.1 Der Sachstand war wahrscheinlich noch nie so gut wie heute, der Forschungsstand wohl noch nie so ausgereift, und selbst die Konzepte für Good Practices oder gar Best Practices sind für Fachkräfte besonders qualitativ hochwertig und praxistauglich-verständlich dargestellt (vgl. Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. 2021, S. 7f.). Somit fehlt es also weniger an Daten als an Taten (vgl. Klundt 2019, S. 10ff.; Klundt 2022a, S. 91ff.). Warum dann eigentlich noch ein Buch zum Thema?
Wer sich im Jahre 2022/2023 mit dem Thema „Kinderarmut“ erstmalig beschäftigt, könnte fast den Eindruck gewinnen, dass buchstäblich alle gesellschaftlichen und politischen Instanzen (eigentlich schon immer) Kinderarmut vermeiden oder bekämpfen wollen. So sagte die Familienpolitikexpertin Petra Mackroth aus dem Bundesfamilienministerium in einem Interview mit der Zeitschrift DJI-Impulse 1/2022 (S. 16): „Es herrscht breiter politischer Konsens, dass Kinderarmut bekämpft werden muss.“ Wenn dem so wäre und wenn Daten, Theorien sowie wirksame Praxiskonzepte in Hülle und Fülle vorhanden sind, stellte sich allerdings die Frage, warum die Kinderarmut in den letzten Jahrzehnten nicht wirksam verhindert oder vermindert wurde, sondern sich eher noch gesteigert oder verfestigt hat. Viele (Kinder-)Armutsforscher/innen erforschen zwar Ungleichheitsprozesse und entwickeln richtige, bedarfsgerechte Lösungen für sozialpolitische Probleme und gegen gesellschaftliche Polarisierung in einerseits arme und benachteiligte Lebenslagen und andererseits reiche und privilegierte Milieus (vgl. Becker/Schmidt/Tobsch 2022, S. 9ff.). Ursachenanalysen jedoch, warum es zu den von ihnen festgestellten Ungleichheitsprozessen gekommen ist und Hinderungsgründe, warum kluge und angemessene Vorschläge regelmäßig seit Jahrzehnten eher nicht angenommen oder angewandt werden, bleiben oft unterbelichtet. Offensichtlich wird unter diesem breiten gesellschaftlichen Konsens zur Kinderarmutsbekämpfung Unterschiedliches verstanden, Unterschiedliches beabsichtigt – und vor allem: Unterschiedliches erzielt. Auch damit möchte sich dieses Buch näher beschäftigen.
Es geht von der These aus, dass die Ermittlung von Primärdaten zweifellos notwendig ist zur Erforschung der sozialen Lage von Kindern; dass es jedoch vor allem darauf ankommt, wie diese Daten in der medialen, politischen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit behandelt und verhandelt werden. Demnach wäre es nicht so entscheidend, ob wir 15,7 Prozent oder 20,3 Prozent Kinderarmut, ob wir 2,3 Millionen oder 3,4 Millionen Kinder in Armut(snähe) haben, sondern was mit diesen Zahlen und Daten in den wesentlichen Diskursen und Debatten sowie in den relevanten Entscheidungskreisen gemacht wird. Dass Armut im Jahre 2022/23 – also auch die von Kindern – anders aussieht als die Armut im Mittelalter, vor der Französischen Revolution von 1789 oder unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, scheint doch eigentlich selbstverständlich zu sein. Dennoch müssen wir vorurteilsbewusst und selbstkritisch berücksichtigen, dass viele Erwachsene die Lebensverhältnisse der Kinder und ihrer Familien heute gerne (manchmal unbewusst) mit ihrer eigenen Kindheit vergleichen und dann oft heutige Armut als geradezu harmlos und unproblematisch betrachten im Verhältnis zu früheren Zuständen. Dazu wäre zu berücksichtigen, dass dieser Vergleich den Kindern und ihren Eltern heute leider wenig bringt. Beispiel Handy: Selbstverständlich spielt der Besitz eines Smartphones in einer Gesellschaft, in der niemand ein solches Gerät besitzt, eine gänzlich andere Rolle als in einer Gesellschaft, die zentrale Kommunikations-, Bildungs- und Partizipationsmöglichkeiten beinahe ausschließlich von der adäquaten Verfügbarkeit über ein Smartphone abhängig macht. Wenn selbst der Kontakt zu jeglichen Ämtern fast nur noch digital stattfindet, bedeutet der Mangel an entsprechenden Kapazitäten und Kompetenzen zugleich eine fundamentale Ausgrenzung von elementaren Menschenrechten. Weiterhin ist zu beachten, dass es mit der Haltung „wir-hatten-früher-auch-nichts-oder-noch-weniger“ schwerfällt, Kindern und ihren Familien in der Gegenwart praktisch armutssensibel zu begegnen und sie nicht zunächst gar als „selbst schuld“ anzusehen.
Kinderarmut in Deutschland heute bedeutet also Armut in einem der reichsten Länder dieser Erde. Und Armut selbst lässt sich präzise eigentlich immer nur im jeweiligen zeitlichen und räumlichen Kontext, dem jeweiligen aktuellen allgemeinen Lebensstandard betrachten. Wenn fast alle zum Beispiel über einen Kühlschrank, diverses Spielzeug, Malstifte oder einen Schulranzen verfügen, ist es ungerecht, wenn manche davon ausgeschlossen werden. Schmerzhafter noch als materielle Einschränkungen können sich Diffamierungen und Stigmatisierungen auswirken. Auch das Reden über (arme) Kinder und ihre Familien macht also einen Teil der gesellschaftlichen Polarisierungs-Problematik aus, die immer weniger geleugnet werden kann. Dies gilt vor allem dann, wenn die Betrachtung von (Kinder-)Armut durch ein Wechselspiel zwischen Ignoranz, Krokodilstränen und Schicksalsgläubigkeit gekennzeichnet ist. Besonders bedenklich sind diejenigen Debatten, in denen die betroffenen Kinder und Familien mit den Etiketten ‚selbst schuld‘ oder ‚asozial‘ rhetorisch bedacht werden, denn dann steht statt der Bekämpfung von Armut eher die Herabwürdigung und letztlich Bekämpfung der Armen im Vordergrund.
In den letzten Jahren ließ sich zudem feststellen, dass in der deutschen Corona-Politik seit März 2020 anscheinend besonders restriktiv gegenüber Kindern und Jugendlichen, Familien und Bildungseinrichtungen vorgegangen wurde. Doch diese Hypothese ließ sich noch nicht wirklich evidenzbasiert beweisen. Seit Juli/August 2021 lassen die Indizien inzwischen eine Bestätigung dieser Eindrücke zu. Denn die Kommissarin für Menschenrechte des Europarats, Dunja Mijatović, hat in einem Brief vom 13. Juli 2021 an die damalige deutsche Justiz- und Familienministerin Christine Lambrecht die Bundesrepublik Deutschland bei der Umsetzung der Kinderrechte im Vergleich zu den anderen 46 Europarats-Mitgliedsstaaten besonders gerügt. Und sie tat dies nicht nur wegen der im Sommer 2021 gescheiterten Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, sondern explizit auch wegen der besonderen Schärfe der Corona-Maßnahmen gegenüber Kindern und Bildungseinrichtungen seit März 2020.2 Erstaunlicherweise hat Lambrecht in ihrer Antwort vom 24. August 2021 auf den Brief der Europarats-Kommissarin dieser Recht gegeben und zugegeben, dass dieser Eindruck stimme. So schreibt die deutsche Ministerin: „Soweit Sie anmerken, Deutschland habe im europäischen Vergleich einen besonders strikten Kurs eingeschlagen, was Schulschließungen angeht, gebe ich Ihnen zunächst Recht: Deutschland ist zu Beginn der Pandemie angesichts der noch unerforschten Krankheit und der dünnen, zum Teil noch gar nicht vorhandenen Datenlage hinsichtlich der Auswirkungen des Virus auf Kinder sowie deren Rolle im Infektionsgeschehen in der Tat mit besonderer Vorsicht vorgegangen.“3
Selbst der dem Bundeskabinett am 15. September 2021 vorgestellte interministerielle Report des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundesfamilienministeriums gesteht eine zumindest bislang nicht ausreichende Berücksichtigung des Kindeswohlvorrangs und der Kinderrechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung mehr als indirekt ein, wenn dort angemahnt wird: „Zu beachten ist, dass Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie erlassen werden, nicht nur mit den Grundrechten, sondern auch mit der VN-Kinderrechtskonvention (VN-KRK) in Einklang stehen müssen, zu der u. a. das Recht auf Bildung (Art. 28 VN-KRK), das Recht auf Freizeit (Art. 31 VN-KRK) und das Recht auf Gesundheit (Art. 24 VN-KRK) zählen. Diese Vorgaben sind ebenfalls zu berücksichtigen.“4 Wenn solche völkerrechtlichen und rechtsstaatlichen Selbstverständlichkeiten von einem interministeriellen Bericht für das Bundeskabinett am 15. September 2021 explizit eingefordert werden, so lag deren Berücksichtigung bisher offenbar im Argen. Dass dabei der Kindeswohlvorrang (nach Art. 3 UN-KRK) und die Kinderrechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung noch nicht einmal (ausreichend) Erwähnung finden, darf ebenfalls als Ausdruck für deren bisherige Relevanz im Regierungshandeln betrachtet werden.
„Hat Deutschland ein Problem mit Kindern?“, fragte folglich Ende 2021 auch die „Süddeutsche Zeitung“ und konstatierte: „Verlass ist in der deutschen Pandemiepolitik bisher fast immer darauf gewesen, dass die Kinder in der Debatte um Maßnahmen zunächst mal vergessen wurden.“ Kindern wurden dabei durchaus in der Öffentlichkeit Rollen zugewiesen, zuerst jene als „potenzielle Virenüberträger und folglich Gefährder der öffentlichen Erwachsenengesundheit“, in der Folge als Betreuungsobjekte oder als Leistungserbringer (vgl. Hahn u.a. 2021). Ein Blick in andere Länder zeigt dabei, dass eine andere Prioritätensetzung in der Pandemie, um Kinderrechte zu wahren, durchaus möglich ist, etwa beim Offenhalten von Schulen und Kitas, wie zum Beispiel in Frankreich, der Schweiz oder Dänemark (ebd.; Ehrenstein/Geiger 2021).
So kam der Bildungsbericht 2021 für die Vereinigung der 38 höchstentwickelten Industriestaaten der Welt (OECD) unter der Überschrift „Education at a Glance“ / „Bildung auf einen Blick“ im September 2021 zu dem klaren Ergebnis, dass der Unterricht für die rund elf Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie bis zum Auslaufen der Schulschließungen im Frühjahr 2021 im Schnitt an mehr als 180 Tagen gestört war. Das sind zwei Drittel der rund 270 Schultage im untersuchten Zeitraum zwischen Januar 2020 und dem 20. Mai 2021: „Die Wahrung der Chancengerechtigkeit stellte sich angesichts der Coronapandemie (Covid-19) besonders schwierig dar. Benachteiligte Schüler haben am ehesten Schwierigkeiten mit Fernunterricht und weisen ein höheres Risiko auf, bei anhaltenden Schulschließungen das Interesse an Bildung zu verlieren. Auch sind Personen mit niedrigerem Bildungsstand stärker von Unsicherheit und Instabilität auf dem Arbeitsmarkt betroffen“ (OECD 2021, S. 19).
In einer Sonderbroschüre behandelte die OECD zusätzlich den Aspekt Chancengerechtigkeit in der Pandemie mit dem Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bildungsbereich („The State of Global Education. 18 Months into the Pandemic, Paris 2021“). Dort heißt es etwa zu diesem sensiblen Thema, dass angesichts der schwerwiegenden Auswirkungen von Schulschließungen auf das Lernen und das Wohlergehen der Schüler/innen viele Länder ihre Strategien für Schulschließungen im Zuge der Pandemie angepasst hätten. Wie die Sonderumfrage zu COVID-19 zeige, habe es nach einer quasi systematischen Schließung von Schulen in den meisten Ländern Mitte März 2020 zwischen September 2020 und Anfang 2021 erhebliche Unterschiede in den Ansätzen gegeben. In einigen Ländern blieben die Schulen geschlossen, als die Virusübertragung zunahm, während andere die Schulen auch in einem schwierigen Pandemiekontext offen hielten. In Kolumbien, Costa Rica, der Tschechischen Republik, Litauen, Mexiko, Polen und der Türkei wurde der Unterricht in Schulen der Sekundarstufe II zwischen Januar 2020 und Mai 2021 an mehr als 200 Tagen unterbrochen (vollständige oder teilweise Schließung), während es in Norwegen, Neuseeland und Spanien weniger als 50 Tage waren. Die Sondererhebung zu COVID-19 zeigte auch, dass die Regelungen zum Offenhalten von Schulen oder Klassen sehr unterschiedlich waren. Deutschland beispielsweise hat im Jahr 2021 strenge Regeln eingeführt, so dass alle Schulen hybride Lernprotokolle einführen mussten, wenn die Inzidenzrate in einer Region über 100 lag. Außerdem mussten die Schulen nach drei Tagen mit einer Inzidenz von mehr als 165 pro 100.000 Einwohner für alle Schüler/innen auf Fernunterricht umstellen. Im Gegensatz dazu haben Belgien, Frankreich, Spanien und die Schweiz ihre Schulen der Sekundarstufe II zwischen Januar und Mai 2021 nicht vollständig (oder nur für wenige Tage) geschlossen (vgl. OECD 2021a, S. 3f.).
Auch eine Studie des Münchener ifo-Wirtschaftsforschungsinstituts verglich die Corona-Bildungspolitik in Deutschland mit sechs ausgewählten Ländern Europas im Zeitraum von Januar 2020 bis Mai 2021. Danach zeigte sich, dass der bisherige deutsche Weg bezüglich Schulen in der Pandemie besonders einschränkend für Kinder und Jugendliche gewesen sei: „Deutschland schloss die Schulen insgesamt 183 Tage lang, wenn wir die Zeiten der vollständigen (74 Tage) und der teilweisen (109 Tage) Schließungen addieren. Länger schlossen, nach dieser Berechnung, nur die Schulen in Polen mit insgesamt 273 Tagen. Im Mittelfeld unseres Ländervergleichs liegen Österreich und die Niederlande (152 bzw. 134 Tage), während Frankreich, Spanien und Schweden mit je 56, 45 und 31 Tagen die kürzesten Schulschließungen verzeichnen. Tendenziell waren Grundschulen weniger lang vollständig geschlossen als weiterführende Schulen, in Deutschland und Polen berichten Grundschulen dafür längere teilweise Schließungen“ (Freundl/Stiegler/Zierow 2021, S. 41). Neben den Einschränkungen für Kinder und Jugendliche seien Differenzen in den pandemiebedingten Auflagen für Erwachsene auffallend. Und bei der Herausforderung, auf Distanzlehre umzusteigen, sei als Ausgangslage der Digitalisierungsstand der Schulen vor Corona ein wichtiger Faktor: „Deutschland liegt in Bezug auf Online-Lernplattformen und Ressourcen für die Nutzung digitaler Technologien im Unterricht auf den letzten Rängen, während Skandinavien Vorreiter ist. Dies manifestiert sich auch in Unterschieden in Art und Frequenz des (Online-)Unterrichts während der Pandemie“ (ebd.). Außerdem liefert der Beitrag einen Überblick über verschiedene nationale Kompensationsprogramme und Corona-Bildungsausgaben etwa zur Abmilderung von pandemiebedingten Lernverlusten oder zur Verringerung der Bildungsungleichheit.
Dadurch wird deutlich, dass die verglichenen Staaten bei relativ gleicher Pandemielage trotzdem unterschiedlich in ihren Bildungssystemen agierten, unterschiedliche Maßnahmen präferierten und damit eine unterschiedliche Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention vornahmen.
Doch Kinder- und Jugendrechte sind keine symbolische Schönwetter-Angelegenheit, sondern in der UN-Kinderrechtskonvention verankertes Völkerrecht sowie seit 1992 geltendes Bundesgesetz (seit 2010 explizit vorbehaltlos). Darin verpflichtet sich die Bundesrepublik etwa, dass bei „allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das Wohl des Kindes (…) vorrangig zu berücksichtigen ist“ (Art. 3, UN-KRK). Daran gemessen muss leider festgestellt werden, dass dies in der Praxis der vergangenen Jahre weitgehend versäumt wurde. Dafür steht auch der im Juni 2021 letztlich gescheiterte Regierungsentwurf zur Einfügung von Kinderrechten in das Grundgesetz vom 19. Januar 2021. Denn dass der Gesetzentwurf der damaligen Bundesregierung das Kindeswohl nicht „vorrangig“ berücksichtigen mochte, sondern nur „angemessen“, und dass Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen nur auf „rechtliches Gehör“ beschränkt wurden und nicht umfassend gelten sollten, stellte einen Rückschritt zum Status quo der seit 1992 als Bundesgesetz verankerten UN-Kinderrechtskonvention dar. Insofern ist der im Juni 2021 von der damaligen Familien- und Justizministerin Lambrecht als gescheitert ausgerufene Gesetzentwurf zu Kinderrechten im Grundgesetz (Art. 6) tatsächlich kein großer Schaden. Dass man es besser hätte machen können, beweisen an die 15 Landesverfassungen mit Kinderrechtsformulierungen (zuletzt – mit Volksabstimmung – in Hessen und in Bremen) und auch Art. 24 der EU-Grundrechtecharta. Andererseits hätte selbst eine auch nur symbolische Erwähnung der Kinderrechte insofern mindestens Signalwirkung gehabt, als dass die vielen Jurist(inn)en und Beamte(inn)en in und außerhalb des Bundestages gezwungen gewesen wären, sich wenigstens einmal während der Ausbildung mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinanderzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet der Kinderrechte-Ansatz noch viel mehr für alle mit Kindern arbeitende Professionen (vgl. Maywald 2018, S. 967ff.), doch als erster Schritt sollte dies dann auch für die zukünftigen Lehrer/innen, Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen gelten. Womöglich könnte der gescheiterte Entwurf aber auch als Ausdruck der realen Umsetzungsprobleme bei den Kinderrechten in der Corona-Krise angesehen werden. Dass dabei vor allem sozial benachteiligte, in Armut(snähe) lebende Kinder in besonderem Maße von Einschränkungen ihrer Kinderrechte betroffen waren und sind, soll im Folgenden näher ausgeführt werden.
Dazu geht es zunächst im ersten Kapitel um das Ausmaß und verschiedene Erscheinungsformen von Kinderarmut. Unterschiedliche Verharmlosungsstrategien sind dabei ein nicht zu unterschätzender Untersuchungsgegenstand. Nur deren Überwindung kann dazu beitragen, die Wirklichkeit des Armutsumfangs tatsächlich nüchtern zur Kenntnis zu nehmen. Das zweite Kapitel handelt von Folgen und Auswirkungen der Problematik. Auch hier geht es vor allem um den aktuellen und weitgehend unumstrittenen Forschungsstand. Jedoch sind zugleich einige Ausblendungen relevanter Armuts-Konsequenzen ebenfalls zu ermitteln. Debatten und Diskurse zu Kinder- und Familienarmut sowie Reichtum sind das Thema des dritten Kapitels. Dabei soll gezeigt werden, dass auch politische, mediale und wissenschaftliche Äußerungen und Kontroversen beitragen zur Polarisierungsproblematik im Bereich Kinderarmut. Sie können etwa durch ein Klima solidarischer Sensibilität oder stigmatisierender Segregation (als verächtlich machende Ausgrenzung) politische Willensbildung beeinflussen. Auch können sie den Handlungsdruck erhöhen oder durch Scheindebatten von den realen Schwierigkeiten ablenken und eine Verzögerung der Problembehandlung im Interesse ihrer bisherigen Profiteure begünstigen. Daraufhin beschäftigt sich das vierte Kapitel mit Ursachen und Zusammenhängen, welche immer wieder in Äußerungen politischer, medialer und wissenschaftlicher Öffentlichkeit mit Anlässen und Teil-Aspekten verwechselt werden und somit das kindheits- und sozialpädagogische wie (kindheits-)wissenschaftliche Begreifen und wirksame Verändern der Verhältnisse behindern. So wird immer wieder das beispielsweise hohe Armutsrisiko unter Familien von Alleinerziehenden als Ursache für die soziale Benachteiligung der Ein-Eltern-Familien beschrieben, statt die darunter liegenden, wirklichen sozial- und familienpolitischen Grundlagen zu ermitteln. Als Nächstes werden einige notwendige, kinderrechtsorientierte Maßnahmen und Alternativen im fünften Kapitel erörtert, welche gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen mitberücksichtigen, wie z.B. den gestiegenen privaten Reichtum im Verhältnis zur Ausweitung und Verstetigung von Armut in familiären und kindlichen Lebenswelten. Das sechste Kapitel formuliert schließlich ein Fazit und entwirft einen Ausblick.
1 Ausmaß und Erscheinungsformen von Kinderarmut
Wie viele Kinder sind eigentlich in Deutschland von Armut betroffen und wie nehmen wir im Allgemeinen deren Zustand wahr? Das folgende Kapitel untersucht zunächst das Ausmaß und die Erscheinungsformen sozial polarisierter Kindheiten. Es beweist auch die Relevanz von Wissenschaften, weil sie in vielerlei Dingen aufzeigen können, dass die Erscheinungsform(en) und das Wesen bzw. der soziale Inhalt von Sachverhalten nicht notwendigerweise identisch sind. Das gilt übrigens auch für das subjektive Selbstverständnis bezüglich Haltungen und Handlungen im Verhältnis zur objektiven Funktion dieser Ansichten und Artikulationen. Wer wissen möchte, wie sich Armut „anfühlt“, hat seit Jahren die Möglichkeit, die empirische Forschungsliteratur zu bemühen (vgl. z.B. Chassé/Zander/Rasch 2010), die von der Nationalen Armutskonferenz (NAK) herausgegebenen Betroffenen-Berichte zu studieren (vgl. z.B. NAK 2018) oder seit einiger Zeit im Internet unter #ichbinarmutsbetroffen kurze Beiträge von Betroffenen über ihren Alltag und ihre Lebensrealität kennenzulernen, die für viele Menschen als eigentlich undenkbare Verhältnisse in dem doch so reichen Deutschland erscheinen.
Sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, erfordert somit zunächst einmal, sie wirklich wahrzunehmen und nicht zu verharmlosen oder zu verleugnen. Die Anerkennung der Existenz der Betroffenen als ganz „normale“ Menschen kann dabei als erster Schritt gesehen werden. Wie im folgenden Exempel gezeigt wird, ist dies für viele Menschen und auch für viele Professionelle keineswegs selbstverständlich.
„,Bei uns gibt es so etwas nicht, wir haben keine armen Kinder. Bei uns sind nur ganz normale Kinder‘, sagt die Kitaleiterin eines katholischen Familienzentrums, das im Schatten eines Hochhauskomplexes liegt, und lehnt am Telefon den Wunsch nach einem Interview zum Thema armutsbetroffene Kinder ab“ (Iglesias/Wolter-Buhlmann 2019, S. 4).
Dass Armut im Allgemeinen jedoch seit Jahren in Deutschland vorkommt und sogar gravierende Ausmaße angenommen hat, zeigt der Armutsbericht 2022 des Paritätischen Gesamtverbandes. Danach „hat die Armut in Deutschland mit einer Armutsquote von 16,6 Prozent im zweiten Pandemiejahr (2021) einen traurigen neuen Höchststand erreicht. 13,8 Millionen Menschen müssen demnach hierzulande derzeit zu den Armen gerechnet werden, 600.000 mehr als vor der Pandemie. Der Paritätische Wohlfahrtsverband rechnet angesichts der aktuellen Inflation mit einer weiteren Verschärfung der Lage und appelliert an die Bundesregierung, umgehend ein weiteres Entlastungspaket auf den Weg zu bringen, das bei den fürsorgerischen Maßnahmen ansetzt: Grundsicherung, Wohngeld und BAföG seien bedarfsgerecht anzuheben und deutlich auszuweiten, um zielgerichtet und wirksam Hilfe für einkommensarme Haushalte zu gewährleisten“ (Pressemitteilung Parität 2022). Einen Überblick zum allgemeinen Armuts-Ausmaß unter allen Bewohnerinnen und Bewohnern in den Bundesländern gibt die Karte aus dem Armutsbericht 2022 des Paritätischen Gesamtverbandes (Abb. 1).
Abb. 1: Armutsbericht 2022
Quelle: Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband (2022): Zwischen Pandemie und Inflation. Paritätischer Armutsbericht 2022, Berlin, S. 16.
Anhand der dort aufgetragenen Armutswerte lässt sich erkennen, dass es nicht nur zwischen Stadt-Staaten und Flächenstaaten und nicht nur zwischen Ost- und Westdeutschland große Differenzen gibt, sondern mittlerweile auch zwischen Norden und Süden.
In einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage zu aktuellen Zahlen über Kinderarmut vom März 2022 wird der Umfang der Kinderarmut in Deutschland mit der folgenden Tabelle des Statistischen Bundesamtes durch die Parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme illustriert (Abb. 2). Aus den darin enthaltenen Zahlen geht hervor, dass in der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich etwa jedes fünfte Kind und jede/r fünfte Jugendliche von Armut(srisiken) betroffen sind.
Abb. 2: Armutsgefährdungsquoten1) von unter 18-Jährigen in Deutschland und nach Bundesländern in Prozent gemessen am Bundes- und Landesmedian 2020
2 0 2 0
Bundesmedian
Landesmedian
in %
Deutschland Bundesländer
20,2
–
Baden-Württemberg
15,8
18,8
Bayern
12,2
15,9
Berlin
26,1
24,0
Brandenburg
16,8
15,8
Bremen
42,0
28,0
Hamburg
21,0
22,3
Hessen
23,2
23,8
Mecklenburg-Vorpommern
24,4
17,2
Niedersachsen
23,0
22,2
Nordrhein-Westfalen
23,2
23,1
Rheinland-Pfalz
20,2
20,4
Saarland
21,6
20,8
Sachsen
21,1
14,7
Sachsen-Anhalt
26,2
20,1
Schleswig-Holstein
20,3
21,0
Thüringen
21,7
15,9
Ergebnisse des Mikrozensus; Hochrechnung der fortgeschriebenen Ergebnisse des Zensus 2011.
1) Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
Quelle: Kramme, Annette (2022): Antwort der Parlamentarischen Staatsekretärin auf die Schriftliche Frage des Bundestagsabgeordneten Dr. Dietmar Bartsch im März 2022 zum Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland. Arbeitsnummer 039. Berlin.
Da Kinderarmut in Deutschland heute, wie gesagt, Armut in einem der reichsten Länder dieser Erde bedeutet, geht es in der Regel weniger um absolutes Elend und Verhungern, sondern mehr um Entbehrungen, Ausgrenzungen und Benachteiligungen im Verhältnis zum allgemeinen gesellschaftlichen Lebensstandard. Dabei können sich Diffamierungen und Stigmatisierungen sogar noch schmerzhafter als materielle Einschränkungen auswirken. Dennoch darf nicht vergessen werden, wie viele Hunderttausende Menschen inzwischen wieder in Deutschland wohnungs- oder obdachlos sind (laut Tagesschau.de v. 11.11.2019 über 678.000 Menschen, darunter um die 37.000 Jugendliche) und wie viele Menschen vom Flaschensammeln, Betteln oder von Tafeln leben müssen (vgl. Mehr als zwei Millionen Menschen suchen Hilfe bei der Tafel, in: Zeit.de v. 14.07.2022). Hunderttausende teilsanktionierte ALG II-Bezieher/innen und Zehntausende vollsanktionierte Hartz IV-Empfänger/innen (deren Grundsicherungsleistungen zu einem gewissen Anteil gekürzt oder vollständig gestrichen werden, um sie für ein Fehlverhalten zu bestrafen), darunter viele Jugendliche und Familien mit Kindern, für die tatsächlich absolute Armut – die Sorge um ein Dach über dem Kopf oder um Licht und Wärme in der Wohnung, Hunger, Mangel an Kleidung und medizinischer Versorgung – zum täglichen existenziellen Überlebenskampf gehören, werden seit Jahren allzu oft ignoriert. Etwa 80.000 Minderjährige lebten z.B. 2018 in teilsanktionierten ALG-II-Haushalten, und über 5.000 Kinder mussten ertragen, dass ihre sog. Bedarfsgemeinschaft vollsanktioniert wurde (d.h. die Grundsicherungsleistungen wurden zu 100 Prozent gekürzt; vgl. Tagesspiegel.de v. 21.11.2019).
1.1 Wahrnehmung von und Haltung zu Armut sowie Ungleichheit
Die Wahrnehmung und Bearbeitung von sozialer Ungleichheit und Armut in frühkindlichen Bildungseinrichtungen ist entscheidend für die Entwicklung und das Wohl vieler Kinder. Eine völlige Ignoranz der Problematik, wie im oben zitierten Beispiel, ist dabei in den letzten Jahren eher in den Hintergrund getreten. Stattdessen referieren viele Fachkräfte Standardsituationen in der Kita, die auf Unterversorgung des Kindes in verschiedenen Bereichen schließen lassen: Nicht wettergerechte Kleidung, oft morgens sehr hungrig; immer wieder Nahrung einsteckend und nach Hause mitnehmend. Eine erst mal nachvollziehbare, häufige und geläufige Reaktion einiger Fachkräfte besteht dann oft darin, ihr Unverständnis darüber kundzutun, da in anderen Marken- und Technikdingen das betroffene Kind und/oder seine Eltern oft recht gut ausgestattet zu sein scheinen. Die daraus manchmal abgeleitete vermutete Fehlversorgung wird dann gelegentlich mit dem Vorwurf mangelnder Elternkompetenz verbunden. In jedem Fall führt diese Herangehensweise erst mal dazu, dass die Probleme sozialer Ungleichheit und Armut individualisiert und den Betroffenen selbst zugeschrieben werden. Sie, die Eltern, sind die für viele Fachkräfte auf den ersten Blick sichtbaren, eigentlichen Verursacher der Schwierigkeiten ihrer Kinder und demnach letztlich selbst schuld daran. Dass die damit oft verbundenen verbalen und non-verbalen Zeichen des Mangels an Respekt und der Nicht-Anerkennung durch Professionelle, durch andere Eltern oder auch durch andere Kinder sehr schmerzhaft für von Armut belastete Kinder und Eltern sein können, wird mitunter übersehen. In jedem Fall sind sie für die betroffenen Kinder sehr belastend und wenig hilfreich, wie das folgende Beispiel zeigt:
„Dalias Mutter erinnert sich an diese kleine Situation an der Garderobe der Kita, die möglicherweise davon zeugt: ‚Es gab so ein blondes Mädchen, die hatte in der Nähe von Dalia ihr Fach. Und Dalia hatte einen Einteiler als Schneeanzug, das andere Mädchen aber hatte einen Zweiteiler. Dann wurde Dalia echt fertiggemacht – wie, du kannst dir nur sowas leisten und nicht so, wie ich das habe. Das habe ich miterlebt, sie kam aus reicheren Verhältnissen. Dalia war total verdutzt.‘ In Elterngesprächen wurde der Mutter versichert, Dalia gehe es gut. Tanja L. selbst fand keine Freundinnen unter den Müttern der Kita, und das, obwohl sie offen und freundlich ist“ (Iglesias/Wolter-Buhlmann 2019, S. 7).
Als um die Jahreswende 1999/2000 Erzieher/innen in Ost- und Westdeutschland gefragt wurden, welche Wesenseigenschaft sie bei ihren Kita-Kindern mit Armut in Verbindung sähen, antworteten über die Hälfte der Befragten eines Forschungsprojekts in Ost wie West „Asozialität“. Jenseits der Frage, ob diese Be- bzw. Verurteilung der betroffenen Kinder nicht schon stigmatisierenden Charakter hat, verwechselten sie dabei durch eine verhaltenszentrierte Wahrnehmung womöglich Erscheinungsformen und Wesen der problematischen Lebenslage (Frühauf/Zeng 2001, S. 374f.). Hierbei geht es um die konkrete Beobachtung einer Situation, in der ein Kind als „arm“ wahrgenommen wird – und der Interpretation dieser Situation, bei der dem Kind selbst Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, wie „nicht normal“ oder „asozial“ zu sein. Deshalb ist es wichtig, nach der jeweiligen Wahrnehmung von Kinderarmut bzw. deren Erscheinungsformen zu fragen und die eigene Haltung dazu selbstkritisch zu hinterfragen. Die bisherigen Forschungsergebnisse unterstreichen immer wieder, wie wichtig es ist, Armut als mehr