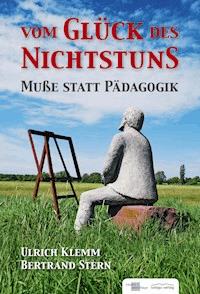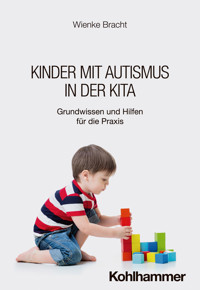
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
InImmer häufiger zeigen Kinder im Kita-Alter Entwicklungsbesonderheiten, auch Autismus-Diagnosen werden früher gestellt. Verhaltensweisen von Kindern im Autismus-Spektrum lösen jedoch oft Unsicherheiten und Stress aus und werden von den Fachkräften als überfordernd erlebt. Nicht selten entstehen angespannte Situationen, unter denen das Kind am meisten leidet. Um autismusspezifische Besonderheiten zu verstehen und Zugang zum Kind zu finden, benötigen Kita-Fachkräfte einen Methodenkoffer. Einen solchen bietet dieses Buch: Praxisnah bereitet es theoretische Grundlagen über Besonderheiten und Sichtweisen von Kindern im Autismus-Spektrum auf, auch der Umgang mit Eltern wird behandelt. Darauf folgen zahlreiche Anregungen für konkrete Unterstützungsmöglichkeiten in der Kita-Praxis, mit denen Fachkräfte Kinder im Autismus-Spektrum in ihrer Entwicklung gezielt fördern und sie auch in schwierigeren Situationen im Kita-Alltag begleiten können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
1 Kurze Einordnung: Was ist Autismus?
1.1 Definition und Hintergründe
1.2 Autismusspezifische Besonderheiten
1.3 Schlussfolgerungen
2 Wie zeigt sich Autismus in der Kita?
2.1 Möglicher Kita-Alltag eines autistischen Kindes
2.2 Warum herausfordernde Verhaltensweisen entstehen, was sie sind und wie man damit umgehen kann
2.3 Hinweise zu Krisen und Krisenmanagement
2.4 Hinweise für sensible Elterngespräche bei einem Verdacht auf Autismus
2.5 Umgang mit Wartezeiten zur Diagnostik und einer intensiven Förderung
3 Praktische Tipps für den Kita-Alltag
3.1 Zugangswege zum Kind finden
3.2 Allgemeine Hinweise für eher schwierige Situationen
3.2.1 Übergang in die Kita (Eingewöhnung)
3.2.2 Morgens ankommen
3.2.3 Essenssituation
3.2.4 Freispiel
3.2.5 Kreisgestaltung
3.2.6 Ausflüge
3.2.7 Sauberkeitserziehung
3.2.8 Schlaf
3.2.9 Wechsel zur Schule
3.2.10 Veränderungen
3.2.11 Rituale und Routinen
3.3 Aufklärung in der Kindertageseinrichtung (Kinder und Eltern)
3.4 Hinweise zur begleitenden Elternberatung
3.5 Umgang mit unterschiedlichen Haltungen von Kolleg:innen oder anderen Fachkräften
3.6 Gezielte Unterstützungsimpulse und Anregungen für Kindertageseinrichtungen nach Fähigkeitsbereichen
3.6.1 Schlüsselkompetenzen
3.6.2 Kommunikation
3.6.3 Wahrnehmung
3.6.4 Emotionale Fähigkeiten
3.6.5 Soziale Fähigkeiten
3.6.6 Anpassungsmöglichkeiten des Umfeldes (Strukturierungen und Visualisierungen)
4 Abschließendes
Literaturverzeichnis
Die Autorin
Wienke Bracht, Heilpädagogin, nach dem Studium zunächst Berufspraxis in der mobilen Frühförderung, darauffolgend in einer integrativen Kindertagesstätte. Seit mehreren Jahren ist sie am Hamburger Autismus Institut tätig und bietet außerdem zu verschiedenen Themen rund um Autismus-Spektrum-Störungen Fortbildungen an.
Wienke Bracht
Kinder mit Autismusin der Kita
Grundwissen und Hilfen für die Praxis
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-044599-4
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-044600-7epub:ISBN 978-3-17-044601-4
1 Kurze Einordnung: Was ist Autismus?
Beginnt man, sich mit Autismus auseinanderzusetzen, oder fällt das Wort Autismus, gibt es womöglich bereits Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt ein sehr bekanntes Sprichwort: »Kennst du einen Autisten, kennst du genau einen Autisten« (von unbekannt). Vielleicht gibt es im privaten Umfeld die eine oder andere Person1, die eine Autismus-Diagnose erhalten hat. Vielleicht ist man im beruflichen Kontext bereits mit Autismus konfrontiert worden und nicht zuletzt prägen auch Medien unsere Vorstellungen. Autismus wird z. B. in Serien und Spielfilmen aufgegriffen und formt so auch das Verständnis, dass man bereits über Autismus entwickelt hat. Da dieses oft einseitig ist und nur bestimmte Aspekte berücksichtigt, wird im nachfolgenden Teil kurz eingeordnet: Was ist Autismus?
1.1 Definition und Hintergründe
Die Diagnose »Autismus« (bzw. Autismus-Spektrum-Störung) wird i. d. R. nicht von Kinderärzt:innen gestellt, sondern der/die Kinderärzt:in kann den Verdacht äußern und eine Überweisung erstellen, mit der die Familie z. B. zu einem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) oder einer/einem Kinder- und Jugendlichenpsychiater:in geht. Hier findet dann eine fundierte Autismus-Diagnostik statt. Häufig beinhaltet dies mehrere Termine, in denen den Eltern2 Fragen zu Verhaltensweisen und zur Entwicklung gestellt werden. In der Regel werden standardisierte Testverfahren angewandt, sodass eine Diagnostik in mehreren Terminen stattfindet. Dabei werden Aufgaben an das Kind gestellt und so autismusbedingte Symptomatiken erfasst und eingeordnet. Die Diagnostik kann ambulant oder auch während eines stationären Aufenthalts stattfinden (je nach Einrichtung und Angebot der Einrichtung). Je nach Einschätzung der Fachkraft werden auch andere Behinderungen oder Störungen z. B. durch Testverfahren ausgeschlossen. Wenn andere Erkrankungen oder Behinderungen ausgeschlossen werden können, beschreibt der/die Diagnostiker:in in einem Bericht die Beobachtungen und erfassten Kompetenzen und vergibt die Diagnose, hält sie also schriftlich fest. Die Eltern erhalten dann i. d. R. einen Diagnostikbericht.
Die Diagnose »Autismus« ist klassifiziert im ICD-10 bzw. ICD-11. ICD steht dabei für International Classification of Diseases. Hier sind alle Diagnosen aufgelistet, die es gibt und vergeben werden können, zusammen mit den Kriterien, die zutreffen müssen, um die Diagnose vergeben zu können. Definiert ist dies von der Weltgesundheitsorganisation und wird nicht nur in Deutschland angewandt. Im ICD wird ein Diagnoseschlüssel festgelegt, der bestimmten Krankheiten und Behinderungen zugeordnet wird. Also auch, wenn man Kopfschmerzen hat und zum/zur Hausärzt:in geht, vergibt diese:r anhand der beschriebenen Symptomatik oder im Zuge seiner/ihrer Untersuchung eine Diagnose mit entsprechendem Diagnoseschlüssel, der dann bspw. auch auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vermerkt ist. Diese Kriterien werden immer wieder überarbeitet, da es neue Entwicklungen gibt oder neue Behinderungen/Krankheiten definiert werden sowie neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Behinderungen/Krankheiten gemacht werden, die eine Überarbeitung notwendig machen.
Auch wenn die Autismus-Diagnose vergeben wird, stellt der/die Diagnostiker:in also eine Diagnose nach ICD-10 bzw. ICD-11. Autismus wird hier unter F84 codiert (im ICD-10). Damit wird Autismus bzw. die Autismus-Spektrum-Störung als sog. tiefgreifende Entwicklungsstörung klassifiziert. Am 01. 01. 2022 trat die aktualisierte Form des ICD in Kraft. In der alten Fassung (ICD-10) wird noch unterteilt in frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus, Asperger-Syndrom. In der neuen Form, dem ICD-11, findet keine Kategorisierung mehr statt, sondern nur noch die Diagnose: Autismus-Spektrum-Störung. Die vorher unterteilten Diagnosen werden also in einem Spektrum zusammengefasst. Es gibt nach Inkrafttreten des ICD-11 eine flexible Übergangszeit, in der sich die Diagnostiker:innen und Mediziner:innen mit den neuen Änderungen auseinandersetzen können. Die konkrete Einführung in den klinischen Alltag in Deutschland ist noch nicht umgesetzt, daher scheint ein grundlegendes Wissen über die früheren Unterscheidungen bzw. die neue Klassifizierung sinnvoll.
Autismus gilt demnach als tiefgreifende Entwicklungsstörung, zeigt sich in der frühen Kindheit und kann nicht geheilt werden. Da die Diagnose aufgrund von Fähigkeiten bzw. Verhaltensweisen gestellt wird, ist eine Diagnostik erst ab einem Alter von ca. anderthalb Jahren möglich. Und auch dann sind sich Fachkräfte oft nicht sicher und stellen ggf. einen »Verdacht auf Autismus« fest. Je nach Fähigkeiten oder auch Anpassungsleistungen (auch des Umfeldes) und trotz verbesserter Diagnostikmöglichkeiten wird die Diagnose teilweise erst recht spät gestellt. Bei vielen Kindern wird es erst später erkannt, wenn bspw. Schwierigkeiten in der weiterführenden Schule auftreten. Manche erhalten die Diagnose erst im Erwachsenenalter und erleben es als Erleichterung, »endlich« eine Erklärung für ihre Schwierigkeiten zu erhalten.
Insgesamt kann man in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Zunahme der Diagnosen bemerken. Zum einen gibt es eine bessere bzw. standardisiertere Diagnostik, also einheitlichere und damit vergleichbarere Möglichkeiten innerhalb der Diagnostik, um auch mögliche andere Diagnosen von Autismus abzugrenzen. Zum anderen gibt es bei den Diagnostiker:innen und Mediziner:innen ein stärkeres Bewusstsein für Autismus. Die Angaben zur Häufigkeit variieren, da es regionale Unterschiede gibt. Man geht davon aus, dass sich ungefähr ein Mensch pro 100 Menschen im Autismus-Spektrum befindet (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2024). Dabei gibt es mehr diagnostizierte Jungen als Mädchen (ca. vier bis fünf Jungen auf ein Mädchen, vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2024). Man geht aber auch davon aus, dass die Dunkelziffer an nicht diagnostizierten Autist:innen recht hoch ist. Beispielsweise entwickeln Mädchen oft Anpassungsstrategien, die dem Umfeld nicht weiter auffallen und die dann auch nicht diagnostiziert werden, obwohl sie vielleicht im Autismus-Spektrum liegen.
Wissenschaftler:innen gehen davon aus, dass es neuronale Besonderheiten gibt, wenn Autismus vorliegt. Dennoch kann noch nicht klar und konkret benannt werden, welche Veränderungen vorliegen, und auch bei den Ursachen einer Autismus-Spektrum-Störung sind einige Faktoren noch unklar und noch nicht konkret erforscht. Man konnte eine gewisse Vererbbarkeit von Autismus feststellen, wobei sich z. B. bei Zwillingen nicht immer zeigt, dass beide betroffen sind (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2024). Es bedarf weiterer Forschung, um die konkreten Ursachen für das Entstehen einer Autismus-Spektrum-Störung zu identifizieren. Allerdings konnte widerlegt werden, dass entgegen früheren Ansichten weder das elterliche Verhalten (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2024) noch Schädigungen von Impfungen (vgl. Dodd, 2007) Ursachen für Autismus sind.
Im Zuge einer Autismus-Diagnostik gilt es, dass die Diagnostiker:innen fundiert abklären müssen, ob andere Gründe für das gezeigte Verhalten existieren. Es muss also in einer sog. Differentialdiagnostik abgeklärt werden, ob auch andere Erkrankungen oder Behinderungen oder Störungen vorliegen können. Wenn es allerdings zu einer Autismus-Diagnose kommt, gilt es weiterhin zu klären, ob neben einer Autismus-Spektrum-Störung auch andere Krankheiten oder Behinderungen vorliegen. Manche Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind bspw. auch von Epilepsie betroffen. Das Wissen darum ist hilfreich, um geeignete Maßnahmen für das Kind zu treffen, und die Fachkräfte3 einer Kindertageseinrichtung4 können sich gezielt schulen, um Sicherheit im Umgang damit zu erlangen.Aber was bedeutet die Diagnose »Autismus« konkret?
1.2 Autismusspezifische Besonderheiten
Der Bundesverband Autismus veröffentlicht folgende Definition:
»Autismus ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man Autismus bzw. Autismus-Spektrum-Störungen auch als Störungen der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion der Kommunikation und des Verhaltensrepertoirs auswirken.«5
Im Kontext von Autismus spricht man häufig von einer autismusspezifischen Reizverarbeitung bzw. einer autismusspezifischen Wahrnehmungsverarbeitung6. Im Zuge des Wahrnehmungsprozesses bekommt das Gehirn – vereinfacht dargestellt – Informationen über die eingehenden Reize, die mit allen Sinnen aufgenommen werden. Das sind die körpernahen Sinne (taktil – fühlen, olfaktorisch – riechen, gustatorisch – schmecken und über die Tiefenwahrnehmung und den Gleichgewichtssinn) und die Fernsinne (auditiv – hören, visuell – sehen) (vgl. Ayres, 2016). Diese Reize und auch Reizkombinationen, also das gleichzeitige Aufnehmen von Reizen auf mehreren Sinneskanälen, werden im Gehirn verarbeitet und bestimmen, wie wir handeln, was wir fühlen und was wir denken. Dieses Zusammenspiel schafft dann ein Bild und ein Verständnis von der Welt. Auch bei kleineren Veränderungen schafft es unser Gehirn, diese Reize so zu verarbeiten, dass wir in einer Situation angemessen handeln und auf bisherige Strategien zurückgreifen können. Wir passen unser Verhalten an und können so auch mit neuen Begebenheiten umgehen. Also besteht die Wahrnehmung ganz grundlegend beschrieben in einer Reizaufnahme, darauf folgt die Weiterleitung des Reizes und schließlich die Verarbeitung. Dabei ist es nötig, dass unser Gehirn Reize filtert. Dies passiert, ohne dass wir uns ständig Gedanken darüber machen müssen, ganz unbewusst. Das Auswählen der für uns gerade wichtigen Reize passiert automatisch und benötigt kaum spürbar Energie.
Autismusspezifische Besonderheiten in der Wahrnehmung
Bei autistischen Menschen geht man davon aus, dass es innerhalb dieses Wahrnehmungsprozesses Schwierigkeiten gibt, der Wahrnehmungsprozess wird gestört. Das bedeutet, dass die unbewusste Selektion und Integration unterschiedlicher, aber zusammengehöriger Reize nicht funktioniert (vgl. Matzies-Köhler, 2015). Das, was in dem Moment wichtig ist und fokussiert werden sollte, geht dann unter. Das kann z. B. bedeuten, dass beim Morgenkreis im Kindergarten nicht nur die Stimme des/der Pädagog:in, der/die den Morgenkreis leitet, wahrgenommen wird, sondern dass ein autistisches Kind alle anderen Hintergrundgeräusche ebenso laut wahrnimmt, also z. B. das Telefon, das im Nebenraum klingelt, die anderen Kinder, die mit Kleidung rascheln usw. Die Aufmerksamkeit des autistischen Kindes richtet sich dann nicht automatisch auf das Geforderte (vgl. Schirmer, 2018). Diese Auswahl, was gerade wichtig ist, muss bewusst getroffen werden. Auch das Zusammenspiel mehrerer Reizsysteme spielt hier eine Rolle, um nötige Informationen für ein eigenes Handeln erlangen zu können.
Mit einer autismusspezifischen Wahrnehmungsverarbeitung zeigen sich dann im konkreten Verhalten Überempfindlichkeiten oder auch Unterempfindlichkeiten in den einzelnen Wahrnehmungsbereichen. Klassische Beispiele für eine Überempfindlichkeit im auditiven Bereich sind Kinder, die in lauten Umgebungen besonders gestresst sind und teilweise auch mit herausfordernden Verhaltensweisen auf die Situation reagieren. Insgesamt kann es die betroffenen Kinder ganz schnell verunsichern, wenn in der Wahrnehmungsverarbeitung eine Störung vorliegt oder die Wahrnehmungsverarbeitung verzögert passiert. Die Informationen, die beim Gehirn von den einzelnen Sinnesorganen ankommen, passen dann z. B. nicht zueinander und erzeugen Unsicherheiten. Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einer Straße. Sie schließen die Augen und hören ein entferntes, aber sich näherndes Motorengeräusch. Sie öffnen die Augen und das Auto ist direkt vor Ihnen, sodass Sie vor Schreck einen Schritt zurücktreten. Wenn man Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitung hat, ergibt sich oft kein passendes Gesamtbild. Das erzeugt Unsicherheit und Chaos und führt zu einem erhöhten Stresserleben. Das Stressniveau von autistischen Menschen ist häufig höher. Zu diesem beschriebenen Grundstress kommen noch andere Stressoren im Laufe eines Alltags dazu. Wenn viele Reize zueinander kommen, die überfordernd wirken, kann es auch zu einem sog. »sensory overload« kommen. Das heißt, dass das Kind dann nicht mehr mit den auf es einprasselnden Reizen adäquat umgehen kann, der Stress ist zu hoch und es ist eine Überforderungssituation. Dann ist eine mögliche Reaktion, dass die Kinder sich zum Selbstschutz ›abschalten‹, also wie abwesend wirken. Es kann auch sein, dass die Kinder selbst laut werden, um bspw. die unangenehmen auditiven Reize zu übertönen und die Kontrolle über den Reiz zu erlangen. Auch hier ist es wieder wichtig, daran zu denken, dass die Reaktionen nicht gleich sind. Manchen Autist:innen fällt es bspw. eher leicht, in einem trubeligen Einkaufsgeschäft zu sein, andere haben mit dieser Situation große Schwierigkeiten. Auch die Tagesform und vorher Erlebtes spielen dabei eine Rolle. Dies macht es häufig nicht leicht, das Verhalten zu verstehen. Auch durch eine mögliche verzögerte Wahrnehmungsverarbeitung können noch Erlebnisse aus der Vergangenheit, die längst vorbei sind, Überforderungssituationen auslösen. Es können aber Handlungsstrategien erarbeitet werden, damit autistische Menschen mit stressigen Situationen entspannter umgehen können.
Die Störung in der Wahrnehmungsverarbeitung hat Auswirkungen auf die Kommunikation, auf die Interaktion und die Verhaltensweisen des Kindes. Diese drei Bereiche werden genau angeschaut, um eine Autismus-Diagnose zu stellen. Die Gesamtzahl der Symptome spielt dann für die Vergabe der Diagnose (nach ICD-10) eine Rolle. Da es sich wie beschrieben um ein Spektrum handelt, gibt es Unterschiede und verschiedene Ausprägungen von autismusspezifischen Besonderheiten. Jeder Mensch (also auch ein Mensch im Autismus-Spektrum) ist individuell und hat somit individuelle Herausforderungen und Stärken, die sich dann auch im Verhalten zeigen können. Beispielsweise gibt es durchaus autistische Kinder, die entgegen einem gängigen Vorurteil Körperkontakt angemessen ertragen können oder sogar als beruhigend empfinden. Das »nicht ertragen können« von Körperkontakt ist nach diesem Verständnis also als ein Verhalten einzuordnen, das (bedingt durch die Autismus-Spektrum-Störung) aus einer möglichen Überempfindlichkeit taktilen Reizen gegenüber resultieren kann.
Im Folgenden werden konkrete Beispiele von Verhaltensweisen genannt, die häufig in Zusammenhang mit einer Autismus-Spektrum-Störung gezeigt werden, um ein Verständnis, aber auch eine Sensibilität im Umgang mit ihnen zu erweitern.
Autismusspezifische Besonderheiten in der Kommunikation
Im Bereich der Kommunikation können unterschiedliche Besonderheiten beobachtet werden. Zum einen kann es eine ungewöhnliche Reaktion auf den Namensruf geben, ein autistisches Kind reagiert also nach Ruf aus der Ferne kaum oder nicht. Auch eine ungewöhnliche Form der Kontaktaufnahme kann beobachtet werden. So können bspw. bei autistischen Kindern auch herausfordernde Verhaltensweisen zur Kontaktaufnahme dienen. Dies kann z. B. sein, wenn die Kinder keine »angemessene« Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zu gleichaltrigen Kindern gelernt haben und einfach nicht wissen, wie sie in den Kontakt treten können. Dazu kann man beobachten, dass autistische Kinder oft auch keine eigeninitiierten Kontaktaufnahmen gestalten und eher für sich spielen, also nicht aktiv auf z. B. Gleichaltrige zugehen.
Eine weitere autismusspezifische Besonderheit kann sein, dass verzögert oder kein sprachlicher Kontakt begonnen wird. Insgesamt können Sprachentwicklungsverzögerungen auftreten. Das Erkennen vom Sinn der Kommunikation kann gestört sein. Nicht-autistische Kinder können z. B. anhand der Reaktionen ihrer Umwelt merken, dass sie sich durch Kommunikation mitteilen können, bspw. Bedürfnisse äußern können. Das intentionale Einsetzen von Kommunikation, um bspw. etwas zu erreichen, wird von manchen autistischen Kindern nicht erkannt. Sie wiederholen einzelne Worte oder Wortphrasen echolalisch. Sie geben dann exakt das wieder, was man ihnen gesagt hat, ohne die Bedeutung nachzuvollziehen.
Auch können nonverbale Kommunikationsformen, also Gestik und Mimik, zu übertrieben oder wenig bis gar nicht eingesetzt werden, um Gesagtes zu unterstreichen. Auch wörtliches Verstehen bzw. die Konzentration auf den Sachinhalt einer Nachricht können beobachtet werden. Weiterhin können Besonderheiten in der Betonung, im Ausdruck, in der Melodik, der Satzstellung usw. beobachtet werden. Das indirekte Mitschwingen von unausgesprochenen sozialen Regeln können autistische Menschen oftmals nicht intuitiv erfassen. Wenn bspw. der Tonfall oder die Stimmlage eine Aufforderung vermitteln, wird diese häufig nicht erkannt. So können Missverständnisse entstehen. Auch entsteht häufig Frust bei autistischen Kindern, wenn sie sich nicht verstanden fühlen bzw. ihre Bedürfnisse nicht entsprechend äußern können (vgl. Lindmeier & Sallat & Ehrenberg, 2023).
Beispiel7: Kommunikation und versteckte Aufforderung
Eine Familie sitzt beim Essen zusammen. Der Vater fragt das Kind: »Kannst du mir bitte das Wasser reichen?« und der Junge antwortet: »Ja.« – ohne eine Handlung auszuführen. Der Junge hat die reine Sachfrage korrekt beantwortet – die indirekt transportierte Aufforderung des Vaters, dass der Junge ihm die Flasche auch reicht, hat er nicht interpretiert. Dies könnte der Vater als Provokation deuten und so entstehen oft Missverständnisse und Frust, weil diese Erfahrungen im alltäglichen Miteinander entstehen.
Autismusspezifische Besonderheiten in der sozialen Interaktion
Ein häufig auffallendes Verhalten im Zusammenhang mit Autismus im Bereich der sozialen Interaktion ist der Augenkontakt bzw. das Blickkontaktverhalten. Dabei wird dieser häufig vermieden oder nicht angemessen gehalten. Auch ein Starren und ein »Nicht-Wissen« um eine angemessene Dosierung des Blickkontakts kann im Zusammenhang mit Autismus beobachtet werden. In sozialen Situationen fallen autistische Kinder auf, weil es ihnen schwerfallen kann, zu teilen, Kompromisse einzugehen oder zu verlieren. Diese gehen über die typischen Schwierigkeiten von nicht-autistischen Kindern hinaus. Es kann wirken, als wüssten sie sich nicht richtig zu verhalten. Sie können teilweise abwesend wirken oder auch ungewöhnlich auf Ärger oder Zuneigung reagieren. Auch der Umgang mit Veränderungen fällt oft schwer. Das können auch vermeintlich kleine Änderungen sein, wie bspw. die neue Frisur einer Bezugsperson, also Veränderungen, die anderen Kindern kaum oder nicht auffallen (vgl. z. B. Mathies-Köhler, 2015).
Im Spielverhalten kann es ebenfalls Auffälligkeiten geben. So wird teilweise nicht fantasievoll im Als-Ob-Spiel oder im Rollenspiel gespielt. Hierzu wieder der Hinweis, dass jeder Mensch mit Autismus individuell zu betrachten ist und manche autistischen Kinder durchaus fantasievoll spielen können. Häufig spielen autistische Kinder für sich, zeigen ein eher einseitiges Interaktionsverhalten und haben eher Schwierigkeiten, mit anderen Kindern zu spielen. Auch die geteilte Aufmerksamkeit bereitet mitunter Schwierigkeiten: Einen Aufmerksamkeitsfokus zwischen bspw. einer Sache und einer Person herzustellen, einen sog. triangulären Blick, kann schwerfallen. Gerade das Fehlen dieser Schlüsselkompetenz hat sehr große Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung eines Kindes. Durch Situationen, in denen das Kind seine Aufmerksamkeit z. B. auf seine Eltern richtet, entstehen eine Vielzahl an Lernsituationen. Wenn diese Situationen aufgrund des Fehlens grundlegender Kompetenzen (Blickkontakt, geteilte Aufmerksamkeit) nicht entstehen, werden Entwicklungschancen nicht erschlossen und Lernmöglichkeiten nicht genutzt. Daher ist ein möglichst frühzeitiges Erkennen der Schwierigkeiten bzw. des Vorliegens einer autismusspezifischen Wahrnehmung besonders wichtig, um entsprechende (Förder-)Angebote zu installieren oder alternative Lernwege zu finden (vgl. Rogers & Davis, 2014).
Beispiel: soziale Interaktion
Ein Junge mit Autismus beschäftigt sich im Freispiel gerne in der Bauecke. Wenn bereits andere Kinder hier spielen, setzt er sich dazu. Er baut häufig dasselbe: einen hohen Turm mit blauen und grünen Bausteinen. Er nimmt sich die Bausteine, die er benötigt – ggf. auch direkt aus der Hand oder vom Gebauten der anderen Kinder. Wenn diese verärgert reagieren, gibt er nicht nach. Wenn andere Kinder ihn nach Bausteinen fragen, gibt er keine ab. Dies führt im Kita-Alltag zu Konflikten und dazu, dass der Junge kaum als Spielpartner aufgesucht wird.
Autismusspezifische Besonderheiten im Bereich Verhalten und Interessen
Autistische Menschen können Stereotypien zeigen. Das sind Bewegungsabfolgen oder auch verbale Äußerungen, die sich wiederholen und gleichbleibend zeigen können. Auch Stimming-Verhalten kann beobachtet werden, etwa mit dem Oberkörper wippen, um sich zu beruhigen, oder Zähneknirschen bei Stress, also durch Verhaltensweisen Anspannung verringern oder sich emotional ausdrücken.
Viele autistische Menschen entwickeln Spezialinteressen. Sie interessieren sich dann für bspw. ein Themengebiet sehr stark, zeigen hier eine hohe Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, beschäftigen sich sehr intensiv und ausführlich mit der Thematik und erlangen so auch ein umfangreiches Wissen darüber. Dies kann sich auch verändern, sodass mit dem Älterwerden andere Themenbereiche fokussiert werden. Autistische Menschen entwickeln darüber hinaus häufig Rituale oder orientieren sich sehr stark an gewohnten Abläufe. Wenn dann eine Änderung stattfindet, kann dies verunsichern und dazu führen, dass das autistische Kind handlungsunfähig wird oder auch herausfordernde Verhaltensweisen zeigt. Auch können autistische Menschen ein sehr starkes oder sehr niedriges Gefahrenbewusstsein haben bzw. zeigen.8
Beispiel: Interesse
Ein Mädchen mit Autismus hat ein großes Interesse an allem, was sich dreht oder sich hin und her bewegt. Gerade mit Kreiseln kann sie sich stundenlang alleine beschäftigen, indem sie den Kreisel dreht, zuschaut, bis er umkippt, den Kreisel wieder dreht usw. Hier zeigt das Mädchen eine hohe Ausdauer. Die Eltern haben diesen Kreisel mehrfach: Wenn er nämlich kaputt oder verloren ist, reagiert das Mädchen verunsichert und zeigt herausfordernde Verhaltensweisen wie schreien.
Im Zusammenhang mit Autismus wird weiterhin häufig von den kognitiven Theorien gesprochen, also von kognitiven Fähigkeiten bzw. Funktionsweisen, die im Zusammenhang mit Autismus eingeschränkt sind, in denen Schwierigkeiten vorliegen können, die sich wiederum auf die beobachtbaren Verhaltensweisen auswirken. Diese beziehen sich auf drei Bereiche: die zentrale Kohärenz, die Theory of Mind und die exekutiven Funktionen. Zur Einordnung werden diese Begriffe bzw. der Zusammenhang zu Autismus daher im Folgenden kurz angerissen.
Zentrale Kohärenz
Die zentrale Kohärenz beschreibt die Fähigkeit, einzelne Reizwahrnehmungen in ein gesamtes Bild zusammenzufassen. Für autistische Menschen ist es bspw. – wie im Zusammenhang der Wahrnehmungsverarbeitung beschrieben – schwierig, Wichtiges und Unwichtiges zu differenzieren. Auch Rückschlüsse zu ziehen oder in Bildern zu denken, kann mit Autismus schwerfallen. Eine schwache zentrale Kohärenz hat auch zur Folge, dass Generalisierungsschwierigkeiten vorliegen können. Das bedeutet, dass einmal Erlerntes nicht unbedingt auf eine neue Situation übertragen werden kann. Ein im häuslichen Umfeld erlerntes Verhalten (z. B. Tisch decken) kann dann bspw. nicht automatisch in einer ähnlichen Situation im Kindergarten gezeigt werden, sondern muss dort ganz neu erlernt werden. Es kann auch das Tisch Decken mit neuem Geschirr schwerfallen, obwohl es bereits beim vorherigen Geschirr geklappt hatte. Eine Stärke in diesem Zusammenhang kann eine eher detailorientierte Wahrnehmung sein, das heißt den Fokus eher auf einzelne Aspekte zu legen und Dinge bzw. Details zu sehen, die andere Menschen nicht bemerken würden.
Theory of Mind
Eine weitere Besonderheit im kognitiven Bereich, die oft im Zusammenhang mit Autismus beschrieben wird, ist die Theory of Mind. Dies beinhaltet, mögliche Gefühlszustände und Bedürfnisse, aber auch Sichtweisen und eventuelle Gedanken eines anderen Menschen erkennen zu können, eventuell auch im Ansatz vorhersehen und damit »angemessen« umgehen zu können. Oft ecken autistische Menschen gerade in sozialen Situationen an, weil ihr Verhalten als »nicht angemessen« oder »seltsam« eingeordnet wird. Soziale Regeln sind oft nicht bekannt. Im Gegensatz zu nicht-autistischen Menschen lernen sie diese nicht intuitiv »ganz automatisch«, sondern müssen unausgesprochene Verhaltensregeln bewusst erlernen, wie z. B. die andere Person ausreden zu lassen oder sich in eine Warteschlange anzustellen. Auch Zwischentöne oder nicht unbedingt rational nachvollziehbare Absichten können nicht sicher erkannt werden. Und auch das eigene Handeln kann nicht immer an die Situation angepasst werden. Die Schwierigkeiten einer schwachen Theory of Mind können dann als Konsequenz haben, dass es insgesamt wenig Orientierung in der sozialen Welt gibt. Gerade, wenn man die Zwischentöne nicht versteht und immer wieder die Erfahrung macht, dass das eigene Handeln aneckt, schafft und vergrößert dies Unsicherheiten. Weiterhin gibt es bei autistischen Kindern häufig die Schwierigkeit, dass sie davon ausgehen, dass andere Personen auf dem gleichen Wissensstand sind wie sie selbst und sie ihr Handeln gar nicht mehr erklären müssen. Dies kann dazu führen, dass die Kinder eigene Bedürfnisse nicht adäquat äußern, da sie davon ausgehen, dass ihr Gegenüber diese schon kennt. Daraus entsteht Frust oder Verzweiflung, wenn sie bspw. vor einem Regal stehen und weinen und nicht nachvollziehen können, warum ihre Bezugspersonen nicht verstehen, dass sie genau das eine Spielzeug haben wollen, was in diesem Regal liegt. Sie wissen dann manchmal nicht, dass (und wie) sie ihre Bedürfnisse mitteilen müssen, weil andere Personen nicht wissen, was sie wollen oder denken. Dies ist auch im Kommunikationsverhalten bemerkbar, weil hier eben der Sinn der Kommunikation manchmal nicht erkannt wird. Diese Schwierigkeiten verursachen dann Missverständnisse. Das kann dazu führen, dass eine ständige Verunsicherung existent ist. Kinder ziehen sich dann auch zurück, weil sie gemerkt haben, dass sie keinen großen Einfluss darauf haben, ob eine Situation gelingt oder nicht. Sie können nicht nachvollziehen, warum es nicht geklappt hat, bspw. mit jemanden in einen Kontakt zu treten. Dies kann auch weiterhin dazu führen, dass ein übermäßiges Misstrauen entsteht oder eine Naivität, weil sich auf das Wort anderer verlassen und nicht mehr hinterfragt wird. Auch können die eingeschränkten Fähigkeiten in der Theory of Mind dazu führen, dass weniger Nachahmung stattfindet. Lernsituationen können so nicht oder weniger umgesetzt werden, was sich wiederum auf die gesamte Entwicklung auswirken kann.
Exekutive Funktionen
Die exekutiven Funktionen ermöglichen es uns, unser Verhalten zu planen und umzusetzen. Auch die Kontrolle und den Umgang mit den eigenen Gefühlen und Emotionen beinhalten die exekutiven Funktionen. Viele Menschen mit Autismus haben beeinträchtigte Fähigkeiten in den Exekutivfunktionen. Es fällt ihnen dann bspw. schwer, ihr Handeln in angemessene Teilschritte zu gliedern. Es können Handlungsblockaden existieren, weil sie nicht wissen, wie sie handeln müssen oder was nächste sinnvolle Teilschritte einer Handlung sind. Auch Schwierigkeiten mit dem Konzept von Zeit können damit einhergehen – also wenig Orientierung über bspw. Ereignisse zu haben, die gestern oder am letzten Wochenende passiert sind. Schwierigkeiten in Situationsübergängen gehen damit oft einher, weil kein übergeordneter Blick vorliegt, um den ganzen Kontext einordnen zu können. Das beinhaltet auch eine begrenzte Flexibilität, z. B., wenn etwas anderes eintritt als erwartet. Der Umgang mit Veränderungen fällt aufgrund der eingeschränkten Fähigkeiten in den exekutiven Funktionen oft schwer. Dies hat auch Auswirkungen auf die Flexibilität im Denken und Handeln. Nicht nur mit unerwarteten Änderungen umzugehen, sondern auch das eigene Denken flexibel zu halten und entsprechend zu handeln, kann schwerfallen. Weiterhin ist es oft schwierig, Impulse zu kontrollieren, was auch mit einer Störung in den Exekutivfunktionen einhergeht. Am Verhalten erkennt man dies, wenn das Kind sehr bedürfnisorientiert handelt und eigene Handlungsimpulse oder Bedürfnisse nur schwer oder nicht aufschieben kann. Auch Wartesituationen können dann eine Herausforderung werden.9
1.3 Schlussfolgerungen
Was bedeutet das jetzt alles? Die Schilderungen über mögliche Verhaltensweisen und Schwierigkeiten sind notwendig, um das Handeln autistischer Menschen verstehen zu können. Aus den Überlegungen kann man weiterhin verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Die erste Schlussfolgerung ist, dass Menschen mit Autismus Bewältigungs- bzw. Anpassungsstrategien entwickeln, um mit ihren autismusspezifischen Besonderheiten in einer übermäßig nicht-autistisch denkenden und wahrnehmenden Welt zurechtzukommen (vgl. Rickert-Bolg, 2017). Es kann sein, dass sich die Kinder vermehrt zurückziehen, weil sie überfordernde Situation vermeiden, und ihre Sicherheit suchen, z. B. durch Rituale oder Stereotypien. Dadurch kommt es aber zu weniger Lernsituationen, weil sie von sich aus weniger oder gar nicht in den Kontakt mit anderen treten und keine Lernsituationen für sich nutzen können. Eine weitere Strategie kann eine möglichst große Anpassung sein. Hier versuchen die Kinder, alles so zu machen, wie es vorgegeben ist. Sie stellen eigene Empfindungen zurück, wollen alles richtig machen. Sie streben nach dem Bestmöglichen, was eigentlich nur misslingen kann. Dieses Misslingen wird dann häufig zurückgeführt auf das eigene Scheitern und führt perspektivisch zu Selbstwertproblemen. Die wiederholte Erfahrung, das eigene Verhalten sei nicht passend, und wiederholtes Scheitern in sozialen Situationen führen dazu, dass man sich ständig hinterfragt und evtl. denkt, man wäre »falsch« oder »etwas stimmt nicht mit einem«. Ein weiteres Verhalten, das viele autistische Kinder entwickeln, um mit den eigenen spezifischen Besonderheiten umzugehen, ist ein starkes oder erhöhtes Kontrollverhalten. Es werden eigene Regeln aufgestellt und Vorgehensweisen festgelegt. So bleibt die Situation für das autistische Kind vorhersehbar und es gibt vermeintlich keine Überraschungen. Dies ist vor allem für Umfeldpersonen belastend, weil die aufgestellten Regeln oft nicht nachvollziehbar oder sehr einengend sind (bspw. immer am Dienstag muss dieser eine Pullover getragen werden, es wird nur eine bestimmte Sorte Nudeln gegessen usw.). Jedoch belasten ein starres Festhalten an eigenen Regeln und eine damit einhergehende Unflexibilität, mit Neuem umzugehen, nicht nur die Bezugspersonen und den gemeinsamen Alltag, sondern schränken auch die autistische Person selbst ein. Alltagsnahe Lernsituationen bleiben aus.
Beispiel: Anpassung
In der Elternberatung berichtete ein Vater von seiner Tochter. Sie gehe jeden Tag gerne in den Kindergarten und beim Abholen berichte der Erzieher immer positiv von den Erlebnissen des Tages. Zuhause jedoch erlebte der Vater i. d. R. ein »ganz anderes« Kind: Es reiche die kleinste Irritation und die Tochter zeige sehr herausforderndes Verhalten wie Schreien oder auch mit dem Kopf gegen die Wand Schlagen. Letzteres belastete die Familie sehr, weil sie die Not des Kindes sahen, aber keine Handlungsidee hatten, wie sie es unterstützen konnten. Der Vater konnte nicht verstehen, dass es im Kindergarten anscheinend keine Schwierigkeiten gab. Gleichzeitig konnte der Erzieher sich ebenfalls kaum vorstellen, dass es zuhause große Schwierigkeiten gab, weil die Anforderungen im Kindergarten sehr gut umgesetzt werden konnten. In einem gemeinsamen Gespräch wurden zunächst Beobachtungen geschildert, um ein beidseitiges Verständnis der jeweiligen Perspektive zu schaffen und zu erweitern. Dann wurden verschiedene Ideen zu den Hintergründen des Verhaltens gesammelt. Gemeinsam wurde überlegt, dass das Kind sog. Masking-Verhalten zeigt: Das Mädchen passt sich sehr stark an, um nicht anzuecken. Im Kindergarten investiert es viel Energie, um sich möglichst angepasst zu verhalten, nicht (unangenehm) aufzufallen oder Konflikte zu verursachen. Die Energiereserven sind zuhause aufgebraucht, sodass selbst kleinste Irritationen dazu führen, dass keine anderen Handlungsmöglichkeiten (mehr) zur Verfügung stehen.