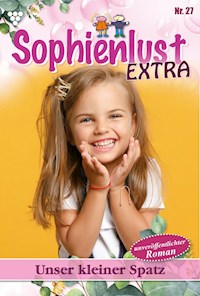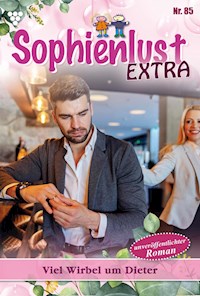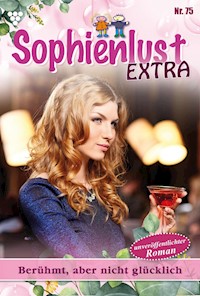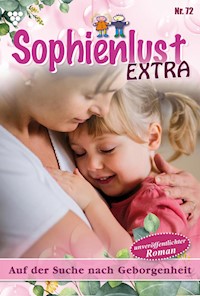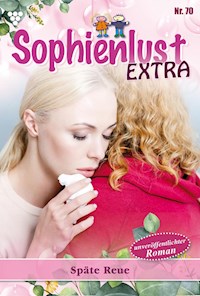Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Extra
- Sprache: Deutsch
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie ist Denise überall im Einsatz. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Doch auf Denise ist Verlass. In der Reihe Sophienlust Extra werden die schönsten Romane dieser wundervollen Erfolgsserie veröffentlicht. Warmherzig, zu Tränen rührend erzählt von der großen Schriftstellerin Patricia Vandenberg. Gaby glättete den Sand in dem Förmchen, drehte die Kuchenform um und presste sie auf die Holzbank, die rund um den Sandkasten lief. Doch der ›Kuchen‹ zerrann auf der Stelle wieder. Der Sand war trocken und klebte nicht zusammen. Gaby schüttelte entrüstet das Köpfchen. Ihre schulterlangen seidigen blonden Locken flogen dabei um ihr schmales Gesichtchen. Nun wischte sie die schmutzigen Finger an dem kornblumenblauen Röckchen ab, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Augen. Auf diesem Röckchen blühten leuchtendrote Mohnblumen und weiße Margeriten, von einer geduldigen Hand gestickt. Die Margeriten nahmen durch den Sand eine leicht gräuliche Tönung an, auch die Mohnblumen blühten jetzt an manchen Stellen in erdbraunen Tönen. Das kleine Mädchen warf die Kuchenformen und die Schaufel in das Plastikeimerchen und stellte alles in einer Ecke des Sandkastens ab. In diesem Moment wurde ein Fenster in einem der gegenüberliegenden Hochhäuser geöffnet, und eine Frauenstimme rief: »Gaby, bist du noch da?« Das kleine Mädchen nickte ernsthaft, hob die Hand und winkte seiner Mutter zu. »Ja!«, rief es zurück. »Aber mir ist schrecklich langweilig, Mutti!« »Ich komm später zu dir runter, Gaby«, versprach die junge Frau. »Ich muss nur noch das Abendbrot richten. Dass du mir aber nicht auf die Straße läufst, hörst du?« »Ja, Mutti«, antwortete Gaby gehorsam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust Extra – 62 –Kinderglück kehrt nie zurück
Wie Gaby und Roland Geschwister wurden
Gert Rothberg
Gaby glättete den Sand in dem Förmchen, drehte die Kuchenform um und presste sie auf die Holzbank, die rund um den Sandkasten lief. Doch der ›Kuchen‹ zerrann auf der Stelle wieder. Der Sand war trocken und klebte nicht zusammen.
Gaby schüttelte entrüstet das Köpfchen. Ihre schulterlangen seidigen blonden Locken flogen dabei um ihr schmales Gesichtchen.
Nun wischte sie die schmutzigen Finger an dem kornblumenblauen Röckchen ab, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Augen.
Auf diesem Röckchen blühten leuchtendrote Mohnblumen und weiße Margeriten, von einer geduldigen Hand gestickt.
Die Margeriten nahmen durch den Sand eine leicht gräuliche Tönung an, auch die Mohnblumen blühten jetzt an manchen Stellen in erdbraunen Tönen.
Das kleine Mädchen warf die Kuchenformen und die Schaufel in das Plastikeimerchen und stellte alles in einer Ecke des Sandkastens ab. In diesem Moment wurde ein Fenster in einem der gegenüberliegenden Hochhäuser geöffnet, und eine Frauenstimme rief: »Gaby, bist du noch da?«
Das kleine Mädchen nickte ernsthaft, hob die Hand und winkte seiner Mutter zu. »Ja!«, rief es zurück. »Aber mir ist schrecklich langweilig, Mutti!«
»Ich komm später zu dir runter, Gaby«, versprach die junge Frau. »Ich muss nur noch das Abendbrot richten. Dass du mir aber nicht auf die Straße läufst, hörst du?«
»Ja, Mutti«, antwortete Gaby gehorsam. Zugleich dachte sie, dass auf der Straße viel mehr los sei als hier auf dem Kinderspielplatz. Im Moment war ihr jedenfalls fürchterlich langweilig.
Gaby wartete, bis ihre Mutter das Küchenfenster wieder geschlossen hatte, dann schlenderte sie wie zufällig in Richtung Straße. Die Wagen brausten an ihr vorbei. Manchmal waren hohe Lastwagen darunter, die bis in den Himmel zu reichen schienen. Wenn es einmal zwischen den Autos eine Lücke gab, sah Gaby, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Hund vor einem Lebensmittelgeschäft angebunden war. Sie liebte Tiere sehr, vor allem Hunde, und hätte den einsamen Dackel auf der anderen Straßenseite gern einmal gestreichelt. Aber die Mutti hatte ihr verboten, den Spielplatz zu verlassen.
Eine Minute lang kämpfte Gaby mit sich. Dann kam sie zu dem Schluss, dass sie es riskieren könne. Sie war schließlich schon drei Jahre alt und wusste genau, wie man es machen musste, wenn man eine Straße überqueren wollte. Zuerst musste man nach links schauen, dann nach rechts. Und dann nichts wie über die Fahrbahn gerannt.
Wohlbehalten kam das kleine Mädchen auf der anderen Seite an. Nun hörte es, dass der Dackel leise vor sich hin winselte, und sah, dass er mit sehnsuchtsvollen Blicken zur Ladentür schaute.
Gaby kauerte sich neben dem Hund auf den Bürgersteig und streichelte vorsichtig das glänzende braune Fell des Dackels. »Du bist doch nicht mehr allein«, versuchte sie ihn zu trösten. »Jetzt bin ich doch bei dir.«
Der Dackel schien Kinder zu mögen. Er schwieg unvermittelt, musterte Gaby aus treuen braunen Augen und leckte ihr mitten übers Gesicht.
Die Kleine lachte laut auf. »Du bist aber ein ulkiger Kerl!«, rief sie. »Meine Mutti hat mich schon gewaschen. Und deine Zunge ist so rau.«
Gaby verstummte und überlegte angestrengt, ob sie es wagen könne, die Leine von dem Fahrradständer zu lösen und ein paar Schritte mit dem Dackel den Bürgersteig entlangzuspazieren. Schließlich entschied sie, dass sie das sicherlich tun dürfte. Sie konnte dabei ja ständig den Ladenausgang beobachten.
Mit geschickten Händen löste sie den Knoten und nahm die Leine in die Hand. In diesem Augenblick trat eine ältere Frau mit scharfen Gesichtszügen und straff nach hinten gekämmten Haaren aus dem Laden heraus auf die Straße. Mit einem Blick hatte sie die Situation erfasst! Sie sah das fremde Mädchen mit der Leine in der Hand, den Dackel, der entzückt an der Kleinen emporsprang und in hohen fiependen Tönen bellte.
Mit zwei Schritten war sie bei Gaby und riss ihr die Leine aus der Hand. »Was fällt dir ein?«, schrie sie dabei mit zornrotem Gesicht. »Noch so klein und stiehlt schon Hunde! Man sollte es einfach nicht für möglich halten.«
Gaby war zuerst sehr blass geworden. Nun brannten ihre Wangen wie im Fieber. »Das ist nicht wahr!«, verteidigte sie sich aufgebracht. »Ich hab den Hund nicht stehlen wollen. Ich hab nur …Ich wollte ein Stück mit ihm laufen. Er hat geweint, und ich war auch so allein.« Sie verstummte und fuhr sich mit der Hand über die Augen, in denen es verdächtig feucht glänzte.
Die fremde Frau warf ihr einen verachtungsvollen Blick zu und nahm ihren Hund auf den Arm. »Tz, die Jugend von heute«, entrüstete sie sich. »Man kann sich leicht vorstellen, wohin das führt. Spätestens in zehn Jahren landest du zum ersten Mal im Gefängnis.« Damit machte sie auf dem Absatz kehrt und stapfte davon.
Gaby hatte keine Ahnung, was das war, ein Gefängnis. Sie verstand nur, dass man ihr nicht erlaubte, mit dem Dackel zu spielen. Dabei mochte sie Tiere doch so sehr. Und der Dackel hätte bestimmt auch gern mit ihr gespielt.
Mit tränenblinden Augen überquerte Gaby abermals die Straße. Diesmal vergaß sie völlig, nach beiden Seiten zu blicken. Aber sie hatte Glück. Ein Autofahrer hatte das Kind im blauen Röckchen rechtzeitig gesehen und das Bremspedal bis zum Boden durchgetreten. Wohlbehalten langte das kleine Mädchen auf der anderen Seite der Fahrbahn an.
Gaby ging zum Spielplatz, holte ihr Eimerchen aus dem Sandkasten und lief auf das hohe Haus zu, in dem sie mit ihren Eltern wohnte. Sie musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um den Klingelknopf zu erreichen. Doch ihre Mutter öffnete ihr sofort die Tür.
Marianne Römer erschrak, als sie das tränenüberströmte Gesicht ihrer kleinen Tochter gewahrte. »Was ist passiert, Gaby?«, rief sie alarmiert und beugte sich hinab zu dem Kind. »Hast du dir wehgetan?«
Gaby schüttelte den Kopf, dass die Haare flogen. »Nein, Mutti! Aber da war eine Frau, die hatte einen Dackel. Und mit dem wollte ich spielen. Aber sie hat mich nicht gelassen. Sie war böse und hat mit mir geschimpft. Sie hat gesagt, ich stehle den Dackel. Aber das stimmt gar nicht. Bloß spielen wollte ich mit ihm. Mutti, warum kann ich keinen Dackel haben? Oder ein Kätzchen? Ach, bitte, Mutti, kauf mir doch ein Tier!«
Das Gesicht der jungen Frau war blass geworden. Sie strich Gaby die blonden Haare aus der heißen Stirn und erklärte mit gepresster Stimme: »Ich hab es dir doch schon so oft erklärt, mein Liebling. Hier im Haus sind keine Tiere erlaubt. Es steht ausdrücklich im Mietvertrag.«
»Dann such doch eine andere Wohnung«, schlug Gaby vor. »Eine mit Garten. Das wär überhaupt viel schöner – ein Garten. Mit ganz vielen Blumen und Tieren drin.«
Mit kaum vernehmlicher Stimme antwortete Marianne: »Ich weiß, mein Liebling, dass ein eigenes Haus viel schöner ist als eine Mietwohnung in einem Hochhaus. Aber so ein Häuschen kostet sehr viel Geld. Das haben wir leider nicht.«
Gaby hatte nachdenklich die Stirn gerunzelt. Nun erkundigte sie sich ernst: »Vati ist doch fort, um Geld zu verdienen, nicht wahr? Du hast es mir doch erzählt, Mutti!«
»Das stimmt, Herzchen. Dein Vati arbeitet als Vertreter und ist ständig unterwegs. Aber sein Verdienst ist leider nicht sehr groß.« Marianne Römer verstummte und dachte, dass sie gern in ihren Beruf zurückkehren und ein wenig Geld dazuverdienen würde. Aber da war Gaby. Sie wollte nicht, dass ihr Kind in einem Kindergarten oder in einem Jugendhort aufwachsen musste. Dazu liebte sie ihr einziges Kind viel zu sehr. Sie wollte sich nicht einmal für ein paar Stunden von Gaby trennen. Deshalb beschied sie sich mit dem, was Friedrich ihr ab und zu in die Hand drückte. Viel Geld war das nicht. Sie verdächtigte ihren Mann bereits seit einiger Zeit, dass er den größten Teil seines Einkommens für andere Dinge ausgebe. Doch sie wagte es nicht, sich auszumalen, wofür das Geld wegging.
»Wann kommt Vati eigentlich wieder heim?«, riss Gaby ihre Mutter aus den trüben Gedanken über ihre Ehe.
»Ich weiß es nicht, Herzchen«, antwortete Marianne wahrheitsgemäß. »Aber nun komm! Dein Abendbrot ist bereits fertig. Nachher geht es in die Badewanne. Du bist ein ganz schöner Dreckspatz. Eigentlich sollte ich dich noch vor dem Essen abduschen.«
»Au ja!«, rief Gaby entzückt. Ihr abendliches Bad liebte sie sehr. Sie nahm ihre sämtlichen Tiere, so weit sie nicht aus Plüsch waren und sofort im Wasser versanken, mit in die Badewanne. Außerdem ein paar Boote, die ihr die Mutter im Laufe der letzten beiden Jahre geschenkt hatte. Jeden Abend fand in der Badewanne eine größere Seeschlacht statt, die Marianne auch diesmal wieder lächelnd verfolgte. Gaby war ihr Ein und Alles, seit Friedrich kaum noch nach Hause kam.
Eine Stunde später saß die junge Frau am Bett ihres Kindes und erkundigte sich: »Welche Geschichte möchtest du denn heute hören?«
»Die vom Schneewittchen und den sieben Zwergen«, kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Gaby hatte das Märchen mindestens schon fünfzigmal gehört, aber ihre Mutter musste es immer wieder erzählen. Insgeheim hoffte Gaby nämlich, selbst einmal einem Zwerg zu begegnen. Leider war ihr dies bis jetzt noch nicht geglückt. Bestimmt kam das daher, dass sie mitten in der Stadt wohnte, wo Tag und Nacht die Autos durch die Straßen fuhren. Zwerge dagegen bevorzugten offensichtlich Wälder und finstere Höhlen. Warum waren ihre Eltern auch ausgerechnet nach Stuttgart gezogen?
Marianne war in ihrer Erzählung gerade bei der Stelle angelangt, als die böse Stiefmutter Schneewittchen von gedungenen Mördern in den Wald führen ließ, da merkte sie an Gabys ruhigen Atemzügen, dass das Kind bereits eingeschlafen war. Schneewittchen und die sieben Zwerge hatten es also doch nicht wachhalten können.
Lächelnd erhob sich die junge Frau, strich ihrem Töchterchen unendlich behutsam über die Stirn und zog die Bettdecke zurecht. Dann verließ sie auf Zehenspitzen das Zimmer und zog die Tür vorsichtig hinter sich ins Schloss.
Draußen lehnte sie sich mit müdem Gesicht gegen die Wand. Wie sollte sie den Rest des Abends verbringen? Sich vor den Fernseher setzen und sich die Schicksale fremder Menschen ansehen, die sie doch nicht berührten, da sie der Erfindung fantasiereicher Autoren entsprangen? Dazu hatte sie keine Lust.
Blieben noch ihre Bücher. Aber selbst darauf konnte sie sich in letzter Zeit nicht mehr konzentrieren. Ihre Gedanken schweiften ständig ab. Immer wieder musste sie an ihren Mann denken. Warum kam er nur noch so selten nach Hause? Hielten ihn tatsächlich nur Geschäfte von Stuttgart fern? Marianne Römer wusste keine Antwort auf all diese quälenden Fragen. Und das machte sie tief unglücklich.
Schließlich entschloss sie sich doch dazu, einen Kriminalroman zu lesen. Vielleicht würde es einer spannenden Handlung gelingen, sie wenigstens für kurze Zeit von ihren trüben Ahnungen abzulenken.
Doch als Marianne auf Seite zwanzig angelangt war, stellte sie fest, dass nichts in ihrem Gedächtnis haften geblieben war. Mit einem leisen Seufzer legte sie das Buch aus der Hand und zündete sich eine Zigarette an. Das Schrillen des Telefons ließ sie zusammenfahren. Sie drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und rannte hinaus auf den Flur.
Nachdem sie mit zitternden Fingern den Hörer abgenommen hatte, sagte sie mit belegter Stimme: »Römer.«
Am anderen Ende meldete sich zunächst niemand. Marianne vernahm jedoch deutlich Stimmengemurmel, das helle Auflachen einer Frauenstimme und im Hintergrund Klaviermusik. Sie dachte sofort an die Geräusche in einer Bar. »Hallo, wer spricht denn?«, rief sie aufgeregt in die Muschel und presste den Hörer fester ans Ohr.
»Frau Römer?«, meldete sich endlich eine rauchig klingende Frauenstimme.
»Ja, am Apparat.« Marianne fühlte, wie ihr das Herz bis in die Kehle klopfte.
»Möchten Sie wissen, wo Ihr Mann ist?«
»Ja, aber«, stammelte Marianne hilflos. »Er ist in Hamburg, so viel ich weiß.«
»Kommen Sie mal in die Lido-Bar«, schlug die Stimme am anderen Ende vor. »Hier in Stuttgart. Ich könnte mir denken, dass Sie da eine kleine Überraschung erleben.«
»Wer sind Sie?«, flüsterte Marianne mit versagender Stimme. »Was wollen Sie von mir?«
Aber sie erhielt keine Antwort mehr. Am anderen Ende war aufgelegt worden.
Eine ganze Weile blieb Marianne reglos mitten im Flur stehen. Sie hielt den Telefonhörer noch immer in der Hand. »Nein«, murmelte sie, »nein, das ist nicht wahr.«
Endlich schien sie zu sich zu kommen. Sie legte den Hörer auf die Gabel zurück und ging ins Wohnzimmer. Dabei dachte sie: Bestimmt hat sich jemand auf meine Kosten einen Scherz erlauben wollen. Vielleicht ging es um eine Wette. Betrunkene kamen ja oft auf die absonderlichsten Ideen. Am besten, sie vergaß das Gespräch gleich wieder.
Marianne schlug den Kriminalroman wieder auf. Aber es gelang ihr einfach nicht, sich auf die Handlung zu konzentrieren.
Kurz entschlossen klappte sie den Roman zu und ging hinüber in ihr Schlafzimmer. Dort zog sie ihr geblümtes Sommerkleid aus und nahm eine schwarze Hose und einen dunklen Rollkragenpullover aus dem Schrank. Rasch schlüpfte sie in diese unauffälligen Kleidungsstücke, band ihre schulterlangen blonden Haare im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammen und verbarg alles unter einem dunklen Kopftuch.
Im Flur nahm sie den Schlüsselbund aus der Handtasche, steckte den Wohnungsschlüssel in die dunkle Hose und öffnete anschließend die Tür zu Gabys Zimmer.
Das kleine Mädchen schlief fest. Erleichtert schloss Marianne Römer die Tür wieder und verließ die Wohnung.
Es war den ganzen Tag über sehr schwül gewesen. Nun fauchte ein heftiger Wind durch die engen Straßen der Innenstadt. Gleich darauf klatschte ein dicker Regentropfen auf Mariannes Handrücken. Doch sie kümmerte sich nicht darum. Atemlos rannte sie weiter. Bis ihr einfiel, dass sie gar nicht wusste, wo die Lido-Bar lag. Zum Glück fand sie in der Nähe eine Telefonzelle. Sie schlug das dicke Nummernverzeichnis auf und suchte nach der Anschrift der Bar. Das Lokal lag ganz in der Nähe.
Marianne verließ die Telefonzelle und rannte weiter. Der Regen war inzwischen heftiger geworden. Donnergrollen war in der Ferne zu hören.
Die Leuchtschrift, mit der die Lido-Bar ihre Kunden anzog, war schon von Weitem zu erkennen: ein leuchtendes Rot, das von einem kräftigen Grün unterstrichen wurde.
Mit klopfendem Herzen zog Marianne die Tür auf.
Ein breitschultriger Mann trat ihr in den Weg. »Sie haben hier nichts zu suchen, wir haben unsere eigenen Damen«, sagte er zu Marianne und musterte sie gleichzeitig von oben bis unten, als wollte er abschätzen, ob er sie unter seine ›Damen‹ einreihen könne.
Marianne achtete gar nicht auf ihn. Mit einer Handbewegung fegte sie ihn beiseite und betrat die eigentliche Bar, die in Dämmerlicht gehüllt war.
Im ersten Moment konnte sie nichts erkennen. Nur die Geräusche, die hier durch den Raum schwirrten, kamen ihr bekannt vor. Leises Stimmengemurmel, dazwischen das helle Lachen einer Frau, im Hintergrund Klaviermusik.
Kein Zweifel, dies war das Lokal, aus dem der Anruf gekommen war. Und nun sah sie auch den Telefonapparat, der auf der hohen Bartheke stand.
Die junge Frau blickte sich suchend in dem kreisrunden Raum um. Gleichzeitig bemerkte sie, dass viele neugierige Blicke auf ihr ruhten. Kein Wunder, mit ihrer Aufmachung passte sie nicht in dieses Lokal, in dem alle anwesenden Frauen tief dekolletierte Kleider trugen, die jedoch zwanzig Zentimeter über dem Knie endeten. Marianne kam sich wie Aschenputtel am Königshof vor. Aber darauf konnte sie jetzt keine Rücksicht nehmen. Sie war hergekommen, um ihren Mann zu suchen.
Endlich entdeckte sie ihn. Er saß an einem der kleinen Tische, die rund um die Tanzfläche standen. Vor ihm stand ein Sektkübel, in seinem Glas perlte das teure Getränk. Doch er saß nicht allein an diesem Tisch. In seiner Begleitung befand sich eine junge Dame, die Marianne noch nie zuvor gesehen hatte. Das Mädchen mochte etwa zwanzig Jahre alt sein und hatte silberblonde Haare, die ihm fast bis zur Taille reichten, und zweifellos unecht waren. Das Kleid der jungen Dame schimmerte ebenfalls silbrig und war so kurz, dass es fast wie ein Badeanzug wirkte. Ihre Hand lag auf der von Friedrich. Ihre stark geschminkten Augen hingen anbetend an seinem Gesicht.
Beinahe automatisch registrierte Marianne, dass ihr Mann sehr schlecht aussah. Unter seinen Augen lagen violette Schatten, als habe er seit vielen Tagen keinen Schlaf mehr gefunden. Auf seinen Wangenknochen brannte eine hektische Röte, zu beiden Seiten des Mundes lagen tiefe Falten.
Friedrich Römer war erst fünfunddreißig Jahre alt, aber jeder hätte ihn an diesem Abend auf fünfzig Jahre geschätzt. Nun beugte er sich vor, nahm die Hand des Mädchens in die seine und küsste zärtlich jede einzelne Fingerspitze. Anschließend erhob er sich ein wenig von seinem Stuhl und küsste das Mädchen mitten auf den Mund, ohne sich um die übrigen Gäste zu kümmern.
Marianne hatte genug gesehen. Sie machte auf dem Absatz kehrt und rannte aus dem Lokal.
Draußen regnete es unterdessen heftig. Marianne trat in Pfützen, sodass das Wasser hoch aufspritzte, doch sie bemerkte es nicht. Sie sah nur immer wieder ihren Mann vor sich, in dem dunklen Anzug, den sie erst vor einem halben Jahr gemeinsam gekauft hatten, die Augen verliebt auf das Mädchen vor ihm gerichtet.
Wer mochte sie nur vorhin angerufen haben?, überlegte Marianne, während sie weiterrannte. Vielleicht eine der Bardamen, die Friedrichs Namen kannte? Oder das Mädchen mit den silberblonden Haaren selbst? Vielleicht wollte es, dass sie endlich die Wahrheit erfuhr und sich scheiden ließ?
Ein heftiger Donnerschlag ließ Marianne erschreckt zusammenfahren. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie nass war bis auf die Haut. Aus ihren Haaren lief das Wasser wie Tränen über ihr Gesicht. Marianne leckte über ihre Lippen. Das Wasser darauf schmeckte salzig. Schmeckte Regenwasser salzig? Bestimmt nicht! Es mussten also Tränen sein, die über ihr Gesicht rannen.
Endlich war Marianne vor dem Hochhaus angelangt. Mit zitternden Fingern tastete sie nach dem Wohnungsschlüssel in ihrer Hose und schloss die Haustür auf. Kurz darauf öffnete sie die Tür zu ihrer Wohnung. Sekundenlang blieb sie im Flur stehen und lauschte. In Gabys Zimmer rührte sich nichts. Bestimmt schlief ihr Töchterchen tief und fest.
Auf Zehenspitzen ging Marianne ins Bad und zog die nassen Kleider aus. Anschließend frottierte sie ihre langen blonden Haare. Dabei warf sie einen Blick in den Spiegel.
In ihren blauen Augen stand noch immer das Entsetzen über die Entdeckung, die sie vor Kurzem gemacht hatte. Ihre Pupillen wirkten riesig, die blaue Iris war kaum noch zu sehen.