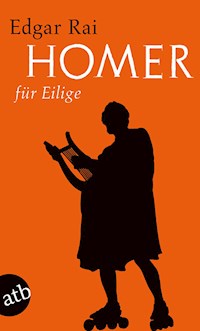10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wie ein Teller Spaghetti: Dieses Buch macht einfach glücklich Noah verbringt die Ferien bei seiner verrückten Oma Violetta in Venedig. Jeden Morgen um sieben klingelt dort der Wecker, denn Oma Violetta war zwar mal eine berühmte Opernsängerin, aber das ist lange her und jetzt hat sie einen kleinen Kiosk. Ein Ort, an dem alle aus der Nachbarschaft zusammenkommen, miteinander quatschen, tratschen und lachen. Nicht im Traum hätte Noah gedacht, dass er diesen Platz so sehr ins Herz schließen würde. Aber vor allem hat er nicht geahnt, welche Abenteuer ihn in Venedig noch erwarten. Und das hat nicht nur mit Ombretta, dem geheimnisvollen Mädchen aus dem Hotel nebenan, zu tun …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Edgar Rai
Kiosk, Chaos, Canal Grande
Mit Illustrationen von Katharina Grossmann-Hensel
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Kapitel 1
Plötzlich steht Aysun neben mir. Das Flugzeug fliegt gerade eine Kurve und liegt schräg in der Luft.
Sie deutet zum Fenster: »Schau mal.«
Erst sehe ich nur Blau, aber dann erkenne ich kleine Punkte in dem Blau und mir wird klar, dass es das Meer ist und die Punkte Schiffe sind. Die Anzeige über meinem Sitz fängt an zu leuchten.
»Landeanflug«, sagt Aysun und lächelt. »Du musst dich anschnallen.«
Ich taste nach dem Gurt und merke, dass ich mich zwischendurch gar nicht abgeschnallt habe.
»Brauchst du noch was?«, fragt sie.
»Nein, danke.«
Weil ich erst elf bin und außerdem alleine fliege, sitze ich in der ersten Reihe. Der Sitz neben mir ist frei. Auf den setzt sich Aysun jetzt und schnallt sich an. Aysun ist meine Flugbegleiterin.
»Wer holt dich denn am Flughafen ab?«
»Meine Oma.«
Sie zwinkert mir zu. »Und die ist so schlimm?«, fragt sie. Dabei hab ich gar nichts gesagt.
Oma war mal zu Besuch, an Weihnachten. Da war ich noch ziemlich klein. Sie hatte weiße Handschuhe, die sie sogar in der Wohnung getragen hat, und ihre Lippen waren so krass geschminkt, dass man woanders gar nicht hinsehen konnte. Bevor ich meine Geschenke auspacken durfte, hat sie sich vor den Baum gestellt und so laut und so hoch gesungen, dass ich dachte, in meinem Kopf geht was kaputt. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich sie gesehen habe, jedenfalls kann ich mich an ein anderes Mal nicht erinnern.
Ich sehe zu Aysun und verdrehe die Augen. »Sie war mal Opernsängerin«, sage ich und ziehe dabei das O in die Länge.
Aysun zuckt mit der Nase, zeigt ihre Schneidezähne und formt ihre Finger zu Krallen. »Meine muss mal eine Wühlmaus gewesen sein. Steckt in alles ihre Nase rein.«
Wir lachen, und für einen Moment denke ich, dass es das irgendwie leichter macht, wenn man weiß, dass sogar Erwachsene noch blöde Omas haben können. Dann setzt das Flugzeug auf der Landebahn auf.
Als wir aus dem Sicherheitsbereich kommen, sind da lauter Leute, die auf irgendwen warten, aber Oma erkenne ich trotzdem sofort, weil sie ganz vorne steht und aussieht wie ein Tischfeuerwerk. Sie hat dieselben ultrarot geschminkten Lippen wie damals.
»Ist sie das?«, flüstert Aysun.
»Ja.«
»Verstehe.«
Oma muss etwas unterschreiben, dann beugt Aysun sich zu mir runter und sagt: »Mach’s gut. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem Rückflug. Würde mich freuen.«
Oma Violetta tritt einen Schritt zurück und fixiert mich. »Du bist also der Noah«, sagt sie, und weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich nichts.
Sie hat rot gefärbte Haare und türkis lackierte Nägel. Außerdem trägt sie jede Menge Ringe, an einem Finger gleich drei. Plötzlich greift ihre Hand nach meinem Kinn und dreht meinen Kopf nach oben. Ihre Ringe bohren sich in meinen Kiefer.
»Ein bisschen männlicher hab ich mir dich ja schon vorgestellt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Andiamo!«
Sie lässt mein Kinn los, wendet sich ab und stöckelt voran. In dem Moment weiß ich: Das wird der schlimmste Sommer meines Lebens.
Kapitel 2
Der Grund, weshalb ich in den Sommerferien zu Oma Violetta muss, ist, weil Mama und Papa sich sortieren wollen. So hat Mama das genannt: Wir müssen uns jetzt erst einmal sortieren. Ich glaube ja, dass sie mit »sortieren« eigentlich »trennen« meint, nur dass sie es nicht aussprechen will. Sie haben sich, bevor ich abgeflogen bin, gestritten. Und wie! Ich hab sie bis in mein Zimmer gehört, sogar Papa. Das machen sie sonst nie. Sonst schweigen sie immer nur, und das kann ich dann auch bis in mein Zimmer hören.
Eigentlich wollten wir zusammen Urlaub machen, also Papa, Mama und ich, im Allgäu. Da waren wir letztes Jahr und das war echt cool, weil die da ein Waldschwimmbad haben, mit Riesenrutsche und Strudel. Aber dieses Jahr ist alles anders, weil Mama eine neue Arbeit angeboten bekommen hat. Sie hat gesagt, der Job sei eine Riesenchance für sie. Als könnte sie da was gewinnen. Sie soll Pressesprecherin werden bei irgendeinem Minister in Berlin. Sie hat mir auch erklärt, was sie da machen würde, nämlich dass sie den Leuten von der Zeitung und vom Fernsehen sagt, was der Minister entschieden hat. Als könnte der das nicht selber. Auf jeden Fall will sie unbedingt diesen Job, aber Papa ist dagegen, weil er sich dann »alleine um alles kümmern müsste«. Mit »alles« bin vor allem ich gemeint.
Mama war so genervt, dass ich jedes Wort verstehen konnte. »Was glaubst du, wie oft die mir so einen Job anbieten?«, schimpfte sie.
»Noah ist zehn«, antwortete Papa.
»Er ist elf, Jakob. Elf! Und hör auf, unseren Sohn zu instrumentalisieren, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Wenn dir so ein Angebot gemacht wird, wie ich es gerade bekommen habe, und du es ablehnst, dann wirst du kein zweites Mal gefragt.«
Papa sagte entweder nichts, oder er sagte es so leise, dass ich es nicht hören konnte.
»Es wäre auch finanziell gesehen eine enorme Entlastung«, meinte Mama nach einer Weile.
Da rief Papa: »Es geht also mal wieder nur ums Geld!«
»Tut es nicht. Aber es geht auch ums Geld.«
»Ist es etwa meine Schuld, dass die Leute nur noch chinesischen Plastikmist für ihre Kinder wollen?«
»Nein. Aber meine ist es auch nicht.« Auf einmal klang Mama ziemlich müde. Diese Diskussion hatten sie nicht zum ersten Mal. »Vielleicht wäre es hilfreich, wenn du dir nach zehn Jahren endlich eingestehen könntest, dass dein Businessmodell nicht aufgegangen ist.«
Mit Businessmodell meinte sie, dass Papa in seiner Werkstatt Holzspielzeug baut und das dann auf Märkten verkauft und in zwei kleinen Läden in Frankfurt.
Bis dahin hatte ich in meinem Zimmer gesessen und gezeichnet. Rennende Pferde. Die wurden aber alle nichts. Rennende Pferde sind so schon schwer zu zeichnen, aber wenn du dabei noch deinen Eltern zuhören musst, wie die sich streiten, kannst du es vergessen.
Ich riss das Blatt aus meinem Skizzenblock, zerknüllte es und ging in den Flur.
»Auf diese Chance warte ich seit Jahren«, hörte ich Mama im Wohnzimmer rufen.
»Du wartest also seit Jahren auf die Chance, von hier wegzukommen, ja?«, rief Papa zurück.
Ich blieb stehen und überlegte, was ich machen sollte. Für drei Sekunden oder so war es, als wäre der Strom ausgefallen. Dann zog ich die Tür auf und im selben Moment sagte Mama: »Vielleicht tue ich das wirklich.«
Zum Flughafen fuhr Mama mich dann alleine. Ich glaube, Papa wäre gerne mitgekommen, aber Mama und er waren wie zwei Magneten, die sich gegenseitig abstoßen. Als könnte das Auto nicht losfahren, wenn beide drinsitzen. Zum Abschied hielt er eine Schachtel in der Hand, eingepackt in Geschenkpapier und mit einer Schleife drum.
»Ich hab noch was für dich.«
»Der Koffer platzt doch so schon aus allen Nähten«, meinte Mama.
Papa sah sie an und ich dachte nur: Jetzt hat sie etwas in ihm kaputt gemacht.
»Das passt noch ins Handgepäck«, entschied er, zog den Reißverschluss von meinem Rucksack auf und stopfte das Päckchen hinein.
»Lasst ihr euch jetzt scheiden?«, fragte ich auf dem Weg zum Flughafen.
Mama fuhr gerade von der Autobahn ab. »Jetzt nicht, okay, Noah? Jetzt nicht.«
Also sagte ich nichts mehr und blickte in den Himmel. Da waren lauter Kondensstreifen, kreuz und quer, wie Krickelkrakel. Manche hatten sich schon fast wieder aufgelöst, andere waren noch ganz frisch. Ich mag kein Krickelkrakel. Oma Violetta, dachte ich. Die schicken mich echt zu Oma Violetta.
Plötzlich sagte Mama doch noch was: »Ist nicht leicht für Jakob im Moment, weißt du?«
»Meinst du sein Businessmodell?«
»Das auch.«
»Was denn noch?«
»Mein Jobangebot. Dass ich etwas habe, das mich nach vorne schauen lässt.«
»Soll das heißen, dass Papa nur nach hinten schaut?«
Sie sah mich kurz an, und da wusste ich, dass es tatsächlich das war, was sie dachte. Dass Papa nur nach hinten schaut.
»Jedenfalls«, sagte sie, »ist es im Moment nicht einfach für ihn.«
»Das hast du gerade schon gesagt.«
Wir fuhren eine Kurve, die gar nicht mehr aufhörte und mich gegen die Tür drückte, und dann kam plötzlich das Flughafengebäude auf uns zu. Wir fuhren auf einen Parkplatz.
»Na, bist du aufgeregt?« Mama wollte so klingen, als müsste ich mich freuen.
Ich sah mir weiter die Kondensstreifen an. »Warum können wir nicht einfach zusammen nach Berlin ziehen?«
Mama pustete die Luft aus, als könnte sie so meine Frage vertreiben.
»Mama?«
»Hm?«
»Warum können wir nicht einfach zusammen nach Berlin ziehen?«
»Weil das so einfach nicht geht. Aber dir das jetzt zu erklären wäre etwas kompliziert, fürchte ich.«
»Wäre es nicht«, sagte ich. »In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Du willst nicht, dass wir zusammen nach Berlin ziehen.«
»Das stimmt so nicht. Es ist komplizierter als das, glaub mir.« Bevor wir ausstiegen, sagte sie noch: »Die meisten Menschen würden dich darum beneiden, einen ganzen Sommer in Venedig verbringen zu dürfen.«
»Dann fahr du doch.«
Kapitel 3
Oma und ich verlassen die Ankunftshalle des Flughafens und gehen den längsten Gang hinunter, den ich je gesehen habe. Eigentlich gibt es Laufbänder, aber die werden gerade repariert. Ich komme kaum hinterher, obwohl die Absätze von Omas Schuhen so hoch sind, dass sie aussehen wie Mäuserutschen. Aber Oma hat auch keinen schweren Rucksack auf und muss keinen Rollkoffer hinter sich herziehen, bei dem außerdem eine Rolle klemmt. Mir ist gleichzeitig heiß und kalt. Mit uns laufen ganz schön viele Menschen in die gleiche Richtung, Omas Absätze höre ich trotzdem. Mama hat solche Schuhe gar nicht.
Oma sagt die ganze Zeit über nichts, und umdrehen und nachsehen, ob ich noch da bin, tut sie sich auch nicht. Am liebsten, denke ich, würde sie vor mir weglaufen. Irgendwann quetschen wir uns in einen Aufzug, fahren nach unten, und als wir aussteigen, sind wir im Freien. Erst jetzt merke ich, wie heiß es ist.
Wir sind übrigens nicht auf einem Parkplatz oder an einer Bushaltestelle, sondern auf einem Pier, an dem lauter Boote liegen. Es herrscht ein ziemliches Gedränge.
»Fahren wir mit dem Boot?«, frage ich.
»Wolltest du etwa schwimmen?«, fragt Oma zurück und zieht mich aus der Menge. Sie blickt zu einem der größeren gelben Boote, vor dem sich eine Schlange bildet. Dann entscheidet sie: »Wir nehmen ein Taxi. Auf der Fähre fühlt man sich ja wie in einer Sardinenbüchse.«
Sie geht zum Ende des Piers, wo zwei Boote liegen, die zwar kleiner sind als die Fähren, dafür aber aussehen wie aus einem alten James-Bond-Film. Oma redet mit einem der Fahrer und wedelt mit ihren Armen herum. Schließlich ruft sie »Va bene!«, lässt sich vom Fahrer eine Hand reichen und steigt ins Boot. Der Fahrer nimmt mir meinen Koffer ab, dann steige ich ebenfalls ins Boot. Kaum habe ich mich zu Oma auf die gepolsterte Bank gesetzt, fängt der Motor an zu gluckern und wir fahren rückwärts aus der Anlegestelle.
Zuerst fahren wir ganz gemütlich durch eine Art Kanal, in einer Reihe mit den anderen Booten, aber als dann plötzlich Platz da ist, dreht der Fahrer voll auf. Das Heck des Bootes schiebt sich ins Wasser und Oma muss sich den Sonnenhut auf den Kopf drücken, damit er nicht wegfliegt.
Als wir die Fähre überholen, ruft sie: »Na bitte!«
Mir wird ein bisschen schlecht, weil der Bug immer wieder ziemlich hart auf dem Wasser aufschlägt, aber es ist auch toll, weil wir echt schnell sind und sich die Sonne auf dem Wasser spiegelt, dass es mir in den Augen wehtut. Und dann, erst nur klein und als dunklen Umriss, sehe ich eine Stadt, die auf dem Wasser schwimmt.
Für einen Moment vergesse ich tatsächlich, wie blöd es ist, dass ich den Sommer über zu Oma muss, vergesse Mama und Papa und dass wir nicht gemeinsam in Urlaub fahren können. Stattdessen hole ich mein Smartphone aus dem Rucksack und filme, wie die Stadt langsam auf uns zukommt.
»Immer wieder ein erhebender Anblick«, ruft Oma, »auch wenn man es schon hundertmal erlebt hat!«
Erst als wir fast an der Kaimauer sind, bremst das Boot ab und der Bug taucht wieder ins Wasser. Wir tuckern unter einer Brücke durch und dann sind wir in der Stadt, und rechts und links gibt es nur Häuser, keine Bürgersteige oder so. Die Häuser stehen tatsächlich im Wasser, und was bei uns Straßen sind, sind hier kleine Kanäle. Die Häuser sind total schön, aber viele sehen aus, als müssten sie dringend renoviert werden. Dann fällt mir auf, dass sie genau deshalb so schön aussehen. Weil man merkt, wie alt sie sind.
Es ist enger, als ich es mir vorgestellt habe. Als uns ein Boot entgegenkommt, müssen wir ausweichen, und wenn ich meinen Arm ausstrecken würde, könnte ich die Hauswand berühren. Wir fahren unter einer niedrigen Brücke durch und biegen in einen Minikanal ab, der so schmal ist, dass die Fassaden nur ganz oben noch ein bisschen Sonne abkriegen. Oma redet mit dem Fahrer, dann halten wir an einem kleinen Vorsprung, der gerade so breit ist, dass zwei Füße nebeneinanderpassen. Der Fahrer legt ein Seil um einen aus dem Wasser ragenden Pfahl. Der Vorsprung hat ein Geländer, das man an einer Stelle hochklappen kann. Das macht Oma jetzt.
Sie dreht sich zu mir um: »Worauf wartest du?«
Kapitel 4
Ich weiß nicht, warum, aber ich habe gedacht, Oma Violetta würde in einem Palast oder so wohnen, jedenfalls irgendwas Großes, wo sie umhergeht wie auf einer Bühne. In Wirklichkeit ist ihre Wohnung noch kleiner als unsere in Glashütten, und die ist schon nicht besonders.
Zuerst steigen wir eine verwinkelte Treppe in den ersten Stock hoch, dann schließt Oma eine Tür auf und wir stehen in einem winzigen, dunklen Flur mit drei Türen. Hinter der einen ist das Bad, das genauso winzig ist wie der Flur, hinter der zweiten sind noch einmal vier Stufen, die in die Küche führen. Die ist niedriger als das Bad, dafür gibt es ein Fenster, zum Kanal hin, und davor einen Tisch, an den sich sogar zwei Leute setzen könnten, allerdings gibt es nur einen Stuhl, was irgendwie traurig aussieht, als würde Oma da immer nur alleine sitzen.
Hinter der dritten Tür ist das Wohnzimmer, und wenn man da reingeht, kommt man sich vor wie in dem Antiquitätenladen in Bad Soden, in dem ich mal mit Mama war. Nur dass es in dem Antiquitätenladen besser gerochen hat. In der linken Wand ist eine Schiebetür und hinter der ist Omas Schlafzimmer. Omas Bett sieht aus, als hätte mal eine Königin darin geschlafen, außerdem hat sie ungefähr eine Million Kleider und Schuhe, und deshalb ist Omas Schlafzimmer genauso voll wie der Rest der Wohnung. Es gibt nirgends einen Platz für meinen Koffer. Und für mich auch nicht.
»Stell erst mal dahin«, sagt Oma und fuchtelt in Richtung Fenster, und weil ich nicht weiß, was sie meint, schiebe ich den Koffer unter den Flügel.
Während Oma in ihrem Schlafzimmer herumwirbelt und sich, wie sie sagt, etwas Bequemes anzieht, stehe ich blöd im Wohnzimmer herum und merke, wie müde ich bin und dass ich Hunger habe und Durst und mir die Füße wehtun.
Auf dem Boden liegen drei Teppiche, und weil eigentlich nur Platz für einen ist, überlappen sie sich, was ich nicht mag. Es gibt einen Schrank mit Glastüren, einen Tisch, einen Schreibtisch und ein Sofa, und alles sieht so aus, als dürfte man es nicht anfassen. Aber vor allem gibt es einen schwarzen Flügel, der halb so groß ist wie das Zimmer und um den sich alles andere herumdrücken muss. Von den Wänden kann man eigentlich gar nichts sehen, weil sie vollgehängt sind mit Engeln, Bildern, Spiegeln und einer Uhr mit Pendel. Neben dem Schrank mit den Glastüren steht eine Säule mit einem Frauenkopf drauf, und weil dahinter ein Spiegel hängt, kann man den Kopf von vorne und hinten gleichzeitig sehen.
»Wo schlafe ich denn?«, frage ich.
Die Schiebetür fährt zur Seite. Oma kommt aus dem Schlafzimmer und hat irgendein Gewand an, das kein bisschen bequem aussieht.
»Hm.« Sie blickt sich um.
Das gibt’s doch nicht, denke ich. Die weiß genau, dass ich komme, und hat sich noch nicht einmal überlegt, wo ich schlafen soll?
»Ich sehe nicht, dass du woanders schlafen könntest als auf dem Sofa«, entscheidet sie.
Vorsichtig setze ich mich aufs Sofa. Das Ding federt wie ein Trampolin.
»Kann ich was essen?«, frage ich.
»Von mir aus.« Oma geht in den Flur, dann höre ich ihre Schritte auf der Treppe zur Küche. »Aber viel hab ich nicht da!«, ruft sie.
In der ersten Nacht schlafe ich gar nicht. Ich komme mir vor wie ein Eindringling. Oma wäre es auf jeden Fall lieber, ich wäre nicht gekommen, so viel ist mal klar. Und die Sachen in ihrer Wohnung scheinen mich auch nicht zu wollen. Zumindest nicht der Frauenkopf auf der Säule. Der starrt mich die ganze Zeit nur an und sieht in dem bisschen Licht, das aus der Gasse hereindringt, echt gruselig aus.