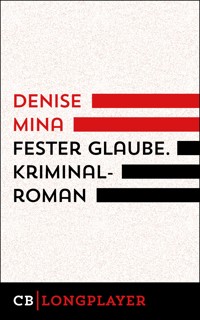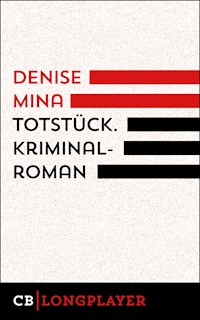14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anna McDonald liebt ihre Töchter, erduldet ihren lokalpatriotischen Ehemann und hält sich ansonsten unterm Radar. Doch eines Morgens stellen zwei Dinge ihren Alltag auf den Kopf. Erstens stößt sie in einem neuen True-Crime-Podcast auf eine vertraute ¬Gestalt aus ihrer Vergangenheit, was böse Erinnerungen wachruft und die Story mit ihr verknüpft. Dabei ist der Podcast schon gruselig genug: Es geht um ein versunkenes Schiff und eine getötete Familie, von einem Fluch ist die Rede … Zweitens brennt ihr Mann mit ihrer besten Freundin Estelle durch – und nimmt ihre beiden Töchter mit. Benommen hockt Anna in den Scherben ihres Lebens, bis Fin Cohen, ein anorektischer Popstar und der Mann von Estelle, sie aus ihrer Lethargie reißt. Woraufhin Anna und Fin zusammen auf Phantomjagd gehen. Denn Anna muss unbedingt erfahren, wie eine junge Londoner Podcasterin auf ihre alte Erzfeindin Gretchen Teigler gestoßen ist. Und was die aktuell im Schilde führt. »Eine radikal moderne Erzählung über sexuelles und ¬finanzielles ¬Raubtierverhalten und Soziale Medien: Schlüssig und mitreißend entfalten sich parallel zur Handlung Geheimnisse der ¬Vergangenheit, bis sie gefährlich mit der Gegenwart ¬kollidieren.« The Guardian »Ein Thriller, der oft fast Hitchcock-artig mit Paranoia spielt, mit Zweifel, Identitäten, Sexualität und Nerven¬kitzel, und der mit finsteren Zugfahrten und beißendem Witz gleich durch mehrere Länder vagabundiert. Dies ist ein Roman über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Es geht um die öffentlichen Sphären des ständigen Gebrülls und die seltsame Privatsphäre der Ohrhörer. Es geht ums Auffallen und Verstecktsein. Es geht um die Macht des Zuhörens und die Macht des Sich-Äußerns. Es geht um das Selfie und das angeknackste Selbst. Klare Sache ist eins dieser raren perfekten Bücher …« The Scotsman »Mit das Genialste an diesem Krimi ist, dass er den alten Satz bekräftigt, den ein Weiser einst sagte – ›Die Wahrheit wird euch befreien‹ –, und das mittels Erzählen umsetzt.« The Scotsman
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2019
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der englischen Originalausgabe
Conviction
2019 by Denise Mina
Das Motto am Anfang stammt aus: Steven Pinker: Gewalt.
Eine neue Geschichte der Menschheit. FISCHER E-Books,
Kindle-Positionen 2819–2821
Printausgabe: © Argument Verlag 2019
Übersetzerin: Zoë Beck
Lektorat: Else Laudan
Covergestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: August 2019
ISBN 978-3-95988-143-2
Über das Buch
Anna McDonald führt in Glasgow ein unauffälliges Leben. Ihre Leidenschaft sind True-Crime-Podcasts. Eintauchen in eine Parallelwelt voller Rätsel und ungelöster Verbrechen … Ihr neuer Podcast klingt besonders verheißungsvoll: ›Der Tod und die Dana‹. Ein versunkenes Schiff, ein uralter Fluch, Explosion und Mord. Was will man mehr? Aber auf Anna wartet eine böse Überraschung.
Über die Autorin
Denise Mina, Jahrgang 1966, brach nach einer rastlosen Kindheit in Glasgow, Paris, London, Invergordon, Bergen und Perth die Schule ab, jobbte halbherzig in einer Fleischfabrik, in Bars, als Köchin und als Krankenpflegehelferin, qualifizierte sich per Abendschule fürs Jurastudium an der Universität Glasgow. Statt danach wie geplant in Kriminologie und Strafrecht zu promovieren, begann sie Kriminalliteratur zu schreiben. 2014 aufgenommen in die Crime Writers’ Association Hall of Fame. Sie hat 13 Romane publiziert, außerdem verfasst sie Shortstorys, Bühnenstücke, Graphic Novels und macht TV- und Radiosendungen. Denise Mina lebt in Glasgow.
Denise Mina
Klare Sache
Kriminalroman
[Ein Dogma] besagt, Gewalt werde durch einen Mangel an Moral- und Gerechtigkeitsgefühl verursacht. Im Gegenteil: Sehr oft ist ein übertriebenes Moral- und Gerechtigkeitsgefühl die Ursache, oder zumindest wird es vom Täter so wahrgenommen.
Steven Pinker:
Vorbemerkung von Else Laudan
Ein Krimi, ein Schauerroman, ein Roadmovie, ein Märchen, ein hochmoderner Überwachungsthriller. Die schottische Meistererzählerin Denise Mina greift tief in die Schatzkiste populärer Narrative, lässt es funkeln und blitzen. Aus traditionsreichen Zutaten, Fantasie und scharf geschliffenem Realismus kreiert sie einen wilden Ritt durch die historische und aktuelle Literaturküche, lässt Porzellan gegen Stahl scheppern, kombiniert Petits Fours mit dampfendem Haggis und Nouvelle Cuisine, tischt ein gewagt unterhaltsames Menu Surprise auf.
Typisch Mina, wie hinter dem Kleinen stets das Große durchscheint, hinter dem Privaten das Gesellschaftliche: Privilegien, Dünkel, Vorurteile, Imponiergehabe, alltägliche Gewalt, Siegerrecht. Die oft sarkastische, hyperpräzise Beobachterin erfasst ganz nebenbei mit knappen Chiffres, wie und wo wir alle wider besseres Wissen Spiele mitspielen, Kompromisse eingehen, den Blick abwenden auch von dem, was uns angeht. Aber Denise Mina belehrt uns niemals, sie erzählt »nur« eine Geschichte. Eine bei aller Rasanz escheresk angelegte Geschichte, die aus etlichen ineinandergreifenden Storys besteht, und jede davon ist so süffig wie subtil aufgeladen mit Wahrheiten über unsere Welt.
Für mich ist das Erzählen die wahre Heldin dieses Romans. Das Erzählen wird bedroht, entführt, missbraucht, verunglimpft, glorifiziert, vereinnahmt, totgesagt, neu erfunden, angeprangert, rehabilitiert. Das Erzählen wechselt die Gestalt, die Ebene, entzieht sich und taucht wieder auf. Das Erzählen überlebt – und triumphiert.
Prolog
Sagt einfach die Wahrheit. Das habe ich auch meinen Kindern eingetrichtert. Wie lächerlich, Kindern so etwas beizubringen. Niemand will sie hören. Es muss einen Grund dafür geben, die Wahrheit zu sagen. Ich habe vor einiger Zeit damit aufgehört, und ich muss sagen, es war großartig. Die beste Entscheidung meines Lebens. Immer wieder lügen, sich einen Namen ausdenken, eine Vorgeschichte, eigene Vorlieben und Abneigungen, einfach ein Lügenmärchen stricken. Das ist so viel vernünftiger. Aber ich verrate Ihnen die Wahrheit, hier in diesem Buch. Dafür gibt es einen sehr guten Grund.
Ich habe mein Leben ruiniert, indem ich die Wahrheit sagte. Ich war noch sehr jung. Meine Mutter war gerade gestorben. Abends versammelten sich Männer in meinem Garten und schleuderten wüste Beschimpfungen gegen mein Haus, weil ich nicht lügen wollte. Alle verbreiteten sich darüber, was mit mir nicht stimmte, was Leuten wie mir fehlte. Jemand nagelte eine Katze an meine Haustür. Ein Mann brach bei mir ein und versuchte mich zu töten, damit ich endlich den Mund hielt.
Also hielt ich den Mund und lief weg. Ich änderte meinen Namen. Ich wurde verschlossen und vorsichtig und schottete diesen Teil meines Lebens ab. Ich sprach nie wieder darüber. Wenn die Rede auf etwas kam, das diese Geschichte auch nur am Rande berührte – Hausbrände, Gretchen Teigler, Fußball –, ging ich aufs Klo oder wechselte das Thema. Ich hatte nicht das Gefühl zu lügen, ich war einfach nicht mehr Sophie Bukaran. Ich war Anna McDonald, und das alles hatte nichts mit mir zu tun. Ich fühlte mich sicher.
Wenn man müde ist und jung und verängstigt und einen die ganze Welt hasst, dann ist es ein Luxus, den Mund zu halten.
Aber jetzt erzähle ich diese Geschichte wieder. Warum schreibe ich ein ganzes Buch darüber, das Sie dann lesen können? Was hat sich geändert? Ich würde es nicht machen, wenn an jenem Morgen nicht mein Leben implodiert wäre. Ich bin keine Heldin. Ich bin keine vor Zivilcourage strotzende Whistleblowerin, die sich lieber bis ins Grab verfolgen als mundtot machen lässt. Ich sage aus einem ganz anderen Grund die Wahrheit. Er ist weniger löblich, aber vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer. Und: Es ist die Wahrheit.
1
Der Tag, an dem mir mein Leben um die Ohren flog, fing gut an.
Es war früh an einem Novembermorgen, und ich wachte ohne Wecker auf. Das gefiel mir. Es war ein Zugeständnis an unsere Paartherapie: Ich störte Hamish nicht morgens um sechs mit meinem Wecker, und er spielte nicht den ganzen Abend auf seinem Handy Candy Crush und ignorierte die Kinder.
Ich freute mich auf meinen Tag. Auf meinem Handy erwartete mich ein neuer True-Crime-Podcast, über den ich schon viel Gutes gehört hatte. Ich wollte mir den ersten Teil anhören und in die Geschichte hineinschnuppern, bevor ich die Kinder für die Schule weckte, und mir dann später das Ganze gönnen, während ich mich durch die öden Pflichten des Tages ackerte. Ein guter Podcast kann so ziemlich alles zum glorreichen Mehrere-Welten-Erlebnis aufwerten. Ich habe mal einer assyrischen Invasion getrotzt, während ich Sachen aus der Reinigung holte. Ich erlebte, wie einem bestialischen Mörder Gerechtigkeit widerfuhr, während ich Unterhosen kaufte.
Ich lag im Bett und genoss die Vorfreude, während ich zusah, wie das Licht von der Straße über die Zimmerdecke kroch, und darauf lauschte, wie die Heizung ansprang und diese vornehme alte Dame von einem Haus ächzte und die Knochen knacken ließ. Ich stand auf, zog Pullover und Hausschuhe an und stahl mich aus dem Schlafzimmer.
Ich liebte es, vor allen anderen aufzustehen, wenn es im Haus ruhig war und ich lesen oder in einer stillstehenden Welt einen Podcast hören konnte. Ich wusste, wo alle waren. Ich wusste, sie waren in Sicherheit. Ich konnte mich entspannen.
Hamish störte sich daran. Er fand es gruselig. Warum brauchte ich diese Zeit für mich allein, in der ich durchs Haus schlich? Warum musste ich so viel allein sein?
Die Paartherapeutin nannte das Vertrauensprobleme.
Ich versuchte, Hamish zu beruhigen. Ich habe nicht vor, dich zu ermorden oder so etwas. Aber das war offenbar nicht gerade beruhigend. Eigentlich könnte das für Hamish sogar recht feindselig klingen, Anna, wenn man es mal aus seiner Sicht betrachtet. Wirklich? (Ich ließ es feindselig klingen.) Klingt das tatsächlich feindselig? Dann sprachen wir eine Weile darüber. Es war ein dämlicher Vorgang. Beide waren wir feindselig und traurig. Unsere Beziehung befand sich längst im Todeskampf.
Ich schlich auf Zehenspitzen über den Flur, mied die am lautesten knarrenden Dielen und sah nach den beiden Mädchen. Sie schliefen tief und fest in ihren Bettchen, die Schuluniformen lagen auf den Stühlen bereit, Socken steckten in den Schuhen, Krawatten unter den Krägen. Ich wünschte, ich hätte etwas länger verweilt. Ich sollte sie nie mehr so unschuldig zu Gesicht bekommen.
Ich ging zurück in den Flur. Ein Geländer aus Eichenholz schlängelte sich sanft vom obersten Stockwerk bis nach ganz unten. Es war so geschnitzt, dass es sich in die gewölbte Hand fügte, in der Berührung rau, und es folgte den Windungen der Treppe wie eine große, lange Schlange aus gelbem Marzipan. Es führte hinab in eine prachtvolle Diele mit Marmorsäulen, die die Haustür flankierten, und einem Bodenmosaik, das das Wappen von Hamishs Vorfahren zeigte. Das Haus war 1869 von Hamishs Urgroßvater gekauft worden. Er kaufte es neu von Greek Thomson, dem Architekten.
Hamish war sehr stolz auf seinen familiären Hintergrund. Er wusste gar nichts über meinen. Das muss ich betonen. Ich sage es nicht nur, um ihn zu schützen, jetzt, da alles herausgekommen ist. Er war ein langjähriges Mitglied der Anwaltskammer und hoffte darauf, wie seine Vorfahren ein Richteramt zu bekommen. Er hätte das nicht aufs Spiel gesetzt, nur um mit mir zusammen zu sein.
Als ich ihn kennenlernte, war ich Anna, die neue Aushilfe aus Irgendwo-bei-Aberdeen. Ich suchte mir Hamish sehr sorgfältig aus. Ich liebte ihn wirklich, das muss ich sagen, und ich tu es noch immer, manchmal. Aber ich suchte mir bewusst einen älteren Mann mit Geld und Status. Einen pomphaften Mann voller Fakten und Meinungen. Er war das perfekte Versteck.
Hamish war in diesem Haus geboren und hatte nie woanders gelebt. Seine Familie war seit zweihundert Jahren im oder für das schottische Gerichtswesen tätig. Er verreiste nicht gern ins Ausland. Er las nur schottische Autoren. Das erschien mir sehr seltsam. Ich glaube, ich fand es ein wenig exotisch.
An jenem Morgen war es kalt im Flur. Ich ging in die weiß schimmernde, nach deutschem Design gefertigte Küche und kochte eine Kanne starken Kaffee. Ich nahm mein Handy. Der True-Crime-Podcast hieß Der Tod und die Dana. In der Beschreibung stand: »Eine versunkene Jacht, an Bord eine ermordete Familie, ein bis heute ungelöstes Rätsel …«
Oh ja: gewichtiger Tonfall, Geheimnisse, Morde, dieser Podcast hatte alles. Und der Fall hatte sich ereignet, als meine Töchter noch klein waren, in der Zeit der kleinen Strickpullis und der Warterei vor der Schule, schweigendes Herumstehen in der zeitlosen Phalanx von Müttern, fern von der großen weiten Welt. Ich wusste nichts über diesen Mordfall.
Ich goss mir einen großen Kaffee ein, setzte mich hin, legte mein Handy vor mich auf den Küchentisch und klickte auf Start. Ich erwartete eine fesselnde Story, bei der es ums Ganze ging.
Ich hatte keine Ahnung, dass ich Leon Parker wiedertreffen würde.
2 Episode 1: Der Tod und die Dana
Hi.
Mein Name ist Trina Keany, Redakteurin hier beim MisoNetwork. Herzlich willkommen zum Podcast Der Tod und die Dana.
Laut der französischen Polizei ist dieser mysteriöse und verstörende Fall abgeschlossen. Sie haben ihn aufgeklärt. Amila Fabricase wurde wegen Mordes an drei Mitgliedern derselben Familie verurteilt. Aber Amila Fabricase kann es nicht getan haben: Die Morde konnten nur von jemandem an Bord begangen werden, und etliche Zeugen, Überwachungskameras und Passkontrollen belegen, dass Amila zur Tatzeit in einem Flugzeug nach Lyon saß.
An dem fraglichen Abend aß eine wohlhabende Familie – ein Vater und seine beiden Kinder – an Bord ihrer angedockten Privatjacht, der Dana, zu Abend. Die Crew war auf Drängen des Vaters an Land geschickt worden, und die Familie blieb unter sich.
Während Amila sich in der Luft befand, verließ das Schiff in der Dunkelheit den Hafen. Segel wurden nicht gesetzt. Funk und Navigationslichter blieben ausgeschaltet. Trotzdem navigierte die Dana durch die heiklen Sandbänke der bretonischen Meerenge, änderte den Kurs um zweiunddreißig Grad und fuhr auf den Atlantik hinaus. Nach einigen Meilen auf offener See kam es zu einer Explosion im Rumpf, und das Schiff sank. Alle drei an Bord befindlichen Personen kamen ums Leben.
Wie also konnte das geschehen? Warum waren die Behörden so wild entschlossen, etwas zu glauben, das nachweislich nicht stimmte? Und warum wurde nie Einspruch gegen die Verurteilung eingelegt?
Noch bevor sie unterging, hatte die Dana bereits den Ruf, auf ihr laste ein Fluch. Abergläubische Kommentatoren sahen in ihrem Untergang den Beweis dafür. Einen Monat später schienen bizarre Unterwasseraufnahmen des Wracks die Spukgeschichten über rachsüchtige Geister an Bord zu bestätigen.
Trina Keanys Südlondoner Akzent war weich, ihr Timbre tief, die Betonung melodisch. Ich legte die Beine auf dem Stuhl neben mir hoch und nippte von dem köstlichen Kaffee.
Aber fangen wir ganz von vorn an und setzen erst einmal den Rahmen.
Die Île de Ré ist ein schicker Ferienort vor der französischen Westküste. Sie hat eine skurrile Vorgeschichte. Die lange, flache Insel ist im Grunde eine Sandbank zwischen La Rochelle und dem Golf von Biskaya. In der Vergangenheit war die Insel meist vom Festland abgeschnitten und sehr arm. Die Wirtschaft hing an der Salzernte und Gefangenentransporten. Von Saint-Martin, der Hauptstadt der Insel, wurden französische Gefangene in die Strafkolonien von Neukaledonien und Guayana gebracht. Dreyfus fuhr von Saint-Martin aus zur Teufelsinsel. Der Autor von Papillon, Henri Charrière, verließ die Insel 1931 in einem Gefangenenschiff.
Weil sie arm und abgeschnitten war, blieb die Insel unerschlossen. Sie behielt ihre alten kopfsteingepflasterten Straßen, die hübschen sonnengebleichten Häuschen mit den Terrakottadächern und den pastellgrün oder blau gestrichenen Türen und Fensterläden. Hohe, rosafarbene Malven explodieren im Sommer auf den Bürgersteigen. Die Insel gehört zum UNESCO-Welterbe. Aber die Bevölkerung ist heute sehr wohlhabend, und das liegt an der Brücke.
In den späten 1980ern wurde mit großem finanziellem Aufwand eine lange Straßenbrücke gebaut, um die Insel mit La Rochelle zu verbinden. Französische Urlauber entdeckten nach und nach das unverdorbene Eiland. Es wurde zu einem moderaten Ferienort, unaufdringlich und vergleichsweise bescheiden. Das Klima ist angenehm, so sonnig wie der Süden Frankreichs, aber durch die Atlantikbrise, die die Hitze abmildert, kühler. Die Insel ist flach. Überall gibt es Fahrradwege.
Während der nächsten zwei Jahrzehnte verlangte es mehr und mehr Menschen nach einfachem Leben in idyllischer Umgebung. Kinostars, Musiker, ehemalige Präsidenten und Industrielle zogen dorthin. Es begann ein erbitterter Wettbewerb um Immobilien. Selbst schlichte Häuser wurden erst teuer, dann unerschwinglich. Die Hütten armer Fischer stehen leer, nur gelegentlich bewohnt von Luxustouristen, die am Jachthafen im Stadtzentrum anlegen. Die Läden verkaufen kein Pferdefleisch mehr und auch keine Haushaltswaren, sie verkaufen Gucci und Chanel. Die Insel atmet Reichtum.
Manche Einheimischen haben sich gewehrt. Es wurden Ferienhäuser niedergebrannt. Zugezogene berichteten von Schikane und massiven Vorurteilen. Eine Familie aus Neuseeland behauptet, man habe sie von der Insel gejagt. Aber meistens ist es friedlich.
Als die Dana an jenem Tag in Saint-Martin anlegte, weilten dort viele Hobbysegler, die sie erkannten und bewunderten. Sie war ein wunderschönes Schiff.
Die Dana war keine Privatjacht von der Sorte, an die wir heute spontan denken: Sie hatte keine Plasmabildschirme oder Hubschrauberlandeplätze, keine vier Stockwerke mit weißen Sofas und Minibars. Sie war ein Segelschiff, ein Schoner. Schoner sind berüchtigt. In früheren Zeiten liebten Piraten und Kaperer Schoner wegen ihrer Schnelligkeit. Sie haben hohe Segel und einen gewölbten Bug, der tief im Wasser liegt wie der Pistolengurt eines schmalhüftigen Cowboys.
Die Dana war also schön, und sie war berühmt. Nachdem sie das Prädikat »die Jacht mit dem größten Fluch auf See« erhalten hatte, wurde in den 1970ern ein Spielfilm über sie gedreht, ganz in der Tradition von Amityville Horror. Wie dieser und andere Horrorstreifen aus jener Zeit wirkt Der Fluch der Dana heute auf uns knarzig, war aber damals sehr erfolgreich, wie auch das Buch, auf dem er beruhte. Die Verrufenheit des Schiffs begleitete es fortan und sorgte für neugierigen Rummel, wo es auch anlegte.
An jenem Nachmittag legte die Jacht in Saint-Martin an, wurde an Bug und Heck vertäut, und ein Landesteg wurde ausgefahren.
Man sah ein ungleiches Paar sich dem Schiff nähern. Die junge Frau war schlank, gebräunt, blond und wirkte sehr italienisch. Sie trug ein ärmelloses, knöchellanges Kleid von Missoni und Sandalen. Ihr Begleiter war ein schlaksiger Teenager in ausgebeulten kurzen Hosen, Skateschuhen und einem übergroßen T-Shirt. Ein Augenzeuge dachte sogar, der Junge wäre ein Horrorfan, der das Glück hatte, unerwartet über die Dana zu stolpern, weil auf seinem T-Shirt ein Motiv des Kult-Horrorfilms Drag Me to Hell prangte. Der Zeuge erinnerte sich, noch gedacht zu haben, der Junge müsse hocherfreut darüber sein, das berühmte Schiff zu sehen. Er war überrascht, als ein Mann mit demselben Haar und demselben Gesicht, ganz offensichtlich der Vater, dem Jungen von der Jacht aus zuwinkte. Er fragte sich: Hatte der Vater die Jacht gekauft, um dem Jungen eine Freude zu machen, oder trug der Junge das T-Shirt, um den Vater zu erfreuen? Das blieb ihm im Kopf.
Ich war ganz entspannt, hatte die Füße nun auf den Tisch gelegt und trank so starken Kaffee, dass ich etwas ins Schwitzen kam. Meine Gedanken schweiften ab zu dem Tag, der vor mir lag, aber dann sagte Keany:
Tatsächlich handelte es sich bei den ungleichen jungen Leuten um Geschwister, die ihren Vater Leon Parker besuchten, den neuen Besitzer der Jacht.
Erschrocken setzte ich mich auf. Ich musste mich verhört haben. Ich war noch nicht ganz wach, es war früh am Morgen. Mein verschlafener Verstand musste mir einen Streich gespielt haben, so dass ich Leons Namen zu hören glaubte. Ich hatte jahrelang nicht mehr an ihn gedacht und war verblüfft, dass mir sein Name jetzt begegnete.
Er hatte seine beiden Kinder nach Saint-Martin auf die Dana eingeladen. Sie wollten den einundzwanzigsten Geburtstag der älteren Tochter Violetta feiern. Die Kinder kannten sich kaum. Sie lebten in unterschiedlichen Ländern und hatten unterschiedliche Mütter. Leon hatte vor kurzem wieder geheiratet und versuchte nun, aus den Scherben seiner Vergangenheit eine Familie zu schmieden, was möglicherweise auf Drängen seiner neuen Frau geschah. Es war eine deutliche Abweichung von seinem bisherigen Verhalten.
Er gedachte ihnen an Bord seiner Jacht ein Festmahl auszurichten und seiner Tochter zur Volljährigkeit ein traumhaft schönes antikes Diamantcollier zu schenken.
Ich saß kerzengerade in der kalten morgendlichen Küche und wollte es immer noch nicht wahrhaben, bestimmt hatte ich den Namen falsch verstanden, aber zugleich schlug mein Herz immer schneller. Es war, als wüsste mein Blut schon, dass er es war, bevor mein Verstand es fassen konnte.
Als der Landesteg befestigt war, stürmte eine junge Frau vom Schiff. Sie hatte eine Reisetasche dabei, hielt eine Hand über ihr rechtes Auge, und der Kapitän brüllte etwas hinter ihr her.
Das war Amila Fabricase, die Schiffsköchin.
Amila verließ das Schiff schnell und mit einem lauten Klong Klong Klong auf dem Metallsteg. Der Lärm zog die Blicke mehrerer Zeugen auf sich. Sie drängte sich durch die Menge, rannte quer durch den Ort und blieb nur stehen, um einen Kellner in einem Café zu fragen, wo sie ein Taxi zum Flughafen bekommen könnte. Als er sie später beschrieb, sagte er, sie habe sich die Hand über ein Auge gehalten, ihr Gesicht sei aschfahl gewesen, sie habe gezittert, Tränen seien über die verdeckte Gesichtshälfte gelaufen und vom Kinn getropft. Der Kellner brachte sie dazu, sich hinzusetzen, und rief ihr ein Taxi. Sie schien große Schmerzen zu haben, er dachte, ihr Auge sei verletzt, und fragte sie, ob er es sich einmal ansehen solle, aber das wollte sie nicht. Er half ihr ins Taxi, das sie zum Flughafen bringen sollte, und sie bedankte sich bei ihm.
Der Kapitän der Dana schäumte vor Wut. Die Familie hatte sich zu einem Festmahl versammelt, aber die Köchin war fort. Er rief bei der Agentur an, die Amila vermittelt hatte, und forderte Ersatz an, aber es war Hochsaison, und niemand stand zur Verfügung. Er hinterließ zornige Nachrichten auf Amilas Handy und bestand darauf, dass sie ihren Lohn zurückzahlte: Alle Crewmitglieder waren zu Beginn der Reise bar bezahlt worden. Das ist eine sehr unübliche Verfahrensweise, und es ließ den Kapitän schlecht dastehen. Amila hatte ihr gesamtes Geld mitgenommen. Sie rief ihn nicht zurück.
Die beiden jungen Leute sahen Amila aufbrechen, sahen den Kapitän schimpfen, aber dann kam ihr Vater über den Landesteg. Sie umarmten sich und machten sich zu dritt auf zu einem Spaziergang, während der Kapitän vor Wut schäumte und das Abendessen organisierte.
Sie schlenderten durch den Ort und tranken in einer Kaffeebar Bier und Fanta. Die Barbesitzerin erinnerte sich, dass Leon rauchte und viel redete und dass sie alle gemeinsam lachten, aber auch angespannt wirkten.
Auf der Dana suchte der Kapitän noch nach einer Lösung für das Festmahl. Les Copains, ein Restaurant im Ort mit Michelin-Stern, fand sich bereit, eine Bouillabaisse zu liefern sowie Brot, Charcuterie als Vorspeise, Käseplatte und Salat. Bouillabaisse ist eine Fischsuppe. Wie bei vielen ländlichen Gerichten handelte es sich ursprünglich um eine einfache Speise, jetzt allerdings muss sich strengstens an das Rezept gehalten werden. Der Fischeintopf, der die Grundlage bildet, ist mit frisch gekochten Miesmuscheln, Langusten und Knoblauchbrot zu garnieren, was alles erst unmittelbar vor dem Servieren hinzugefügt gehört. Das wurde später noch wichtig für die Rekonstruktion des Ablaufs der Ereignisse. Das Restaurant wollte einen Souschef an Bord lassen, um die Bouillabaisse tadellos anzurichten, aber der Kapitän lehnte das ab. Leon Parker wollte die Jacht an diesem Abend für sich. Keinem Souschef war es erlaubt zu bleiben. Leon wollte, dass sie allein waren.
Les Copains schämte sich entsetzlich wegen der unsachgemäß servierten Bouillabaisse, deshalb verging eine Woche, ehe man zugab, dass man schon vor dem Kredenzen der Suppe gegangen war.
Das Abendessen wurde vom Les Copains auf die Dana geliefert und in der Kombüse vorbereitet, die zum Auftragen bereite Bouillabaisse in einem Warmhaltetopf, die Garnierung auf einem Extrateller daneben. Der Käse war auf einer Platte angerichtet, ebenso die Charcuterie. Die Crew deckte den Tisch in dem luxuriösen Speiseraum unter Deck. Leon hatte noch keine Gelegenheit gehabt, ihn zu benutzen, und war ganz erpicht darauf, ihn zur Geltung zu bringen. Eine Magnumflasche Champagner lag an Deck auf Eis, wie von Leon angewiesen. Die Crew wartete auf die Rückkehr der Familie.
Als sie sahen, wie die Parkers am Kai entlang auf das Schiff zukamen, stellten sich Kapitän und Crew in einer Reihe auf, um sie willkommen zu heißen. Leon ging als Letzter an Bord. Er gab dem Kapitän ein paar hundert Euro und wies ihn an, die Crew in eine Bar mitzunehmen und sich ein wichtiges Fußballspiel anzusehen, Frankreich gegen Deutschland im Europacup-Halbfinale. Sie sollten nicht vor elf zurückkommen.
Der Kapitän tat, was man ihm sagte. Er ging mit seinen Leuten in eine nahegelegene Bar, und sie sahen sich das gesamte Spiel an. Frankreich gewann und kam ins Finale, Deutschland schied aus. Die französische Crew hatte einen prima Abend. Sie gingen noch eine Pizza essen, bevor sie sich um zehn nach elf wieder am Hafenkai einfanden.
Aber die Dana war weg. Kein Mitglied der Familie Parker wurde je wieder lebend gesehen.
Es gab keinerlei Funkverkehr von Bord aus, aber Gäste eines nahegelegenen Dachrestaurants beobachteten Folgendes: Sonnenuntergang war gegen halb zehn. Man sah eine Person an Bord, möglicherweise Violetta, aber es war dunkel. Der Motor der Dana wurde angeworfen, und das Schiff fuhr hinaus auf die offene See.
Als die Marsstenge am Dachrestaurant vorbeiglitt, etwa siebzig Meter entfernt, klatschten die Zuschauer spontan Beifall. Aber die Gäste mit Segelerfahrung merkten, dass etwas nicht stimmte.
Die Navigationslichter auf dem Schiff waren aus.
Diese Lichter müssen ständig eingeschaltet sein, wenn ein Schiff in Bewegung ist: ein Licht am Hauptmast, eins vorn und eins hinten, und farbige Lichter an den Seiten – rot an Backbord, grün an Steuerbord, damit die anderen Boote wissen, in welche Richtung das Schiff fährt.
Zwei der Gäste waren so beunruhigt, dass sie die Küstenwache anriefen, um zu melden, dass etwas mit der Dana nicht in Ordnung war. Jemand hatte ohne Positionslichter abgelegt. Es war von einem inkompetenten Segler auszugehen, der entweder keine Erfahrung hatte oder die Vorschriften nicht kannte. Die Küstenwache versuchte, Kontakt mit der Jacht aufzunehmen, aber der Seefunk war ausgeschaltet.
Die Dana fuhr direkt auf den Atlantik hinaus und querte dabei eine große Schifffahrtsstraße. Ohne Funk ist das gefährlich, weil moderne Containerschiffe riesig sind und blind fahren. Sie müssen sich auf Funkkontakt verlassen, um kleinere Schiffe zu warnen.
Wundersamerweise kreuzte die Dana die Schifffahrtsstraße, ohne dass etwas passierte, aber jetzt meldete die Küstenwache sie über Funk als Sicherheitsrisiko.
Das weckte die Aufmerksamkeit anderer Schiffe.
Ein Containerschiff in der Nähe stellte ein Crewmitglied ab, um die Dana im Auge zu behalten, bis die Küstenwache eintraf. Sehr viel später, nachdem Amila bereits wegen Mordes verurteilt worden war, interviewte man dieses Crewmitglied für eine Dokumentation. Er beschrieb, was er gesehen hatte.
Der Klang veränderte sich, wurde qualitativ besser und hatte das trockene Ambiente eines Studios. Der Mann sprach perfekt Englisch mit starkem niederländischem Akzent.
»Ja, wir haben sie mehrfach angefunkt, aber es kam keine Antwort. Ich sollte auf der Brücke bleiben und Wache halten, bis die Küstenwache kam. Es war eine klare Nacht, ich hatte ein Fernglas. Ich konnte die Umrisse sehen, wir näherten uns, aber da war niemand an Bord. Also, na gut. Das war schon eine merkwürdige … ähm … Situation. Die Lichter waren aus, sogar am Masttopp, aber der Motor lief weiter. Ich konnte die Abgase sehen, und das Schiff fuhr geradeaus. Vielleicht ein Stromausfall? Ich weiß es nicht. Aber während ich noch hinsah, ist diese Jacht auf einmal gesunken wie ein Stein.
Ich sah zu, wie sie einfach so unterging. Sie krängte nicht. Es ging alles sehr schnell, das Meer schwappte über das Deck, dann eine kleine Rauchwolke, als der Motor unter Wasser sank, die See verschluckte die Marsstenge, dann war das Wasser wieder ruhig. Sie ging einfach unter, und weg war sie.
Es war verrückt. Wir lachten alle. Wir wussten ja nicht, dass da eine Familie an Bord war. Wir dachten, da hat jemand die Jacht versenkt, um Versicherung zu kassieren, und er hat es richtig schlecht gemacht, so dass es rauskommen würde. Sie können sich nicht vorstellen, wie teuer diese Schiffe sind, selbst wenn sie nur im Hafen liegen. Das dachten wir in dem Moment. Weil, na ja, was sollte denn sonst dahinterstecken?«
Ja genau, was sonst?
Amila Fabricase wurde angeklagt und verurteilt, das Schiff versenkt zu haben. Die Polizei fand Hinweise darauf, dass sie mit Sprengstoff zu tun gehabt hatte, und behauptete, sie hätte welchen im Maschinenraum der Dana platziert, bevor sie von Bord gegangen war. Die Frage, die bei der Ermittlung anscheinend nie gestellt wurde, lautet: Wer steuerte das Schiff aufs Meer hinaus? Das muss jemand an Bord getan haben.
Mal angenommen, Leon Parker hätte ein bisschen was getrunken und beschlossen, nach dem Abendessen rauszusegeln. Mal angenommen, er hätte vergessen, die Lichter und den Funk einzuschalten – selbst dann hätten die Gäste im Dachrestaurant ihn fröhlich lossegeln sehen. Aber so war es nicht. Ein Zeuge im Hafen sah eine einsame Gestalt, sagte jedoch, sie bewegte sich geduckt, verstohlen, als wollte sie sich verstecken. Es geschah heimlich.
Amila wurde aufgespürt, durchsucht und vernommen, dann wurde gegen sie ermittelt.
Die wohlhabende Familie sah man sich kaum an.
Die Polizei richtete ihr Augenmerk nicht auf Leon, der die Kinder eingeladen und die Crew weggeschickt hatte, nachdem er sie in bar bezahlt hatte. Leon, der sowohl ablegen als auch das Schiff steuern konnte. Leon, der den Kapitän angewiesen hatte, das Abendessen im Speiseraum zu arrangieren, unter Deck, an einem warmen Juliabend, wenn ein Essen auf Deck doch so naheliegend gewesen wäre. Niemand prüfte, ob Leon Parker seine Familie umgebracht hatte. Die Polizei konzentrierte sich ausschließlich auf Amila.
Leon hatte erst vor kurzem in eine sehr mächtige Familie eingeheiratet. Sie sind bekanntermaßen medienscheu und haben gute Beziehungen. Ist es möglich, dass die Polizei angewiesen wurde, Leon nicht ins Visier zu nehmen? Ist es möglich, dass man den Behörden mit Nachdruck nahegelegt hat, die Polizei möge sich auf jemand anderen konzentrieren?
Ich tippte auf Pause. Ich wusste, es ging um meinen Leon. Meinen Freund Leon.
Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich nahm mein Handy und öffnete die Homepage des Podcasts.
3
Das Hintergrundbild zeigte die Dana, die in den Seilen im Trockendock hing. Es war durch eine Fisheye-Linse verzerrt, und der rot-weiße Bug bäumte sich auf wie ein großer, freundlicher Hund, der die Kamera beschnüffelt. Der Himmel dahinter war klar und blau, ein Côte d’Azur-Winterhimmel, und das lackierte Holzdeck blinkte in der Sonne.
Seitlich am Rand des Bildes gab es Dateien, jede beschriftet mit der Episode, auf die sie sich bezog. »Ep1«. »Ep2«. Sie waren gestaltet wie Papierstapel, die auf einem Schreibtisch abgelegt sind und auf die man von oben hinabsieht. Aber es war kein Schreibtisch, es war ein Foto einer Jacht.
Ich tippte auf »Ep1«, und eine ganze Reihe Fotos trennte sich auf und glitt über den Bildschirm.
Da war er: Leon Parker.
Ein grinsender, zahnlückiger, älterer Leon.
Seine Arme ruhten auf den Schultern zweier schlanker Jugendlicher, einem schlaksigen blonden Jungen im zu großen T-Shirt und einer schönen jungen Frau in einem gold-grün gestreiften Kleid. Sie grinste und trug ein klobiges Diamantcollier. Sie berührte es mit dem Mittelfinger, als wollte sie der Kamera den Stinkefinger zeigen. Alle drei prosteten mit Champagnerschalen in die Kamera.
Leon Parker war tot. Verdammt, das machte mich traurig. Ich hatte ihn jahrelang nicht mehr gesehen, aber manche Menschen sind einfach ein Verlust für die Welt. Leon Parker war einer davon.
Er war in den letzten zehn Jahren nicht sehr gealtert. Er war eins achtzig groß, massiv gebaut, ging um die Taille herum auseinander, sah aber immer noch gut aus für einen Mann Ende fünfzig. Seine Haare waren etwas grauer, immer noch recht lang und lockig, von der salzigen Seeluft zerzaust. Weißes Brusthaar kräuselte sich aus dem breiten Kragen seines offenen Hemds, in hartem Kontrast zu seiner wettergebräunten Haut. Er grinste, neben dem Schneidezahn fehlte ein Zahn. Er sah glücklich aus.
Mein Blick wanderte von dem blauen Himmelhintergrund, seinen Kindern und dem Diamantcollier zu der dünnen Zigarette, die zwischen Leons Fingern brannte. Leon drehte selbst. Ich wusste aus Erfahrung, dass er es einhändig konnte.
Auf dem Bild hatte er die Arme um seine Kinder gelegt, hielt aber die Zigarette zur Seite, als wollte er nicht, dass der Qualm ihnen zu nahe kam. Fast konnte ich seinen billigen Tabak riechen, warm wie Bratensoße, konnte ihn in sich hineinlachen hören, wenn er mit einer Geschichte fertig war, die er bestimmt schon hundert Mal erzählt hatte.
Ich wollte es mir nicht weiter anhören, aber ich musste wissen, was mit ihm geschehen war. Ich drückte auf Play.
Leon Parker war ein ganz besonderer Typ. Das konnte niemand leugnen. Was für Fehler er auch haben mochte – er wusste, wie man es sich gut gehen ließ. Geboren in einer Arbeiterfamilie im Londoner East End, arbeitete er als Wertpapierhändler in der City, wurde dann Geschäftsmann. Er riskierte viel, er machte Vermögen und verlor sie.
Nach seinem Tod grub man dieses kleine Interview mit ihm auf London Tonight aus. Aufgenommen wurde es auf der Straße am Schwarzen Mittwoch 1992, als in London die Märkte zusammenbrachen.
Das Geräusch von Bussen, die durch eine belebte Londoner Straße poltern. Ein Interviewer mit gepflegter Aussprache rief über den Lärm hinweg:
»Entschuldigen Sie, Sir, haben Sie heute Geld verloren?«
»Alles futsch.« Leons Stimme war rau und heiser. »Ich hab den ganzen Scheiß verloren.«
»Dann ist das ein schlimmer Tag für Sie?« Der Interviewer klang düster.
»Ach, na ja …« Leons Stimme wurde unvermittelt heller. »Mal verliert man, mal gewinnt man, was?«
Dann stieß er sein anzügliches Lachen aus, eine herrliche Mischung aus Verzweiflung und Freude am Spiel. Der Interviewer stimmte in sein Lachen ein. Ich merkte, wie ich ebenfalls lächelte.
Oh Gott, Leons Lachen. So dunkel und wild, man hätte darin einen Sack voller Kätzchen ertränken können.
Es katapultierte mich zurück zu einem Sommer in den schottischen Highlands, weit die Westküste hinauf, weiter als Inverness, jenseits der Black Isle, rauf nach Dornoch, wo die Berge alt und rund und hoch sind, wo kaum mehr Züge fahren, wo das Wetter überraschend mild und das Land vernarbt ist von verlassenen Bauernhöfen, die wieder mit den Feldern verschmelzen.
Zurück nach Skibo Castle.
4
Skibo Castle ist ein exklusives Feriendomizil nur für Clubmitglieder in der Nähe von Dingwall.
Als Andrew Carnegie es 1897 kaufte, war das Schloss verfallen. Er war Schotte, im Alter von zehn nach Amerika ausgewandert und hatte dort ein Vermögen gemacht. Zu der Zeit war er der reichste Mann der Welt. Carnegie ließ Skibo als edwardianisches Schloss wiederaufbauen, um es als Sommerresidenz zu nutzen. Es liegt auf einem achtundzwanzigtausend Morgen großen Stück Land und bietet jeden Luxus: Fliegenfischen und Rotwildjagd, Segeln und Kajakfahren, Reiten, exzellentes Essen und wunderschöne Zimmer. Es hat ein Spa, in dem Kuren verkauft werden, die nichts bringen, für Wehwehchen, die man nicht hat. Madonna hat hier ihren Hochzeitsempfang gehalten.
Wenn man von der Zufahrt kommt, sieht es relativ groß aus, aber das täuscht. Es wurde auf einen steilen Hügel gebaut. Es ist nicht einfach groß, es ist riesig, und es wurde so entworfen, dass die Funktionsräume unter der Erde sind. Dadurch sind die Haupträume frei von Haushaltsgeräten und erwecken den Eindruck eines Hauses mit zwanzig Schlafzimmern, aber ohne Besenschrank.
Dieser Teil der Highlands ist mit Schlössern verseucht. Der Besitzer von Harrods hat eins. Bob Dylan hat eins. Die Queen Mother hat hier gewohnt. Den Dukes of Sutherland gehört Dunrobin Castle, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Dort gibt es eine recht hübsche Teestube und ein Museum, in dem mit keinem Wort die Vertreibung der Pachtbauern erwähnt wird, die von ihrem Land verjagt wurden, um die profitable Schafzucht einzuführen, und auch nicht die Wirtschaftsflüchtlinge, die es in der Folge gab. Aber es gibt dort eine Büste von Garibaldi aus Carraramarmor. Der Duke traf ihn nur für ein paar Tage, aber Garibaldi war zu der Zeit sehr berühmt. Die Büste war im 19. Jahrhundert das, was heute ein signiertes Hendrix-Poster ist.
Es ist ein seltsamer, abwegiger Ort für seltsame, abwegige Menschen, meist Zugezogene, die so tun, als wären sie Schotten. Die gesamte Gegend ist mit Erfundenem überschwemmt. Ich liebte es dort.
Leon Parker kam mit seiner holländischen Freundin nach Skibo. Sie war Clubmitglied, aber weder jagte noch segelte noch schwamm oder ritt sie. Sie trug hohe Absätze, die das Eichenparkett zerkratzten, und verbrachte ihre Zeit im Spa, nippte Gesundheitstees und war mit dem Service unzufrieden. Sie war klein und dunkelhaarig und sehr schön.
Leon und ich trafen uns eines Abends, als es dunkel wurde, bei einem der Müllhäuschen: Ich hatte meine Rauchpause, er wollte spazieren gehen. Er bat mich um eine Zigarette, weil er seinen Tabak im Zimmer gelassen hatte. Ich konnte ihm schlecht sagen, er solle sich verpissen. Ich hatte bereits Ärger mit dem Manager.
Da standen wir an diesem ruhigen Abend und rauchten. Ich fühlte mich etwas unwohl, mit ihm allein zu sein. Ich stellte mich so hin, dass ich ins Küchenfenster sehen konnte, um mich zu vergewissern, dass immer jemand in Rufweite war. Nicht, dass Leon etwas Bedrohliches gehabt hätte, nur traute ich damals niemandem.
Wir sprachen über das Rauchverbot und wie sehr es unser Rauchverhalten beherrschte. Er erzählte mir, wie er einmal auf einem Langstreckenflug so sehr verzweifelte, dass er Tabak aß und ihm anschließend stundenlang schlecht war. Wir lachten darüber.
Er schien dieses Lachen dringend zu brauchen.
Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber er erzählte mir eine wunderschöne Geschichte von einem Bettler, den er vor seinem Hotel in Paris gesehen hatte. Der schmutzstarrende Mann setzte sich auf den Bürgersteig, zog ein sauberes Tischtuch aus der Tasche und legte es vor sich. Dann holte er aus anderen Taschen ein Messer, eine Gabel, einen Löffel und eine Serviette, deckte den Platz vor sich ein und stellte ein Schild hin, auf dem »Danke« stand. Dann steckte er sich die Serviette in den Kragen und wartete. Während Leon zusah, wurde dem Mann von einem der umliegenden Restaurants ein Essen serviert. Am nächsten Tag kam der Mann wieder, deckte den Platz vor sich ein und bekam wieder ein Essen, diesmal von einem anderen Restaurant. Leon war vier Tage lang dort, und der Mann blieb nie ohne Mittagessen. »Paris!«, sagte er am Ende, als wäre das von Bedeutung.
Aber die Geschichte gefiel mir, also antwortete ich: »Ja, Paris!«
Dann verstummten wir und rauchten und sahen zu, wie die Sonne unterging. Es war beeindruckend. Sonnenuntergänge in jenem Sommer bestanden aus grellpinkfarbenen Himmeln, die gegen marineblaue Nacht kämpften.
Der erste Abend brachte dieses Lachen.
Aber am zweiten Abend tauchte Leon wieder bei den Mülltonnen auf. Ich fürchtete schon, dass er sich falsche Hoffnungen machte. Wir plauderten steif über den Tag, und er drehte mir Zigaretten, um sich für den vorangegangenen Abend zu revanchieren. Tabak mit Johannisbeer-Vanille-Aroma.
Angestellte durften Gästen nicht sagen, dass sie sich verziehen sollten, und sie durften ihnen auch kein Tablett auf den Kopf knallen, wie ich erst kürzlich zu meinem Leidwesen erfahren hatte. Damals hatte ich ein ziemliches Temperament.
Ich wollte diesen Job behalten. Es war ein guter Job, gut bezahlt, bequeme Unterkunft, sicher und ab vom Schuss. Ich hatte dort einen engen Freund, Adam Ross. Die Clubmitglieder kamen aus aller Welt, und die meisten waren ziemlich nett. Wenn sie es nicht waren, sprach Albert, der Manager, mit ihnen. Der Mann brachte es fertig, in einem Fünf-Meilen-Radius Schamgefühle auszulösen. Dienstleistung ist ein Machtspiel, sagte Albert gern, und Formvorschriften sind unsere einzige Waffe. Immer schön professionelle Distanz halten. Aber da stand ich nun und rauchte neben den Mülltonnen mit einem Gast Zigaretten. Das war nicht richtig.
Leon bemerkte mein Unbehagen und sprach mich direkt darauf an. War es mir nicht recht, dass er hier draußen mit mir rauchte?
Es wirkte wie eine Fangfrage. Wenn ich sagte, dass ich eigentlich nichts dagegen hatte, würde er dann übergriffig werden? Am besten war es, mit einer Gegenfrage zu antworten, also sagte ich: »Warum kommen Sie zum Rauchen hier raus an die Mülltonnen? Ich würde mich in die Raucherlounge setzen, wenn ich dürfte.«
»Na ja«, er lächelte schüchtern, »diese junge Dame, mit der ich hier bin, meine Freundin, ich meine, ich mag sie und alles, aber man kann mit ihr nicht entspannt plaudern, wissen Sie, was ich meine?«
Ich hielt sie für eine griesgrämige Ziege, aber ich sagte: »Ja, ich kenne auch solche Leute …«
»Wenn ich ihr eine Geschichte erzähle wie die von dem Bettler in Paris, dann schaut sie irritiert und sagt so was wie: Warum hat er sich den Platz eingedeckt? Wo hatte er als Bettler das Besteck her? Sie kann mit Geschichten nichts anfangen.«
Ich sagte, vielleicht käme sie eben nicht aus einer Familie, in der man sich Geschichten erzählt.
»Ja. Sie kapiert’s nicht.« Er wirkte besorgt und zog heftig an seiner Zigarette. »Sie sagt: ›Immer erzählst du solche Geschichten, Le-on. Zu allem und jedem hast du eine kleine Geschichte auf Lager.‹« Er ließ es abfällig klingen, machte ihren Akzent nach, aber er hielt den Blick abgewandt, er versuchte nicht, mich zum Mitmachen zu bringen, und dann murmelte er: »Sie kapiert’s nicht …« Er wirkte ein bisschen traurig.
Ich sagte, dass eine der Geschichten in Tausendundeiner Nacht ausdrücklich von dem Drang handelt, eine Geschichte zu erzählen. Es ist ein Urverlangen, Geschichten zu erzählen. Es geht dabei weniger um den Zuhörer, sondern um den Erzähler. In manchen Kulturen wird es als Geisteskrankheit angesehen, wenn man nicht seine Geschichte erzählt.
»Tausendundeine Nacht«, er lächelte. »Ist das Ali Baba? Aus der Weihnachtspantomime?«
Ich war entsetzt. Ich legte los und ereiferte mich über Tausendundeine Nacht, was für ein kollektiver Schatz das war, wie durch die diversen Schachtelgeschichten eine ganze Welt erwuchs: Schichten aus gleichzeitig gelebten Leben, die sich verknüpften und überschnitten. Und wie das von Genre zu Genre sprang, die Geschichten komisch und gewalttätig und romantisch und tragisch, wie das Leben, sagte ich, das ist wie das wirkliche Leben. Die Erzählung wurde geschaffen, bevor Geschichten auf eine Gestalt festgelegt waren, bevor die Formen erstarrten. Ich sagte, wie dumm und beschränkt an der westlichen Kultur es war, dass sich immer alles nur um eine Person drehen sollte. Ich klang wichtigtuerisch. Ich klang wie meine Mutter, die Literaturprofessorin am Institut für orientalische und afrikanische Studien an der University of London gewesen war. Ich trug es vor, um ihn zu beeindrucken, weil er sehr gut aussah, und ich glaube, ich wollte ihn wissen lassen, dass ich nicht bloß ein Zimmermädchen war.
Leon nickte und lauschte und lächelte und fand das interessant. Er sagte, er kenne eine Frau, die alles daransetzte, ihre Geschichte nicht zu erzählen, weil ihre Familiengeschichte so ein dunkles Geheimnis war. Superverschwiegen, superreich. Medienscheu. Rückblickend war es bloß ein unbeholfener Anknüpfungsversuch, aber ich wusste schon, von wem er sprach, noch bevor er »Nazis« sagte. Damals war ich ständig extrem auf der Hut.
»Sie heißt Gretchen Teigler«, sagte er. »Ist sie hier Mitglied?«
»Nein.« Das hatte ich als Erstes überprüft, als ich dort ankam. Ich wäre nicht in Skibo geblieben, wenn sie Mitglied wäre. Ihretwegen war ich auf der Flucht. Gretchen Teigler hatte versucht, mich umbringen zu lassen.
Leon wirkte überrascht, neigte den Kopf zu mir und fragte: »Woher wissen Sie das so genau?«
»Ach, Mr. McKay hält uns da immer auf dem neuesten Stand.« Es war eine ziemlich dumme Antwort, als ob Albert mit seinen Angestellten eine Liste der Leute durchgehen würde, die nicht Mitglied waren.
Ich sah, wie Leon lächelte und auf meinen Mund sah. Mit einem Mal wurde mir bewusst, dass mein Akzent verrutscht war. Es lag daran, dass er Londoner war – ich hatte seine Aussprache übernommen, ohne es zu merken. Dabei war ich doch ein Zimmermädchen aus Aberdeen.
Erschrocken murmelte ich etwas von wegen ich sollte ohnehin eigentlich gar nicht mit Gästen reden. Vielleicht wäre es besser, wenn er einfach wieder reinging.
Leon ließ eine Pause verstreichen, dann sagte er: »Nee.« Und beließ es dabei.
Er bohrte nicht nach, woher ich Gretchen Teigler kannte, aber vielleicht wusste er auch längst, wer ich war. Ich habe eine Narbe über der Augenbraue, die recht markant ist. Man kann mich leicht erkennen, wenn man Bescheid weiß, und Leon kam aus London. Er musste den Skandal mitbekommen haben. Der war kaum zu verpassen gewesen.
Jedenfalls verdrehte Leon die Augen, wechselte das Thema und sprach wieder übers Rauchen. Ich glaubte schon, er wäre ganz im Hier und Jetzt, bei mir, seiner neuen Bekanntschaft, um zu rauchen und Geschichten zu erzählen. Dann kam er noch einmal darauf zurück und sagte: »Ach, scheiß auf die Nazis.«
Darüber mussten wir beide lachen. Und dann lachten wir, weil wir beide so lachen mussten, über eine scheinbare Lappalie, aber wir verstanden uns zutiefst, und das war etwas Flüchtiges, und Lachen war eine Möglichkeit, es zu verlängern. Aber dann war es vorbei. Wir wischten uns die Augen, und er seufzte, und ich sagte: »Hey, Leon, hab ich Ihnen von den Jungs erzählt, die mit ihrem Maultier in einem Salzsee schwimmen?«
Und er machte ein gieriges Gesicht und knurrte: »Ah!«, was hieß, ich sollte ihm die Geschichte erzählen. Ich tat es. Sie war gut. Dann erzählte er mir eine. Sie war herrlich. Ich weiß nicht mehr, worum es darin ging, nur dass sie klein und rund war und sich am Ende fein zusammenfügte.
Unsere Geschichten waren keine verkappten Lebensläufe. Wir erzählten sie uns nicht, um zu prahlen oder unseren Platz in der sozialen Rangordnung abzustecken. Es ging nicht um solchen Scheiß. Es waren Geschichten zur Unterhaltung, erzählt um ihrer Gestalt willen, um ihrer selbst willen, um der Liebe zum Erzählen willen. Es ging dabei einzig um die Geschichten und die Gestalt der Geschichten. Runde, spiralförmige, perfekte Bögen, ein Abheben im rechten Winkel mit vierfachem Aufschlag bei der Landung, und eine von seinen, daran erinnere ich mich lebhaft, war eine absurde Fingerfalle. Was immer danach geschah, als wer er sich auch herausstellte, zu diesem Zeitpunkt war die Sache zwischen mir und Leon echt.
Ich vertraute ihm ein kleines bisschen. Als am nächsten Tag niemand kam, um mich zu töten, vertraute ich ihm ein bisschen mehr. Im Laufe des Tages musste ich zum Manager, Mr. McKay, und er sagte nichts von Gretchen Teigler, da wusste ich, dass Leon meinen Ausrutscher nicht erwähnt hatte. Vielleicht fand er es unwichtig.
Am nächsten Abend bei den Mülltonnen erzählte er mir von seiner Tochter. Wenn Männer über Töchter reden, ist das oft ein verschlüsselter Hinweis darauf, dass sie nicht vorhaben, handgreiflich zu werden. Mütter sind ein anderer Code. Müttergeschichten können so oder so ausgehen. Leon hatte sich von der Mutter des Mädchens getrennt und seine Tochter im Stich gelassen. Die Kleine wuchs unter schrecklichen Bedingungen auf, ihre Mutter war drogenabhängig, und die Sozialisation des Mädchens verlief wüst. Das fand er erst später heraus, es war eine hässliche Scheidung gewesen, und er war so mit sich selbst beschäftigt, dass er gar nicht daran dachte, sich nach ihr zu erkundigen. Er war Ende dreißig, als sie geboren wurde, er hatte keine Ahnung, wie es war, Vater zu sein. Jetzt unterstützte er die beiden finanziell, aber seine Tochter war stinkwütend auf ihn. Er fand, dass sie jedes Recht dazu hatte.
Es war ehrlich, eindeutig wahr, und er fühlte sich mies dabei. Ich hatte das Gefühl, dass er sich eine Blöße gab. Er fragte mich, ob ich Familie hätte, und aus irgendeinem Grund sagte ich ihm die Wahrheit. Meine Mutter war an Brustkrebs gestorben, als ich siebzehn war. Sie hatte mir alles bedeutet. Mein Vater hatte sich umgebracht, als ich klein war. Ich erinnerte mich nicht an ihn. Leon schüttelte den Kopf und sagte, das sei fürchterlich. Er meinte es nicht wertend, nur, dass es furchtbar für mich sein musste. Er sagte, mein Vater hätte abwarten sollen, und dass so etwas vorbeiging, normalerweise. Dann nahm er einen tiefen Zug von seiner Zigarette, verbrannte einen Zentimeter Asche. Es schien mir, als hätte er ebenfalls schon mal Selbstmord in Betracht gezogen und es sich wieder aus dem Kopf geschlagen. Ich mochte ihn dadurch noch lieber. Ich habe meinem Vater nie verziehen, was er getan hat. Selbstmord ist virulent. Er kann durch ganze Familien wüten, so wie Tuberkulose früher ganze Straßenzüge niedermähte. Er brachte uns den Erreger ins Haus. Besonders zum Ende hin, als sie schrecklich krank war, quälte sich meine Mutter wegen dem, was er getan hatte. An manchen Tagen fühlt sich mein eigenes Lebendigsein wie eine Trotzreaktion an, wie ein riesiges »Fick dich« an meinen feigen Vater.
Dann ging Leon wieder rein.
Er blieb eine Woche. Er kam jeden Abend raus, und wir rauchten und erzählten uns Geschichten, aber auch still zu sein machte ihm nichts aus, und er ließ mir immer Zeit, noch eine allein zu rauchen.
An seinem letzten Abend kam er zu den Mülltonnen und hatte zwei Gläser mit fünfzehn Jahre altem Springbank dabei. Er sagte, es sei der beste Malt Whisky, den es gab.
Ich bedankte mich, und wir tranken und betrachteten den knallpinken Sonnenuntergang, wie er den Kampf über den Müllhäuschen verlor. Es war ein guter Malt.
Leon sagte, Trottel wären immer auf den teuren Whisky aus, aber dieser sei der beste. Er erzählte mir eine lange Geschichte über einen Millionär, der achttausend für eine Einheit eines hundert Jahre alten Malt Whiskys bezahlt und dann ein Bild der Flasche gepostet hatte. Experten reagierten darauf und erklärten ihm, dass diese Destillerie erst seit dreißig Jahren existierte. Sie prüften ihn, und der Whisky erwies sich als billiger Blend, die Flasche war gefälscht. Leon gefiel diese Geschichte ungemein. Ich weiß gar nicht genau, warum es ihm so viel Freude machte, sie zu erzählen. Am Ende lachte er überrascht los, und sein Gelächter klang voll und herzhaft. Es kam tief aus seinem Bauch, und er öffnete den Mund ganz weit und ließ es in bellenden Stößen heraus. Und dann sagte er: »Es gab Zeiten, da hätte ich das auch bezahlt. Aber man kann sich das Besondere nicht kaufen. Es hat mich einen Haufen Kohle gekostet, das rauszufinden.«
Ich hätte ihn fast gefragt, was zur Hölle er dann auf Skibo Castle suchte, aber das hätte er vielleicht nicht so lustig gefunden, und ich mochte ihn, also ließ ich es bleiben. Hatte er eigenes Geld oder bloß eine reiche Freundin? Das kam nie richtig raus. Und dann war meine Pause vorüber, der Whisky alle, und wir hatten unsere Zigaretten aufgeraucht.
Er wandte sich mir zu, was sich seltsam anfühlte, weil wir normalerweise den Blick auf die Aussicht gerichtet hielten, aber er wandte sich mir zu und sah mich an und sagte: »Sie sind zu gut für diesen Job, Anna. Versprechen Sie mir, dass Sie hier nicht hängenbleiben.«
Meine Kündigungsfrist lief bereits. Man hatte mich gebeten zu gehen, wegen des Vorfalls mit dem Tablett und ein paar anderer Dinge, bei denen ich rückblickend verwundert bin, dass man sie mir bis dahin hatte durchgehen lassen. Aber Leon wusste davon nichts, und ich mochte ihn, also ließ ich ihm die Genugtuung.
»Okay, versprochen«, sagte ich. »Und Sie sollten zusehen, dass Sie von dieser elendigen Holländerin wegkommen. Suchen Sie sich jemanden, der Sie mag.«
Er grinste, und mir fiel die Lücke neben seinem Schneidezahn auf. »Mag sie mich denn nicht?«
»Sie mag nichts und niemanden.«
Er lachte wieder und sagte, ich solle auf mich aufpassen, und ging.
Als ich am nächsten Morgen meine Schicht antrat, war Leon fort. Er war mitten in der Nacht gefahren, ohne seine holländische Freundin. Sie stand höchst wütend an der Rezeption und schikanierte das Personal wegen der Spa-Rechnung und verlangte nach einer Limousine, die sie zum Flughafen bringen sollte. Ich wurde raufgeschickt, um für sie zu packen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich in ihre Crème de la Mer spuckte. Ich war damals wirklich eine kleine Giftspritze.
Da saß ich in meiner blitzblanken deutschen Küche, meine Mädchen und Hamish schliefen oben, der Kaffeebecher in meiner Hand wurde kalt, ich starrte auf das Foto meines Freundes Leon und weinte. Es nahm mich sehr mit, dass er tot war.
Trauer ist wie eine Narbe. Das Gewebe ist zäh, und wenn man es erneut aufreißt, heilt es nur schlecht.
Ich dachte, ich sollte mit meiner besten Freundin Estelle reden, meine Trauer würde nachlassen, wenn ich ihr Leon beschrieb, ihr erzählte, was für ein guter Kerl er gewesen war. Dann könnte ich es hinter mir lassen. Wir waren verabredet, sie sollte mich um halb zehn zu unserem Bikram-Yoga-Kurs abholen, aber es war noch früh. Ich warf einen Blick auf die Uhr und stellte erschrocken fest, dass es bereits nach sieben war. Ich musste meine Familie wecken und meinen banalen Vorstadt-Montag angehen.
Ich hätte lieber unter dem Meeresspiegel bei den Geistern bleiben sollen.
5
Ich hörte das Klopfen an der Haustür zum ersten Mal, als ich den Mädchen ihre Lunchpakete machte. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Fünf vor acht. Ich nahm an, dass es sich um einen verirrten Taxifahrer oder ein falsch adressiertes Päckchen handelte.
Alle anderen waren oben und machten sich fertig. Ich ging im Geiste Sportstundenpläne durch und machte Bedarfslisten: Jessica hatte heute Schwimmen, Lizzie hatte Turnen. Jess brauchte ihren Badeanzug und Shampoo, weil ihr sonst vom Chlor die Kopfhaut juckte.
Ich hörte das Klopfen erneut, hakte aber im Kopf Listen ab und wollte mich nicht stören lassen. Ich ignorierte es.
Ich nahm die Schultaschen und stellte sie in den Flur, rief zu den Mädchen nach oben, dass sie noch zehn Minuten hatten, also los jetzt, ging zur Wäschekammer, holte einen Badeanzug und ein frisches Handtuch, rollte den einen in das andere und kam wieder raus.
Als ich den Flur entlangging, blinzelte ich und sah Leon vor einem pinkfarbenen Himmel lachen. Die Erinnerung war so lebendig, dass sie mir den Atem raubte. Ich sank gegen die Wand, um Luft zu holen. Scheiße.
Ich hatte den Podcast beim Frühstück nicht erwähnt. Hamish wusste nicht, dass ich mal auf Skibo gearbeitet hatte, es gab also keinen harmlosen Anknüpfungspunkt, um von Leon zu erzählen, und abgesehen davon sprachen wir ohnehin kaum.
Ich stand noch im Flur und dachte an Leon, als ich oben in unserem Schlafzimmer Hamishs Handy klingeln hörte.
Dann hastig schlurfende Schritte, als er quer durchs Zimmer eilte, um ranzugehen.
Ich war sauer. Wenn ich ihn anrief, ließ mich Hamish auf der Mailbox landen. Manchmal rief er dann später zurück. Manchmal tat er es nicht und behauptete, gar nicht bemerkt zu haben, dass sein Telefon geklingelt hätte. Aber wenn sein Büro anrief, ging er immer sofort ran. Jetzt hoppelte er durchs Schlafzimmer, um morgens um acht einen Anruf entgegenzunehmen. Komisches Gebiet, dieses Gesellschaftsrecht. Tag und Nacht kamen Anrufe.
Ich konnte ihn eindringlich murmeln hören, seine Stimme schlängelte sich die Treppe hinunter. Dann hörte ich, wie er die Schlafzimmertür schloss, um ungestört zu sein.
Das machte mich wütend, und ich konnte es nicht begründen.
Ich stopfte die Schwimmsachen in die Tasche.
An der Haustür klopfte es wieder, diesmal mit Nachdruck. Ein dreimaliges Pochen in gleichmäßigen Abständen. Klopf. Klopf. Klopf.
Ich ging zur Tür und langte nach dem Riegel, da verdunkelte sich der Flur.
Ich drehte mich um. Hamish stand auf dem Treppenabsatz und blockierte das Licht, das durch das Fenster fiel. Mit seiner Silhouette stimmte etwas nicht. Er trug keinen Anzug mit Krawatte, sondern eine Art T-Shirt mit einem scheußlichen Kragen und widerwärtige beigefarbene Hosen mit Bügelfalten. Ich wusste nicht einmal, dass er solche Sachen überhaupt besaß.
»Was um alles in der Welt hast du da an?«
Er antwortete nicht. Er stand im Gegenlicht, so dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte, aber dann bemerkte ich den Koffer zu seinen Füßen: einen gelben Handgepäck-Rollkoffer. Ich hatte ihn vor knapp einem Monat in den Keller geräumt, als er von seinem Juristenkongress in St. Lucia zurück war.
Klopf. Klopf. Klopf.
Jetzt wusste ich es. Gleich da draußen vor der Tür befand sich die Erklärung für seine Launen während des letzten Jahres, für meine Paranoia, für alles. Ich streckte die Hand aus und öffnete.
Mit ihr hatte ich nicht gerechnet.
Meine beste Freundin Estelle, in einem brandneuen Kleid und ziemlich viel Make-up für einen Bikram-Yoga-Kurs am Montagmorgen. Und sie hatte einen kleinen Koffer dabei.
Nein.
Falsch.