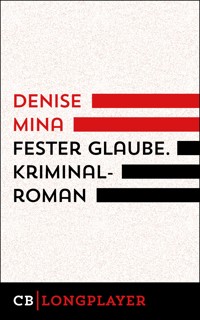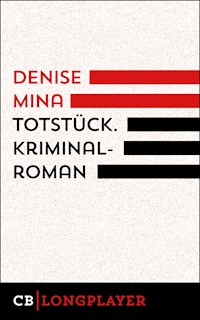
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Dr. Margo Dunlop tappt im Dunkeln, was ihre biologische Herkunft angeht. Ihre Adoptivmutter ist gerade gestorben, ohne etwas darüber preiszugeben, doch in ihren Unterlagen tauchen Briefe von Nikki auf, der Schwester ihrer leiblichen Mutter Susan. Darin steht, dass Susan schon lange tot ist. Wenn Margo glaubt, was diese unbekannte Tante in den etwas wirren Briefen behauptet, treibt in Glasgow ein Serienkiller sein Unwesen. Der es vor allem auf Straßenhuren abgesehen hat … »Denise Mina ist Expertin für Atmosphäre und Lokalkolorit. Die Real-time-Komponente wirkt dabei wie ein Handlungsbeschleuniger.« Katharina Granzin, taz »Verdammt spannend und trotzdem intelligent.« Ursula März, Die Zeit »Die schottische Noir-Meisterin mit wachem Blick für die gesellschaftlichen Verhältnisse und für die Beziehungen zwischen den Geschlechtern.« Hanspeter Eggenberger, Tagesanzeiger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2021
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der englischen Originalausgabe: The Less Dead
© 2020 by Denise Mina
Diese Übersetzung wurde ermöglicht mit der Hilfe des
Publishing Scotland translation fund.
Printausgabe: © Argument Verlag 2021
Lektorat: Else Laudan
Covergestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Dezember 2021
ISBN 978-3-95988-214-9
Über das Buch
Dr. Margo Dunlop tappt im Dunkeln, was ihre biologische Herkunft angeht. Ihre Adoptivmutter ist gerade gestorben, ohne etwas darüber preiszugeben, doch in ihren Unterlagen tauchen Briefe von Nikki auf, der Schwester ihrer leiblichen Mutter Susan. Darin steht, dass Susan schon lange tot ist. Wenn Margo glaubt, was diese unbekannte Tante in den etwas wirren Briefen behauptet, treibt in Glasgow ein Serienkiller sein Unwesen. Der es vor allem auf Straßenhuren abgesehen hat …
»Die schottische Noir-Meisterin mit wachem Blick für die gesellschaftlichen Verhältnisse und für die Beziehungen zwischen den Geschlechtern.« Hanspeter Eggenberger, Tagesanzeiger
Über die Autorin
Die Schottin Denise Mina hat bisher 15 Romane publiziert und zahllose Preise erhalten, was ihr den Ehrentitel »Queen of Tartan Noir« eintrug. Als junge Frau jobbte sie in Bars, in der Fleischfabrik, als Köchin und Krankenpflegehelferin, studierte dann Jura an der Universität Glasgow und fing an, Kriminalliteratur zu schreiben. 2014 wurde sie in die Hall of Fame der Kriminalschriftstellinnen und Kriminalschriftsteller
Denise Mina
Totstück
Kriminalroman
Für DM, KM, LM, MR, JG, TW, ML, EC
Vorbemerkung von Else Laudan
>Von einer, die auszieht, um mehr über ihre Herkunft zu lernen: Die artige Ärztin Margo verlässt die Sicherheit des Gewohnten und betritt ein Zwielicht aus Ungewissheit. Wirft erstmals Blicke in eine Welt, in der brutale körperliche Gewalt ebenso präsent ist wie die indirekte Gewalt der Bigotterie. Wahrheit und Moral erweisen sich als Verschiebemasse, die beweglich wird, wenn die Protagonistin sich bewegt. Wie rezipiert, wie empfindet, wie handelt eine Person außerhalb ihrer Routine?
Denise Mina benutzt grimmige Thriller-Versatzstücke, um diese Parabel über Aufgehobenheit und ihr Gegenteil zu erzählen. Es geht um den fest in die Normalität eingeschriebenen Klassismus und Sexismus, konkret: um den gewöhnlichen gesellschaftlichen Umgang mit Armut und mit Frauenkörpern.
Glasgow ist Minas urbane Bühne, auf der sie universelle Themen mit lokaler Geschichte verknüpft. »Eine so irre Mischung aus schöner Architektur und unsäglicher Gewalt. Glasgow ist ein wirklich schräger Ort«, so Denise Mina im Guardian. Und: »In Totstück sollte es um Opfer gehen, deren Tod nicht gerade emotionale Riesenwellen schlägt, wie bei Sexarbeiterinnen und Obdachlosen. Solche Fälle werden häufig Cold Cases, Zeugen machen sich nicht die Mühe auszusagen. Ich wollte erst über die realen Morde an Glasgower Sexarbeiterinnen in den späten 80ern und frühen 90ern schreiben. Das letzte Opfer kam damals aus einer entzückenden Familie, sie waren im Fernsehen und alle Leute nahmen Anteil, die anderen Fälle wurden sehr anders behandelt. Da zeigte sich ein umfassendes gesellschaftliches Bewertungssystem, welche Opfer haben welche Priorität. In Zeiten von Black Lives Matter gehört aufgearbeitet, wie einigen Menschen per se Wert zugemessen wird und anderen einfach nicht, das ist absolut wichtig.«
Totstück ist ein gebrochener Thriller, der aus instabilen Blickwinkeln Schlaglichter wirft und provoziert. Wieder einmal zeigt Mina: Krimi kann alles.
1
Hoffnung stirbt langsam, aber irgendwann stirbt sie. Obwohl längst klar ist, dass Margo versetzt wurde, kann sie sich nicht dazu durchringen, zu gehen. Sie ist Ärztin und weiß genau, wie hartnäckig und verderblich Hoffnung sein kann. Ohne jede Ermutigung, solange sie nicht ausdrücklich widerlegt wird, hält sich Hoffnung weit über den Punkt hinaus, wo sie nützt. Die Geschwindigkeit ihres Sterbens hängt oft vom Grad der Ausgangsinvestition ab.
Sie wartet jetzt seit einer Stunde und vierzig Minuten allein in diesem komisch geschnittenen Raum, horcht auf den Fahrstuhl und starrt die Tür an, will sie dazu bringen, sich zu öffnen und ihr Leben zu verändern. Sie ist hergekommen, um zum ersten Mal ihre Ursprungsfamilie zu treffen. Allerdings nicht ihre leibliche Mutter, denn es hat sich herausgestellt, dass Susan schon vor langer Zeit gestorben ist. Wie, das stand nicht in den Kontaktbriefen, aber Margo muss es unbedingt wissen. Sie ist Ärztin. Sie ist schwanger und hat Angst vor ihrem genetischen Erbe. Sie ahnt Schlimmes.
Sie ist nicht objektiv. Sie hätte nicht herkommen sollen. Sie hätte sich besser vorsehen müssen.
Die leibliche Familie ist sehr spät dran. Insgeheim weiß Margo, dass wahrscheinlich niemand mehr kommt, aber sie versucht, nicht sauer zu werden. Sie klammert sich noch an die abwegige Möglichkeit, dass die Verspätung einen guten Grund hat – ein Zugunglück oder eine stehengebliebene Armbanduhr, als gäbe es so etwas noch. Sollte die Person doch noch und unverschuldet zu spät kommen, möchte sie nicht, dass das Treffen in einen Streit über Pünktlichkeit ausartet. Es gibt Fragen, auf die sie Antworten braucht.
Sie wartet in einem Raum ganz oben in einem alten Bürogebäude im Herzen von Glasgow, gleich beim George Square. Es ist heiß hier und es riecht komisch, als ob in der Bausubstanz des Gebäudes irgendwas verrottet. Die Leute von der Adoptionsagentur haben versucht, den Raum heimelig zu machen, aber die Möbel sind billig und wirken seltsam unheilvoll, wie die Tatortrekonstruktion eines Familienwohnzimmers, in dem etwas Grässliches geschehen ist. Es gibt ein durchgesessenes Sofa mit niedriger Rückenlehne, einen Couchtisch mit einer Schachtel Papiertaschentücher darauf und einen Esszimmerstuhl. Außerdem ein Ikea-Regal mit zerfledderten Kinderbüchern und einem klebrigen Hippo-Flipp-Spiel, bei dem die Murmeln fehlen. Sie ist schon so lange hier, dass sie nachgesehen hat.
Auch der Schnitt des Raums stört sie. Er ist quadratisch mit einer niedrigen Decke aus Glasquadraten, die mit weißer Farbe blickdicht zugestrichen sind. Sie vermutet, dass das Gebäude entkernt und modernisiert wurde und dies hier mal der oberste Absatz eines herrschaftlichen alten Treppenhauses war, dass sie unter dem ehemaligen Oberlicht sitzt. Wenn sie daran denkt, spürt sie den Abgrund unter sich und ihre Schienbeine kribbeln, wie eine Erinnerung an einen Sturz.
Margo hat die Briefe von Nikki ganz unten in einer Schublade im Nachttisch ihrer Mutter versteckt gefunden. Beim ersten lag das Datum schon mehrere Jahre zurück, beim letzten erst ein paar Monate. Sie waren an Margo gerichtet, unter Janettes Adresse, und Margo wurde gebeten, doch bitte zu antworten. Nikki schrieb, sie müsse sie unbedingt sprechen, denn sie brauche bei etwas dringend Margos Hilfe.
Janette lag im Sterben und war kaum je bei Bewusstsein, als Margo auf das Bündel Briefe stieß. Sie hat versucht zu verstehen, warum Janette sie ihr nicht weitergegeben hat. Nikki klang durchaus irre, all dieser Quatsch über einen »Glasgower Jack the Ripper«, der seit dreißig Jahren hinter ihr her ist, aber Margo interessiert weniger der Wahrheitsgehalt ihrer Wahnvorstellungen, als vielmehr wie sie klingen. Margo ist sich ihrer psychischen Stabilität nicht ganz sicher. Sie will wissen, ob Nikki eine schizotype Störung hat, ob es eine genetische Disposition gibt, dass sie es auch kriegt. Aber Nikki kommt nicht.
Margo starrt auf die kleine Tür und stellt sich vor, wie sie wohl auf eine hereinkommende Fremde wirken würde. Sie ist groß und die Decke ist niedrig, ihre Hände liegen auf ihren Knien, die Füße stehen flach auf dem Boden. Sie muss einschüchternd wirken, wie eine Statue von Queen Victoria, die in einer Kiste entdeckt wird. Sie versucht ein einladendes Lächeln, doch die Anspannung verwandelt es sofort in ein Zähnefletschen.
Aber es kommt sowieso kein Mensch. Sie lässt das gruselige Lächeln sein und schaltet ihr Gesicht in den Leerlauf. Kein Mensch. Sie nimmt ihren Mantel von der Couch und legt ihn auf ihre Knie, die Vorstufe davon, ihn anzuziehen.
Nun wird sie nie erfahren, was mit Susan passiert ist oder ob sie ihre Größe von ihr hat, ob sie gemischter Herkunft ist. Ihre Haare sagen ja, aber ihre Hautfarbe sagt nein. Sie kriegt keine Chance zu fragen. Kein Mensch kommt.
So verdammt unhöflich. Egoistisch. Was für ein Mensch verabredet ein dermaßen emotional aufgeladenes Treffen, legt Ort und Uhrzeit fest und taucht dann nicht auf? Sie schaut auf die Uhr auf ihrem Handy; jetzt sind es eine Stunde und fünfzig Minuten. Sie steigert sich in ihre Entrüstung hinein, aber eine unbeantwortete SMS von vor einer Stunde lenkt sie ab.
Ihre beste Freundin Lilah hat gefragt: Wie sieht’s inzwischen aus, Schnecke, gibt’s was Neues?
Margo hat immer noch nicht zurückgeschrieben. Sie hat die ganze Zeit gehofft, eine bessere Antwort geben zu können.
Ein sehr sachtes Klopfen, dann öffnet sich die kleine Tür. Es ist Tracey, die Mediatorin, die Margo beim Reinkommen einen langen Vortrag gehalten hat, sie solle nicht zu viel erwarten. Margo kann Tracey nicht leiden, ohne so recht zu wissen warum.
Vielleicht ist es die angespannte Situation. Vielleicht ist es Traceys angriffslustiger Gang. Sie wiegt die Schultern und betritt den Raum mit dem Bauch voran, als wäre sie schwanger und wollte darüber reden oder als wäre sie fett und wollte es nicht. Sie trägt eine dicke Brille, die ihre großen grünen Augen verzerrt, und ein Kleid mit tiefem Ausschnitt, der zehn Zentimeter Dekolleté zur Schau stellt. Eine Goldkette mit grünem Anhänger surft auf ihren rekordverdächtig langen Möpsen, dümpelt darauf herum und geht manchmal unter, nur um gedankenlos von Traceys wurstigem Zeigefinger wieder herausgefischt zu werden.
»Hallo noch mal«, flüstert sie, den Kopf mitfühlend zur Seite geneigt, die Lippen zu tieftraurigem Bedauern zusammengepresst, als sie sich aufs Sofa setzt und die Hände verschränkt. Gleich sagt sie Margo, sie soll es aufgeben und verschwinden. Sie wird es nett verpacken, aber das wird sie meinen.
Noch ehe Tracey etwas sagen kann, platzt Margo heraus, dass sie einfach noch eine halbe Stunde wartet, wenn das geht?
»Na ja, also, ja nee«, nölt Tracey mit einem rauchigen nordirischen Akzent, der wie ein melancholischer alter Song klingt, »das kleine Problem dabei ist, dass wir das Büro eigentlich schon in zehn Minütchen schließen müssen. Ich wollte quasi vorher bloß noch mal ein Pläuschchen mit Ihnen halten, nur damit Sie nicht mit dem Gefühl gehen, dass Sie vielleicht noch mit jemand hätten reden wollen? Würden Sie vielleicht gern ein klitzekleines Pläuschchen halten? Über Ihre Gefühle?«
An jedem Satzende geht ihre Stimme nach oben, jede Aussage ist vollgemüllt mit nervtötenden Relativierungen – Vielleichts und Verniedlichungen und Unklarheit. Aber Margo ist Ärztin und hat von Patientinnen und Patienten schon genug hilflose Wut abbekommen, um zu wissen: Tracey ist nicht schuld daran, wie sie sich fühlt.
»Dann warte ich einfach noch die letzten zehn Minuten ab, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« Margo sagt es leise, überkompensiert ihre weißglühende Wut. »So weiß ich wenigstens mit Sicherheit, dass Nikki nicht gekommen ist. Es sind nur zehn Minuten. Die kann ich auch noch warten.«
»Aye, ja, warum nicht, klar, klar. Ja, warum nicht.« Tracey tätschelt ihr eigenes Knie und sieht dabei Margos an. »Sie schulden denen gar nichts, das wissen Sie? Sie haben denen lang genug Zeit gegeben, um herzukommen. Sie haben getan, was in Ihrer Macht steht. Sie müssen nicht warten.«
Margo weiß nicht, warum Tracey den Plural benutzt. Der geschlechtsneutralen Form zuliebe? Oder weiß Tracey etwas, was Margo nicht weiß? Ist Nikki trans, oder haben gerade mehrere Leute Margo versetzt? Ist das besser oder schlimmer?
»Na ja, ich warte die zehn Minuten noch ab.«
»Natürlich.«
»Wenn das in Ordnung ist.«
Tracey nickt und lächelt unbestimmt. Sie luftnotrettet den grünen Stein aus der Schlucht ihres Ausschnitts, macht aber keine Anstalten zu gehen. Sie will nett sein, mit ihr warten und Margo die Möglichkeit geben, über ihre Gefühle zu reden, falls sie möchte. Margo traut ihr kein Stück.
Laut sagt Margo dann nur, dass es hier ja sehr ruhig zugeht, ist das immer so? Tracey erzählt ihr, um ehrlich zu sein, machen sie eigentlich gar nicht mehr so viele Mediationen von Familienzusammenführungen. Früher schon, aber jetzt finden die Leute ihre leiblichen Familien eher auf Facebook. Sie würde das ja nicht empfehlen. Das kann ganz, ganz böse schiefgehen. Versetzt zu werden ist nicht das Schlimmste, das können Sie glauben. Sie machen sich keine Vorstellung. Ehrlich.
Margo hat sich immer noch an die ferne Möglichkeit eines Autounfalls oder aufregungsbedingten Herzinfarkts geklammert, aber Tracey weiß, dass kein Mensch kommt. Sie arbeitet hier, sie hat das alles schon erlebt. Margo ist plötzlich so wütend, dass ihr schlecht wird, und Tracey merkt das. Sie ergreift Margos Hand und drückt sie mitleidig, was es noch schlimmer macht.
Margo legt ihre andere Hand auf Traceys und drückt zurück, vielleicht ein bisschen zu fest, und dann heult sie vor Wut los. Lilah nennt es das hässlichste Heulen überhaupt.
Tracey sagt nettes Zeugs: Na kommen Sie, das wird schon wieder, das wird alles wieder. Es hätte schlimmer kommen können.
Margo jodelt: »Wie sollte es denn bitte noch schlimmer kommen?«
Tracey spricht sanft: Das ist nicht das Schlimmste, was ich mitangesehen habe, ganz und gar nicht. So etwas kann sehr übel ausgehen, besonders wenn es keine Mediation gibt. In welchem Zustand die manchmal sind! Kann man nicht mal vorher in den Spiegel schauen und sich die Haare waschen? Wir haben hier schon richtige Arschlöcher gehabt. Tracey äußert sich jetzt wesentlich freimütiger als bei Margos Ankunft. So was kann der Horror sein, und sie muss es wissen, denn sie hat das selbst durchgemacht, oh ja, und deshalb arbeitet sie hier nämlich, ehrenamtlich, wegen ihrer eigenen schrecklichen, schrecklichen Erfahrung.
Sie sieht Margo an, wartet auf die Nachfrage, aber Margo ist egal, was Tracey passiert ist. Das hier passiert ihr jetzt gerade, und sie ist überfordert.
Es dauert einen Moment, bis Tracey kapiert, dass sie nicht danach fragen wird. Sie blinzelt, klappt diese Kiste der Schrecken wieder zu und macht weiter, spricht in Gemeinplätzen: Wenn sich die Leute im Internet kennenlernen, na ja, viele sind viel zu jung. Hassen nicht alle Teenager ihre Eltern? Bei Tracey war es auf jeden Fall so. Das gehört zum Großwerden dazu, oder? Es ist so verlockend, sich eine andere Familie zu suchen. Anfangs ist die Begeisterung groß, man hat immerhin ein Geheimnis gelüftet, nicht? Alle sind darauf konzentriert, was sie gemeinsam haben, und man ignoriert die Unterschiede, die Konfliktfelder, und man ist ein klitzekleines Spürchen zu offen miteinander. Und dann diese leiblichen Familien, oje! Also das ist noch mal ein ganz anderes Paar Gummistiefel. Bei den meisten Leuten sind Sachen los, verstehen Sie mich nicht falsch, aber manchmal haben Sie es einfach mit schlechten Menschen zu tun, die zum Beispiel Geld wollen. Es hat schon Situationen gegeben … Stalking, Polizeieinsätze …
Tracey steigen Tränen in die Augen. Das ist ihre Geschichte. Margo hat nicht nachgefragt, als sie sollte, aber Tracey hat es trotzdem geschafft, sie auf den Tisch zu bringen. Sie sorgt dafür, dass es hier um sie geht. Ihr Kinn zittert, gleich wird sie weinen, und jetzt reicht es Margo. Sie hebt beide Hände.
»Tracey, nein, hören Sie, es tut mir wirklich leid – das ist so schon alles zu viel für mich. Meine Adoptivmutter ist kürzlich gestorben, ich habe mich von meinem Partner getrennt …« Sie fängt sich, bevor sie damit herausplatzt, dass sie schwanger ist. »Könnten Sie mich allein lassen?«
Tracey nimmt es gut auf. Sie sagt, natürlich, überhaupt kein Problem, lassen Sie sich Zeit, und sie steht auf und geht hinaus und schließt vorsichtig die Tür hinter sich, als wollte sie aufpassen, kein schlafendes Baby zu wecken.
Margo versteckt ihr Gesicht und schluchzt. Sie hat sich diesen Moment vorgestellt, seit sie ganz klein war. Ihr wäre ein völliges Fiasko lieber, als dass niemand auftaucht. Sie will wissen, woran Susan gestorben ist, haben sie genetisch bedingte psychische Probleme, sie muss das wissen, für sich selbst, für das Baby. Sind sie anfällig für postnatale Depressionen? Aber sie will auch trivialere Dinge wissen: Wollte Susan sie behalten? Hat sie versucht, sie zurückzukriegen? Ist ihre leibliche Familie arm oder reich, sind sie katholisch oder jüdisch, Iren oder Roma? Sind sie musikalisch? Sportlich? Margo hatte immer das Gefühl, von den vielen Unklarheiten verwässert zu sein. Zersplittert. Sie hat sich vorgestellt, all diese alternativen Ichs existierten in Parallelwelten, und diese anderen Leben haben ihr so viel bedeutet. Sie nährten Möglichkeiten und trösteten sie, wenn es zu Hause elend war.
Aber sie wird nie fragen können. Nikki kommt nicht.
Die Hoffnung, die sie gehegt hat, ist endlich futsch, und ihr wird klar, sie hätte nicht hierherkommen und nach Antworten suchen sollen. Sie hätte überhaupt nicht herkommen sollen. Das ist im Moment zu viel für sie.
Es ist gelaufen. Scheiß drauf und scheiß auf sie alle. Scheiß auf den Tod und auf ihren Ex Joe und den Mief hier drin und Traceys bekloppten Singsang. Scheiß auf alles. Von jetzt an zählen nur noch Margo und die Krabbe in ihrer Gebärmutter.
Heute Abend tut sie sich was Gutes, sie wird allein ins Kino gehen und sich einen Streifen mit Explosionen reinziehen, einen Eimer sprudeliges Zuckerzeug trinken und eine Familienpackung Schokorosinen verdrücken. Sie steht auf, zieht die Haarklammern raus und kratzt sich die Kopfhaut, schüttelt die Haare, lässt sie hochstehen und abstehen und tun, was sie wollen. Sie reibt sich die heißen Augen und verschmiert Wimperntusche auf einer Seite ihres Gesichts.
So sieht sie aus, als sich vor der Tür die Atmosphäre ändert. Sie fühlt es, bevor sie es hört: das gedämpfte Kreischen eines ankommenden Fahrstuhls.
2
Ein plötzlicher Aufruhr draußen, eine schrille Stimme sagt undeutliche Worte, Tracey ruft von ihrem Büro aus ein nervöses »Hallo?«, die neue Stimme senkt sich, nähert sich der Tür.
Die Tür wird eilig geöffnet, bevor Tracey von ihrem Schreibtisch herübergaloppieren kann, und eine sehr kleine Frau betritt den Raum und stellt sich hin.
»O mein Gott!«, kreischt Nikki. »Ich kann nicht fassen, was du da anhast, Patsy!«
Es ist viel auf einmal: Patsy ist der Name auf Margos Geburtsurkunde, der Name, den sie bekommen hat, bevor sie mit zwei Tagen weggegeben wurde. Margo trägt nichts Besonderes, nur eine Baumwollbluse und schwarze Jeans, das ist also komisch. Außerdem ist sie von Nikkis Stimme abgelenkt, die nicht laut oder wütend klingt, sondern nur ein sehr spezielles nervöses Timbre besitzt, darauf eingestellt, sich über plärrende Fernseher und pöbelnde Menschen hinweg Gehör zu verschaffen. Eine Stimme wie bei Patienten in der Praxis, so klingen sehr angespannte Leute und Mütter, die ihre Kinder nicht unter Kontrolle halten können.
»Hallo?«, sagt Margo. »Bist du Nikki?«
»Bist du das?«, fragt Nikki.
Sie mustern einander mit dem unverblümten Starren kleiner Kinder, die sich zum ersten Mal begegnen.
Sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Nikki ist klein und blond und untergewichtig. Margo ist groß, mit dicken schwarzen Haaren, tiefliegenden braunen Augen und schimmernder Haut.
Nikkis Aufzug ist seltsam, sie wirkt verkleidet. Alles, was sie anhat, ist nagelneu und etwas zu groß: eine pieksaubere Trainingsjacke direkt aus der Packung, die Ärmel hochgekrempelt, die dazu passende weite Jogginghose. Über dem properen Grau trägt sie einen beigen Mantel mit baumelndem Stoffgürtel, der noch nie gebunden wurde. Sie sieht aus, als hätte sie einen Unfall gehabt und für den Heimweg fremde Kleidung bekommen. So öde Klamotten passen eigentlich nicht zu einer Frau wie Nikki, weil sie umwerfend schön ist. Sie hat gute Knochen, sie ist elegant und bewegt sich mit einem Bewusstsein für ihre Körpermitte wie eine Tänzerin: Unwillkürlich bewundert Margo die geschmeidige Kurve ihres langen Halses, ihre Wirbelsäule schlängelt sich, als sie in den Raum gleitet, ihre Handbewegungen sind ausdrucksvoll. Und nichts davon wirkt affektiert, sondern unbewusst und natürlich.
Die blonden Haare sind streng im Nacken zusammengebunden. Sie trägt keinen Schmuck und ihr Gesicht ist dick gepudert, wie in der ersten Phase eines Make-up-Tutorials auf YouTube. Margo nimmt an, es ist extra für ihr Treffen. Das ist es aber nicht. Sie wird bald erfahren, dass Nikki den ganzen Tag im Gericht verbracht hat, ihre schlichte, asexuelle Aufmachung ist eine ostentative Botschaft an alte Bekannte und Widersacher, dass ihr Leben jetzt ganz anders ist, dass sie jetzt ganz anders ist.
Sie zittert vor Nervosität, schwebt durchs Zimmer, legt in einer unbeholfenen Pflichtgeste ihre Arme um Margos Ellbogen. Margo hat plötzlich Angst, dass Nikki weinen könnte. Sie sieht in der Praxis oft Gefühlsausbrüche und weiß, emotionale Gesten sind nicht dasselbe wie tiefe Gefühle, sind oft genau das Gegenteil. Sie betrachtet große Dramen mit Argwohn, und wenn sie ehrlich ist, findet sie sie ein bisschen vulgär.
Weil sie nicht weiß, was sie sonst tun soll, erwidert sie die Umarmung, drückt Nikki ein bisschen zu lang an sich. Reserviert streben beide in der Umarmung voneinander weg, halten die Gesichter auf Abstand und geraten aus dem Gleichgewicht, sodass sie von einem Fuß auf den anderen schwanken wie kämpfende Krebse.
Schließlich lassen sie los und sehen einander noch mal an. Plötzlich sieht Margo ihr eigenes Gesicht.
Sie sieht tiefliegende braune Augen und ein spitzes Kinn. Sie sieht gute Haut unter dem ganzen Puder und verirrte Wimpern und Augen wie Spiegel ihrer eigenen. Sie sieht Dinge, die sie an sich selbst noch nie bemerkt hat: Die Brauen bilden fast schon Zacken wie bei Ming dem Grausamen, die Lippen sind leicht asymmetrisch.
Margo schaut diese Echos ihres eigenen Gesichts an und spürt, wie sie sich verändert. All die Splitter-Margos fügen sich zusammen und bilden ein Ganzes, nehmen mehr Platz im Raum ein. Sie ist ein Luftballon, der zum ersten Mal aufgeblasen wird, eine Strichzeichnung, die dreidimensional wird.
Nikki sieht die Ähnlichkeit auch. Einen reglosen Moment lang ist nichts im Raum bis auf zwei gleiche Augenpaare, die einander aufsaugen.
Sie setzen sich, ihre Knie berühren sich, Nikki auf dem Sofa, Margo auf dem Bürostuhl. Tracey setzt sich einen Platz weiter aufs Sofa und lehnt sich zurück, eine Schiedsrichterin, die den Kämpferinnen Raum lässt, einander wehzutun, sie lächelt und legt den Kopf auf eine Art schief, die künstlich wirkt. Margo spürt, dass sie ihnen nicht wohlgesonnen ist, und versucht Tracey ins Gespräch zu ziehen. »Wollten Sie nicht gerade schließen?«
»Ich warte sehr gerne noch.« Tracey blinzelt langsam, zeigt, wie geduldig sie ist, sagt aber zu Nikki: »Sie sind fast zwei Stunden zu spät.«
»Wurde aufgehalten.«
Margo fragt: »Wodurch?«
»So Zeug. Hab auf was gewartet«, sagt Nikki, »aber sie haben es nicht drangenommen, und sie haben die ganze Zeit nicht gesagt, dass sie's nicht drannehmen, erst so vor zehn Minuten. Ich konnt’s nicht wissen.« Sie schüttelt den Kopf, als hätte sie keine Lust, darüber zu reden, und schaut Margos Haare an. »Unsere Susan hatte auch so irre viele Haare. Dicke schwarze Haare. Daher hatte sie ihren Spitznamen. ›Hairy‹ haben sie sie genannt.«
Margo zieht eine Grimasse. »Hairy« ist Glasgower Alte-Damen-Jargon, eine abwertende Bezeichnung für ein primitives Unterklassemädchen. Ein Überbleibsel aus König Edwards Zeiten, als nur niedere Mädchen keine Hüte trugen. Nikki merkt, dass das Margo nicht gefällt.
»Nein, ich weiß«, sagt sie und zerrt verunsichert ihren Mantel zu. »Ich weiß, es ist nicht sehr nett, sie Hairy zu nennen, aber wir hatten damals alle bescheuerte Namen, so war das einfach. Mich haben sie ›Goofy‹ genannt. Ich hatte früher so vorstehende Zähne.« Sie schiebt mit zwei Fingern die Oberlippe hoch, um Margo zu zeigen, wie es ausgesehen hat. Margo merkt erst jetzt, dass sie falsche Zähne hat. »Ja. Hat mir ein Ex-Lover ausgeschlagen.« Nikki verzieht das Gesicht, weiß, dass sie alles falsch versteht. »Ich meine, eigentlich hat er uns damit einen Gefallen getan.« Sie sieht Margo flehentlich an.
»Wie war Susan?«
»Klein. Schlagfertig. Witzig …« Sie lächelt bei der Erinnerung an ihre jüngere Schwester, aber ihr Gesichtsausdruck verrutscht, wird auf einmal todunglücklich, und ihr kommen die Tränen. Sie flüstert: »Sie war echt schlimm auf Drogen. Heroin. Sie war klein. Sie hatte keine Chance«, und wird rot, blinzelt die Tränen weg, ihr Blick schießt immer wieder zu Margo, nimmt sie stückchenweise auf: Haare, Kleidung, Haltung, Handtasche.
Das hier läuft nicht besonders gut. Der Klassenunterschied zwischen ihnen klafft tief und demütigt Nikki. Und er ist auch für Margo extrem unbehaglich, denn sie denkt nicht gern über Klasse nach oder darüber, wie privilegiert sie ist. Sie hält sich einfach für normal.
Nikki hat Narben auf den Handrücken zwischen den Fingerknöcheln, sehr weiß auf der hellrosa Haut, verheilte Einstichspuren: weiße Haltestationen auf der Karte ihres Versorgungssystems. Sie hat sich regelmäßig etwas gespritzt, aber vor langer Zeit damit aufgehört. Sie hat nicht die Weggetretenheit einer Methadonkonsumentin an sich oder die rammdösige Reizbarkeit einer Person auf Valium. Sie scheint auch sonst auf nichts drauf zu sein.
»Es tat mir so leid, als ich erfahren habe, dass sie tot ist.«
Nikki lässt die Hände sinken, nickt und sagt: »Furchtbar traurig.«
Margo vermutet eine Überdosis Heroin. In Glasgow gab es in den Jahren um ihre Geburt die reinste Epidemie an Überdosen, und jetzt, wo sie Nikkis Hände gesehen hat, erscheint es ihr noch wahrscheinlicher. Sie hofft, dass es das ist und kein Selbstmord, nichts, was mit einer katastrophalen erblichen Störung zu tun hat.
»Du hast in deinen Briefen nicht genau erklärt, wie sie gestorben ist.«
Nikki zuckt entweder zusammen oder sie zwinkert. Margo hofft, dass es ein Zusammenzucken ist. »Ich fand es nicht richtig …«
»Darf ich dich ganz offen etwas fragen?«
Nikki stimmt mit einem Nicken zu.
»Warst du auch heroinabhängig?«
Nikki wirft einen Blick auf Tracey und unterdrückt ein Grinsen. Es zuckt um ihre Lippen, aber ihr Blick ist stählern. »Warum fragst du mich das?«
»Deine Hände. Ich weiß, du hast dir Drogen injiziert, aber ich sehe, dass du nicht mehr drauf bist.«
Nikki zerrt die Mantelärmel über ihre Hände und reckt trotzig das Kinn. »Seit vier Jahren clean und trocken.« Ihr Blick ist erbost, dass Margo gefragt hat, und dann auch noch vor Tracey.
»Vier Jahre? Das ist beeindruckend«, sagt Margo. »Harte Arbeit.«
»Fixen ist viel härtere Arbeit. Wenn man das Arbeitsethos von Süchtigen anderweitig einspannen könnte, wäre Glasgow ein Paradies.« Angetan von ihrer eigenen Schlagfertigkeit lächelt Nikki und lässt für einen Moment die Deckung sinken.
»Ich bekomme in der Praxis viele Süchtige zu sehen«, sagt Margo. »Ich habe eine vage Ahnung davon, was du da geschafft hast.«
»Du bist Ärztin. Du bist beeindruckend.«
Margo ist eigentlich nicht beeindruckend. Sie kommt nicht sehr gut klar. Sie hatte nach Janettes Tod einen kleinen Zusammenbruch und drückt sich seitdem vor der Arbeit, weil sie Angst hat, nie wieder arbeiten zu dürfen, wenn sie zugibt, dass sie psychisch labil ist. Sie passt das Kompliment zurück: »Nein, Nikki, du bist beeindruckend. Vier Jahre, das ist beeindruckend. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und dass du geschrieben hast.«
»Aber ich hab dir seit Jahren geschrieben, und du hast nie geantwortet.«
Margo will Janette, die die Briefe versteckt hat, nicht bloßstellen, ihr fällt aber sonst nichts ein. Sie zuckt die Achseln. »Meine Mum – meine andere Mum. Sie hat die Briefe nicht weitergegeben. Ich weiß gar nicht, warum. Sie ist vor kurzem gestorben, und da hab ich sie gefunden.«
Sie erwartet, dass Nikki nach Janette fragt, wer war sie, hat sie Margo anständig großgezogen, wie war ihre Kindheit, aber Nikki tut es nicht. Ihr Blick schießt kurz zur Seite, schüttelt das unwillkommene Thema ab, wie man ein Staubtuch ausschlägt.
»Ich dachte schon, du willst nichts mit mir zu tun haben«, seufzt Nikki. »Aber das Timing könnte nicht besser sein. Weil du Ärztin bist, weißt du? Der Fall jetzt gerade … da kannst du helfen.«
Nikki erwartet, dass Margo nach diesem Fall jetzt gerade fragt, der ihr ganz klar so wichtig ist. Sie schaut Margo auf den Mund und nickt langsam. Aber Nikki hat nicht nach Janette gefragt, und das ist Margo wichtig. Sie hat zwei Stunden gewartet. Sie weiß nicht, warum sie immer die Folgsame sein soll.
»Na, jedenfalls, Nikki, ich möchte dich so viel fragen. Wann ist Susan gestorben?«
»Was?«
»Wie lange nach meiner Geburt?«
»Nicht lang.« Nikki passt der Themenwechsel nicht. Ihr Blick wird hart.
»Und sie hat mich zwei Tage nach meiner Geburt weggegeben?«
»Nein, sie hat dich sofort weggegeben.« Sie merkt, dass das nicht gut ankommt. »Hör zu, Susan wollte dich behalten, aber wie die Dinge lagen … sie hatte einen Haufen Probleme, Drogen. Schlimm. Also … so war das.«
»Entschuldige. Ich hab mich nicht gut ausgedrückt. Ich mache niemandem einen Vorwurf.«
Nikki nickt und blinzelt und starrte auf Margos Bluse, dann lächelt sie leicht und wechselt das Thema. »Okay, pass auf, ich muss das wissen: Kannst du hellsehen?«
»Kann ich was?«
»Hellsehen. Das können in unserer Familie viele. In die Zukunft sehen, solche Sachen?«
»Nein, das kann ich leider nicht.«
»Oh.« Nikki ist enttäuscht. »Ein Jammer, eigentlich zieht sich das zweite Gesicht bei uns durch, sehr stark. Ich hab schon überlegt, ob du deshalb Ärztin geworden bist.«
»Nein, ich, ähm …«
»Ich meine, ich frage, weil – siehst du das? Was du anhast?« Sie zeigt auf die rote Bluse und die schwarze Jeans. »Das ist ein bisschen hellsichtig. Guck …« Sie holt ein vergilbtes altes Foto aus ihrer Schultertasche. »Das hier hab ich dir mitgebracht. Das ist Susan.«
Sie reicht ihr das kleine Bild.
Vor langer Zeit steht Susan Brodie in einem Wohnzimmer, hinter sich eine Kommode und ein Gemälde mit Bergpanorama, und grinst in die Kamera. Ihre Nase ist symmetrischer als die von Margo und ihr rechter Schneidezahn steht schief, aber sie hat Margos buschige schwarze Haare, ihre Augen, ihre Haut, ihr Gesicht. Sie trägt eine seidige rote Bluse mit großem Kragen und einen schwarzen Bleistiftrock, wie eine Kellnerin im Steakhouse. Im Grunde das, was Margo jetzt anhat. Margo ist gebannt von dem Foto.
»Wow.«
»Ich weiß. Siehst du die Klamotten, siehst du, was ich meine?«
»Ja.«
Nikki kichert entzückt. »Das ist deine Mum.«
»Das ist meine Mum«, wiederholt Margo.
So sitzen sie eine Weile da.
»Das ist für dich. Behalt es«, flüstert Nikki.
»Danke.«
Margo steckt es weg, in eine Innentasche ihrer Handtasche, und sieht, wie Nikkis Blick ihm folgt. Das Foto herzugeben ist ein Verlust. Damals hat man nicht viele Fotos gemacht. Sie dankt Nikki, aber es fühlt sich nicht ausreichend an.
»Entschuldige, Nikki, ich will nicht abfällig klingen, es ist nur so, ich bin eben Wissenschaftlerin und glaube eigentlich nicht an dieses Zeug.« Ihre Skepsis kommt nicht gut an. Sie versucht es sanfter. »Glaubst du, du kannst hellsehen?« Ob sie Stimmen hört?
»Oh nein«, sagt Nikki ernst, »ich hab die Gabe nicht. Es ist nur … wir brauchen wirklich eine Ärztin, und dann bist du eine. Ich dachte, vielleicht hast du’s gewusst, irgendwie übersinnlich …«
Diese Ansage führt zu nichts.
»Verstehe«, sagt Margo, »tut mir leid, aber wie gesagt, ich bin Wissenschaftlerin.«
»Oh, dann weißt du also alles.«
Sie starren einander unfreundlich an, und Margo durchbricht das. »Hat Susan gewusst, wer mein Vater war?«
Zögern. »Ja.« Langsames Blinzeln.
Es fühlt sich an, als ob Nikki an einer Lüge feilt. Auf Margos Geburtsurkunde steht kein Vater.
»Ich meine, es ist okay, wenn sie nicht …«
»Barney Keith.«
Der Name klingt erfunden. »Ja? Aber sie hat den Namen nicht in meine Geburtsurkunde eintragen lassen.«
»Du würdest seinen Namen nicht wollen.« Nikki kann sie nicht ansehen. »Sie hat dir damit einen Gefallen getan. Er ist wahrscheinlich sowieso längst tot.«
Kälte breitet sich zwischen ihnen aus. Margo weiß nicht, was sie falsch gemacht hat. Sie will wissen, ob Susan an etwas Erblichem gestorben ist, aber sie weiß nicht, wie sie das jetzt fragen soll.
»Arme Susan …«
»Aye.«
»Es tut mir so leid.«
»Oh, aye, ja. Sie war alles für mich. Sie war meine kleine Schwester. Sie war die Welt für mich und ich für sie. Weißt du, was ich meine?«
»Wie ist sie gestorben …?«
»Ermordet.« Sie sagt es so beiläufig, als spräche sie von einem verlorenen Schal.
»Ermordet?«
»Ja. Das gab’s damals oft.«
»Ach? Damals – von wann reden wir?«
»Aye … späte Achtziger, frühe Neunziger. Kam oft vor.«
»Es tut mir so leid, das wusste ich nicht. Wer hat sie ermordet?«
»Ein Fremder von der Straße.«
»O Gott, wie schrecklich, das tut mir wirklich leid.«
»Ich weiß, wer es war, ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, was er getan hat, ich krieg ihn bloß nicht dran.«
»Oh!« Darüber hat sie Andeutungen in ihren Briefen gemacht, das ist dieser Jack-the-Ripper-Kram. Margo will sie davon weglenken. »Also! Was kannst du mir noch über Susan sagen? War Susan groß?«
»Nein. Etwa eins sechzig.«
»War sie gut in der Schule?«
»Nein.«
»Hat sie gern gelesen?«
»Nein.«
Das läuft nicht gut. Vielleicht würde Nikki lieber über sich reden. »Hast du Kinder, Nikki?«
»Ah, nein, leider.«
»Wolltest du Kinder?«
»Natürlich. Ich bin normal.«
Ein seltsames Motiv zum Kinderkriegen, aber Margo hat Patienten, die aus weniger stichhaltigen Gründen Kinder bekommen haben.
»Wann hat Susan …«
»Du, das sind ziemlich viele Fragen.« Nikki blinzelt nervös. »Ich dachte, wir lernen uns erst mal kennen.«
»Tut mir leid.«
»Schon okay, aber … das ist happig. Heute war … happig.«
»Na klar. Vielen Dank noch mal für das Foto. Es bedeutet mir viel.«
»Gern geschehen. Kann nicht fassen, dass du ihre Haare hast.«
»Ich hab bisher noch nie jemanden mit meinen Haaren gesehen.«
»Ich weiß, ich auch nicht, die sind einzigartig! Das hat sie immer gesagt. Einzigartig!«
Zuversichtlich, dass das Treffen glattläuft, steht Tracey auf und sagt, sie machen jetzt zu, aber ob sie vielleicht noch ein Viertelstündchen bleiben und ein Tässchen Tee trinken möchten? Das ist sehr nett von ihr. Sie bleibt ja jetzt schon länger, obwohl ihre Schicht vorbei ist, in der Hoffnung, dass das Treffen zu retten ist. Margo ist sich dessen bewusst und sagt nein danke, aber Nikki sagt, oh, aye, ja bitte, sie ist am Verdursten. Abgang Tracey. Sie lässt die Tür einen Spalt offen.
Nikki sieht ihr nach, behält den Flur im Blick und flüstert Margo eindringlich zu: »Sie ist von Martin McPhail ermordet worden. Sie hatten nie genug gegen ihn in der Hand, aber du und ich, mit dir als Ärztin, wir können den Scheißkerl drankriegen.«
Margo blinzelt. In der Ferne hört sie einen Wasserkessel pfeifen.
3
»Du bist doch Ärztin, oder?«
»Ja.«
»Patientenakten sind doch heute digital, oder?«
»Ja.«
»Okay. Sie haben ihn zu dem Mord an Susan verhört, aber angeblich war er zu der Zeit im Krankenhaus. Du bist Ärztin, du kannst in seiner Krankenakte nachsehen, du kannst klarstellen, dass er nicht im Krankenhaus war, und wir können beweisen, dass er es war.«
»Entschuldige – warum erzählst du das nicht der Polizei, wenn du so sicher bist?«
»Die Cops wissen Bescheid. Die Cops haben es vertuscht. Eine Verschwörung.«
Margo merkt, wie sie auf Abstand geht. Die Polizei tut so etwas nicht, hat keinen Grund dazu. Nach ihrer Erfahrung von der Arbeit beim National Health Service ist bei einer so großen Organisation gar keine Zeit, irgendwas aufwändig zu vertuschen oder sich zu verschwören, schon weil so viel Zeit für interne Machtkämpfe draufgeht, und ziemlich sicher läuft es bei der Polizei genauso.
»Sie haben gelogen, was sein Alibi angeht, aber du kannst beweisen, dass er in der Nacht nicht im Krankenhaus war. Ich hab alle anderen Beweise, die wir brauchen. Ich hab’s.« Nikki starrt Margo an, ihr Mund steht offen.
»Ich kann das nicht machen.«
»Aber es ist alles auf Computer. Du kannst in seine Akte gehen …«
»Nur wenn er mein Patient ist, sonst nicht. Das ist illegal.«
Nikki schnalzt geringschätzig mit der Zunge.
»Nein«, sagt Margo, »du verstehst das nicht: Ich kann meine Approbation verlieren, wenn ich auf Daten von jemandem zugreife, der kein Patient von mir ist. Wir dürfen nicht einfach Akten aufrufen und darin herumstöbern. Das ist keine Dating-App, du kannst nicht einfach die Einträge deiner Familie und deiner Freunde durchgucken. Für so was haben schon Leute ihre Arbeit verloren.«
»Na ja, ich meine, ich verpetze dich schon nicht.«
»Wenn bekannt wird, was in der Akte steht, prüfen sie im System, wer darauf zugegriffen hat. Das würde sie direkt zu mir führen.«
»Aber wir können es leaken. Dann weiß keiner, dass du es warst. Wir leaken es.«
»Du hörst mir nicht zu: Ich muss mich einloggen, es gibt Sicherheitsüberprüfungen bei der Einsicht in Patientenakten. Sie können jeden Zugriff zurückverfolgen.«
»Du könntest es tun, wenn du wolltest.«
»Das stimmt. Ich will nicht und ich tu’s nicht.« Sie möchte nicht grob sein, aber sie will es sehr deutlich sagen.
»Du lässt ihn einfach davonkommen?« Nikki sieht angewidert aus. »Er hat deine Mutter ermordet, und du guckst einfach weg?«
»Na ja, was interessant ist an dem, was du sagst, was mir auffällt, wenn ich dir so zuhöre …« Margo hat ihre Techniken. Die meisten ihrer Zunft sind nicht sonderlich gut in sozialer Kompetenz, aber sie schon. Sie kann ein Gespräch gestalten und lenken, vom Ärger über Nachbarn zu dem riesigen, sich ständig verändernden Muttermal am Hals eines Patienten. Sie bekommt in der Praxis erstaunlich viele Verschwörungstheorien zu hören und verfolgt sie aufmerksam. Manchmal weist das auf verborgene psychische Störungen hin. Manchmal heißt es nur, dass jemand online zu viel Müll liest und mehr aus dem Haus kommen müsste. »… warum sollte die Polizei Susans Mörder ein Alibi geben? Welches Interesse können sie daran haben?«
»McPhail war damals ein Cop.«
Margo blinzelt.
»Sie werden ihn nie stellen. Sie müssten richtig viel Entschädigung zahlen, wenn herauskäme, dass er schuldig ist. Er ist unantastbar. Das weiß er.«
»Oh.«
»Aye, ich weiß. Neun Mädels wurden damals in Glasgow umgebracht, man hat zwei Leute verurteilt, denen haben sie es angehängt. Verschleierungstaktik. Um sich abzusichern. Ich weiß, es gibt noch andere Familien, die genauso denken, aber denen wird nicht so nachgestellt wie mir. Ich kann einfach nichts machen. Und es wird schlimmer. Er schreibt mir immer noch.«
»Er schreibt dir?«
»Bedroht mich. Macht mir klar, dass er weiß, wo ich wohne, schreibt, er bringt mich um.«
Margo sagt es reflexhaft: »Du solltest zur Polizei gehen … oh.«
»Siehst du, was ich meine?«
»Oh.« Sie würde gern etwas Aufmunterndes sagen, aber eigentlich will sie nur noch hier weg. »Unterschreibt dieser McPhail die Briefe?«
»So gut wie. Er schickt mir Fetzen von den Sachen, die Susan anhatte, als er sie ermordet hat, er beschreibt sie, schreibt Dinge, die nur er wissen kann.«
»Hat das gerade erst angefangen?«
»Er macht das seit dreißig Jahren. Seit sie tot ist, macht er das. Jahre zwischen den Briefen, aber er weiß immer, wo ich wohne. Wenn ich umziehe, schreibt er mir.«
»Trotzdem, wenn du das seit dreißig Jahren bekommst und nichts weiter passiert ist? Eine ziemlich lange Zeit für Drohungen, oder? Das heißt doch wahrscheinlich, dass er in Wirklichkeit gar nichts macht?«
»Bis er’s doch tut. Ich weiß, er genießt es, mich nervös zu machen.« Nikki lächelt bitter. »Ich weiß, dass es ihm darum geht. Aber kennst du den Film? Den über den Cop? In dem die Dings mitspielt?« Sie schnippt mit den Fingern, versucht, sich zu erinnern. »Den kennst du: Er ist Psychiater beim FBI und sie ist ein Cop? Wenn sie ihn nicht rechtzeitig erwischen, tötet er wieder?«
»Ist das nicht in allen so?«
»Aber in dem geht es ihm nicht ums Töten, er will ihnen Angst machen. Am Ende bringt er sie schon um, aber was ihn anmacht, ist ihre Angst, daran geilt er sich auf –« Sie mimt ein bisschen zu anschaulich, wie sie einem Mann einen runterholt. Fehlt nur, dass sie in ihre Hand spuckt.
Das Gespräch hat eine bizarre Wendung genommen. Margo berücksichtigt durchaus den Umstand, dass längerer Drogenmissbrauch Nikki enthemmt hat, mit seltsamen Sprachmustern und eigenartigen Bewältigungsstrategien, möglicherweise Erinnerungslücken, aber routiniert einen Handjob zu mimen ist schon ziemlich hardcore, speziell bei einer Frau Mitte fünfzig in den ersten fünf Minuten einer Familienzusammenführung. Nikki weiß, dass sie einen Schnitzer gemacht hat, redet aber weiter drauflos. »Wenn du seine Akte nicht prüfen willst, könntest du doch jemand anders dazu bringen, oder?«
Margo schüttelt den Kopf. »Das mache ich nicht.«
»Okay.« Nikki schnaubt entnervt. »Also gut, du könntest noch was anderes tun: Ich hab DNA-Proben von ihm. Ich kann beweisen, dass er Susan umgebracht hat, aber die Cops wollen sie nicht mal untersuchen.«
»Woher stammen die Proben?«
»Von den Briefen.«
»Na ja, falls das klappt, hast du nur den Beweis, dass er die Briefe geschrieben hat, nicht dass er den Mord begangen hat.«
»Aber nur der Mörder konnte die Briefe schreiben, weil er mir Sachen schickt, die sie in der Nacht bei sich hatte, in der Mordnacht. Ich hab das Beweismaterial. Was ich brauche, ist eine Ärztin, die es testet.«
»Du brauchst keine Ärztin, du brauchst ein DNA-Labor.«
Aber Nikki hört nicht zu. »Heute, ja? Ich war bei Gericht, am High Court, da war so ein armes Schwein mit russischem Namen angeklagt, Moorov, für einen von diesen alten Morden vor Gericht. DNA. Er wurde damals nicht mal befragt, sie dachten, ihr Freund war’s.«
»Du warst dort?«
»Ich hab gewartet, dass der Fall verhandelt wird, aber sie haben ihn nicht aufgerufen. Wir haben alle stundenlang gewartet. Ich musste da hin, für Susan. Deswegen hab ich an was Übersinnliches gedacht, das Timing und alles passt so gut.«
Margo räumt ein: »Ja, schräg ist das schon.«
Und Nikki erwärmt sich. »Oder? Ist doch so!«
»Ja.«
»Aber ich meine, was heißt das? Dass ich dich am selben Tag treffe, an dem das dran ist: nichts. Es heißt gar nichts. Aber es ist schräg.«
»Es ist ziemlich schräg.«
Sie sind sich einig: Das ist ziemlich schräg. Und irgendwie überbrückt das die Kluft zwischen ihnen, denn der Wille, sich zu verstehen, ist da. Aber Margo sieht, dass sich Nikki unvermittelt fragt, wie sie sie einspannen kann, um zu kriegen, was sie will.
»Ich dachte, McPhail könnte heute da sein.«
»Warum?«
»Bei dem war er auch der Täter. So was genießt er. Uns alle zu beobachten. Sie sagen, sie haben die DNA von dem Russen an dem Mädel gefunden. Heißt das, er hat sie umgebracht? Ich weiß nicht. Könnte auch wieder McPhail gewesen sein. Die Kleine war auf dem Straßenstrich, verdammt, sie muss von DNAs gewimmelt haben. Aber weißt du …«, sie beugt sich zu Margo vor, »… die DNA auf den Briefen – das ist definitiv er.«
»Also … entschuldige, was genau ist mit Susan passiert?«
Nikki holt Luft und bremst sich. »Sie wurde in einem Van entführt. Sie wurde ermordet. Ihre Leiche wurde an einer Bushaltestelle in Easterhouse abgeladen und am nächsten Morgen gefunden.«
»Meine Güte, und das war …?«
»Am zwölften Oktober 1989. Ihr Todestag war erst neulich. Ich zünde eine Kerze an … Heute erinnert sich kaum noch jemand, aber damals war es wie zu Zeiten von Jack the Ripper. Da draußen starben die Mädchen wie die Fliegen, und niemand erinnert sich. Den Cops war es scheißegal, niemanden schert’s, aber du könntest mir helfen, wenn du willst. Du könntest in seine Akte schauen. Du könntest seine DNA untersuchen.«
»Ich verstehe.« Margo hat teilweise dichtgemacht. Sie ist selber im öffentlichen Dienst und weiß, so ist die Polizei nicht. Das gibt es nicht, dass Menschen ermordet werden und niemanden schert’s. Sie braucht noch ein paar Informationen, und dann will sie gehen. »Wie alt war Susan, als sie mich bekommen hat?«
Nikki zuckt die Achseln. »Neunzehn?«
»Oh, nicht ganz so jung, wie ich dachte …« Sie ist davon ausgegangen, dass Susan minderjährig war, vielleicht zu jung, um sich um ein Baby zu kümmern. Neunzehn scheint doch ziemlich erwachsen.
»Also, die Cops wollten nicht zugeben, dass McPhail es getan haben könnte. Weigern sich heute noch. Aber er war korrupt. Er hat gegen Blowjobs Stoff ausgegeben, er war gewalttätig, er hat sich im Auto über die Mädchen hergemacht, zwei, drei auf einmal, er stand auf Pissen. Ich meine, wir kannten ihn alle, ich, Susan, alle Mädels, die für Drogen auf dem Strich waren, oh aye, wir haben es alle gewusst.«
Hat Nikki Margo gerade gesagt, dass ihre leibliche Mutter eine drogensüchtige Straßenprostituierte war? Margo blickt auf und sieht, dass es so ist. Nikki beobachtet, wie es ankommt. Trotzdem glaubt Margo nicht, dass sie es ihr in gehässiger Absicht erzählt hat. Es musste wohl einfach nur raus.
»Im Ernst?«, sagt Margo. »Susan? Sie war …« Ihr fällt kein gutes Wort ein. »Da draußen?«
»Sie wollte das nicht. Niemand will das. Sie hat’s getan, weil sie verzweifelt Stoff brauchte, unsere Susan. Einfach unglaublich, das Schlimmste, was ich je gesehen hab. Hab nie jemanden gesehen, bei dem es so schlimm war. Sie hat dreihundert am Tag ausgegeben.« Nikki legt die flache Hand auf die Brust. »Ich? In meinen schlimmsten Zeiten zweihundert, und ich war schon schlimm.«
»Und diese Abhängigkeit führte Susan in die … Sexarbeit?«
»Oh ja. Sie hat auf dem Drag Richtung Anderston angeschafft, da gab’s Männer, die machten Jagd auf uns wie Jack the Ripper. Genau wie er, genauso bösartig. Manche Leute glauben, es war alles ein Kerl, manche denken, es war alles McPhail …«
»Nikki … das ist mir zu viel.«
»Ja, ich weiß, also – nicht die Akten, aber hilfst du mir mit der DNA?«
»Nein, ich meine das Ganze, es ist mir zu viel. Ich bin nur hier, um zu erfahren, woher ich komme, das ist nichts für mich.«
»Aber sie ist deine Mum.«
»Nicht für mich.«
Margo räuspert sich. Sie hat Angst, den Blick zu heben und Nikki in die Augen zu sehen.
Draußen im Büro hören sie, wie Tracey den Tee fertig macht, den Kühlschrank öffnet, um Milch rauszuholen – ffutt – ihn zumacht – fump – ein Tablett belädt. Margo plant, wie sie von Nikki wegkommt. Wenn sie unten auf der Straße sind, wird sie weglaufen oder in ein Taxi springen, scheiß auf das alles hier.
»Du bist wie alle anderen«, flüstert Nikki. »Es ist dir egal.«
»Nein, das nicht, Nikki, aber ich bin nicht hier, um mich in etwas verwickeln zu lassen … ich muss das erst mal verarbeiten.«
»Du könntest helfen, wenn du willst.« Nikki macht die Augen schmal. »Du bist gescheit. Eine gescheite Studierte.«
Nikki hat keine Ahnung, ob Margo gescheit ist; was sie meint, ist: Margo ist Mittelklasse und man wird ihr zuhören, sie hat Zugang zu Ressourcen und Krankenakten und DNA-Laboren und Nikki nicht. Ja, Margo hat diesen Zugang, und sie behält ihn, weil sie nach den Regeln spielt, die Grenzen kennt, weiß, wann man den Mund halten muss, und weiß, dass man der Polizei keine Verschwörung vorwirft.
»Ich glaube, Tracey will jetzt Feierabend machen.«
»Es ist dir egal.«
»Ich glaube wirklich, du solltest die Briefe der Polizei geben.«
»Hab ich. Die sagen, das hat nichts zu bedeuten.«
»Also wenn die Polizei das sagt …«
»Du könntest die DNA doch prüfen.«
»Hör zu: DNA-Tests dienen nur zur Bestätigung und sie kosten Geld und wären in diesem Fall komplett sinnlos, weil ich keinen Zugang zu einer Datenbank habe, mit der ich die Proben abgleichen kann.«
»Kannst du den Zugang nicht kriegen?«
Nikki ist frustriert, aber es gibt so viel zu erklären, dass Margo nicht weiß, wo sie anfangen soll. Sie will nur aufstehen und gehen, aber in dem Moment wischt sich Nikki mit der Hand die Nase ab. Sie wischt von links nach rechts und wieder nach links, benutzt den Zeigefinger und rollt beim Zurückwischen die Hand ein. Es ist eine sehr charakteristische Geste, ausgeführt auf eine sehr charakteristische Weise. Eine leichte Falte an ihrem linken Nasenflügel zeigt, dass sie genau diese Bewegung seit Jahren wiederholt. Margo hat das auch gemacht. Sie hat es früher immer gemacht, bis Janette schimpfte, sie solle es lassen – benutz ein Taschentuch, meine Güte, das ist ekelhaft. Sie muss sich bis heute ermahnen, es nicht zu tun. Sie hat diese Geste nie, absolut nie bei jemand anderem gesehen.
»Du bist doch Ärztin. Ich meine, wer denn sonst, wenn nicht du?«
»Nikki«, sagt Margo vorsichtig, »hör mir bitte zu: Ich mische mich da nicht ein. Es ist nicht so, dass ich dir nicht helfen will; ich kann dir nicht helfen. Ich versuche, mich sehr klar auszudrücken. Du hast das Vorgehen missverstanden, wie man Zugang zu Krankenakten bekommt und was man mit DNA-Proben erreichen kann.«
»Oh. Okay.« Nikki schlägt die Beine übereinander, von ihr weg. »Okay, na dann, schön. Worüber willst du dann reden, wenn du nicht über Susan reden willst?«
Über mich, denkt Margo. Ich will über mich reden. »Ich möchte schon über Susan reden …«
»Es war hart für eine Süchtige, eine komplette Schwangerschaft durchzuziehen, weißt du? Es war für uns alle hart.«
Jetzt reicht es Margo. »Pass auf, ich weiß, Susan war clean, als sie mich bekommen hat.«
Nikki sieht schuldbewusst aus. »Nein, war sie nicht. Sie war heroinabhängig, sie war drauf bis zur letzten Minute, bevor du geboren wurdest …«
»Nein, war sie nicht. Ich weiß, dass das nicht stimmt.«
Sie sieht, wie Nikki überlegt, woher sie das wissen kann. »Nein, aber …«