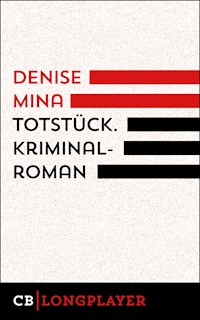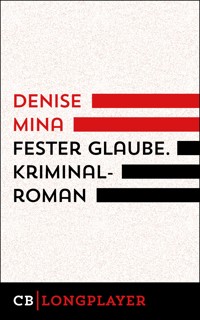
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wer’s glaubt, wird selig Viele von uns laufen vor irgendetwas weg. Anna McDonald kann ein Lied davon singen. Auch jetzt flüchtet sie Hals über Kopf aus dem Familienurlaub, den sie selbst angezettelt hat. Und macht sich auf die Suche nach einer verschollenen YouTuberin, Lisa Lee. Die scheint beim Stöbern in einem Château über ein religiöses Artefakt gestolpert zu sein, das mit einer bösen Vorgeschichte daherkommt. Wie böse, das wird sich bald zeigen … Ein furioser neuer Roman der schottischen Noir-Meisterin, ein rasanter Roadtrip mit den tollen Figuren aus Klare Sache (Deutscher Krimipreis international). »Mina treibt die Handlung in atemlosem Tempo voran, und Anna ist eine mitreißend peppige Erzählerin. Selbst für True-Crime-Podcaster wird die Wahrheitssuche brenzlig in diesem lebhaften, kurzweiligen Thriller.« Kirkus Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Viele von uns laufen vor irgendetwas weg. Anna McDonald kann ein Lied davon singen. Auch jetzt flüchtet sie Hals über Kopf aus dem Familienurlaub, den sie selbst angezettelt hat. Und macht sich auf die Suche nach einer verschollenen YouTuberin, Lisa Lee. Die scheint beim Stöbern in einem Château über ein religiöses Artefakt gestolpert zu sein, das mit einer bösen Vorgeschichte daherkommt. Wie böse, das wird sich bald zeigen …
Ein furioser neuer Roman der schottischen Noir-Meisterin, ein rasanter Roadtrip mit den tollen Figuren aus Klare Sache (Deutscher Krimipreis international).
Die Autorin
Die Schottin Denise Mina brach nach einer rastlosen Kindheit in Glasgow, Paris, London, Invergordon, Bergen und Perth die Schule ab, jobbte halbherzig in einer Fleischfabrik, in Bars, als Köchin und als Krankenpflegehelferin, qualifizierte sich dann per Abendschule fürs Jurastudium an der Uni Glasgow, das sie auch abschloss. Statt wie geplant in Kriminologie und Strafrecht zu promovieren, begann sie Krimis zu schreiben. 2014 wurde sie in die Hall of Fame der Kriminalliteratur aufgenommen. Sie veröffentlichte bisher 17 Romane und bekam mehr als ein Dutzend Preise, zudem verfasst sie Shortstorys, Bühnenstücke, Graphic Novels und macht TV- und Radiosendungen, unterrichtet Schreiben und sitzt in Jurys.
Über die Übersetzerin
Denise Mina
Fester Glaube
Roman
Für unsere Mum Edith. Als sie starb, ist der globale Panache-Quotient
»Kunst ist eine Täuschung.«
Vorbemerkung von Else Laudan
Wie wohltuend wäre in diesen Zeiten der feste Glaube daran, dass doch noch alles gut wird – doch die Tage unbeirrbaren Glaubens sind wohl gezählt. Oder ist es andersherum, steigt die Bereitschaft schon wieder, alles Mögliche zu glauben?
Wieder sind es Erzählungen, historische und hochmoderne Narrative, die Denise Minas ideensprühenden Roman vorantreiben. Urban Exploring, das Erkunden verlassener Gebäude mit einer Webcam, ist mehr als ein typisches Hobby unserer Zeit: Es gibt einen Kodex und eine Tradition, die bis in die 1970er zurückreicht – anfangs ging es ums Überwinden von Angst, darum, sich dem Ungefügen und Unbegriffenen zu stellen, dann um Guerilla-Aktionen und subversives Theater. Aber Anna McDonald und Fin Cohen folgen für ihren Podcast noch einer anderen Fährte in die Vergangenheit: der eines mysteriösen religiösen Artefakts. Die verschwundene Lisa Lee hatte es, der südafrikanische Schmuggler Bram van Wyk will es, ein geheimnisvoller Pater kennt es gut.
Und wie so oft bei Mina ist jede Figur der Geschichte verblüffend präsent. Mit schnellem Pinselstrich entwirft sie faszinierende Gestalten, die ganze Netflixserien tragen könnten. Fester Glaube, geschrieben mit sichtlichem Spaß am rastlosen Umhertigern in der Geschichte, macht viele Fässer auf und weckt Lust auf noch mehr – mehr Streifzüge in historische Episoden und alte Denkgebäude, mehr Experimente mit Formen, mehr Risikobereitschaft beim Erzählen. Nimmermüde jongliert Mina mit den Möglichkeiten des Spannungsgenres, übertritt Grenzen, erschließt Neues. Fest ist hier gar nichts: Selten war Unruhe so produktiv.
1
Als Lisa Lee verschwand, hatte sie ein Jahr lang auf ihrem YouTube-Kanal Kurzfilme gepostet. Mehr als etwa dreißig Abos hatte sie bis dahin nicht. Dafür gab es keinen besonderen Grund, ihre Filme waren interessant und nicht schlecht gemacht, der Sound war gut, sie waren nur ein bisschen daneben.
Lisa war ein bisschen daneben.
Sie spielte die Hauptrolle in allen ihren Filmen, aber ihr Gesicht war ausdruckslos, ihr Text vorhersehbar. Sie streifte durch umwerfende verlassene Gebäude, richtete die Kamera auf einen Tisch und sagte: Oh, guckt mal, da steht ein Tisch. Durch diese leicht geistlose Fadheit wirkte sie, als wäre sie auf Medikamenten, was die Frage aufwarf, weshalb sie Medikamente nahm, und schon war man nicht mehr bei dem Film. Wenn man erst mal über sie nachdachte, stellte man sich prompt noch mehr Fragen: Warum filmte sie sich beim Einbrechen? Hatte sie keine Angst, verhaftet zu werden? Wollte sie über etwas wegkommen oder floh sie vor irgendwas? Warum hatte jemand mit so einem starken Arbeiterklasse-Akzent ein dermaßen aufwendiges, teures Hobby? War der Akzent aufgesetzt? Wieso trug eine klassisch gutaussehende junge Frau so einen strengen Haarschnitt?
Es gab zu viele Ungereimtheiten, um eine reibungslose Internetsensation zu werden. Lisa war auf vielen verschiedenen Levels zugange.
Nach ihrem Verschwinden erreichte die Zahl ihrer Abos einen Höchststand von knapp über einer Million. Ihr Instagram-Kanal ging ebenfalls durch die Decke, obwohl sie vielleicht nie wieder posten würde, oder auch gerade darum.
Die Polizei bat ihren Vater, die Filme aus dem Netz zu nehmen. Man war der Meinung, dass sie Spekulationen förderten, vor allem über das Château, was nur von der Suche nach ihr ablenkte, und sah keinerlei Verbindung zwischen Lisas Verschwinden in North Berwick und ihrer Erkundung eines verlassenen Châteaus in Frankreich.
Was ein Irrtum war.
Es lohnt sich, den Film für die zu beschreiben, die ihn nicht sehen konnten. Es sind bloß so zweiundzwanzig Minuten. Sie hatte ihn sechs Monate zuvor gedreht, aber erst zwei Wochen vor ihrem Verschwinden ins Netz gestellt.
Es fängt abrupt an – Lisa geht durch einen herbstlich kahlen Birkenwald, hält die Kamera mit der linken Hand auf ihr Gesicht gerichtet und schaut nach vorn, als wüsste sie nicht, dass sie gefilmt wird.
Die Luft ringsum wirkt unnatürlich reglos, aber wir hören das Rascheln von totem Laub beim Gehen und ab und zu das leicht saugende Schmatzen nasser Erde unter ihren Füßen. Es muss kalt sein, denn ihre Wangen sind rosa, man sieht ihren Atem ein Stück vor den Lippen, aber der Boden ist nicht mehr gefroren, also ist es vielleicht um die Mittagszeit.
Lisa ist zwanzig, dünn, mit stopplig kurzgeschnittenen blonden Haaren. Sie wirkt ein bisschen nervig. Als sie im Sucher ihr Gesicht sieht, rümpft sie die Nase und zieht die Schulter hoch bis zum Ohr. Sie trägt lässige Army-Kluft: schwarzgraue Tarnhose, Jacke überm Hoodie. Sie hat etwas knisternd Nervöses an sich, mit Recht, denn sie will gerade in irgendjemandes Haus einbrechen, herumschnüffeln und alles beäugen.
Heya. Ich bin in Frankreich! Aufregend. Ich nehm euch mit in ein echtes Schättu, spricht man das so? Schättu? Na jedenfalls so ’n kleines Schloss. Oder so.
Ihr Dialekt ist gemäßigtes Ostküstenschottisch, mit hoher Mädchenstimme.
Wenn’s euch gefällt, gebt ihr mir ein Like, ja? Und Bewertungen helfen wirklich, damit mich andere Leute hier finden … und abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt … Sie guckt kurz in die Kamera, zuckt genervt, reckt im Weitergehen das Kinn vor. Da wollen wir hin. Da rein.
Sie richtet die Kamera auf den Waldrand und ein Türmchen mit grauem Schindeldach, das über die Bäume lugt. Verblasste gelbe Mauern. Es sieht aus wie ein verwesendes Disneyschloss.
Da. Der spitze Turm. Da wollen wir hin. Ich hab gehört, da hat eine große Familie gewohnt – fünf Kids und Ma und Pa, und Oma hat auch da gelebt, ihr wisst schon, also groß für heutige Familien, aber vor paar Jahren sind sie eines Morgens alle weg und nie wiedergekommen. Warum weiß wohl niemand. Und sie haben alles dagelassen, Möbel, Kleider, Puppen und all so was …
Sie geht weiter, hält die Kamera nach vorn, schwenkt über die Baumstämme und den Boden.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein alter Wald, aber dann wird klar, dass die Geschichte komplexer ist. Ein paar Bäume sind umgestürzt. Einige lehnen sich betrunken an ihre Nachbarn, einer fast rechtwinklig, sein freigelegter Wurzelballen hat noch die Form des Topfs, in dem er aus der Baumschule gekommen ist. Das hier ist ein kostspielig kuratiertes Scheinbild eines alten Birkenwalds, was uns zweierlei sagt: Da hatte irgendwer viel Geld, denn so etwas ist teuer, und außerdem den Willen, mit diesem Geld eine Privat-Umwelt zu erschaffen.
Lisa richtet die Kamera wieder auf sich.
Ganz ehrlich, ich mach mir vor Angst in die Hose, an diesem Punkt mach ich mir immer fast in die Hose, aber ich geh da jetzt rein. Darum geht’s ja bei alldem hier. Auf ’ne Art. Darum geht es. Jedenfalls für mich. Sich den eigenen Ängsten stellen und das engagiert mit anderen teilen, sag ich mal … Sie versucht ein Lächeln, aber es gerät zur Grimasse.
Eine plötzliche Bewegung zieht unseren Blick auf sich, fünfzehn Meter hinter ihr im Wald. Zwei Männer nähern sich, bleiben auf Abstand, aber mit Blick auf Lisa, folgen ihr. Einer schaut direkt in die Kamera, einen schwarzen Schlauchschal über Mund und Nase.
Lisa lächelt immer noch verkrampft in die Kamera, da hört sie den Knall eines knackenden Zweigs hinter sich. Angst lodert in ihren Augen auf.
Schnitt.
Jetzt sehen wir ein Standbild: ein katholischer Altar mit dunstigem Gelbfilter. Auf dem Altar liegt ein einfaches weißes Tuch, auf das mit rotem und goldenem Faden ein Christusmonogramm gestickt ist: ein P mit einem X durch den Stamm. Ein großes silbernes Kruzifix steht aufrecht in der Mitte, und an der Seite hängen priesterliche Gewänder an einem Kleiderständer, als wäre der Unsichtbare ordiniert worden und wartete auf seinen Einsatz.
Ich fand diesen Cut verstörend, als ich ihn zum ersten Mal sah. Fast hätte ich ausgemacht. Ich dachte, Lisa wäre von den zwei Männern im Wald überfallen worden, vergewaltigt und ermordet, und der Film wäre ihr zu Gedenken. Aber dann kommt der Filmtitel in einer verrückten albernen Schrift:
Verlassene Villa in Frankreich: Sie ließen alles zurück!
Das ist typisch für ihre Technik. Die ist krude und häufig ohne Bedeutung. Lisa ist keine Filmkünstlerin, sie will nicht subtil sein, sie will uns bloß was zeigen. Aber es fällt schwer, in Schnitt und Technik keine Bedeutung hineinzulesen. Einen Film sehen heißt nach dem Sinn suchen. Die Schnitte ließen meine Mustererkennungsinstinkte anspringen, aber für Lisa war der Schnitt nur das, was sich gerade ergab. Seht euch dies an, nun seht euch das an. Das ist schwer hinzunehmen. Unser Verstand wehrt sich gegen Bedeutungslosigkeit.
Nach ein paar Herzschlägen weicht die Texttafel Drohnenaufnahmen des Walds, von oben durch die nackten Birken auf den Waldboden. Die Einstellung ist superhochauflösend und in Zeitlupe. Jeder Zweig und jedes Blatt in allen Details, auch der Schatten der Drohne hüpft gestochen scharf über die hohen Zweige.
Die Drohne schwebt über den Waldrand hinaus, über einen geschotterten Vorplatz vor dem Château, und man sieht Lisa mit den zwei Männern, die im Wald hinter ihr gegangen sind.
Sie stehen dicht beisammen auf der Treppe zur Eingangstür. Die untergehende Herbstsonne wärmt ihre Gesichter, sie grinsen zu uns hoch, winken und hüpfen, rufen stumm »Hallo!«. Es ist später am Tag, nachdem sie schon drinnen waren, Taschen und Kapuzen fehlen jetzt.
Vielleicht sieht man es nur wegen der Zeitlupe, wäre es schneller, würde man den leichten Stimmungsumschwung vielleicht gar nicht mitkriegen, aber Lisa und die zwei Männer sehen sich an, merken, dass sie übertrieben auf die Drohne reagieren, lachen über sich und äffen ihre eigene Begeisterung nach. Großes gemeinsames Feixen.
Aber da ist noch ein anderer Mann, der gehört nicht zu der fröhlichen Gruppe, steht am Fuß der Treppe, ernst und streng. Er ist stämmig und älter, trägt ein verwaschenes T-Shirt einer Metal-Band und Jogginghosen. Das Kinn auf die Brust gesenkt, sieht er aus, als ob er angestrengt mit beiden Händen auf einem Handy herumtippt. In Wirklichkeit bedient er die Fernsteuerung der Drohne und muss sich sehr konzentrieren.
Die Drohne zieht hoch, zeigt die gelbe Fassade des Châteaus und die Türmchen an allen vier Ecken. Das Dach ist hinten eingebrochen. Rings um das Château sieht man gepflügte Felder und in der Ferne eine Pferdekoppel mit einem weißen Lattenzaun. Eine wohlhabende Gegend.
Die Drohne schwenkt einmal rund um das Gebäude, wird langsamer, als sie sich der Gruppe auf der Treppe nähert. Der Drohnenlenker schaut zu uns hoch, direkt in die näher kommende Linse, seine Augenbrauen dick und schwarz, seine blauen Augen beglückt, sein Arm ausgestreckt wie der eines Falkners. Die Drohne landet und ein warmes Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus.
Schnitt.
Wir sind jetzt im Château und blicken durch eine der schmutzigen Glasscheiben in der Eingangstür nach draußen auf den Vorplatz und die Treppe. Lisa spricht in ehrfürchtigem Ton:
So, ich bin DRIN. Aber ich sag euch was: Der Boden hier fühlt sich echt morsch an. Dieses Gebäude bricht bald zusammen. Das Gefühl kenne ich von anderen Lost Places, es gibt da eine Art Kipppunkt oder so was, wo sich alles wie nasse Pappe anfühlt, und in dem Zustand kann ein Gebäude nicht mehr lange stehen, ja? Als ob’s bald zusammenklappt. Aber jetzt guckt euch hier mal alles an: Seht ihr, wie schnell die Familie abgehauen ist?
Sie dreht sich langsam in der Eingangshalle und zeigt uns eine wuchtige Holztreppe, auf der ein Teppich aus grauem Staub liegt. Daneben steht ein für eine Kinderteeparty gedeckter Tisch mit Tassen und kleinen Tellern, einer silbernen Kaffeekanne und sogar Besteck. Dicker Staub hat sich darübergelegt wie eine Tischdecke.
Die sind einfach so – wusch – alle auf einmal zur Tür rausmarschiert und nie wiedergekommen.
Sie schiebt sich seitlich am Tisch vorbei zu einer kleinen Tür unter der Treppe, öffnet sie und leuchtet mit ihrer Handytaschenlampe hinein. Es ist ein dunkler Korridor, er führt zu einer Steintreppe und hinab in schwarzes Wasser, das träge an den Stufen leckt; die Bewegung verstärkt von einer ölig schillernden Oberfläche.
Gott … Da drin stinkt’s ja furchtbar.
Sie weicht zurück, streckt die Hand aus, um die Tür zu schließen, und die Kamera fängt zufällig die zwei Männer von vorhin ein, die hinter ihr die Halle durchqueren. Sie merken, dass sie gefilmt werden, und erstarren.
Oh, sagt Lisa und dreht sich so, dass sie vor der Linse steht und die Männer über ihrer Schulter im Hintergrund zu sehen sind.
Lisa wirkt hier drin jetzt größer, jünger, ihre Augen leuchtend und weit offen, ihr blasser Teint gerötet. Sie zeigt über die Schulter auf die Männer, beobachtet sich im Sucher.
Das ist Florian.
Er ist groß und dünn, blond, trägt eine Art Schuhlöffel-Schnauzbart und hat die makellose Haut eines sehr jungen Mannes.
Das ist Gregor.
Gregor ist klein und bullig mit einem schiefen Grinsen. Er hat kurze dunkle Haare und eine chaotische Monobraue. Den Mund hat er erwartungsvoll geöffnet, als würde er gleich loslachen.
Das ist das belgische UrbEx-Team, mit dem ich online gechattet habe, das habt ihr vielleicht gesehen … Wir sind alle zusammen hergefahren. Na ja – sie haben mich gefahren. Sagt ihr mal Hallo, Jungs?
Florian und Gregor sind kamerascheu. Florian winkt kurz, quietscht panisch, und beide kichern und wieseln aus dem Bild. Lisa wartet, bis sie im Nebenraum sind, und flüstert:
Wir kommen in der Community nicht immer alle miteinander aus, das wisst ihr, ich hatte auch meine Kämpfe, aber diese Jungs sind echte Schätze. Haben mir grade verklickert, dass ich nicht »Schättu« sagen soll, sondern »Schattoh«. Aber nicht so, dass ich mich voll blöd gefühlt hätte oder so. Sie, na ja, sie haben’s einfach lieb rübergebracht, wisst ihr?
Gedankenlos, wie zum Üben oder aus Freude am Klang, flüstert sie vor sich hin: Schattoh. Geht mal auf ihre Website. Den Link pack ich in die Kommentare.
Durch eine andere kleine Tür führt sie uns in eine Hauskapelle. Sie ist neuer, ein Anbau aus Ytong-Steinen und Beton.
Ich fass es nicht. Seht euch das an! Ich sag’s euch, die Familie war sehr religiös, hier sind überall Kruzifixe und religiöses Zeug.
Weil sie sich mit Katholizismus nicht auskennt, benennt sie fast alles falsch.
Da, das ist … das kleine Podium, wo der Priester predigt … hier Bänke, für die Leute. Tischdecke auf dem Altar – die ist immer noch da. Die Tracht vom Priester. Sogar das Silberkreuz steht noch. Und ich sag euch mal was – das ist ein echt schönes Kreuz. Dass es nicht aus Eisen ist, weiß ich, weil es sonst inzwischen rostig wäre wie sonst was. Seit Jahren hier eingeschlossen. Es ist nämlich aus Silber. Seht ihr die Flecken von der Feuchtigkeit und wie grau es ist? Das ist echt Silber. Die haben es einfach hier stehenlassen. Ein Jammer.
Sie dreht die Kamera zum Boden; nackter Beton, auf dem ein schöner roter Perserteppich liegt. Hier waren die Motten am Werk, haben das Gewebe aufgelöst, das den Flor hält, nun krümelt die Ecke des Teppichs weg wie ein Ingwerplätzchen in einer Untertasse mit Milch.
Schon traurig, diese verwaisten Sachen. Das müsste man retten, das ganze Zeug, weil es ja im Grunde Antiquitäten sind.
Schnitt.
Sie ist in einem riesigen Salon mit gelben Tapeten. Ganze Bahnen sind an der feuchten Wand heruntergerutscht und entblößen glatten nassen Putz. Das Gelb ist hell und fröhlich, Damast mit sehr großem Muster. Das ganze Dekor des Châteaus ist voll mit solchen mutigen Entscheidungen.
Lisa schwenkt die Kamera auf einen tiefschwarz samtigen Schimmelfleck, der sich galoppierend an der Decke ausbreitet.
Au, Scheiße … Sie zerrt sich den Schal vor Mund und Nase. Das will man nicht in die Lunge kriegen, schwarze Schimmelsporen, die sind so schlimm wie Asbest. Muss aufpassen … Manchmal ist Asbest der Grund, warum ein Haus plötzlich leer steht, aber ich glaub nicht, dass es hier welchen gibt. Das ganze Gebäude wirkt renoviert. Der Putz unter der Tapete ist neu. Der Boden sieht ziemlich neu aus. Die kleine Kapelle war auch neu. Sie haben das alles gemacht und sind dann plötzlich weg. Komisch. Aber das Ganze hier ist komisch. Seht euch das an …
Sie schwenkt langsam zu einem weißen Marmorkamin, über dem ein riesiges Bild des von Pfeilen durchbohrten heiligen Sebastian hängt. Auf einem besseren Gemälde von einer besseren Künstlerin würde er in frommer Verzückung gen Himmel blicken, aber es ist nicht besonders gut und er sieht aus wie ein überforderter Aushilfslehrer.
Ich meine …
Schnitt.
Sie ist in einer Küche mit hoher Decke, hell, apfelgrün gestrichen. An den Wänden hängen überall langstielige Kupfertöpfe, so hoch oben, dass sie nur Dekoration sein können, kreuz und quer, aber auch irgendwie ein stimmiges Muster. Wie der Rest des Hauses wirkt der Raum heiter, gestaltet mit gutem Auge und feinem Sinn für Farben und Oberflächen.
Ich fand diese Küche den unheimlichsten Teil des Films, weil manches darin unverkennbar modern war: Den freistehenden Herd in Pastellblau, teure Marke, hatte ich online gesehen und begehrlich betrachtet, den Hochstuhl in dänischem Design hatte ich für meine Mädchen, als sie klein waren. Man kann ihn umbauen vom Hochstuhl zur unbequemsten Sitzbank der Welt. Ein überteuerter Toaster und eine Bodum-Presskanne, die ich in hundert Küchen gesehen habe. Aber alles am Verlottern und dick mit Staub überzogen. Dadurch wirkte die Küche gleichzeitig topaktuell und antiquiert, wie ein Blick aus der Zukunft in die Gegenwart.
Schnitt.
Kurze Einstellung: Lisa auf der breiten Treppe in der Eingangshalle, sie hält sich dicht an der Wand, da regnet plötzlich Staub von der Decke auf sie herab. Sie zeigt uns, wie er tanzt und fällt und das Licht einfängt wie ein Kronleuchter in einem Hotel in Vegas. Lisas Gesicht ist in der Einstellung halbiert und sie erstarrt, den Mund geöffnet, das Auge klar, sieht direkt in die Kamera. Als der Schauer endet, tritt ein frohes Lächeln auf ihr Gesicht. Sie hat es überlebt.
Schnitt.
Sie ist in einem Kinderzimmer und betrachtet eine Fensterbank voll mit Furbys in allen Farben, das Fell staubverfilzt. Ihre toten Augen sind halb geschlossen und sie starren beduselt und herablassend ins Zimmer.
Woah! Echte Furbys. Mit denen könnte man auf eBay fett Kohle machen. Aber nein, so was läuft nicht, wisst ihr. Ist klar. Nichts mitnehmen. Und wenn man anfängt, alles umzustellen, um bessere Bilder zu kriegen, kann man auch gleich zu Hause bleiben. Dafür müsste man nicht extra herkommen … Das bringt nichts.
Schnitt.
Sie kraxelt noch durch ein paar Schlafzimmer und ein Bad mit eingebrochenem Fußboden. Aber der Knaller kommt auf dem Dachboden.
Sie steht in einem kleinen Durchgang im obersten Stockwerk und blickt in einen niedrigen Raum mit einer Reihe verdreckter kleiner Fenster. Es geht ein paar Stufen runter und die Wände sind gesäumt mit Bücherborden, ein paar davon haben nachgegeben und die Bücher liegen am Boden. Vor dem Kamin steht ein bequemer Lesesessel mit einer Stehlampe hinter der Lehne. Hier drin wuchert der Schimmel. Lisa macht das Sorgen, bis sie die Kadaver sieht.
Drei tote Tauben liegen unterm Fenster, ausgetrocknet, nur noch Häufchen aus Federn und Knochen und Schnäbeln. Sie liegen da schon lange. Wahrscheinlich saßen sie hier in der Falle, sagt sie, sind da hinten durch das Loch im Dach rein und haben nicht mehr nach draußen gefunden.
Die armen Dinger. Ach Mann, die armen Würstchen, hier drin gefangen …
Sie ist total mitgenommen von den Leichen, drückt sich beim Kamin an die Wand, steigt über einen Haufen Bücher, um den toten Vögeln auszuweichen. Und da stolpert sie, fällt fast hin, klatscht eine Hand an die Wand neben dem Kamin, um das Gleichgewicht zu halten.
Die Wand öffnet sich.
Es ist eine Geheimtür.
Oh! Oh?
Sie richtet sich auf. Sie sieht sie an, berührt sie, drückt sie ein bisschen weiter auf. Sie lächelt uns an.
Ui …
Sie späht durch den Spalt hinein, blickt wieder zu uns, ihr Mund formt ein lächelndes kleines »O«, dann drückt sie die Tür weiter auf, vergisst uns zu zeigen, was sie sieht.
Was zum …?
Sie schaltet ihre Handytaschenlampe an, leuchtet hinein und macht große Augen.
O mein Gott. Woah!
Mit der Schulter drückt sie die Tür weit auf und hält die Kamera hin, damit wir sehen, was sie sieht.
Es ist ein beängstigender Raum, fensterlos, nichts von der Häuslichkeit des restlichen Châteaus. Wände, Decke und Boden sind schwarz gestrichen. Eine tote Glühbirne hängt am nackten Kabel. Der Boden ist nicht staubig, denn dieser Raum war versiegelt.
In der Mitte steht ein alter Büroschreibtisch aus den 1980ern, davor ein orangefarbener Plastikstuhl in seltsamem Winkel mit Blick auf eine Wand, die kahl ist bis auf ein kleines quadratisches Gemälde, goldgerahmt und mit Zellophan umhüllt. Das Bild auf der Leinwand sieht man nur kurz, es blinzelt uns zwischen den blitzenden Reflexionen von Lisas Handytaschenlampe auf dem Plastik zu.
Das Gemälde zeigt eine Hand. Eine Hand hält einen gelben Stift und schreibt, aber das Bild ist so beschnitten, dass wir nicht sehen, was geschrieben wird. Der Pinselstrich ist grob und impressionistisch, zu ungenau für etwas so Kleines. Es wirkt wie ein Ausschnitt aus einem größeren Bild.
Auf dem Schreibtisch steht eine Schachtel, geformt wie eine Stange Zigaretten aus dem Duty-free-Shop, aber mit abgerundeten Kanten. Sie ist silbern, fleckig und angelaufen wie das Kreuz auf dem Altar. An den Seiten sind kunstvolle erhabene Verzierungen und obendrauf eine Inschrift.
Wooow! Lisa grinst sie an. Scheiße, was geht denn hier ab?
Sie betritt den Raum und streckt die Hand nach der silbernen Schachtel aus. In diesem selbstvergessenen Moment rutscht ihr Ärmel hoch, und wir sehen heftige Narben auf ihrem Unterarm. Wir sehen das nur sehr kurz, wie das Bild mit der Hand; eine ganze Bergkette aus Narbengraten. Lisa muss sich schon seit langem ritzen, tiefe Schnitte ins Fleisch ihres Unterarms.
Schnitt.
Sie ist in einem hellen Raum, möglicherweise einer Garage, und filmt eine Düne aus kaputten Möbeln, angeschwemmt an einer Wellblech-Seitenwand. Einer der Jungs, Florian oder Gregor, fragt sie, ob alles in Ordnung ist. Er klingt besorgt.
Aye! Aye! Ja, mir geht’s prima. Alles gut.
Aber ihre Stimme bebt und die Kamera zittert.
Schnitt.
2
Ich sah diesen Film in einem albtraumhaft schlecht durchdachten Urlaub, damals, als Reisen nicht nur ganz leicht war, sondern die Leute noch darüber maulten.
Ich hatte diesen Urlaub für unsere zersplitterte Patchworkfamilie organisiert, bezahlt und alle zum Mitkommen überredet, weil ich dachte, dass all die anderen Patchworkfamilien nur zu blöd waren, um sich richtig gut zu verstehen. Sobald wir ankamen, war klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte.
Ich meinte es gut. Wir waren eine eingespielte Gruppe, und Fins neue Partnerin Sofia hatte Mühe damit. Er hatte die Hoffnung wohl aufgegeben, dass wir es ihr leicht machen würden. Er wollte nicht, dass sie mitkam, aber ich mischte mich ein und lud sie selbst ein.
Ich hatte mir lange Spaziergänge vorgestellt und große dicke Pullis, Lesen im Bett, Filmabende und Zusammenrücken bei gemeinschaftlichen Mahlzeiten.
So lief es nicht.
Ich organisierte es nicht nur für Sofia, es ging mir auch um meine Mädchen. Wenn wir alle zusammen wegfahren konnten, bräuchten sie sich nicht zu entscheiden, mit welcher Familie sie in die Ferien wollten. Aber Zank und Streit gingen los, sobald wir ankamen, und die Mädchen schlichen umher wie Widerstandskämpferinnen, wichen Spannungen aus, verstummten, sobald jemand von uns hereinkam.
Wir wohnten in einem Leuchtturm, saßen drinnen fest, weil ein schweres Unwetter tobte, gestrandet eine Meile weit draußen auf einer felsigen Landspitze im äußersten Südwesten Schottlands.
Der Wind war so laut, dass man nur mit Mühe den Fernseher hören konnte, wir konnten nicht raus, ohne zu riskieren, von einer Klippe in die Irische See geweht zu werden, und das Warmwasser funktionierte nicht. Jemand wies darauf hin, dass man früher Leute dafür bezahlt hatte, dort zu leben. Es war so zugig und kalt, dass wir fast unsere gesamte Kleidung trugen und den ganzen Tag zusammengepfercht im einzigen warmen Raum hockten, dem Wohnzimmer, wo wir lasen oder einzeln auf Displays starrten und warteten, dass es vorbeiging.
Anwesend waren mein Ex Hamish und Fins Ex Estelle – jetzt ein Paar mit eigenem Baby –, meine beiden Mädchen Jess und Lizzie, zwölf und zehn, Fin und seine neue Partnerin, die attraktive Sofia.
Estelle wärmte an diesem Abend Lasagne auf und wir anderen saßen herum, ignorierten einander und warteten. Sofia redete über Lasagne und die italienische Küche im Allgemeinen, über Zutaten und regionale Variationen. Sofia, das ist natürlich nicht ihr richtiger Name, so ein Rabenaas bin ich nun doch nicht, war elfenhaft und sehr hübsch und hielt einfach nie die Klappe. Wenn sie mal nicht über sich selbst redete, beschwerte sie sich über die Unterkunft oder ihr Zimmer oder das Essen, und nun wärmte Estelle eine Tiefkühl-Lasagne aus dem Supermarkt auf, um sie mit Plastik-Knoblauchbrot zu servieren. Wir wappneten uns alle für eine Szene.
Fin war eh ein passiver Mensch, aber seit er was mit Sofia angefangen hatte, wirkte er regelrecht geschlagen. Ich hatte ihn am ersten Tag zur Seite genommen und ihn gebeten, Sofia zu sagen, sie solle doch ab und zu den Mund halten, ständig kommandierte sie meine Mädchen herum und erzählte ihnen, sie würden fett, wenn sie Zucker aßen. Fin zuckte die Achseln und sagte, Estelle habe ihn auch schon darum gebeten, aber er wisse nicht, wie er es ansprechen solle, Sofia sei sehr zerbrechlich. Das war, bevor sie meiner Zehnjährigen ein Umstyling verpasste, mit dem sie aussah wie eine verbitterte, dreimal geschiedene Golf-Witwe aus Florida.
Wir hatten noch nicht mal eine halbe Woche geschafft. Das Gefühl drohenden Unheils war mit Händen zu greifen.
Die Mädchen sahen Trickfilme auf ihrem gemeinsamen iPad, ein Ohrstöpsel für jede, stumpf vor Langeweile nach einem Tag aufgezwungener Brettspiele. Um sie nicht zu beglucken, widmete ich mich meinem Handy, scrollte durch Twitternachrichten von Leuten, die unseren Podcast hörten. Admin-Arbeit.
Ich las nicht richtig, überflog bloß die Überschriften, aber ich blieb an einem Namen hängen, den ich kannte: Lisa Lee. Es war die Alliteration, die mir ins Auge fiel. Die Nachricht kam nicht von Lisa, es ging um sie und sie war sehr kurz. Sie war fünf Tage alt.
Lisa Lee hat sie nicht genommen. Sagt ihnen das bitte.
Der Absender, er hieß @WBGrates, hatte mehrere Links hinzugefügt. Ich klickte auf den ersten und sah Lisas Film an.
Schnell vergaß ich, dass ich in einem Leuchtturm saß und dass Sofia immer weiter nörgelte. Ich war an einem schönen Herbstnachmittag in Frankreich und ging durch einen Wald. Ich verstand nicht, was Lisa da tat, warum sie dermaßen unverblümt irgendwo einbrach. Ich erschrak, als Florian und Gregor hinter ihr auftauchten. Ich erstarrte mit ihr auf der bröckelnden Treppe, teilte ihr Entzücken, als sie den Geheimraum fand, und es wühlte mich auf, wie erschüttert sie am Ende war. Die Zahlen stiegen rasant: fünfundneunzigtausend Klicks, als ich anfing, hundertzwanzigtausend, als ich fertig war. Das freute mich für Lisa, sie wirkte wie eine, der gute Zahlen etwas bedeuten, nicht nur für den Ertrag.
Zurück zu @WBGrates’ Nachricht.
Der nächste Link war ein Auktionskatalog. Die silberne Schatulle stand diese Woche in Paris zum Verkauf. Es gab detaillierte Nahaufnahmen davon.
Sie war gesäubert worden, seit Lisa sie gefunden hatte, und das Silber wirkte strahlend weiß, leuchtend vor einem dunklen Hintergrund. Eine Nahaufnahme des Deckels mit einer lateinischen Inschrift, die ich nicht verstand. Das nächste Bild zeigte die Seitenansicht, eine römische Matrone im Profil, entspannt auf einer Liege. Die Flechten ihres Haars harmonierten mit den Falten ihrer Toga, diese Einzelheiten im Silber waren mit Blattgoldeinlagen betont. Es war sehr detailgenau und ziemlich hübsch. Die Frau sah zu einer Taube auf, die sich von ihrer ausgestreckten Hand erhob, die Flügel ausgebreitet, den Schnabel himmelwärts gerichtet. Unter diesen Bildern stand im Katalogeintrag:
Römische Schatulle. Datum unbekannt. Inschrift: »Lass dies, o Pilatus von Balaton, Jünger des Königs der Juden, ein würdiges Gefäß für den Beweis seiner Auferstehung sein«. Provenienz und Mindestpreis auf Anfrage.
Ich verstehe absolut nichts von Antiquitäten, die Auktionshäuser der Welt könnten voll mit solchen Schatullen sein, also ging ich wieder zu YouTube und machte einen Screenshot von der Schatulle in Lisas Film, machte dasselbe mit dem Auktionsfoto und legte sie nebeneinander. Für mich sahen sie gleich aus. Vielleicht hatte sie die Schatulle ja doch mitgenommen. Mir war nicht ganz klar, was daran so schlimm wäre. Das Château war verlassen, den Besitzern schien an all dem Zeug, das sie zurückgelassen hatten, nichts zu liegen.
Ich googelte die Geschichte und fand einen Haufen Artikel, vorwiegend von christlichen Webseiten und Provinzblättchen, viele davon in den USA: »Beweis für Kreuzigung steht zum Verkauf«, »Christus-Schatulle bei Auktion«, »Halleluja in Paris«. Es war zu viel zum Durchsehen, deshalb öffnete ich einen Longform-Artikel auf einer Nachrichtenseite, der ich vertraue.
Die Schatulle hatte eine undurchsichtige Vorgeschichte. Es ging das Gerücht, sie sei im kommunistischen Ungarn gefunden worden, über Jahrzehnte verschwunden gewesen und in den späten Neunzigern in Süditalien wieder aufgetaucht, nur um wieder verloren zu gehen. Die Inschrift legte nahe, dass sie dem römischen Beamten gehört hatte, der Jesus von Nazareth zum Tod durch Kreuzigung verurteilte. Das Besondere daran war der Hinweis darauf, dass Pontius Pilatus, Statthalter von Judäa, zu der neuen Religion konvertiert war, was vorher unbekannt gewesen war, und dass die Schatulle angeblich den Beweis für die Auferstehung enthielt. Viele Wissenschaftler hielten die Schatulle für einen Mythos, bis sie in der Auktion in Paris auftauchte, Verkäufer unbekannt. Allerdings war sie nach wie vor versiegelt und nie untersucht worden. Es gab Aufrufe verschiedener Kirchen, Religionsgemeinschaften und Historiker, den Verkauf zu stoppen, bis die Schatulle von Experten untersucht werden konnte, denn Funde dieser Größenordnung sollten dem Gemeinwohl zugutekommen, wie ein Professor aus Yale sagte. Ein Käufer könnte sie in einem Tresor lagern und die Welt würde nie erfahren, was sich darin befand. Der Verkauf sollte in vier Tagen stattfinden, und die Gebote könnten auf hunderttausende Dollar steigen, oder hunderte Millionen, niemand wusste, für wie viel sie weggehen würde. Es gab nichts Vergleichbares.
Religiöse Menschen begannen in Paris einzufallen, suchten die Nähe zu diesem kostbaren Gegenstand. Die französischen Behörden riefen sie auf, nicht zu kommen. Wahllose Gruppen wurden gezeigt, Männer und Frauen, manche mit Kindern, die sich vor dem Auktionshaus versammelten, auf den Straßen von Paris beteten und in Parks zelteten.
Fin und ich sind kleine Fische, und so faszinierend sie war: Diese Geschichte war viel zu groß für uns. Die Mainstream-Medien waren da dran, und wir würden nie ein Interview mit jemand Wichtigem bekommen.
Ich versuchte mich zu erinnern, woher ich Lisa Lees Namen kannte. Hatte sie uns vor einer Weile kontaktiert? Es könnte eine der E-Mails gewesen sein, in denen ich gebeten wurde, Nachrichten an Fin weiterzuleiten – davon bekam ich erstaunlich viele. Aber das glaubte ich nicht. Ihr Name löste so ein verlegenes Glühen in mir aus, als ob es etwas Schmeichelhaftes gewesen wäre. Ich wusste, es war nichts Gehässiges und keine Drohung, an die erinnere ich mich Wort für Wort, ob ich will oder nicht, aber ich sah nicht nach, denn das Passwort für diesen E-Mail-Account lag zu Hause, auf ein Post-it auf meinem Schreibtisch gekritzelt.
Estelle rief aus der Küche, das Abendessen sei in zwanzig Minuten fertig. Alle rührten sich, freuten sich auf warmes Essen, was die Bettgehzeit und Schlaf näher brachte und die Aussicht, irgendwann hier wegzukommen. Wir hatten noch vier Tage vor uns.
Alle gaben sich Mühe, lieb zu sein. Außer Sofia.
Sofia ist Mailänderin und hatte Fin voriges Jahr bei einem Podcasting-Kongress in Leipzig kennengelernt. Seitdem waren sie zusammen, aber niemand von uns kannte sie bisher, nicht richtig.
Sie war uns gegenüber spürbar unsicher gewesen, und Fin machte es nervös, sie mit Estelle und Hamish zusammenzubringen. Ich dachte, wenn wir freundlich und gesellig waren, könnte nichts schiefgehen, aber seit wir hier angekommen waren, konnte sie ihren gereizten Widerwillen gegen uns alle nicht bemänteln. Hamish war zu laut. Estelle war zu müde und sollte mit Yoga aufhören. Die Mädchen bekamen zu viel Bildschirmzeit und ihre Ernährung war ganz falsch. Ich »saß schlecht« und schnarchte wie ein Schwein.
Als wir uns zum ersten Mal begegneten, ging ich davon aus, wir würden uns super verstehen. Sie ist sehr cool. Sie redet, als ob sie auf Italienisch denkt und beim Sprechen übersetzt, wodurch noch der banalste Kommentar episch und kategorisch klingt.
JETZT IST DIE STUNDE, DA WIR DIE KINDER HOLEN.
PULLIS SIND GUT WENN WETTER IST KALT.
Sie ist klein und sehr stolz auf ihre Figur. Ich habe sie mindestens zehn Leuten erzählen hören, dass ihre Taille fünfundfünfzig Zentimeter misst. Um das zu betonen, trägt sie enge Tops und Jacken über schwingenden Röcken, dazu Plateauschuhe und die schwarzen Haare in einem hohen Pferdeschwanz.
Meine Mädchen fanden sie toll, weil sie aussieht wie ein Popstar, weshalb ich dachte, sie sei interessant und lustig und wir würden uns gut verstehen. Es sollte nicht sein. Vielleicht bin ich nicht interessant und lustig. Sofia sah in mir eine nervige Idiotin, die ihr diesen Scheißurlaub aufgeschwatzt hatte und Fin zu langweiliger Arbeit zwang und lautstark protestierte, wenn meine Töchter sich anzogen wie Pädo-Köder.
Die Stimmung zwischen Sofia und Fin war angespannt. Sie wollte, dass er mit nach unten kam und irgend so ein Training mit Fitnessbändern machte, und er wollte sein Taschenbuch weiterlesen.
»Sport ist gut für Ängste«, erklärte sie und sah sich nach einem verirrten Blick um, den sie auffangen konnte.
»Ich lese gerade«, sagte Fin, ohne die Nase aus dem Buch zu nehmen.
Über die Beziehung eines Paars urteilen ist leicht, wenn man Single ist. Und macht Spaß. Mir gefällt es. Ich war die einzige alleinstehende Erwachsene in diesem Urlaub, und ihre Geplänkel taten mir gut.
Sofia fing meinen Blick auf. Ihr Gesicht wurde streng. »Fin leidet an Anorexie«, teilte sie mir mit.
Fins Essstörungen sind ziemlich gut bekannt. Er war früher ein Popstar, hat einen dichten Bart und reichlich blonde Haare, die er als gepflegte Mähne trägt. Er sieht aus wie ein verklemmter Wikinger. Seit er online geoutet wurde, als er echte Probleme hatte – »Ihr werdet nicht glauben, wie Fin Cohen heute aussieht« –, geht er offen damit um, hat es auch in den sozialen Medien ausdiskutiert. Die Angst ist immer da, ihr leises Hintergrundrauschen, aber das ist nicht das Interessanteste an ihm, und inzwischen waren wir seit zwei Jahren engste Vertraute. Ich brauchte keine Erklärungen von Sofia über ihn, aber ich nahm es hin.
»Ja?«
»Ja«, sagte sie. »Also: es ist ein Angstproblem. Sport ist gut dafür.«
»Wirklich?«
»Ja.«
Anscheinend hatten sich meine Augen ganz von selbst verdreht, denn ich sah sie an, dann nicht mehr, und dann war sie sehr wütend auf mich.
»Was weißt du über Anorexie, Anna?«
Ich bereute, dass ich das getan hatte, es war nicht nett, und sie fühlte sich sowieso schon unerwünscht. Ich fand, ich sollte etwas Positives sagen. »Na ja, vermutlich viel weniger als du.«
»Ja«, sagte Sofia und lächelte in ihren Schoß, während sie den Rock auf ihren Knien glattstrich, »ich hatte natürlich in meiner Vergangenheit selbst auch Essstörungen …«
Ich konnte ihr einfach nicht mehr zuhören und stand auf. »Hey, Mädchen, kommt bitte den Tisch fürs Abendessen decken.«
Sie maulten, bis ich das iPad zu konfiszieren drohte.
»Ihr könnt es wiederhaben, wenn ihr fertig seid.«
Sie zogen ab in die Küche.
»Fin, kann ich dir was zeigen, betrifft Arbeit?«
Fin nickte eifrig und versuchte aufzustehen, aber Sofia packte seinen Oberschenkel und fragte: »Worum geht’s?«
»Nur eine PN.«
»Fin arbeitet zu viel. Immer muss er weg.« Sie reckte ihr Kinn trotzig in meine Richtung.
Fin sah zu Boden.
»Sofia«, sagte Hamish, ohne aufzublicken, »lass den Mann gehen.«
Sie legte den Kopf schief und dachte über die Aufforderung nach. »Urlaub ist wichtig für die psychische Verfassung«, sagte sie und sah Fin an, als hätte er ein Wochenende Ausgang aus der Geschlossenen.
»Lass sie arbeiten.«
Sie respektiert Hamish und seine dröhnende Stimme. Er ist Anwalt und kann einen Satz mit der nötigen Autorität bringen. Sie gab ihre Geisel frei, und Fin sprang auf und ließ sein Buch zu Boden fallen.
Wir setzten uns an eine Ecke des Esstischs, als die Mädchen mit Besteck und einem Stapel Teller aus der Küche kamen, und ich zeigte ihm die Nachricht von WBGrates. Ich gab ihm meine Airpods und drückte auf Play.
Er sah Lisa durch den Wald gehen, sein Mund stand offen, sein Blick war entspannt und interessiert. Sofias Kinn landete auf seiner Schulter. Sie hatte ihren Stuhl hinter ihn gezogen und lächelte mich, ihn, das Display an.
Fin drückte Pause.
»Ich gucke mit.« Sie lächelte, küsste ihn auf die Wange. Dann lächelte sie mich an, bezog mich irgendwie ein.
Ich sah Fin achselzuckend an. Fin blinzelte leicht.
»Sofia, kann ich es dir später zeigen?«
»Nein, nein, nein, nein.« Schmollend öffnete und schloss sie energisch die Hände, forderte einen Ohrstöpsel wie ein Kleinkind seinen Keks. »Will mitgucken, will mitgucken.«
Fin gab ihr einen und sie steckte ihn ins Ohr, legte ihr Kinn wieder auf seiner Schulter ab und schlang ihm die Arme um den Oberkörper.
Ich seufzte. Hamish seufzte. Vielleicht seufzten sogar die Kinder. Er würde ihr in keinster Weise die Stirn bieten, also konnten wir es auch nicht.
Es war anstrengend.
Fin und Sofia sahen den Rest von Lisas Film, während ich dasaß und das Handy für sie hielt. Sie schoss die ganze Zeit triumphierende kleine Lächeldolche auf mich ab, und ich zählte die wachen Stunden, bis dieser Urlaub endlich vorbei war.
Fin ging bei dem Film voll mit. An einer Stelle fuhr er zusammen, und ich warf einen Blick aufs Display. Es war die Szene mit der gefährlichen Treppe. Als die Staubdusche aufhörte, erwiderte er Lisas Lächeln. Ich sah zu, wie überrascht er von der Geheimtür war, wie er den Hals reckte, um zu sehen, was Lisa sah. Es machte Spaß, ihm beim Gucken zuzusehen und die Szene auf dem Display zu erraten.
Die Mädchen waren mit Tischdecken fertig und verzogen sich. Fin war mit dem Film fertig und lehnte sich lächelnd zurück.
»Warum bricht sie in Gebäude ein?«, fragte ich.
»Das ist UrbEx«, sagte er. »Urban Exploring. Es gibt eine ganze Szene von Leuten, die das machen.«
Ich zeigte ihm den Katalogeintrag. »In der Nachricht von WBGrates steht, sie hat sie nicht genommen, aber warum soll sie sie nicht mitnehmen? Wenn sie doch da zurückgelassen wurde?«
»Das ist ein Grundprinzip des Urban Exploring.«
Ich fand das ein bisschen schlicht gestrickt, wollte aber nichts sagen, also fragte ich nur, ob er sich an eine Nachricht von Lisa erinnerte. Müsste so ein Jahr her sein, grob geschätzt? Er wusste es auch nicht mehr.
Ich klickte wieder zu dem Film, um Screenshots von ein paar Links zu machen, die Lisa am Ende eingefügt hatte, aber er war weg. Der Film war nicht mehr online. Lisas Filme waren alle entfernt worden, und ihr Instagram-Account war eingefroren. Ich googelte ihren Namen. Sie war seit einer Woche verschwunden. Die Polizei suchte nach ihr.
Ich sah Fin an und murmelte: »Weißt du, was? Ich könnte einen Abstecher nach Glasgow machen und nachsehen, was in ihrer E-Mail stand. Bis morgen früh wäre ich zurück.«
»Gute Idee«, sagte Sofia erfreut und setzte sich auf.
Fin sah mir in die Augen, fest und streng. »Du willst abhauen?«
»Ich haue doch nicht ab. Ich bin ja morgen wieder hier.«
Aber ich dachte daran, wie herrlich es wäre, eine Auszeit zu nehmen, allein im Auto, ohne die Spannungen und die Launen und die Sofia.
Fin war angefressen. Ich wusste, er glaubte, dass ich mir was vormachte, dass es mir zwar noch nicht klar war, ich aber morgen nicht zurückkommen würde. Er lag falsch. Es war mir klar. Ich würde nicht zurückkommen.
»Es ist sehr windig da draußen«, sagte er. »Bestimmt nicht ungefährlich, bei so einem Sturm über die Landspitze zu fahren.«
»Ich finde, du solltest es machen, Anna, ich glaube, das ist euer neuer mysteriöser Fall!« Sofia klang laut und schrill. Sie wollte so, so sehr, dass ich abreiste.
»Oi, Sofia«, sagte Hamish lustlos, »deine Stimme ist sehr laut.«
Sie fuhr herum. »Du bist grob!« Sie klang nicht sonderlich angegriffen, nur laut und wütend.
»Mäßige dich. Du weckst das Baby auf oder die Fenster zerspringen.«
In diesem Moment kam Estelle mit der Lasagne und einer veganen Variante aus der Küche, und alle im Haus setzten sich an den Tisch.
Wir aßen. Das Essen war heiß ersehnt, schwer verdaulich und wohltuend. Der Wein floss reichlich und der warme Duft des Knoblauchbrots umwehte uns, aufgewirbelt vom Luftzug der klappernden Fenster. Sofia erklärte uns allen, inwiefern und warum die Lasagne weder gut noch echt war, und berichtete von so ziemlich jeder anderen Lasagne, die sie je gegessen hatte. Ich trank nichts, weil ich die köstliche Hoffnung hegte, hier wegzukommen. Und die Stimmung zwischen Sofia und mir wurde immer schlechter.
Sie war scharf darauf, dass ich wegfuhr, und kam beim Essen unter verschiedenen Vorwänden darauf zurück, lobte meinen Arbeitsethos und meine Fahrkünste, fragte sich, ob mein Dach all diesem Wind standhielt, redete über andere Podcaster und darüber, wie viel größer ihr Publikum war als unseres. Aber die unverblümte Abneigung beruhte jetzt auf Gegenseitigkeit. Mich nervte ihr makabres und maßloses Augenmerk darauf, was Fin aß, mir fiel auf, dass sie kaum einen Satz sagte, der nicht mit »ich« anfing, und dass ihr eines Auge höher saß als das andere. Ja, ich schoss mich auf sie ein. So schlimm war sie bestimmt gar nicht.
»Wisst ihr, was«, verkündete ich der Runde, »das hier ist ja nun kein großes Vergnügen. Fahren wir doch einfach alle nach Hause, sowie der Sturm nachlässt. Was meint ihr?«
Wie angespannt die Lage war, zeigte sich daran, dass für eine Schrecksekunde niemand etwas sagte, bis Lizzie einen quietschenden kleinen Jubelschrei ausstieß und alle loslachten.
Damit hätte es gut sein sollen. Wir würden es bald hinter uns haben und brauchten einander nichts übelzunehmen. Schwamm drüber.
Aber das war es noch nicht.
Sofia wurde noch grimmiger. Sie schmollte und blickte finster drein. Dann fiel sie Estelle, die über eine Yogalehrerin sprach, ins Wort und erzählte in höchster Lautstärke davon, wie unglücklich sie als Kind gewesen war, weil sie immer stillsitzen musste. Mädchen wurden nicht zu Sport ermuntert. Die Geschichte stieß auf einen spürbaren Mangel an Mitgefühl.
»Das war sehr traurig für mich. Ich war ein leidendes Kind.«
Hamish brummte: »Wenn du willst, dass es dir besser geht, langweile alle anderen zu Tode.«
Das fanden sogar die Mädchen grob.
»Ach, um Himmels willen.« Er winkte ab. »Wenn du dich beim zwanglosen Tischgespräch mit relativ Fremden darüber auslässt, war deine Kindheit wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich wurde mit neun ins Internat geschickt. Meine Eltern mochten mich nicht mal genug, um mich zu Hause zu behalten.«
»Nein, Hamish«, sagte Sofia defensiv und rötete sich um die Augen, »du weißt doch, man sagt: ›Geteiltes Leid ist halbes Leid‹. Meine Traurigkeit macht deine nicht kleiner, und es ist nicht nett von dir, das dagegenzustellen.«
»Tja, also ich sage Folgendes« – Hamishs Stimme war ein bisschen zu laut, und ich merkte, dass er reichlich Wein getrunken hatte – »Bedenke dein Publikum, bevor du alle volljammerst. Andere haben auch verdammt viel durchgemacht.«
Estelle wandte sich Hamish zu, die Schultern gestrafft, das war kein bloßes Zuhören, sondern ein wortloses Signal, er solle sich beruhigen. Sie ist gut für ihn. Besser, als ich es je war.
»Ich meine, EIN MAL«, grölte Hamish so laut, dass wir alle ein bisschen zurückfuhren, »war ich mit einem Mandanten unterwegs, der hatte es im Schlauchboot aus Libyen raus und übers Mittelmeer geschafft, und wir trafen diesen Wicht, ein Bekannter von mir, der uns zehn Minuten lang erzählte, welch absolute Hölle er als Pendler täglich auf der M25 durchmacht. Was ich sagen will: Überleg einmal kurz, wen du vor dir hast, bevor du voll auf die Tränendrüse drückst.« Er nahm sein Weinglas und schwenkte es aus unklaren Gründen in meine Richtung. »Denn eins kann ich euch versprechen, ihr wollt auf keinen Fall, dass irgendwer so von euch denkt, wie ich an dem Tag von diesem Mann gedacht habe. Nie. Der war ein totales Arschloch.«
Lizzie war entzückt über das Schimpfwort. Jess machte ts, ts. Eine Weile aßen wir alle schweigend.
»Ah!«, sagte Sofia und zeigte auf mich, als ginge ihr gerade auf, was los war. »Ich verstehe! Weil Anna ein Gang-Rape-Opfer war?«
Meinen beiden Töchtern fiel das Besteck aus der Hand, sie starrten erst Sofia an, dann mich.
Jess war aschfahl. Lizzie war verwirrt. Wusste sie, was das Wort bedeutete? Sie legte den Kopf schief, ich sah, wie sie ihm nachhorchte, überlegte, ob es ein Schimpfwort war, aber dann sah sie Fin an und dann Jess und wusste: Das war nichts, was man über seine Mum hören wollte.
Sofia grinste irgendwie geziert. »Sorry, ist das …? Sorry. Aber es ist doch bekannt … jeder weiß es.«
Hamish starrte sie unverwandt an. »Halt dein verfluchtes Maul.«