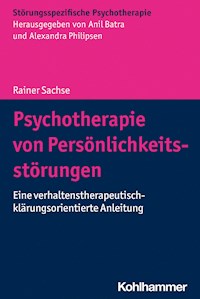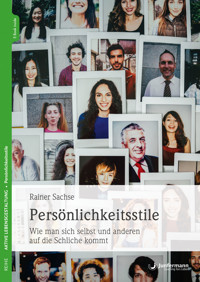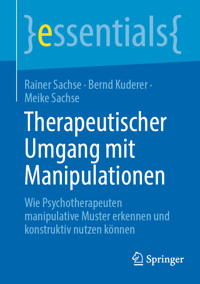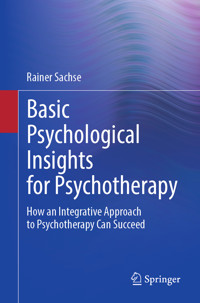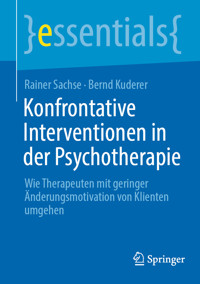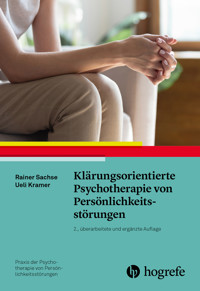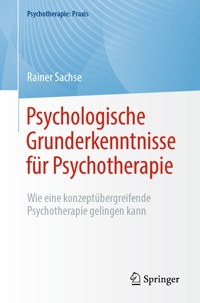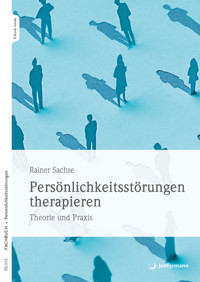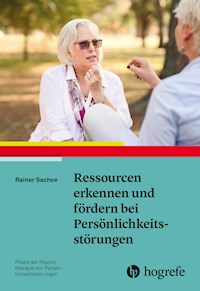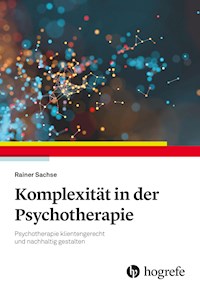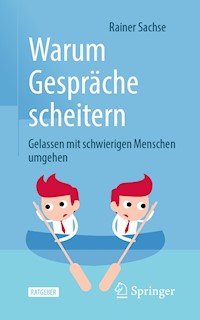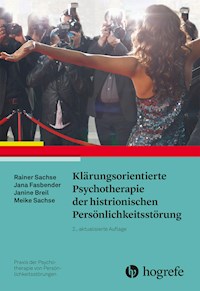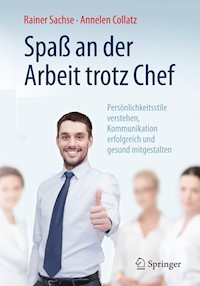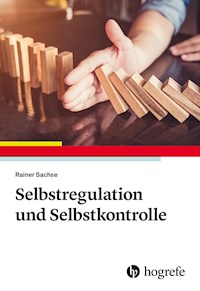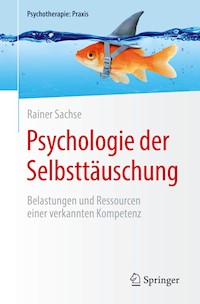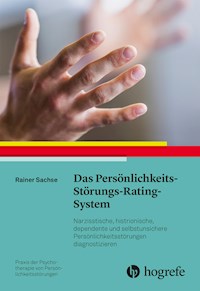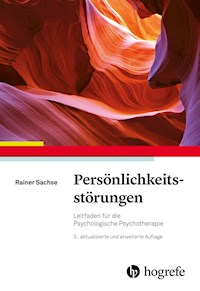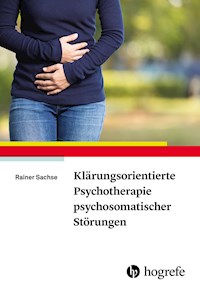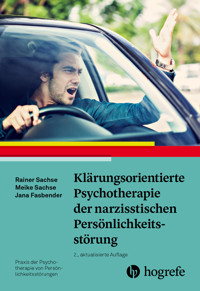
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Klienten und Klientinnen mit Narzisstischer Persönlichkeitsstörung (NAR) stellen Therapeutinnen und Therapeuten vor große Herausforderungen und verlangen von ihnen eine hohe therapeutische Expertise, damit eine Intervention erfolgreich verlaufen kann. Das Buch behandelt das Therapiekonzept der Klärungsorientierten Psychotherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass sich als sehr effektive Therapiemethode erwiesen hat. Thematisiert werden insbesondere die komplementäre Beziehungsgestaltung, Strategien der Konfrontation und Motivierung, Strategien zum Umgang mit Manipulation und schwierigen Interaktionssituationen, der Schemaklärung und Schemabearbeitung. Dabei werden drei Typen von Narzissten unterschieden: Erfolgreiche, Erfolglose und Gescheiterte Narzissten. Diese werden anhand von Transkripten exemplarisch verdeutlicht. Auf die diagnostische Relevanz dieser Unterscheidung wird eingegangen, und es werden spezifische therapeutische Vorgehensweisen für die unterschiedlichen Gruppen entwickelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rainer Sachse
Meike Sachse
Jana Fasbender
Klärungsorientierte Psychotherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung
2., aktualisierte Auflage
Praxis der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen
Band 2
Klärungsorientierte Psychotherapie der narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Prof. Dr. Rainer Sachse, Dipl.-Psych. Meike Sachse, Dipl.-Psych. Jana Fasbender
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Rainer Sachse, Prof. Dr. Philipp Hammelstein, PD Dr. Thomas Langens
Prof. Dr. Rainer Sachse, geb. 1948. 1969–1978 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 1980 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum. 1985 Promotion. 1991 Habilitation. Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. Seit 1998 außerplanmäßiger Professor. Leiter des Institutes für Psychologische Psychotherapie (IPP), Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Persönlichkeitsstörungen, Klärungsorientierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
Dipl.-Psych. Meike Sachse, geb. 1983. 2002–2008 Studium der Psychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Seit 2009 Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie). Seit 2009 Mitarbeiterin am Institut für Psychologische Psychotherapie (IPP), Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Klärungsorientierte Psychotherapie, Persönlichkeitsstörungen.
Dipl.-Psych. Jana Fasbender, geb. 1976. 1996–2001 Studium der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum. 2005 Approbation als Psychologische Psychotherapeutin. Seit 2005 psychotherapeutische Tätigkeit in privatpsychologischer Praxis in Bochum. Ausbildungskoordinatorin, Dozentin und stellvertretende Leiterin des Instituts für Psychologische Psychotherapie (IPP), Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Klärungsorientierte Psychotherapie, Verhaltenstherapie.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / seb_ra
Satz: Michael Kleine, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
2., aktualisierte Auflage 2025
© 2011 und 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3337-0; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3337-1)
ISBN 978-3-8017-3337-7
https://doi.org/10.1026/03337-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Worum es uns geht: eine fundierte Theorie und Therapie der narzisstischen Störung
1.2 Das Konzept des Narzissmus: Einführungen und alternative Konzepte
1.3 Psychologische und psychoanalytische Konzepte
2 Das Klärungsorientierte Konzept von narzisstischer Persönlichkeitsstörung: Konzeption und Diagnostik
2.1 Was sind Narzissten?
2.1.1 Eine erste Beschreibung
2.1.2 Drei Typen von Narzissten
2.1.3 Erfolgreiche Narzissten
2.1.4 Erfolglose Narzissten
2.1.5 Gescheiterte Narzissten
2.1.6 Weitere Typen von Narzissten
2.2 Narzissten: Ein neuer Denkansatz ist nötig
2.2.1 Eine neue Definition von Narzissmus
2.2.2 Spezielle diagnostische Probleme bei Klienten mit Persönlichkeitsstörungen
2.2.3 Ist das System des ICD-11 besser geeignet, Persönlichkeitsstörungen zu diagnostizieren?
3 Überblick über empirisch validierte Charakteristika von Narzissmus
3.1 Relevanz der Forschung
3.2 Empirische Ergebnisse
4 Das Modell der Doppelten Handlungsregulation: Eine spezifische Theorie der narzisstischen Störung
4.1 Das Modell der Doppelten Handlungsregulation
4.2 Ziele und Vorteile des Modells der Doppelten Handlungsregulation als Theorie der Persönlichkeitsstörungen
4.3 Definitionskriterien von Narzissmus nach dem Modell der Doppelten Handlungsregulation
4.4 Erfolgreiche Narzissten
4.4.1 Motive
4.4.2 Schemata
4.4.3 Manipulatives Handeln
4.4.4 Reale Kompensation
4.4.5 Ziele
4.4.6 Intrinsische Motivation
4.4.7 Alienation
4.4.8 Kosten
4.4.9 Ich-Syntonie
4.4.10 Perspektive
4.4.11 Vermeidung
4.4.12 Charakteristika erfolgreicher Narzissten
4.4.13 Drei „Typen“ erfolgreicher Narzissten
4.5 Gescheiterte Narzissten
4.5.1 Das Phänomen
4.5.2 Charakteristika gescheiterter Narzissten
4.5.3 Fremdbestimmung
4.6 Erfolglose Narzissten
4.6.1 Das Phänomen
4.6.2 Charakteristika erfolgloser Narzissten
4.6.3 Wie wird man erfolgloser Narzisst?
4.6.4 Unrealistisch-positives Selbstkonzept
4.6.5 Verantwortungsübergabe und Lageorientierung
4.6.6 Unrealistische Ziele
4.6.7 Regelsetzen und VIP-Status
4.6.8 Die drei Typen von Narzissten im Vergleich
5 Allgemeine therapeutische Strategien bei narzisstischen Klienten
5.1 Allgemeine therapeutische Grundhaltungen
5.2 Therapiephasen
5.3 Komplementarität auf der Motivebene
5.4 Explizierung der Beziehungsmotive
5.5 Klärung
5.6 Entwicklung von Änderungsmotivation
5.6.1 Allgemeines
5.6.2 Konfrontation mit Kosten
5.6.3 Konfrontation mit Intentionen
5.6.4 Konfrontation mit Spielen und mit Manipulation
5.6.5 Konfrontationen mit Regeln
5.6.6 Umgang mit Tests
5.6.7 Explizieren der Schemata
5.6.8 Biographische Arbeit
5.7 Bearbeitung der Schemata
5.8 Trojanische Pferde
6 Spezifische therapeutische Strategien für erfolgreiche, gescheiterte und erfolglose Narzissten
6.1 Therapeutischer Umgang mit erfolgreichen Narzissten
6.2 Gescheiterte Narzissten
6.3 Erfolglose Narzissten
7 Empirische Ergebnisse zur Klärungsorientierten Psychotherapie mit narzisstischen Klienten
7.1 Effektivität Klärungsorientierter Psychotherapie bei den drei Typen von Narzissmus
7.1.1 Einleitung
7.1.2 Erhebungsinstrumente
7.1.3 Ergebnisse
7.2 Prozessforschungsergebnisse bei narzisstischen Klienten
7.2.1 Einleitung
7.2.2 Ergebnisse
7.2.3 Untergruppen-Bildung bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung anhand von Klientenvariablen
8 Beispiele für den therapeutischen Umgang mit Narzissten
8.1 Beispiel 1: Komplementäre Beziehungsgestaltung im Erstgespräch
8.1.1 Das Transkript
8.1.2 Kommentar
8.2 Beispiel 2: Konfrontation des Klienten
8.2.1 Das Transkript
8.2.2 Kommentar
8.3 Beispiel 3: Besondere Konfrontation
8.3.1 Das Transkript
8.3.2 Kommentar
8.4 Beispiel 4: Klärung negativer Selbst-Schema-Aspekte
8.4.1 Das Transkript
8.4.2 Kommentar
8.5 Beispiel 5: Eine Schemabearbeitung in einem Ein-Personen-Rollenspiel
8.5.1 Das Transkript
8.5.2 Kommentar
8.6 Beispiel 6: Umgang mit einer schwierigen Interaktionssituation
8.6.1 Das Transkript
8.6.2 Kommentar
Literatur
|9|1 Einleitung
1.1 Worum es uns geht: eine fundierte Theorie und Therapie der narzisstischen Störung
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (abgekürzt: NAR) ist eine in der ambulanten Psychotherapie häufig vorkommende Störung: Therapeuten werden daher mit Sicherheit mit entsprechenden Klienten konfrontiert. Klienten mit NAR sind jedoch leicht bis hochgradig interaktionsschwierig: Daher benötigen Therapeuten eine hohe therapeutische Expertise, um angemessen mit diesen Klienten umgehen zu können. Diese Expertise wollen wir in diesem Buch bereitstellen.
Wir wollen dabei eine spezifische theoretische und therapeutische Konzeption vorstellen, die Konzeption „Klärungsorientierter Psychotherapie“ der Persönlichkeitsstörungen (Sachse & Kramer, 2023). Deshalb ist dieses Buch ein „Konzept-Buch“, keine Monographie: Wir weisen zwar auf andere Ansätze hin und grenzen uns ab, diskutieren diese Ansätze aber nicht im Detail. Der Schwerpunkt liegt darauf, unseren Ansatz darzustellen.
Was die Terminologie betrifft, so haben wir deutlich gemacht (Sachse & Kramer, 2023), dass wir den Terminus „Persönlichkeits“-Störungen unglücklich finden. Vielleicht sollte man den Vorschlag von Lammers (2023) aufgreifen und lediglich von „narzisstischer Störung“ sprechen.
Es geht uns primär darum, ein Funktionsmodell der narzisstischen Störung darzustellen, d. h. eine Theorie, die das „psychologische Funktionieren“ der Störung darstellt, die also erklärt, wie und unter welchen Bedingungen Narzissten Informationen verarbeiten und interpretieren, unter welchen Bedingungen welche Schlüsse gezogen werden, welche Handlungen initiiert oder nicht initiiert werden, welche Handlungen welche Konsequenzen nach sich ziehen und wie diese dann wieder verarbeitet werden.
Dieses Modell, das dies tut, ist das Modell der Doppelten Handlungsregulation (MDHR).
Wir sind überzeugt, dass man als theoretische Grundlage für Psychotherapie, Diagnostik und Klienten-Modellbildung eine solche Art von Modell benötigt: Ein dynamisches, systemtheoretisch angelegtes Modell der Verarbeitungs- und Handlungsprozesse.
Wir sind überzeugt, dass für solche Zwecke weder „Trait- noch Symptom-Modelle“ auch nur annähernd ausreichend sind. Das zeigen auch theoretische Analysen (vgl. Sachse, 2020a).
Außerdem geht es uns darum,
|10|einen sehr gut psychologisch fundierten Theorie- und Therapie-Ansatz darzustellen,
der empirisch validierte und als relevant erwiesene Variablen enthält,
der die Komplexität des Störungsbereichs „Persönlichkeitsstörungen“ angemessen abbildet
und dennoch hoch praxisorientiert und praktisch handhabbar ist,
der sich auch in der Praxis bewährt hat und der gute Effektstärken aufweist.
Wir sind überzeugt, dass uns dies mit unserem Modell der Doppelten Handlungsregulation von Narzissmus auch gut gelungen ist: Unsere Ergebnisse zeigen nicht nur „moderate“ Effekte, sondern sehr deutlich positive Therapie-Effekte auf.
Wir gehen zunächst auf ein Funktionsmodell von Narzissmus ein und unterscheiden drei Typen von Narzissten: Die erfolgreichen, die gescheiterten und die erfolglosen NAR. Diese Unterscheidung ist, wie wir zeigen werden, therapeutisch hoch relevant.
Wir stellen dann therapeutische Phasen und für diese spezifische therapeutische Strategien und Interventionen dar. Und da das Buch hochgradig praxisorientiert ist, werden wir diese Strategien und Interventionen an Transkripten exemplarisch verdeutlichen. Wir gehen dabei speziell auf Aspekte komplementärer Beziehungsgestaltung, Konfrontation, Klärung und Schemabearbeitung ein sowie auf den Umgang mit schwierigen Interaktionssituationen.
Die Therapie-Konzepte der Klärungsorientierten Psychotherapie des Narzissmus wurden über längere Zeit hinweg entwickelt, siehe dazu: Kramer & Sachse, 2021; Sachse, 1997, 2001a, 2004a, 2004b, 2005, 2007, 2008a, 2013a, 2014a, 2014b, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2022a, 2022b, 2023a, 2023b; Sachse & Fasbender, 2013; Sachse & Sachse, 2016a, 2016b; Sachse, Sachse & Fasbender, 2011; Sachse & Schirm, 2015a; Sachse & Walburg, 2017a, 2017b. Sie haben sich in der Praxis bewährt und ermöglichen einen effektiven Umgang mit narzisstischen Klienten. Sie sind auch empirisch gut fundiert (s. Kapitel 7).
1.2 Das Konzept des Narzissmus: Einführungen und alternative Konzepte
Wir möchten hier nur kurz auf alternative Konzepte hinweisen, um deutlich zu machen, dass wir unseren Ansatz keineswegs für den einzigen, relevanten Ansatz halten und auch konkrete Hinweise auf Alternativen bzw. Ergänzungen geben.
Für eine allgemeine Erörterung von NAR siehe Akhtar (1996), Cain et al. (2008), Derksen (1995), Emmelkamp und Kamphuis (2007), Fiedler (2007), Horowitz (1996), Levy et al. (2007), Magnavita (2004), Masterson (1981), Millon (1996), O’Donohue et al. (2007), Oldham et al. (2005), Plakun (1996), Ronningstam (1998, 2005, 2009, 2012), Ronningstam und Gunderson (1990, 1996).
|11|Als Einführung für Klienten sind geeignet: Krizan und Herlache (2018), Lammers (2014, 2021, 2023), Lammers und Doering (2018), Lammers und Eismann (2019), Lelord und André (2009), Oldham und Morris (2010), Renneberg und Herpertz (2010), Roepke und Vater (2014), Rogoza et al. (2019), Sachse (2004c), Znoj et al. (2004).
Natürlich gibt es auch sehr unterschiedliche psychologische Ansätze, die mit unserem Ansatz zwar kompatibel sind, sich dennoch von diesem in vielen Aspekten unterscheiden (vgl. Back, 2018; Brakemeier & Lammers, 2021; Dieckmann, 2011; Dieckmann & Roediger, 2021; Drozek & Unruh, 2020; Freeman & Fox, 2013; Kramer et al., 2014, 2020a; Lammers, 2014; Pincus et al., 2014; Rödiger, 2016; Young & Flanagan, 1998). Dabei sind Therapie-Konzepte im eigentlichen Sinne selten und es gibt nur wenige Therapie-Studien (vgl. Kealy et al., 2017).
In den letzten 20 Jahren hat es auch im Bereich psychologischer Theorie-Modelle über Persönlichkeitsstörungen allgemein und über Narzissmus im Besonderen sehr viele theoretische Entwicklungen gegeben. Allerdings gehen diese Konzepte in aller Regel nicht die gleichen oder ähnlich konzeptuelle Wege wie wir im Modell der Doppelten Handlungsregulation.
Die theoretischen Entwicklungen betreffen keine „psychologischen Funktionsmodelle“ der Störung, sondern „Trait-Modelle“ (Hopwood, 2018), also Modelle über „Eigenschaften“, die statisch sind oder die durch statistische Verfahren (z. B. Faktoren-Analysen) zustande kommen. Deren klinisch-therapeutische Relevanz ist aber unklar, d. h. es ist unklar, inwieweit diese Variablen tatsächlich relevante Prozesse erfassen, die auch therapeutisch von Bedeutung sind. Zumindest ist es aus unserer Sicht sehr schwierig bis unmöglich, aus diesen Modellen sinnvolle therapeutische Ansatzpunkte oder Strategien abzuleiten: Die Theorie der Störung ist in keiner Weise mit einer Theorie der Therapie kompatibel, und solche Zusammenhänge werden auch gar nicht reflektiert.
Legt man, wie bisher aber üblich, den Diagnostik-Systemen solche Trait-Modelle zugrunde, dann kann man diese aufgrund der fehlenden Kompatibilität mit Therapie-Modellen gar nicht für eine psychotherapeutisch relevante Diagnostik nutzen. Diagnostik-Theorie und Therapie-Theorie weisen keinerlei Verbindung auf, aus der man etwas ableiten könnte.
Darüber hinaus weisen Trait-Modelle noch weitere Nachteile auf:
Sie beziehen sich nur auf eine geringe Anzahl an Variablen.
Diese sind nicht theoretisch oder empirisch nach Kriterien der Relevanz für die Störung ausgesucht, sondern danach, wie gut sie jeweils zu erfassen sind.
Daher ist die tatsächliche Relevanz der Variablen für eine Störung weder theoretisch abgeleitet noch empirisch erwiesen.
Wie gut ein solches Modell eine Störung damit abbildet, ist unklar.
Aufgrund dieser im Augenblick bestehenden Probleme werden wir hier Trait-Theorien nicht weiter berücksichtigen, da sie keinen Beitrag leisten können zu einem gut funktionierenden Funktionsmodell von Persönlichkeitsstörungen oder von Narzissmus.
|12|1.3 Psychologische und psychoanalytische Konzepte
Wir möchten an dieser Stelle etwas sagen über die Uneinheitlichkeit theoretischer und therapeutischer Konzepte im Bereich von Persönlichkeitsstörungen (PD). Diese Uneinheitlichkeit gilt für alle PD, ist aber aus unserer Sicht bei narzisstischer PD besonders krass.
Der Hinweis auf eine extrem geringe „Übereinstimmung theoretischer und therapeutischer Konzepte“ ist wichtig, da dadurch deutlich gemacht wird,
dass es zur Zeit gar keine einheitliche, konsensfähige PD-Theorie gibt;
dass es keine einheitliche Theorie als Grundlage für Diagnostik gibt und auch z. B. wegen der enormen theoretischen Unterschiede zwischen Konzepten, inbesondere zwischen psychologischen und psychoanalytischen Konzepten, wahrscheinlich auch gar nicht geben kann;
dass es deshalb inkompatible Theorie- und Therapiekonzepte gibt;
dass Therapeuten ihre Klienten ebenfalls auf diese Situation aufmerksam machen sollten, um Missverständnisse zu vermeiden.
Diese Uneinheitlichkeit kommt dadurch zustande, dass es im Wesentlichen zwei grundlegende Konzeptionen gibt. Zum einen psychologisch fundierte Konzeptionen, die in der Psychologie basieren: Diese Konzepte sind zwar auch im Detail unterschiedlich, weisen aber viele Gemeinsamkeiten auf. Zum anderen psychoanalytische Konzeptionen, die einen vollständig anderen theoretischen Hintergrund aufweisen und völlig andere Therapie-Konzeptionen entwickelt haben (vgl. hier: Crisp & Gabbard, 2020; Crowe et al., 2019; Gabbard, 2021; Hartmann, 2021; Hohage, 2004; Kernberg, 1978, 1996, 2006, 2021a, 2021b, 2021c; Kohut, 1971, 1976; Schmidt-Hellerau, 2021).
Wir, als (nicht in Psychoanalyse ausgebildete) psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können natürlich die psychoanalytische Konzeption gar nicht beurteilen und wollen das auch nicht tun. Wir können aber sehr wohl sagen, dass sich für uns eine Beschäftigung mit psychoanalytischen Konzepten anfühlt wie ein Besuch in einem Parallel-Universum: Viele der theoretischen und therapeutischen Konzepte sind für uns unverständlich. Daher bemühen wir uns, unseren Ausbildungskandidat*innen und unseren Klient*inen deutlich zu machen, dass es derart krasse Unterschiede gibt und dass wir eine ganz bestimmte Konzeption vertreten (die wir auch erläutern) und eben keine psychoanalytische. Recherchieren die Personen im Internet, kann das ansonsten zu erheblicher Verwirrung führen.
Neben den stark unterschiedlichen inhaltlichen Konzeptionen gibt es aber noch einen weiteren, aus unserer Sicht relevanten Unterschied: Psychologische Konzeptionen von PD bemühen sich um eine Entpathologisierung der Störungen. Unser Eindruck ist, dass Psychoanlytiker das bedauerlicherweise zunehmend weniger tun, da z. B. immer mehr von „pathologischem Narzissmus“ die Rede ist. Insgesamt ist diese Tendenz jedenfalls nicht erkennbar. Wir Entpathologisieren mit unserem Ansatz der Klärungsorientierten Psychotherapie in besonders hohem Maße. Dagegen weist der psychoanalytische Ansatz aus unserer Sicht ein extrem hohes Ausmaß an Pathologisierung|13|auf. Wir sehen das als problematisch an, u. a. weil es aus unserer Sicht schwer vorstellbar ist, wie ein Therapeut, der eine solche Haltung einnimmt, einem Klienten dann noch respektvoll entgegentreten kann.
Wir sind überzeugt, dass die beiden Ansätze nicht kompatibel sind und ein Therapeut sich entscheiden muss. Und wir sind überzeugt, dass eine Kommunikation zwischen beiden Ansätzen schwierig sein dürfte. Eine „Integration“ beider Ansätze dürfte unmöglich sein und damit werden die Ansätze wohl in einem Konkurrenzverhältnis verharren.
Für uns ist es hier wesentlich deutlich zu machen, dass wir uns eindeutig dem psychologischen Ansatz verpflichtet fühlen: Einer sehr starken Fundierung der Konzepte in der Psychologie, keine Verwendung medizinischer Konzepte, starke Betonung von Entpathologisierung und respektvoller Beziehungsgestaltung.
|14|2 Das Klärungsorientierte Konzept von narzisstischer Persönlichkeitsstörung: Konzeption und Diagnostik
In diesem Kapitel geben wir aus klärungsorientierter Sicht eine Definition von Narzissmus und führen die Unterscheidung ein zwischen erfolgreichen, gescheiterten und erfolglosen Narzissten. Wir geben einen Überblick über Verhaltensmerkmale, die die narzisstische Störung kennzeichnen und stellen dann die relevanten „Tiefen-Strukturen“ (Schemata, Motive und Spielstrukturen) erfolgreicher, gescheiterter und erfolgloser Narzissten dar.
2.1 Was sind Narzissten?
2.1.1 Eine erste Beschreibung
Genau wie bei anderen Persönlichkeitsstörungen auch rangiert der Narzissmus (NAR) von leichtem Stil bis zu einer sehr schweren Störung. Und wie bei anderen Störungen auch, stellt ein narzisstischer Stil eher eine Ressource dar als eine Belastung (d. h. die Gewinne sind höher als die Kosten): Die Personen sind leistungsfähiger, sind „straight“, gut organisiert, haben ein gutes Durchhaltevermögen, sind ambitioniert, zufrieden und erfolgreich (vgl. Campbell, 1999, 2001; Horten & Sedikides, 2009; Johnson, 2005; Kohut, 1977; Lelord & André, 2009; Oldham & Morris, 2010; Ronningstam, 2005; Russ et al., 2008; Stone, 1998; Wink et al., 2005).
Je stärker sich der Narzissmus einer schweren Störung annähert, desto höher werden jedoch die Kosten, die er verursacht. Zum Beispiel komorbide Achse-I-Störungen, Substanzmissbrauch, starke interpersonelle Probleme, erhöhtes Suizidrisiko u. a. (Bachar et al., 2005; Campbell et al., 2002; Caroll et al., 1998; Ehrenberg et al., 1996; Links et al., 2003; Luhtanen & Crocker, 2005; Morf & Rhodewalt, 2001; Rathvon & Holmstrom, 1996; Ritter et al., 2008; Ronningstam, 1996; Ronningstam & Maltsberger, 1998; Vaglum, 1999).
In der ambulanten Psychotherapie sind nach unserer Erfahrung die „mittelschweren“ Störungen am häufigsten: Daher wollen wir mit deren Beschreibung beginnen, um dem Leser einen ersten Eindruck zu vermitteln (vgl. hier Döring & Sachse, 2008; Sachse, 2001a, 2002, 2004a, 2004b, 2006a, 2006b, 2007, 2008a).
|15|Klienten mit NAR weisen immer ein negatives Selbstschema auf mit Annahmen wie „ich bin inkompetent“, „ich kann nichts“, „ich bin ein Versager“ u. ä.: Daher weisen Klienten mit NAR neben einem positiven Selbstschema immer auch ein negatives Selbstschema auf (auch dann, wenn sie extrem erfolgreich sind) und damit zeigt sich auch immer ein (mehr oder weniger) hohes Maß an Selbstzweifeln: Gedanken wie „schaffe ich das wirklich?“, „bin ich wirklich gut genug?“, „an dieser Aufgabe könnte ich scheitern“ u. a. Anders als Personen, die einfach nur hoch leistungsmotiviert sind (im Sinne von „Hoffnung auf Erfolg“ nach Heckhausen, 1963) haben NAR daher immer eine Ebene von Selbstzweifeln, von „Furcht vor Misserfolg“, eine Ebene der Angst, scheitern zu können. Damit sind NAR auch immer (mehr oder weniger stark) kritik-empfindlich oder „verletzlich“: „Verletzlichkeit“ ist damit ein allgemeiner Aspekt von NAR.
Diese Selbstzweifel stammen unserer Erfahrung nach immer aus der Biographie und entstehen über negatives Feedback wesentlicher Bezugspersonen (meist des Vaters), einer Kombination von hoher Erwartung („Du musst erfolgreich sein!“) und Zweifeln („Ich glaube nicht, dass Du es schaffst!“) bzw. aus der Angst der Kinder/Jugendlichen, bei nicht ausreichendem Erfolg (massiv) abgelehnt zu werden. Wir haben in der Therapie noch nie Klienten gesehen, die nur positives (oder nur übertrieben positives) Feedback erhalten hätten.
2.1.2 Drei Typen von Narzissten
Wir unterscheiden in unserem Ansatz drei Kategorien von NAR: Die erfolgreichen (NAR), die gescheiterten (GENAR) und die erfolglosen (ELNAR): Diese Unterscheidung ist nicht nur theoretisch sinnvoll, sie ist auch praktisch-therapeutisch hoch relevant, da die therapeutischen Vorgehensweisen sich unterscheiden und die Therapie-Effekte unterschiedlich sind (vgl. Kapitel 7.2.3).
2.1.3 Erfolgreiche Narzissten
Erfolgreiche Narzissten (ERNAR) bemerken irgendwann in ihrer Biografie, dass sie ihre Selbstzweifel durch Leistung und Erfolge kompensieren können, und entscheiden sich dann dazu, sich anzustrengen und aktiv zu beweisen, dass ihre Selbstzweifel nicht stimmen. Durch die Erfolge, die sich dann, wenn sie gut genug sind, einstellen, entwickeln sie dann ein (zu dem negativen Schema) paralleles positives Schema, das manchmal (auch aus kompensatorischen Gründen) sehr positiv oder sogar unrealistisch positiv ist und Annahmen enthält wie „ich bin toll“, „ich bin hochbegabt“, „ich habe außergewöhnliche Fähigkeiten“ u. a.
Erfolgreiche Narzissten neigen dann dazu,
viel zu leisten, um Erfolge zu haben,
mit diesen Erfolgen anzugeben,
|16|stark mit anderen zu konkurrieren,
jedoch stark kritikempfindlich zu bleiben,
ein hohes Anspruchsdenken zu haben, sich für „was Besseres“ zu halten und davon auszugehen, eine „Sonderbehandlung“ zu verdienen,
manchmal arrogant zu sein, anderen wenig zuzuhören,
stark egozentrisch zu sein und zu glauben, das Universum „drehe sich um sie“.
Obwohl sie erfolgreich und oft sogar sehr erfolgreich sind, haben sie das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt und sie unzufrieden sind, sie verstehen aber nicht, warum. Ihr Verhalten erzeugt oft hohe Kosten: Sie verschleißen sich im Beruf, entwickeln psychosomatische Beschwerden, insbesondere Herz-Kreislauf-Probleme, vernachlässigen wichtige Beziehungen, haben zu wenig Zeit für sich selbst, machen sich ständig Sorgen um Karriere und Erfolg u. a. (vgl. Bornstein & Gold, 2008; Daig et al., 2009; Miller & Campbell, 2008; Miller et al., 2009).
Meist sind es diese Kosten, die einen ERNAR dazu veranlassen, eine Therapie aufzusuchen und nicht die Persönlichkeitsstörung an sich (vgl. Ritter & Lammers, 2007). Sie wissen jedoch nicht, was sie ändern könnten oder denken, dass sie gar nichts ändern können, und hoffen darauf, dass ein Therapeut ihnen einen Ausweg aufzeigt.
Wenn sie in Therapie kommen, erzählen sie oft dem Therapeuten, sie hätten keine Probleme oder wenn, dann hätten sie sie alle „im Griff“. Sie erzählen langatmig von Erfolgen, lassen sich oft nur schwer unterbrechen und gehen auf Fragen des Therapeuten kaum ein. Sie neigen dazu, Therapeuten zu testen, um festzustellen, ob der Therapeut „ihnen gewachsen“ oder ob er gut genug für sie ist. Sie fühlen sich schnell und leicht kritisiert, „defizitär definiert“ und neigen dazu, reaktant zu werden, wenn Therapeuten ihnen Ratschläge geben. Manchmal reagieren sie schon allergisch auf das Wort „Problem“ (denn „Probleme“ haben sie natürlich nicht), und im Grunde „wissen“ sie schon, was sie tun sollten und haben ihre Probleme schon „verstanden“. Sie gehen oft nicht ohne Weiteres in eine Klienten-Rolle und vermeiden sehr stark eine Auseinandersetzung mit ihrem negativen Selbst-Schema.
Aus diesen Gründen gelten sie zu Recht als „schwierige Klienten“, die ein Therapeut unbedingt „richtig abholen“ muss, um effektiv mit ihnen arbeiten zu können (vgl. Gabbard, 2009; Kernberg, 2007). Unerfahrene Therapeuten machen hier viele Fehler, und einige davon führen schnell dazu, dass die Klienten die Therapie abbrechen; andere führen zu „Machtkämpfen“ oder dazu, dass sich die Therapie in ein „Diskussionsforum“ verwandelt.
2.1.4 Erfolglose Narzissten
Erfolglose Narzissten (ELNAR) weisen dagegen praktisch keine realen Kompensationsbemühungen auf und realisieren daher auch keine Erfolge: Entweder vermeiden sie generell die mit der Kompensation verbundene Anstrengung oder sie glauben nicht, dass sie über die Kompetenzen verfügen, überhaupt erfolgreich zu sein. Daher „geben |17|sie auf, bevor sie überhaupt angefangen haben“. Da sie aber ebenfalls ein stark negatives Selbst-Schema aufweisen, meist sogar ein deutlich negativeres als erfolgreiche NAR, benötigen auch sie dazu eine Kompensation. Sie kompensieren stark über illusionäre positive Selbstschemata (über Annahmen wie: „Meine Kompetenzen werden verkannt.“ „Ich bin eigentlich hoch intelligent.“ „Im Grunde könnte ich Anwalt sein.“ „Im Grunde bin ich Anwalt.“).
Ein typischer erfolgloser NAR ist eine Person (meist männlich),
die mit 25 – 40 Jahren in Therapie kommt,
die Schule und/oder mehrere Lehren abgebrochen hat,
noch bei der Mutter wohnt, keine Partnerin und nur wenige Freunde hat,
keine oder nur Gelegenheitsjobs macht,
viel Zeit mit Computer spielen verbringt,
jedoch die Vorstellung hat, große Kompetenzen zu haben, die nur noch nicht erkannt wurden,
und die illusionäre Zukunftsideen hat: So hat z. B. ein Klient ohne Schulabschluss und ohne Lehre mit 34 dem Therapeuten gesagt: „Herr B., dass ich nicht mehr Bundeskanzler werden kann, das weiß ich. Aber Bundesminister werde ich auf jeden Fall.“
Diese Klienten sind extrem schwierig zu therapieren, da sie große Angst haben, sich ihrer desolaten Situation „zu stellen“ und weil sie, ähnlich wie erfolgreiche NAR, hohe Ansprüche haben („unter 4.000 Euro nehme ich gar keine Stelle an“), sodass es nur selten gelingt, negative Schemata zu bearbeiten und Kompetenzen zu trainieren (was oft als „ehrenrührig“ gesehen wird).
2.1.5 Gescheiterte Narzissten
Gescheiterte Narzissten (GENAR) sind Personen, die meist in der Schule erfolgreich sind, dann aufgrund geringer Autonomie und hoher Erwartungsorientierung ein Studium aufnehmen, weil ihre Eltern (meist ihr Vater) es so möchten. Im Studium steigen die Anforderungen. Da die Klienten aber nur (wegen der unfreiwilligen Studienwahl) extrinsisch motiviert sind, reicht die Motivation irgendwann nicht mehr aus, die hohen Anforderungen zu bewältigen: Die Leistungen verschlechtern sich. Nun setzt aufgrund des negativen Selbst-Schemas und aufgrund der hohen elterlichen Erwartungen eine massive Versagensangst ein, die sich in Bewertungs- und Prüfungsangst bemerkbar macht: Die Klienten vermeiden Prüfungen, vermeiden Seminare usw. Da sie aber weiterhin die Erwartungen der Eltern erfüllen wollen, können sie das Studium aber auch nicht beenden. Also „sitzen sie fest“: Sie können das Studium weder beenden noch abbrechen.
Gescheiterte NAR sind damit zwischen den erfolgreichen und den erfolglosen NAR positioniert: Sie sind durchaus anstrengungsmotiviert, jedoch nicht genug, und |18|sie sind nicht autonom genug, Entscheidungen selbst zu treffen, die sie auch durchhalten können.
Unserer Erfahrung nach ist ein Scheitern im Studium bzw. während einer Ausbildung bei den gescheiterten Narzissten am häufigsten, daher werden wir im weiteren Verlauf hierauf genauer eingehen. Ein Scheitern ist prinzipiell aber auch zu einem späteren Zeitpunkt denkbar, etwa mit Beginn der Berufspraxis. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn für die Betroffenen im Studium die Anforderungen nicht zu hoch waren, also das Lernen leichtgefallen ist, sie aber in der Praxis wiederum mit ganz anderen Aufgaben und Anforderungen konfrontiert sind.
2.1.6 Weitere Typen von Narzissten
Es werden in der Literatur noch zwei weitere Typen von NAR dargestellt, die wir an dieser Stelle vorstellen und erörtern möchten: Die „vulnerablen“ Narzissten und die „malignen“ Narzissten.
2.1.6.1 Vulnerable Narzissten
Von verschiedenen Autoren wurde vorgeschlagen, zwei Arten von Narzissmus oder Narzissten zu unterscheiden: Die grandiosen und die vulnerablen (vgl. Besser & Priel, 2010; Dickinson & Pincus, 2003; Fossati et al., 2010; Lammers, 2019; Pincus, Lukowitsky & Wright, 2010; Pincus & Wright, 2021; Rohmann et al., 2012; Wright, 2014). Die beiden Subtypen lassen sich wie folgt definieren (Russ & Shedler, 2013): Grandiose Narzissten können beschrieben werden als grandios, arrogant, neidisch, ansprüchlich, ausbeuterisch. Vulnerable Narzissten können als selbstgehemmt, mit verdeckten, zugrundeliegenden grandiosen Erwartungen an sich und andere beschrieben werden.
Diese Unterscheidung ist aus unserer Sicht nicht überzeugend, da alle Narzissten arrogant, ausbeutend, neidisch und auch selbstgehemmt sein können, je nachdem, ob ihr positives oder negatives Selbst-Schema aktiviert wurde. Da wir theoretisch davon ausgehen (und das in der therapeutischen Praxis auch immer sehen), dass erfolgreiche NAR sowohl ein positives als auch ein negatives Selbstkonzept aufweisen und dass das negative die Klienten immer verletzlich, kritikempfindlich und unsicher macht (wenn das entsprechende Schema aktiviert ist), möchten wir hier nicht zwischen vulnerablen und nicht-vulnerablen NAR unterscheiden.
Aus unserer Sicht sind alle NAR „vulnerabel“, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, was von der Stärke des negativen Selbst-Schemas abhängt. Daher ist es möglich, dass manche Narzissten sich meist oder überwiegend im Bereich des positiven Selbst-Schemas aufhalten und manche überwiegend im Bereich des negativen Selbst-Schemas. Ist das der Fall, stimmt diese Unterscheidung allerdings weitgehend mit unserer Unterscheidung zwischen erfolgreichen und erfolglosen Narzissten überein: Erfolgreiche Narzissten befinden sich meist in einem eher positiven („grandiosen“) Modus |19|und erfolglose Narzissten in einem eher negativen („vulnerablen“) Modus, sodass auch aus diesem Grunde aus unserer Sicht diese Kategorisierung wenig Sinn macht.
2.1.6.2 Maligner Narzissmus
Im psychoanalytischen Kontext wird die Kategorie des „malignen Narzissmus“ verwendet: Er sei eine Kombination aus narzisstischen, psychopathischen und paranoiden Merkmalen (vgl. Horowitz, 2013; Kernberg, 1975, 1998, 2019, 2021a, 2021b; Ogrodniczuk, 2013; Russ & Shedler, 2013).
Wir denken jedoch, dass es sich hier gar nicht um eine „Form des Narzissmus“ handelt, sondern dass eine Person dann „maligne narzisstisch“ erscheint, wenn sie eine Komorbidität von Narzissmus mit Psychopathie und/oder mit paranoider Persönlichkeitsstörung aufweist (Hare, 1970, 1987, 1996; Patrick, 2007; Sachse & von Franqué, 2019).
Der Eindruck eines „malignen Narzissmus“ kommt damit durch eine vorliegende Komorbidität zustande und ist damit kein Aspekt des Narzissmus selbst.
2.2 Narzissten: Ein neuer Denkansatz ist nötig
2.2.1 Eine neue Definition von Narzissmus
Bisher erschien es relativ einfach zu definieren, was ein Narzisst ist: Narzissten gelten meist als Menschen, die übertrieben selbstbewusst sind und die im Allgemeinen recht erfolgreich sind, die sich durchsetzen können, andere für ihre Zwecke einspannen usw. (vgl. Akhtar, 1996; Bierhoff & Herner, 2006; Horowitz, 1996; Levy et al., 2007; Millon, 1996; Ronningstam & Gunderson, 1996).
Zwei Probleme gibt es jedoch mit einigen bisherigen Sichtweisen (z.B der DSM-Definition) von Narzissmus:
Narzissten werden oft nur als die Personen gesehen, die ein Großartigkeitsempfinden aufweisen; Aspekte von Selbstzweifel, Vulnerabilität, Depressivität, negativem Selbstwert werden oft übersehen (vgl. Bockian, 2006; Cain et al., 2008; Gabbard, 2009; Heisel et al., 2007; Levy et al., 2007; Pimentel, 2007; Pincus et al., 2009; Ronningstam, 2009; Russ et al., 2008), die aber ein integraler Teil des Narzissmus sind.
Die Störung wird meist nur auf sogenannte „erfolgreiche Narzissten“ angewandt; dabei werden andere Subtypen von Narzissmus ignoriert (vgl. Russ et al., 2008).
Wir wollen in unserer Konzeption versuchen, ein möglichst vollständiges Bild von Narzissmus zu zeichnen und die daraus resultierenden therapeutischen Konsequenzen diskutieren.
|20|Analysiert man nämlich genauer, was Narzissten charakterisiert, dann wird deutlich, dass nicht alle Narzissten erfolgreich sind. Daher vertreten wir hier die These, dass man die Definition von Narzissmus verändern muss, um auch die gescheiterten und die erfolglosen NAR miterfassen zu können. Es ist nämlich, wie wir sehen werden, aus therapeutischer Sicht von zentraler Bedeutung, diese Unterscheidung zu treffen, denn die sinnvollen therapeutischen Strategien für diese drei Gruppen unterscheiden sich sehr stark (vgl. Sachse, 2002, 2004a, 2004c, 2006d, 2007).
2.2.2 Spezielle diagnostische Probleme bei Klienten mit Persönlichkeitsstörungen
Die Diagnostik von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen und damit auch von Narzissten ist aus verschiedenen Gründen schwierig, und man kann theoretisch zeigen, warum das der Fall ist. Daraus sollten u. E. diagnostische Konsequenzen gezogen werden.
Wir haben ausgeführt, dass ein wesentliches Charakteristikum von Persönlichkeitsstörungen in der Existenz negativer Beziehungsschemata besteht, die verantwortlich sind für ein hohes bis sehr hohes interaktionelles Misstrauen der Personen. Dies gilt auch für narzisstische Klienten.
Da die Klienten den Therapeuten aber so gut wie gar keine expliziten, verbalen Informationen über relevante Probleme geben, solange das interaktionelle Misstrauen in der Therapie nicht abgebaut ist, ist es für Therapeuten extrem schwierig bis unmöglich, aufgrund der „verbalen“ Klienten-Informationen eine valide Diagnose zu stellen (vgl. Sachse, 2020b). Aus dem interaktionellen Misstrauen resultiert, dass diese Klienten dieses Misstrauen auch „in die Therapie mitbringen“ und in hohem Maße versuchen, sich von den Therapeuten „nicht in die Karten gucken zu lassen“! Das heißt sie vermeiden es in hohem Maße, den Therapeuten Informationen über tatsächliche, relevante persönliche Probleme zu geben (vgl. Sachse, 2020a, 2022a; Sachse & Kramer, 2023).
Wir gehen auf dieses Problem noch genauer ein und werden zeigen, dass eine Diagnose am besten durch eine systematische Beurteilung des Interaktionsverhaltens des Klienten getroffen werden kann (durch ein Rating-Verfahren): Dadurch kann ein Therapeut schon sehr früh im Prozess valide diagnostische Hypothesen entwickeln. Die „klassischen“ Diagnose-Instrumente DSM-5 oder ICD-10 sind im Grunde sehr wenig geeignet, eine valide Diagnose zu stellen (vgl. Sachse, 2020a).
Das bedeutet, dass ein Therapeut bei Persönlichkeitsstörungsklienten allgemein und bei narzisstischen Klienten im Besonderen andere diagnostische Zugänge benötigt als „normalerweise“, wenn er eine valide Diagnose stellen will.
Damit lassen sich PD-Diagnosen zu Therapiebeginn kaum bis gar nicht durch Diagnose-Systeme wie DSM-5 oder ICD-10 stellen. Da die Klienten mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit dem Therapeuten oder dem Datenerheber gar keine relevanten Daten liefern werden, ist die Information, die sie geben, irrelevant: Eine Analyse die|21|ser Daten durch DSM oder ICD kann damit nicht zu validen Ergebnissen kommen. Daran ändert auch eine Datenerhebung mit einem SCID-Interview (Beesdo-Baum, Zaudig & Wittchen, 2019) nicht das Geringste.
Es gibt noch weitere relevante Einwände gegen DSM-5 und ICD-10:
Um therapierelevant sein zu können, muss dem Diagnose-System und dem Therapie-System dieselbe Theorie zugrunde liegen: Nur dann lassen sich aus der Diagnostik weitreichende Schlüsse auf therapeutische Entscheidungen ableiten. Damit erweist sich die „relative Theorie-Freiheit“ der Systeme hier als erheblicher Nachteil.
Die Symptome, die zur Definition benutzt werden, sind nicht theoretisch abgeleitet und nicht empirisch validiert.
Die Relevanz der einzelnen Symptome für eine Diagnostik ist unklar: Es wird nicht zwischen zentralen und peripheren Merkmalen unterschieden (was erforderlich ist).
Die Symptomlisten berücksichtigen in keiner Weise die letzten 20 Jahre empirischer Forschung. Sie sind daher in keiner Weise „state of the art“: Die als wesentlich gefundenen Störungsmerkmale kommen überwiegend nicht vor.
Die Angabe, wann eine Liste von Symptomen zu einer Diagnose führt, ist nicht empirisch gesichert und willkürlich (d. h. die Definition einer „Störung“ wird z. B. beim Vorliegen von sechs der Kriterien gegeben – dafür gibt es keine empirischen Belege oder theoretischen Ableitungen).
Es gibt nur sehr wenige psychologisch gut fundierte Theorien über Persönlichkeitsstörungen, aus denen sich ableiten ließe, welche psychologischen Variablen tatsächlich von zentraler Bedeutung sind.
Eine empirische Validierung selbst dieser Theorien ist zur Zeit aber nur in Ansätzen erkennbar: Eine Theorie, die als Ganzes empirisch validiert ist, existiert unseres Wissens nach gar nicht.
Die meisten Theorien befassen sich nur mit wenigen psychologischen Variablen, befassen sich kaum mit komplexen Wechselwirkungen und stellen auch keine psychologischen Funktionsmodelle für eine Störung dar. Daher lassen sich aus diesen Theorien zentrale Störungsaspekte gar nicht schlüssig ableiten.
Insbesondere ist der Theorie-Stand aber äußerst heterogen: Es gibt psychologisch und psychoanalytisch fundierte Theorien, die sich essenziell unterscheiden und nicht kompatibel sind. Und selbst innerhalb der psychologischen Theorien gibt es äußerst viele unterschiedliche: Es gibt also keine einheitliche Theorie, aus der sich Aspekte ableiten ließen, die allgemeingültig ist oder die von allen Forschern oder Praktikern anerkannt werden könnte.
Man kann natürlich wie im DSM-5 dem Vorgehen eine einzelne Theorie zugrunde legen, dann ergeben sich aber die Fragen, wieso diese Theorie besser geeignet sein sollte als andere und ob eine einzelne Theorie überhaupt irgendwie konsensfähig ist. Vor allem auch, da das Problem der theoretischen Kompatibilität zwischen Diagnostik-Theorie und Therapie-Theorie dadurch ja in keiner Weise gelöst werden kann.
Für eine diagnostische Definition allgemeiner, übergreifender Merkmale von Persönlichkeitsstörungen fehlen also sämtliche theoretischen und empirischen Grundlagen.
|22|Betrachtet man den augenblicklichen Entwicklungsstand der Persönlichkeitsstörungstheorien, dann ist auch in absehbarer Zeit nicht mit einer fundierten, einheitlichen Theorie zu rechnen, die eine Grundlage für ein solches Vorgehen abgeben könnte.
Das System verbindet kategoriale nicht mit dimensionaler Diagnostik.
2.2.3 Ist das System des ICD-11 besser geeignet, Persönlichkeitsstörungen zu diagnostizieren?
Das ICD-11 versucht eine (im Vergleich zu ICD-10 oder DSM-5) völlig neue Zugangsweise zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen (vgl. Bach & First, 2018; Bach et al., 2020, 2022; Mulder, 2021; Tyrer et al., 2019). So wurden u. a. „übergreifende Merkmale“ von Persönlichkeitsstörungen zu erfassen versucht, wie z. B. „negative Affektivität“, „Zurückgezogenheit“, „Enthemmung“, „Dissozialität“, „Anankasmus“ und es wird versucht, die Schwere von Persönlichkeitsstörungen zu erfassen.