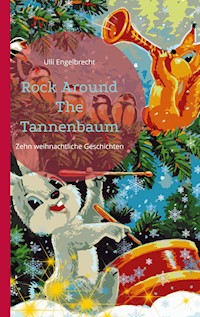Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit einem feinen Gespür für die Klänge der 1970er- und 1980er-Jahre webt Ulli Engelbrecht Geschichten und Gedichte, die das Lebensgefühl einer Generation lebendig werden lassen. Seine unterhaltsamen Erzählungen, in absurder, witziger, surrealer oder lakonischer Manier verfasst, verweilen nicht nur in der Vergangenheit. Die Songs und Sounds von damals umrahmen aktuelle Ereignisse und persönliche Erlebnisse. Ihre ungebrochene Relevanz und der anhaltende Einfluss sorgen nämlich dafür, dass sie auch heute noch das Denken und das Leben begleiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Kleinstadtkneipe
Vor dem Plattenregal
Allein unterm Kopfhörer
Der Benz
Schöne Augen und die Haare so blond
Manchmal bin ich mir selbst ein Rätsel
Am Ostufer von Loch Ness
Zeeland, im März
Bo sei Dank
Die Beatles waren allesamt schwul
Die Nierenschale aus vergoldeter Presspappe
Der gute Tag
Starrummel, Stofftiere, Mädchen, Suiten in aller Welt
Die Welt des guten Geschmacks
Meine Gitarre
Ich bin ein Automensch
Süffiger Blues im grauen Schutzschuber
Klaus Nomi war ja eigentlich Konditor
Lieber mal satt sein
Immer wenn ich Pillen nehme
Über die Dinge am Rand
Vom Geist des Weines
Willkommen in der Villa Albtraum!
Die Sache mit der dunklen Seite des Mondes
Siesta in der Voodoo Lounge
Die Liebe
Ein Grillfest mit Adriano, Sting, Stewart & Andy
Sechs junge Frauen ohne Gesicht
Über die Musik vom Abend am Tag zuvor
Eine Schublade in der Wolke
That’s Rock ’n’ Roll
Die Kleinstadtkneipe
Es gibt diese Kleinstadtkneipen
mit verkachelter Rundtheke
an der Männer mittleren Alters
oder kurz vor der Rente stehen oder sitzen
sie rauchen, trinken Pils und rufen
mach für den Kurt auch noch einen
Musik plärrt unermüdlich
aus versteckten Lautsprechern
meist über der Eingangstür
und man erkennt die Hits von einst
denen aber keiner zuhört
Die Gespräche drehen sich
um Urologen, Herzinfarkte, Nachtfrost
und um die Schwatten und die Genossen
dann wird abgewunken und
für alle Korn bestellt
Mir kommt das dann so vor
als wäre ich in der Kneipe der Kleinstadt
wo ich mal wohnte
und das ist Jahrzehnte her
und da gab es auch einen Kurt
und bei den Hits hörte auch keiner hin
nur da waren sie noch aktuell
Vor dem Plattenregal
Da steht meine Frau vor dem Plattenregal, schiebt sich ihre Lesebrille zurecht, blickt prüfend mal nach rechts, mal nach links und sagt, während sie die ein oder andere Scheibe herauszieht, streng: „Sag mal, sind die nicht eigentlich schon alle tot?“
Pandemische Zeiten. Panische Zeiten.
So ist das, wenn dich der Corona-Lockdown im Griff hat und die Ehefrau zwecks Zuhausebleibenmüssens Zeit findet, über eine Neuordnung der Medienbestände innerhalb unserer Lebensgemeinschaft nachzudenken. Übersetzt heißt das nämlich, dass ich mich wohl von einigen Platten trennen soll, damit mehr Platz für was auch immer geschaffen wird.
Schlagfertig, wie ich bin, entgegne ich spitz, dass sie dann auch darüber sinnieren müsse, was mit den zahlreichen Exemplaren ihrer Bücher geschehen solle. Immerhin seien etliche Schriftsteller, die für all diese Lesevergnügen verantwortlich zeichnen, ebenfalls zum größten Teil bereits ins Jenseits hinübergegangen.
„Das ist doch etwas völlig anderes“, meint sie, blättert durch meine Rock- und Pop-Plattenkollektion und sagt, dass ich nicht vom Thema ablenken solle. Sie hält nach einer Weile inne, zieht Ian Durys „New Boots & Panties!!“ heraus. Sie guckt aufs Cover, schiebt sie dann zurück, zieht sie erneut heraus, schaut mich auffordernd an, fragt, ob die nicht aussortiert werden könne. „Das ist eine sehr gute Platte“, sage ich, „die gebe ich doch um Himmels willen nicht weg!“ Mit einem Achselzucken legt meine Frau Mr. Dury und die Blockheads auf den Beistelltisch – doch plötzlich erschallt ein energisches „Keep your hands off!“ Zu unserem Erstaunen ertönt tatsächlich eine Stimme aus der Platte. „This constant pulling out is driving me crazy! Please put me back or play me!“, beklagt sie sich lautstark. Ich muss grinsen, denn ich kann die Scheibe gut verstehen. Das ständige Hin und Her setzt ihr zu – sie möchte entweder ordentlich einsortiert oder endlich abgespielt werden.
Ich nehme meiner Frau schnell die Platte aus der Hand und stelle sie zurück. Man darf sie offenbar nicht einfach so herumliegen lassen, sonst würde sich die Band höchstwahrscheinlich aus dem Nichts materialisieren, dabei unser Wohnzimmer in Unordnung bringen und uns sowie die Nachbarn ziemlich lautstark mit punkigem Pub-Rock einheizen.
Eine interessante Vorstellung.
Offenbar ist die Musikergemeinschaft in meinem Plattenregal wesentlich lebendiger, als ich bisher vermutet habe. Wir beschließen also, das Plattenregal zunächst einmal unverändert zu lassen.
„Ob die Bücher sich auch beschweren würden, wenn wir sie ausräumen?“ Meine Frau wartet gar nicht erst auf eine Antwort, sondern macht sich ohne Zögern auf den Weg in ihr Zimmer. Nach kurzem Suchen zieht sie einen Kafka-Sammelband hervor und legt ihn auf den Zeitungsstapel. Keine fünf Sekunden später ertönt tatsächlich eine tiefe, unheilvolle Stimme aus dem Inneren des Buches: „Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr mich einfach so achtlos beiseitelegen könnt, oder?“ Wir starren das Buch an, als befürchteten wir, es könnte uns gleich verschlingen. „Oha“, sage ich mit einem nervösen Lächeln, „vielleicht sollten wir das Buch lieber sofort wieder an seinen Platz zurückstellen.“ „Nein“, erwidert meine Frau entschlossen. „Lass uns doch einfach mal abwarten, was passiert.“ „Na schön“, sage ich, „wenn du meinst, dann warten wir ab.“
Kaum habe ich meinen Satz beendet, beginnen die Wände unseres Wohnzimmers zu schmelzen, als hätten sie sich in zähe Wachsschichten verwandelt, die von einer unsichtbaren Flamme verzehrt werden. Langsam zerfließen sie und geben den Blick frei auf ein Labyrinth aus Gängen, das in kaltes, düsteres Licht getaucht ist. Plötzlich finden wir uns in einem vollbesetzten Gerichtssaal wieder, der in einer unheimlichen, geradezu überwältigenden Stille verharrt. Der Richter – eine schemenhafte, stumme Gestalt – gestikuliert mit wilden, unentschlossenen Bewegungen, als wolle er ein Urteil verkünden, doch kein einziges Wort dringt über seine Lippen.
Wie auf einer sich drehenden Theaterbühne wechselt die Szenerie abrupt: Jetzt stehen wir in einem verlassenen Großraumbüro. Das rhythmische Klappern von Schreibmaschinentasten ertönt, zunächst leise, dann immer lauter, bis es sich zu einem monotonen, ohrenbetäubenden Lärm steigert, der den Raum zu füllen scheint. Jeder Tastenanschlag bringt eine neue, absurde Vorschrift hervor, ein weiteres undurchschaubares Netz aus Paragraphen. Die Vorschriften wirbeln wie ein chaotischer Sturm durch den Raum, in dessen Zentrum verängstigte Menschen mit Papier und Tinte um sich werfen und sich so offenbar verzweifelt gegen die Widrigkeiten einer monströsen und unbegreifbaren Bürokratie wehren, die sie mehr erdrückt, als dass sie sie befreit. Nach einer gefühlten Ewigkeit gelingt es uns schließlich, das Buch zurückzustellen. „Puh, das war heftig“, sage ich, während sich die Anspannung in meinen Gliedern löst. Meine Frau nickt ebenfalls erleichtert und sagt dann mit einem gequälten Lächeln: „Ich mache uns jetzt erst mal einen Kaffee.“
Seitdem belassen wir unsere Medienbestände lieber in den Regalen und holen Platten oder Bücher nur noch dann hervor, wenn wir tatsächlich etwas hören oder lesen wollen. Sollte demnächst aber doch eine Aufräumaktion anstehen, werden wir sicherheitshalber einen erfahrenen Exorzisten hinzuziehen.
Das erhöht garantiert die Sicherheit, bevor man wahnsinnig wird.
Allein unterm Kopfhörer
Neulich entspannte ich mich. Ich folgte damit einem ärztlichen Rat, fläzte mich in meinen Schaukelstuhl, setzte mir meinen Kopfhörer auf, schloss die Augen und hörte mir tatsächlich kein Fitzelchen Musik an. Ich genoss die Stille, die mich umgehend umgab und purzelte nach zwei, drei Wimpernschlägen mit allen Sinnen in einen wohligem Schlummer, der mir aber plötzlich eine ganze Reihe rätselhafter Kurzfilme in expressionistischer Manier aus meinem Unterbewusstsein heraus abspulte.
Ich sitze überraschenderweise an meiner Haltestelle, an der allerdings meine Straßenbahn weder abfährt noch hält. Das tut sie witzigerweise nur genau gegenüber. Jene Haltestelle, nämlich die für mich richtige Haltestelle, ist zwar nur ein paar Schritte entfernt, allerdings erreiche ich sie nicht. Ich schaffe es einfach nicht, die kurze Distanz zu überwinden. Kaum laufe ich auf sie zu, hindert mich eine durchsichtige, gallertartige Wand daran, weiterzukommen. Ständig pralle ich zurück. Ich kann nur hier sitzen und zusehen, wie an der für mich unerreichbaren Haltestelle die Bahnen sekündlich einfahren, abfahren, wieder einfahren, abfahren.
Um mich herum stehen zahlreiche Fahrgäste, die offensichtlich ihre Bemühungen, die Bahn an der anderen Haltestelle zu erreichen, schon vor längerer Zeit aufgegeben haben. Ihre modrige Kleidung und ihre verfilzten Haare zeugen davon. Kopfschüttelnd und stumm verfolgen sie meine Bemühungen.
Plötzlich setzt sich eine stämmige Rothaarige neben mich und sagt, dass ich mich stärker auf meine Bahn konzentrieren solle, ich müsse doch sicherlich pünktlich sein, hätte wichtige Termine oder eine Arbeit und so fort.
Ich nicke ihr zu und übernehme ihre Bewegungen: Ich führe meine Zeigefinger an meine Schläfen, massiere sie und finde mich plötzlich vollbekleidet und schwimmend in einem Teich wieder, aus dem meine Haltestelle wie eine Rettungsinsel herausragt. Ich schwimme mehrmals drumherum, angefeuert von der Rothaarigen, dass ich konzentriert darauf zuhalten soll, was mir aber nicht gelingt. Sie springt ebenfalls voll bekleidet ins Wasser, nimmt mich an die Hand, und nach einer gemeinsamen Umrundung der Rettungsinsel sitzen wir beide erneut an der für mich falschen Haltestelle.
Die Rothaarige holt nun ein Butterbrot aus ihrem Rucksack und beginnt zu essen. Ich habe eine Tüte voll Heftklammern vor mir, greife hinein und schiebe sie mir einzeln in den Mund. Die Rothaarige schaut erstaunt zu, schlägt mir auf den Rücken und die Klammern purzeln mir aus dem Mund und auf den Boden. Sofort stürzen sich die wartenden Fahrgäste darauf, als hätte ich Hundert-Euro-Scheine ausgespuckt. Die Rothaarige lacht laut auf, reicht mir ihre Hand, schüttelt sie energisch und ehe ich mich versehe, befinde ich mich in einem Synchronstudio in Berlin, wo ich dem Schauspieler, der seine Stimme einem Raumschiff-Chef leiht, der in Galaxien vordringt, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, gerade die Hand gebe und ihm Glück wünsche.
Ganz allein steht er im abgedunkelten Raum und spricht mal einen Satz, mal zwei Sätze, dann wieder einen, dann wieder zwei und so fort, und er ist so fern vom Alltag entfernt, dass es einem weh ums Herz wird. In einer Arbeitspause frage ich ihn, ob er denn regelmäßig und pünktlich seine Straßenbahn erwischen würde. Er zuckt verwundert mit den Schultern, deutet auf die Tür zum Regieraum, die sich nun öffnet und durch die ein weiterer Raumschiff-Kommandant, nennen wir ihn Dietmar, fröhlich pfeifend hereinspaziert. Ich spitze die Ohren: The Hollies, Bus Stop.
Er hält einen Fahrplan der Berliner Verkehrsbetriebe in Händen, stellt sich vor mich hin und liest vor. Ich hoffe darauf, nun endlich die korrekte Haltestelle zu erfahren und die richtige Abfahrtzeit, doch Dietmar berichtet weitschweifig von einem seiner Patrouillengänge, als er damals mit der Orion einen Planeten ansteuerte, der ausschließlich von Frauen verwaltet und regiert wurde und auf dem Männer nichts zu melden hatten und nur als Gärtner arbeiten durften.
Gärtnern sei generell und tatsächlich eine reine Männersache, sagt Dietmar. Männer täten es schließlich gern, ausgiebig und erfolgreich. Das sehe er immer dann, durchstreife eine Kleingartensiedlung. Männer freuten sich darüber, wenn Kürbisse aus der Saat ballerten, Tomaten in die Luft flögen, Bohnen ins Kraut schössen oder Salatköpfe explodierten. Dann stünden sie selbstvergessen da und schauten liebe- und verständnisvoll auf ihre Hege-Sprösslinge, als wären das ihre wahren Kinder und nicht die plärrende und ungezogene Brut zu Hause, deren Aufzucht sie lieber ihren Frauen überließen.
Das sei ja alles spannend und aufschlussreich, meine ich, aber wie sei das denn nun mit meiner Haltestelle.
Ob ich nicht auch mit einem Tretroller fahren könne, fragt er mich. Er habe gerade zufällig einen bei der Hand. Er greift hinterrücks in seinen Rucksack, hält mir grinsend eine CD der Band Scooter unter die Nase. Ich sage freundlich nein danke, denn diese Musiziergemeinschaft würde ich nur gut finden, wenn sie auf ihren Veröffentlichungen komplett auf Musik verzichten würde. Dass das durchaus möglich sei, habe der amerikanische Komponist John Cage schon in den 1950er-Jahren vorgemacht, informiere ich ihn. 4‘33‘‘ heiße sein dreisätziges Klavierstück, bei dem tatsächlich vier Minuten und dreiunddreißig Sekunde lang kein Ton zu hören sei. Stille eben.
Kopfschüttelnd steckt Dietmar die CD zurück in den Rucksack, drückt mir den Fahrplan in die Hand, wünscht mir gutes Gelingen und verschwindet zurück in den Regieraum.
Kaum hat er die Tür hinter sich geschlossen, finde ich mich in einer grell ausgeleuchteten und voll besetzten Straßenbahn wieder, die mit rasantem Tempo in einer mir völlig fremden Umgebung durch die Nacht rast und nach wenigen Minuten an einem Bahnsteig vor einem monströsen Gebäude hält, an dem eine großformatige Leinwand montiert ist, auf der mir in verschiedenfarbigen Großbuchstaben HALTE-STELLE entgegenleuchtet. Ich steige mit den anderen Fahrgästen aus, lasse mich mit ihnen treiben und gerate in einen Tunnelgang, in dem sich rechts und links ausschließlich Toiletten befinden.
Nach wenigen Metern geraten wir in ein Atrium, vollgestellt mit Marktständen. Plötzlich stürmen aus den umliegenden Räumen jede Menge Menschen auf den Platz, die in einem Anfall von Vandalismus alles zerstören und zertrümmern. Sie stecken die Stände in Brand und verprügeln sich selbst untereinander während dieser Aktion. Irgendjemand schleppt fünf große Holzkisten heran, mit Luftlöchern drin, in denen sich kleine Menschen groß wie Zinnsoldaten befinden: Feuerwehrleute. Sie hüpfen zu Hunderten aus den Kisten und pinkeln auf Kommando in steilem Bogen und ohne Unterlass auf die Flammen.
Ich renne zurück in den Tunnel, um mich in Sicherheit zu bringen, und rüttele an den Toilettentüren, die jedoch verschlossen sind. Ich versuche es weiter, finde doch noch eine Tür, die sich öffnen lässt, und lande in einem gelb ausgemalten Großraumbüro einer Medienagentur, in dem junge Frauen in schicken Gewändern an schrankwandgroßen Bildtafeln arbeiten.
Von dem Trubel im Atrium haben sie offenbar nichts mitbekommen. Sie zeichnen in akribischer Handarbeit und in aller Stille grafische Vorlagen. Es sind ausschließlich Werbeplakate, auf denen ich zu sehen bin, wie ich mit dem Berliner Nahverkehrsnetzplan, den Dietmar mir in die Hand gedrückt hatte, unter einem Bierfass schlafe, aus dessen Zapfhahn der Gerstensaft herauströpfelt und meine Hose einnässt.
Ich wende mich an die stämmige Rothaarige, die ich noch von der gemeinsamen Rettungsinsel-Umrundung kenne. Sie stapelt die Plakate vom Laufband auf Europaletten, und ich frage sie, was denn das zu bedeuten habe.
Sie hält inne, lächelt mich an, streckt ihre Hände vor, massiert mit Daumen und Zeigefinger meine beiden Ohrmuscheln, was in mir ein bislang nie erahntes sinnbetörendes Vergnügen auslöst. Ich fühle mich erotisch perfekt umschmeichelt und komme mir vor wie ein Ferengi, weil diese wulstköpfigen Profitgeier aus dem Star-Trek-Universum galaxieweit die einzigen Aliens sind, die auf diesen exquisiten Ohren-Porno abfahren.
Urplötzlich jedoch kneift mich die stämmige Rothaarige kräftig in beide Ohrläppchen und zieht sie mit ihrem festen Schraubstockgriff im Zeitlupentempo herunter bis auf meine Schultern. Ich schreie laut auf, denn der plötzliche Schmerz fährt mir in Mark und Bein und vor allem in die Blase. Die stämmige Rothaarige lächelt immer noch, schnappt sich ein Plakat, rollt es ein, steckt es mir in die Jackentasche und wünscht mir eine gute Reise. Und während sie zurück zu ihrer Europalette geht, verschwindet im Takt ihrer Schritte nach und nach der Raum um mich herum und gibt den Bahnhof frei, an dem meine Straßenbahn steht. Ich schaue in den Fahrplan, in dem exakt nur dieser eine Bahnsteig mit exakt nur dieser einen Bahn und mit exakt nur dieser einen Abfahrtzeit verzeichnet ist. Ich blicke auf meine Armbanduhr. Mir bleibt nur noch eine knappe Minute Zeit.
Ich muss dringend aufs Klo, finde aber keins. Die Bahn kommt. Ich stehe vor den automatischen Türen. Sie öffnen sich sofort. Ich steige ein. Die Türen schließen sich geräuschlos. Ich nehme erfreut zur Kenntnis, dass ich der einzige Fahrgast bin. Und dass die Fahrgastsitze allesamt Kloschüssel sind. Ich suche mir den erstbesten aus. Ich hocke mich hin. Ich schließe die Augen. Ich atme kurz durch. Die Bahn fährt los. Ich bin erleichtert. Geschafft.
Das unerträgliche Jucken meiner Ohren sorgt dafür, dass ich abrupt aufschrecke. Beim Rubbeln und Reiben meiner Lauscher pendle ich mich langsam und noch ziemlich schlaftrunken in die Wirklichkeit hinein. Schaukelstuhl, Kopfhörer, Kabel. Alles da, alles klar.
Aber was ist nur mit dem Kabel? Ich stelle fest, dass das Zuleitungskabel von meinem Kopfhörer doch nicht verwicklungsfrei ist. Es verhedderte sich und – schwupps – schon lag der Hörer auf dem Boden. Grund genug für mich, nun fix aufzustehen und vor allem geschwind die Toilette aufzusuchen.
Auch wenn ein komplexer Verdauungsprozess für weniger Sauerstoff im Gehirn sorgt, glaube ich nicht, dass die Kürbissuppe und die Lasagne, die ich mir vor meinem Regenerationstrip gegönnt hatte, an den gerade geschilderten Ereignissen schuld waren. Es war tatsächlich die Stille, der ich mich stellen und die ich aushalten musste. Und erzählen Sie mir jetzt bloß nichts mehr von Entspannung!
Allein unterm Kopfhörer, mit geschlossenen Augen und ohne Musik, ist die Stille der reinste Horror!
Der Benz
Der Benz war knallgelb
ein 200er Strich 8 Diesel
gut in Schuss und äußerst preiswert
Weil du es bist
kannst du ihn haben
sagte mir der Freund
und ich griff zu
In der Kleinstadt
war der Wagen bekannt
und man schaute mir nach
Aber man wunderte sich nicht
über die endlosen Bluesrock-Kaskaden
von Johnny Winter
die sich lautstark und in wilden Strömen
aus dem Autorecorder ergossen
und durchs offene Fenster drangen
Es waren auch nicht die zwei HiFi-Boxen
aus Nussbaum auf der Hutablage
die für Aufsehen sorgten
Eine kluge Spanngurt-Konstruktion
eigener Bauart hielt sie fest im Griff
damit sie beim Hören und Fahren
nicht auf die Rückpolster kullerten
die ich halbwegs reinigen konnte
sodass nur noch ein paar
blassrote Flecken übrig blieben
Sie wunderten sich darüber
dass es mir nichts ausmachte
den Wagen zu fahren
in dem der Vater des Freundes
sich erschossen hatte
Schöne Augen und die Haare so blond
Was ich gerne einmal wissen möchte: Stehen bei Ihnen die Lautsprecherboxen frei im Raum? Und wenn ja, liegt oder steht da etwas drauf? Eine Kerze vielleicht? Ein Schälchen mit Knabberzeug? Eine hässliche Vase aus Omas Erbschaft? Oder nutzt gar Ihre Frau oder Ihre Freundin bzw. Ihr/Ihre Lebensabschnittspartner/-partnerin die Boxen als Ablage für Gedöns? Kettchen, Ringe, Eyeliner, Schlüsselbund, Zigaretten, Präservative oder ähnliche Dinge?
Sollte es so sein, empfehle ich die sofortige Trennung von jener unsensiblen Person!
Sollte es nicht so sein, dann ist das sehr gut, dann leben Sie offenbar in einer harmonischen Beziehung.
Es gehört sich nämlich nicht, frei stehende Lautsprecherboxen als Möbelstücke zu behandeln!
Tut man mit Heizkörpern auch nicht. Musik muss sich störungsfrei entfalten können. Allein ein kräftiger Basston reicht manchmal aus, schon hüpfen Krempel, Tand und Nippes im Dreieck und sorgen für negative Schwingungen.
Somit noch einmal zum Mitschreiben: Lautsprecherboxen, die frei im Raum stehen, sind kein Regalersatz! Für nichts! Für niemanden!
Eva weiß das. Für Eva sind frei stehende Boxen tabu. Eva ist eben perfekt programmiert. Eva ist ein Roboter. Aber nicht so eine kantige Metallkiste. Wo denken Sie hin. Evas kunstvoll konstruierter Körper ist von unserem menschlichen Körper kaum zu unterscheiden. Eva bewegt sich wie du und ich und sie hat schöne Augen und die Haare so blond. Genauer: Ihre mandelförmigen Augen sind hellblau und umrandet von dichten, dunklen Wimpern, ihr mittelgescheiteltes Haar fliesst in glatter Form über ihre Schultern und glänzt dabei wie flüssiges Gold.