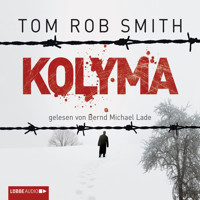
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Leo Demidow
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band der Thrillerreihe um den Geheimdienstoffizier Leo Demidow
Kolyma – das ist der Vorhof der Hölle. Am äußersten Rand von Sibirien gelegen, tausende Kilometer von Moskau entfernt, gibt es hier nur Steine, Schnee, Permafrost – und Lager. Die schlimmsten Gulags der Sowjetunion. In diese eisige Wüste lässt Leo Demidow sich einschmuggeln, denn seine Tochter wurde entführt, und ihr Leben steht auf dem Spiel. Doch als einer der Mithäftlinge ihn als ehemaligen KGB-Agenten enttarnt, sitzt Leo plötzlich in einer tödlichen Falle ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 47 min
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Moskau 1956. Nach Chruschtschows Geheimer Rede herrscht Aufruhr in der Sowjetunion. Überlebende der großen Säuberungen melden sich anklagend zu Wort, es kommt zu ersten Racheakten. Der ehemalige KGB-Agent Leo Demidow soll den Tod von zwei Geheimdienstlern aufklären. Dabei legen seine ehemaligen Kollegen ihm jede Menge Steine in den Weg, denn für sie ist Leo ein Verräter. Erschwerend kommt hinzu, dass die Existenz seines Morddezernats von offizieller Stelle geleugnet wird und Leo verdeckt ermitteln muss.
Als Leos Adoptivtochter Soja gekidnappt wird, lautet die Forderung der Entführer Leben gegen Leben. Denn vor sieben Jahren, als er noch beim KGB war, hatte Leo einen Priester in den Gulag nach Kolyma geschickt. Und jenen soll er jetzt wieder herausholen. Um Soja zu retten, lässt Leo sich in seiner Verzweiflung als Gefangener in die berüchtigte Eishölle am äußersten Rand Sibiriens einschleusen. Doch schon am ersten Abend wird er erkannt, und die Häftlinge beschließen, sich grausam an ihm zu rächen …
Autor
Tom Rob Smith wurde 1979 als Sohn einer schwedischen Mutter und eines englischen Vaters in London geboren, wo er auch heute noch lebt. Er studierte in Cambridge und Italien und arbeitete anschließend als Drehbuchautor. Mit seinem Debüt »Kind 44« gelang Tom Rob Smith auf Anhieb ein internationaler Bestseller. Er wurde u. a. mit dem »Steel Dagger« ausgezeichnet, für den »Man Booker Prize« nominiert und bisher in 26 Sprachen übersetzt. Mit »Kolyma« hat der Autor den zweiten Band um den Geheimdienstoffizier Leo Demidow vorgelegt, womit ihm erneut der Sprung in die Bestsellerlisten gelang. Ein weiterer Band in der Reihe wird in Kürze bei Manhattan erscheinen. Weitere Informationen zum Autor unter www.tomrobsmith.com
Inhaltsverzeichnis
Für meine GeschwisterSarah und Michael
Sowjetunion
Moskau
3. JUNI 1949
Im Großen Vaterländischen Krieg hatte er zur Verteidigung von Stalingrad die Brücke von Kalatsch gesprengt. Fabriken hatte er mit Dynamit präpariert und danach in Schutt und Asche gelegt und Raffinerien, die nicht mehr zu verteidigen waren, in Brand gesetzt, bis überall am Horizont Säulen brennenden Öls gelodert hatten. Alles, was die einfallende Wehrmacht vielleicht requirieren konnte, hatte er in aller Eile zerstört. Mochten seine Landsleute auch Tränen vergießen, wenn ihre Heimatstädte in sich zusammenfielen, ihn hatte der Anblick der Zerstörung mit grimmiger Genugtuung erfüllt. Der Feind würde ein verwüstetes Land erobern, verbrannte Erde und einen rauchenden Himmel. Oft hatte er mit dem improvisieren müssen, was gerade zur Hand war, mit Panzergranaten oder Glasflaschen, das Benzin hatte er sich aus liegen gebliebenen Militärlastwagen abgesaugt. Er hatte sich beim Staat den Ruf eines Mannes erarbeitet, auf den Verlass war. Nie hatte er die Nerven verloren und nie einen Fehler gemacht, auch dann nicht, wenn er unter extremen Bedingungen operierte, in eiskalten Winternächten, bis zur Hüfte in reißenden Flüssen oder unter Feindbeschuss. Für einen Mann mit seiner Erfahrung und seinem Temperament war die heutige Aufgabe eigentlich eine Routineangelegenheit. Er musste sich nicht beeilen, und ihm pfiffen auch keine Kugeln um die Ohren. Dennoch zitterten seine Hände, die doch eigentlich als die ruhigsten in seiner gesamten Zunft galten. Schweißtropfen rannen ihm in die Augen und zwangen ihn, sie mit einem Hemdzipfel abzutupfen. Ihm war schlecht wie einem Anfänger. Denn es war das erste Mal, dass der fünfzigjährige Kriegsheld Jekabs Duwakin eine Kirche in die Luft jagen sollte.
Eine Sprengladung musste noch angebracht werden, direkt vor ihm im Altarraum. Den Altar selbst hatte man ebenso fortgeschafft wie die Ikonostase, die heiligen Ikonen und die Kerzenleuchter. Bis auf das Dynamit, das er in die Fundamente gegraben und an den tragenden Säulen befestigt hatte, war die Kirche leer, entweiht und vollkommen geplündert. Sogar das Blattgold hatte man von den Wänden gekratzt. Nichts war mehr übrig außer dem riesigen, Ehrfurcht gebietenden Raum selbst, dessen Hauptkuppel mit ihrer Krone aus Buntglasfenstern ganz oben so sehr vom Tageslicht erfüllt war, dass sie ihm erschien wie ein Teil des Himmels selbst. Jekabs legte den Kopf in den Nacken und bewunderte mit offenem Mund die Spitze der Kuppel etwa fünfzig Meter über ihm. Sonnenstrahlen fielen durch die hohen Fenster und strahlten Fresken an, die schon bald in die Luft fliegen sollten, eine Million Farbtupfer, zerstäubt in alle Einzelteile. Als wolle es nach ihm greifen, breitete sich das Licht über den glatten Steinboden bis fast zu ihm hin aus, eine ausgestreckte, goldene Hand.
»Es gibt keinen Gott«, murmelte er.
Er wiederholte die Worte, diesmal lauter, das Echo hallte von den Wänden der Kuppel wider: »Es gibt keinen Gott!«
Schließlich war ein Sommertag, logisch, dass es da hell war. Das war kein Zeichen. Kein göttliches Zeichen. Das Licht hatte nichts zu bedeuten. Er grübelte zu viel, das war das Problem. Dabei glaubte er gar nicht an Gott. Er versuchte sich die vielen antireligiösen Maximen ins Gedächtnis zu rufen, die der Staat ausgab.
DIE RELIGION GEHÖRTE EINEM ZEITALTER AN, IN DEM JEDER FÜR SICH SELBST WAR. UND GOTT WAR FÜR ALLE.
Dieses Gebäude war nicht heilig oder gesegnet. Er musste es sehen als das, was es war, nämlich Stein, Glas und Holzbalken, eine hundert Meter lange und sechzig Meter breite Kirche, die nichts produzierte und keine nachvollziehbare Funktion hatte. Ein archaisches Bauwerk, von einer Gesellschaft, die es nicht mehr gab, aus archaischen Beweggründen errichtet.
Jekabs lehnte sich zurück und strich mit der Hand über den kühlen Steinboden, den die Füße Hunderter, Tausender von Kirchgängern jahrhundertelang blank gescheuert hatten. Überwältigt vom Ausmaß dessen, was er im Begriff war zu tun, kämpfte er gegen das Gefühl an, so als ob ihm etwas im Halse stecken geblieben sei. Doch das ging vorbei. Er war müde und überarbeitet, mehr nicht.
Normalerweise wurde er bei einer Sprengung wie dieser von einer ganzen Mannschaft unterstützt. In diesem Fall hatte er sich jedoch dafür entschieden, seine Männer nur am Rande zu beteiligen. Wozu die Kollegen unnötig in etwas hineinziehen? Keiner von ihnen dachte so klar wie er. Nicht alle hatten sämtliche religiösen Gefühle aus ihrem Herzen verbannt. Er wollte nicht mit Männern zusammenarbeiten, die nicht vollkommen hinter der Sache standen.
Fünf Tage arbeitete er nun schon vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Er hatte jede Sprengladung selbst angebracht und sie so positioniert, dass das Gebäude auf jeden Fall nach innen in sich zusammenfallen würde, eine Kuppel fein säuberlich über der anderen. Eine Sprengung war beileibe keine chaotische Angelegenheit, ganz im Gegenteil. Sorgfalt und Präzision zeichnete seine Arbeit aus, und auf diese Kunst war er besonders stolz. Dieses Bauwerk hier stellte eine ungewöhnliche Herausforderung dar. Nicht etwa wegen der moralischen Frage, sondern wegen der intellektuellen Aufgabe. Angesichts des Glockenturms und der fünf vergoldeten Kuppeln, deren größte auf achtzig Meter hohen Bögen ruhte, würde die heutige Sprengung einen würdigen Abschluss seiner Karriere darstellen. Danach hatte man ihm den vorzeitigen Ruhestand versprochen. Selbst davon, ihm den Lenin-Orden zu verleihen, war die Rede gewesen, Lohn für einen Auftrag, den sonst keiner übernehmen wollte.
Er schüttelte den Kopf. Er sollte nicht hier sein. Er sollte so etwas nicht tun. Er hätte sich krankmelden sollen. Er hätte jemand anderen zwingen sollen, die alles entscheidende Sprengladung anzubringen. Das hier war keine Arbeit für einen Helden. Aber wenn man sich vor der Arbeit drückte, waren die Risiken viel größer und viel realer als irgendeine abergläubische Idee, dass der Auftrag verflucht sein könnte. Er hatte eine Familie zu beschützen, seine Frau und eine Tochter. Und die beiden liebte er über alles.
Lasar stand in der Menge, die in einem Sicherheitsabstand von hundert Metern von der Kirche der Heiligen Sophia ferngehalten wurde. Sein ernstes Gebaren stach aus dem aufgeregten Geschnatter der Menschen um ihn herum heraus. Das war die Sorte Leute, dachte er, die wohl auch zu einer öffentlichen Hinrichtung gekommen wären, nicht aus Überzeugung, sondern einfach nur wegen des Spektakels, weil was los war. Die Stimmung war ausgelassen, voller Vorfreude sprudelten die Gespräche. Kinder wippten auf den Schultern ihrer Väter, sie konnten kaum erwarten, dass es losging. Eine Kirche allein reichte ihnen nicht, die Kirche musste schon in sich zusammenfallen, damit sie ihren Spaß hatten.
Vorne an der Absperrung bauten auf einer eigens errichteten erhöhten Bühne Filmleute ihre Stative und Kameras auf. Dabei diskutierten sie, aus welchem Blickwinkel man die Sprengung wohl am besten aufnehmen konnte. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass man auch ja alle fünf Kuppeln im Visier hatte, und es wurde ernsthaft darüber spekuliert, ob sie wohl schon in der Luft auseinanderbrechen würden, wenn sie ineinanderkrachten, oder erst auf der Erde. Das hing, vermutete man, vom Können der Experten ab, die da drinnen das Dynamit anbrachten.
Lasar fragte sich, ob ein paar in der Masse wohl auch traurig waren. Auf der Suche nach Gesinnungsgenossen blickte er nach rechts und nach links – in einiger Entfernung stand ein Ehepaar, beide stumm und aschfahl im Gesicht, die ältere Frau ganz am Rand hatte eine Hand in der Jackentasche stecken. Sie verbarg etwas, vielleicht ein Kruzifix. Lasar hätte gern die Menge geteilt, die Trauernden von den Schaulustigen getrennt. Er hätte gern an der Seite derer gestanden, die begriffen, was hier verloren gehen würde: eine dreihundert Jahre alte Kirche, erbaut nach dem Vorbild der Kathedrale der Heiligen Sophia in Gorki, deren Namen sie auch trug. Bürgerkriege und Weltkriege hatte sie überdauert, und der jüngste Bombenschaden war eher ein Grund gewesen, sie zu erhalten, als sie zu zerstören. Mit Wut im Bauch hatte Lasar den Artikel in der Prawda gelesen, in dem von Baufälligkeit die Rede gewesen war – nichts weiter als ein Vorwand, um das Bevorstehende erträglich zu machen. Der Staat hatte die Zerstörung der Kirche befohlen. Aber noch schlimmer, sogar viel schlimmer war, dass die Orthodoxe Kirche dem Dekret zugestimmt hatte. Beide Parteien, die sich dieses Vergehens schuldig machten, schoben vor, dass es sich um eine rein pragmatische und nicht etwa um eine ideologische Entscheidung handle. Sie hatten eine ganze Liste von Gründen erstellt. Da waren zunächst einmal die durch die deutsche Luftwaffe verursachten Schäden. Dann bedurfte das Kircheninnere einer aufwendigen Restaurierung, für die indes kein Geld da war. Und schließlich wurde der Grund und Boden mitten in der Stadt für ein wichtiges Bauprojekt benötigt. Alle, die etwas zu sagen hatten, waren einer Meinung: Diese Kirche, die noch nicht einmal zu den wichtigsten Moskaus zählte, sollte abgerissen werden.
Was sich hinter dieser beschämenden Argumentation verbarg, war Feigheit. Nachdem die kirchlichen Würdenträger während des Krieges sämtliche Gemeinden hinter Stalin versammelt hatten, waren sie jetzt nur mehr Instrumente des Staates, ein Ministerium des Kremls. Der Abriss war eine Demonstration dieser Unterwerfung. Diese Sprengung hier diente nur einem einzigen Zweck, nämlich die Ergebenheit der Kirche zu beweisen. Ein himmelschreiender Akt der Selbstverstümmelung, um zu zeigen, wie harmlos, fügsam und bezähmt die Religion war. Man brauchte sie gar nicht mehr weiter zu verfolgen.
Lasar verstand die Taktik hinter diesem Opfer. War es nicht besser, eine einzige Kirche zu verlieren als alle? Als junger Mann war er Zeuge geworden, wie theologische Seminare in Arbeiterbaracken umfunktioniert worden waren und Kirchen in antireligiöse Ausstellungsräume. Ikonen hatte man als Feuerholz benutzt, Priester inhaftiert, gefoltert und exekutiert. Permanente Verfolgung oder kritiklose Unterwürfigkeit – das waren die Alternativen gewesen.
Jekabs hörte das Lärmen der Menge, die sich draußen versammelte, wie sie aufgeregt wartete, dass es endlich losging. Er war spät dran, eigentlich hätte er schon so weit sein sollen. Doch in den letzten fünf Minuten hatte er nichts unternommen, hatte nur die letzte Sprengladung angestarrt und sich nicht gerührt. Hinter sich hörte er das Quietschen der Tür und blickte über die Schulter. Es war sein Kollege und Freund, er verharrte auf der Türschwelle, als ob er Angst habe einzutreten. Er rief ihn an, seine Stimme hallte von den Wänden wider.
»Jekabs! Was ist los?«
»Gar nichts«, antwortete Jekabs. »Bin gleich so weit.«
Sein Freund zögerte einen Augenblick, dann fuhr er mit leiserer Stimme fort: »Heute Abend betrinken wir uns, wir zwei, und feiern deine Pensionierung. Morgen früh hast du bestimmt fürchterliche Kopfschmerzen, aber abends geht es dir dann schon besser.«
Jekabs musste lächeln angesichts dieses Trostversuchs seines Freundes. Die Schuldgefühle würden auch nicht schlimmer sein als ein Kater, sie würden verschwinden.
»Noch fünf Minuten.«
Und damit ließ sein Freund ihn in Ruhe.
Wie in der schlechten Parodie eines Gebets, schweißtriefend, kniete Jekabs sich mit schlüpfrigen Fingern hin. Er wischte sich das Gesicht ab, aber das brachte nichts, sein Hemd war schon klatschnass. Bring die Sache zu Ende! Danach würde er nie wieder arbeiten müssen. Morgen würde er mit seiner kleinen Tochter am Fluss spazieren gehen. Und übermorgen würde er ihr etwas kaufen und zusehen, wie sie sich freute. Ende nächster Woche hätte er die Kirche schon vergessen, ihre fünf goldenen Kuppeln und wie sich ihr kalter Steinboden angefühlt hatte.
Hastig griff er nach dem Zünder und hockte sich vor das Dynamit.
Buntglas schoss in alle Richtungen aus der Kirche heraus, als in einem Augenblick sämtliche Fenster unten und oben gleichzeitig barsten und die Luft mit farbenfrohen Bruchstücken füllten. Die eben noch solide Rückwand wurde in eine sich auftürmende Staubwolke verwandelt. Scharfe Steinbrocken flogen in hohem Bogen nach oben und krachten dann auf die Erde, fraßen sich durch die Grasnarbe und schlitterten auf die Menge zu. Die kümmerliche Absperrung bot keinen Schutz, mit lautem Scheppern flog sie zur Seite. Links und rechts von Lasar gingen Menschen zu Boden, weil sie von den Beinen gerissen wurden. Auf den Schultern ihrer Väter hielten sich Kinder die Hände vor die von sirrenden Stein- und Glassplittern zerschnittenen Gesichter. Als wäre sie eins, ein Schwarm, stob die Menge davon, duckte sich, einer suchte Schutz hinter dem anderen aus Angst, dass die Trümmer sie zerfetzen würden. Niemand hatte damit gerechnet, dass es schon losging, viele hatten noch nicht einmal hingesehen. Die Filmkameras waren noch nicht bereit. In der Einsturzzone, die man entweder hoffnungslos unterschätzt oder wo man die Wucht der Explosion verkannt hatte, befanden sich noch Arbeiter.
Mit klingelnden Ohren stand Lasar auf und starrte auf die Staubfahnen, bis sie sich wieder legten. Als die Wolke sich langsam auflöste, enthüllte sie ein Loch in der Wand, das so hoch und breit war wie zwei Männer. Es sah aus, als hätte ein Riese aus Versehen seine Stiefelspitze in die Kirche gesetzt und dann peinlich berührt den Fuß wieder zurückgezogen, um die übrige Kirche nicht auch noch zu beschädigen. Lasar blickte hoch zu den goldenen Kuppeln. Die Umstehenden folgten seinem Blick, und jeder dachte dasselbe: Würden die Türme zusammenfallen?
Aus dem Augenwinkel konnte Lasar sehen, wie die Filmcrew fieberhaft die Kameras ans Laufen brachte, den Staub von den Linsen wischte und die Stative stehen ließ, um nur ja die Szene aufzunehmen. Wenn sie den Einsturz verpassten, egal aus welchem Grund, dann ging es ihnen an den Kragen. Ungeachtet der Gefahr lief keiner von ihnen weg, alle blieben auf ihren Posten und warteten auf die kleinste Bewegung, ein Kippen oder Ruckeln … ein Zittern. Einen Moment lang schien es, als würden selbst die Verletzten in gespannter Erwartung verharren.
Die fünf Kuppeln stürzten nicht ein, majestätisch überragten sie das Chaos zu ihren Füßen. Denn während die Kirche stehen blieb, waren in der Menge viele verwundet, sie bluteten und schrien. Und als ob sich plötzlich der Himmel verdunkelt hätte, spürte Lasar, wie die Stimmung unter den Leuten kippte. Zweifel machten sich breit. War eine überirdische Macht eingeschritten und hatte dieses Verbrechen unterbunden? Die Schaulustigen fingen an, sich zu zerstreuen, eilten schließlich davon. Keiner wollte mehr zusehen. Mit Mühe unterdrückte Lasar ein Lachen. Die Menge war zerstoben, aber die Kirche hatte überdauert! Er wandte sich in der Hoffnung, den Anblick gemeinsam mit ihnen genießen zu können, zu dem älteren Ehepaar um.
Der Mann stand direkt hinter Lasar, so nahe, dass sie sich fast berührten. Lasar hatte sein Näherkommen nicht bemerkt. Der Mann lächelte, aber seine Augen waren kalt. Er trug weder eine Uniform noch zeigte er seinen Ausweis. Trotzdem bestand kein Zweifel, dass er zur Staatssicherheit gehörte. Das war ein Geheimpolizist, ein Mitglied des MGB. Lasar konnte es nicht etwa aus dem schließen, was der Mann tat, sondern aus dem, was er nicht tat. Rechts und links lagen Verletzte herum, doch der Mann zeigte kein Interesse an ihnen. Man hatte ihn in der Menge postiert, um die Reaktionen der Leute zu beobachten. Und Lasar hatte versagt. Als er sich hätte freuen sollen, war er traurig gewesen. Und als er hätte traurig sein sollen, hatte er sich gefreut.
Während der Mann ihn mit einem schmallippigen Lächeln ansprach, ruhten seine toten Augen unverwandt auf Lasar: »Eine kleine Panne, nur ein Malheur, das schnell behoben sein wird. Sie sollten dableiben. Vielleicht klappt es heute doch noch mit der Sprengung. Sie wollen doch bleiben, oder? Sie wollen doch sicher sehen, wie die Kirche einstürzt. Das wird ein ziemliches Schauspiel.«
»Ja.« Eine vorsichtige Antwort und sogar die Wahrheit. Lasar wollte tatsächlich bleiben. Dass die Kirche einstürzte, wollte er allerdings nicht, aber das würde er bestimmt nicht sagen.
Der Mann fuhr fort: »Auf diesem Gelände wird eines der größten Hallenbäder der Welt entstehen. Für die Gesundheit unserer Kinder. Die Gesundheit unserer Kinder ist wichtig. Wie heißen Sie?«
Die einfachste aller Fragen und doch gleichzeitig die furchteinflößendste.
»Ich heiße Lasar.«
»Was sind Sie von Beruf?«
Die Maskerade einer zwanglosen Plauderei war gefallen, jetzt war es ein offenes Verhör. Unterwerfung oder Verfolgung, Pragmatismus oder Prinzipien – Lasar musste sich entscheiden. Anders als viele seiner Mitbrüder, die sofort zu erkennen waren, hatte er immerhin die Wahl. Er musste ja nicht zugeben, dass er ein Priester war. Wladimir Lwow, der ehemalige Oberprokuror der Heiligen Synode, war der Ansicht gewesen, dass die Priester sich nicht mehr durch ihre Tracht absondern mussten, sondern stattdessen »ihre Priestergewänder abstreifen, die Haare schneiden und sich in normale Sterbliche verwandeln« durften. Lasar stimmte ihm zu. Mit seinem kurz geschorenen Bart und seinem unauffälligen Äußeren könnte er diesen Agenten nun anlügen. Er könnte seine Berufung verleugnen und hoffen, dass seine Lüge ihn schützen würde. Er arbeitete in einer Schuhfabrik oder war Tischler – egal was, nur nicht die Wahrheit. Der Agent wartete.
AM SELBEN TAG
Während ihrer ersten gemeinsamen Wochen hatte Anisja nicht groß über die Sache nachgedacht. Maxim war erst vierundzwanzig Jahre alt und Absolvent des Seminars der Moskauer Theologischen Hochschule, die, nachdem sie 1918 geschlossen worden war, erst kürzlich als Teil der Rehabilitation religiöser Einrichtungen wiedereröffnet worden war. Sie selbst war sechs Jahre älter als er, verheiratet, also unerreichbar und eine qualvolle Vorstellung für einen jungen Mann, der vermutlich über wenig, wenn überhaupt irgendeine sexuelle Erfahrung verfügte. Maxim war introvertiert und scheu und hatte sich außerhalb der Kirche nie mit jemandem abgegeben. Er hatte nur wenige Freunde und Verwandte, und von denen lebte niemand in der Stadt. So war es nicht verwunderlich, dass er sich in sie vernarrt hatte. Sie hatte seine schmachtenden Blicke geduldet und sich sogar ein wenig geschmeichelt gefühlt. Hoffnungen gemacht allerdings hatte sie ihm ganz und gar nicht. Er jedoch hatte ihr Schweigen als Erlaubnis missverstanden, ihr weiter den Hof machen zu dürfen. Deshalb nahm er jetzt auch ihre Hand und sagte:
»Verlass ihn. Komm mit mir.«
Sie war überzeugt gewesen, dass er niemals den Mut aufbringen würde, seine so dumme, kindische Schwärmerei tatsächlich in die Tat umzusetzen. Da hatte sie sich getäuscht.
Bemerkenswert war, dass er sich, um die Grenze von einer privaten Träumerei zu einem offenen Antrag zu überschreiten, ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hatte. Sie standen in der Kirche ihres Mannes, in den im Schatten liegenden Nischen richteten die Fresken von Jüngern, Dämonen, Propheten und Engeln über ihr verbotenes Tun. Maxim setzte seine gesamte Ausbildung aufs Spiel, Schande und der Ausschluss aus der religiösen Gemeinde ohne Hoffnung auf Vergebung würden ihm sicher sein. Sein ernstes, aus tiefstem Herzen kommendes Werben beruhte auf einer derartig absurden Fehleinschätzung, dass ihre Reaktion unwillkürlich die schlimmste nur denkbare war: ein kurzes, perplexes Auflachen.
Bevor er noch reagieren konnte, schlug die schwere Eichentür zu. Aufgeschreckt wandte Anisja sich um und sah ihren Mann. Erregt preschte Lasar auf sie zu, und sie konnte nur vermuten, dass er die Szene als Beweis ihrer Untreue missdeutet hatte. Anisja riss sich so abrupt von Maxim los, dass ihre vermeintliche Schuld dadurch nur noch betont wurde. Aber als Lasar näher kam, erkannte sie, dass der Mann, mit dem sie seit zehn Jahren verheiratet war, etwas anderes auf dem Herzen hatte. Er warf einen hastigen Blick zurück zur Tür. So atemlos, als sei er gerannt, ergriff er ihre Hände – dieselben Hände, die noch vor Sekunden Maxim gehalten hatte.
»Ich bin aus der Menge herausgefischt worden. Ein Agent hat mich verhört.« Er sprach hastig, die Worte überschlugen sich und waren so dringlich, dass sie Maxims Antrag einfach beiseitefegten.
»Ist man dir gefolgt?«, fragte sie.
Er nickte. »Ich habe mich in Natascha Njurinas Wohnung versteckt.«
»Was ist dann passiert?«
»Er hat draußen gewartet. Ich musste durch die Hintertür verschwinden.«
»Werden sie Natascha jetzt verhaften und verhören?«
Lasar hielt sich die Hände vors Gesicht. »Ich habe Panik gekriegt. Ich wusste nicht, wohin. Ich hätte nicht zu ihr gehen sollen.«
Anisja packte ihn bei den Schultern. »Wenn sie erst Natascha verhaften müssen, um uns zu finden, dann haben wir noch etwas Zeit.«
Lasar schüttelte den Kopf. »Ich habe ihm meinen Namen genannt.«
Sie verstand. Er würde nicht lügen. Er würde seine Prinzipien nicht verraten, weder für sie noch für irgendjemand anders. Die Prinzipien waren wichtiger als ihr Leben. Er hätte nicht zu der Sprengung gehen sollen. Sie hatte ihn vor dem unnötigen Risiko gewarnt. Mit Sicherheit würde man die Menge überwachen, und er war ein auffälliger Zuschauer. Wie üblich hatte er sie ignoriert. Immer tat er so, als bedenke er ihren Rat, aber nie befolgte er ihn. Hatte sie ihn nicht angefleht, die Kirchenoberen nicht vor den Kopf zu stoßen? Waren sie beide in einer so starken Position, dass sie es sich leisten konnten, sich sowohl den Staat als auch die Kirche zu Feinden zu machen? Aber Bündnispolitik interessierte ihren Mann nicht, er wollte einfach seine Meinung sagen, selbst wenn er sich dadurch isolierte. Offen hatte er das neue Verhältnis der Bischöfe zu den Machthabern kritisiert. Störrisch und eigensinnig hatte er von ihr verlangt, seine Haltung zu unterstützen, ohne ihr auch nur einen Kommentar zuzugestehen. Sie bewunderte ihn, bewunderte seine Integrität. Er hingegen bewunderte sie nicht. Sie war viel jünger als er und erst zwanzig Jahre alt gewesen, als sie geheiratet hatten. Er war damals schon fünfunddreißig.
Manchmal fragte Anisja sich, ob er sie nur geheiratet hatte, weil es per se eine reformerische Haltung verriet, wenn ein sogenannter Weißer Priester, der verheiratet war, das Mönchsgelübde ablegte. Die Vorstellung gefiel ihm, passte in sein liberales philosophisches Weltbild. Immer war sie auf den Moment gefasst gewesen, in dem der Staat in ihr Leben eingreifen würde. Doch jetzt, wo dieser Moment gekommen war, fühlte sie sich betrogen. Sie zahlte nun die Zeche für seine Überzeugungen – Überzeugungen, die sie nie hatte beeinflussen oder mitgestalten können.
Lasar legte Maxim eine Hand auf die Schulter. »Es wäre besser, wenn du ins Priesterseminar zurückkehrst und uns denunzierst. Wir werden sowieso verhaftet, und die Denunziation würde ja nur dazu dienen, dass du dich von uns distanzieren kannst. Du bist noch ein junger Mann, Maxim. Keiner wird schlecht von dir denken, wenn du jetzt gehst.«
Aus Lasars Mund war dieser Vorschlag ein zweischneidiges Schwert. Denn seiner selbst hielt Lasar solch eine pragmatische Handlungsweise natürlich für unwürdig, so verhielten sich andere, schwächere Männer und Frauen. Seine moralische Überlegenheit war erdrückend. Er eröffnete Maxim nicht etwa einen Ausweg, sondern fing ihn in einer Falle. Mit bemüht freundlicher Stimme warf Anisja ein: »Du musst gehen, Maxim.«
Er antwortete scharf: »Ich will aber dableiben.«
Dass sie ihn eben ausgelacht hatte, hatte an seiner Ehre gekratzt, deshalb reagierte er jetzt stur und aufgebracht. Mit einem Satz, dessen Doppelbödigkeit ihrem Mann verborgen blieb, antwortete sie: »Bitte Maxim, vergiss alles, was geschehen ist. Damit, dass du bleibst, bewirkst du doch nichts.«
Maxim schüttelte den Kopf. »Ich habe meine Entscheidung getroffen.«
Anisja registrierte Lasars Lächeln. Ohne Zweifel hatte er Maxim ins Herz geschlossen. Er hatte ihn unter die Fittiche genommen, ohne zu merken, wie sehr der Junge sie vergötterte. Ihm machten nur Maxims Wissenslücken in Bibelstudien und Philosophie Sorgen. Dessen Entscheidung zu bleiben schien ihm zu gefallen, weil er glaubte, dass sie etwas mit ihm selbst zu tun hatte.
Anisja trat näher an Lasar heran.
»Wir können nicht zulassen, dass er sein Leben riskiert.«
»Wir können ihn auch nicht zwingen zu gehen.«
»Lasar, das hier ist nicht sein Kampf!«
Ihrer war es auch nicht.
»Er hat ihn zu seinem gemacht. Ich respektiere das, und du musst das auch tun.«
»Es ist doch sinnlos!«
Offenbar sah Lasar in Maxim ein Ebenbild seiner selbst, den Märtyrer. Er hatte sich entschieden, sie zu erniedrigen und ihn zu zerstören. »Schluss jetzt!«, schrie er. »Wir haben keine Zeit mehr. Du willst, dass Maxim nichts passiert. Ich auch. Aber wenn er bleiben will, dann bleibt er.«
Lasar eilte hinter die Ikonostase zu dem steinernen Altar und räumte ihn hastig ab. Jeder, der mit seiner Kirche in Verbindung stand, war jetzt in Gefahr. Für seine Frau oder Maxim konnte er nicht mehr viel tun, sie standen ihm zu nahe. Aber seine Gemeinde, die Menschen, die sich ihm anvertraut und ihre Ängste mit ihm geteilt hatten – deren Namen mussten unbedingt geheim bleiben.
Kaum war der Altar leer, umfasste Lasar ihn an der Querseite. »Schieb!«
Ahnungslos, aber gehorsam drückte Maxim gegen den Altar, dessen Gewicht ihm alle Kraft abverlangte. Der raue steinerne Sockel knirschte über den Steinboden, und als er langsam zur Seite glitt, kam ein Loch zum Vorschein – ein Versteck, das man vor etwa zwanzig Jahren angelegt hatte, als die Attacken gegen die Kirche am heftigsten gewesen waren. Damals hatten sie die Steinplatten entfernt, sodass die nackte Erde zum Vorschein gekommen war. Dann hatten sie vorsichtig gegraben und das Loch mit Holz ausgekleidet, damit die Seiten nicht einbrachen. Ein einen Meter tiefer und zwei Meter breiter Raum war entstanden, in dem sich jetzt eine Stahlkiste befand. Lasar griff danach, Maxim folgte seinem Beispiel und zog am anderen Ende. Gemeinsam hoben sie die Kiste heraus und setzten sie auf dem Fußboden ab, um sie zu öffnen.
Anisja hob den Deckel hoch.
Maxim hockte sich neben sie und konnte die Verblüffung in seiner Stimme nicht verbergen. »Musik?«
Die Kiste war angefüllt mit handgeschriebenen Notenblättern.
Lasar erklärte: »Der Komponist hat hier den Gottesdienst besucht. Er war noch ein junger Mann, nicht viel älter als du, ein Student am Moskauer Konservatorium. Eines Abends kam er zu uns, außer sich vor Angst, dass man ihn verhaften würde. Er fürchtete, dass man seine Arbeit zerstören könnte, und hat uns seine Kompositionen anvertraut. Vieles davon war als antisowjetisch gebrandmarkt worden.«
»Warum?«
»Ich weiß es nicht. Er wusste es selbst nicht. Er hatte niemanden, an den er sich wenden konnte, keine Familie oder Freunde, denen er vertrauen konnte. Deshalb kam er zu uns. Wir erklärten uns bereit, sein Lebenswerk an uns zu nehmen. Kurz darauf ist er verschwunden.
Maxim warf einen flüchtigen Blick auf die Noten. »Die Musik … ist sie gut?«
»Wir haben sie noch nie gehört. Wir trauen uns nicht, sie jemandem zu zeigen oder uns vorspielen zu lassen. Man könnte Fragen stellen.«
»Ihr habt überhaupt keine Vorstellung davon, wie sie klingt?«
»Ich kann keine Noten lesen. Meine Frau auch nicht. Aber darum geht es hier nicht, Maxim. Als ich versprach, dem Mann zu helfen, ging es dabei nicht um den künstlerischen Rang seiner Arbeit.«
»Ihr riskiert euer Leben. Wenn sie nun wertlos ist …«
Lasar berichtigte ihn: »Was wir schützen, sind nicht diese Noten. Was wir schützen, ist ihr Recht zu überleben.«
Anisja machte die Selbstgefälligkeit ihres Mannes wütend. Schließlich war der junge Komponist, um den es hier ging, zu ihr gekommen, nicht zu ihm. Danach hatte sie Lasar angefleht und ihn dazu überredet, sich der Musik anzunehmen. Als er jetzt die Geschichte weitererzählte, verschwieg er nicht nur geflissentlich seine eigenen Zweifel und Ängste, sondern stellte überdies Anisja lediglich als passive Befürworterin dar. Sie fragte sich, ob ihm überhaupt bewusst war, wie er die wahre Geschichte zurechtgedrechselt hatte, um seine eigene Bedeutung hervorzuheben, sich selbst im Nachhinein in den Mittelpunkt zu rücken. Lasar nahm die komplette Loseblattsammlung der Noten, insgesamt vielleicht zweihundert Seiten. Zwischen den Noten befanden sich Dokumente über Kirchenangelegenheiten und mehrere echte Ikonen, die man hier verborgen und durch Reproduktionen ersetzt hatte. Fieberhaft sortierte er alles in drei Stapel und achtete dabei so gut es ging darauf, dass einzelne Kompositionen zusammenblieben. Der Plan war, alles in etwa gleich großen Tranchen hinauszuschmuggeln. Wenn man es auf drei Päckchen aufteilte, bestand eine realistische Chance, dass ein Teil der Musik überleben würde. Die Schwierigkeit bestand darin, drei verschiedene Verstecke zu finden sowie drei Menschen, die bereit wären, ihr Leben für Notenblätter aufs Spiel zu setzen, obwohl sie weder dem Komponisten je begegnet waren noch seine Musik gehört hatten. Lasar wusste, dass viele aus der Gemeinde ihm helfen würden. Und die waren vermutlich auch aus dem einen oder anderen Grund verdächtig. Für diese Aufgabe brauchten sie die Hilfe eines perfekten Sowjetmenschen, von jemandem also, dessen Wohnung nie und nimmer durchsucht werden würde. Und ein solcher Mensch, wenn es ihn überhaupt gab, würde ihnen niemals helfen.
Anisja machte ein paar Vorschläge.
»Martemjan Systow.«
»Eine Plaudertasche.«
»Artjom Nachajew.«
»Der würde sich bereiterklären, die Noten an sich nehmen, es dann aber mit der Angst kriegen, die Nerven verlieren und sie verbrennen.«
»Njura Dmitrijewa.«
»Sie würde zwar Ja sagen, uns aber dafür hassen, dass wir sie gefragt haben. Sie würde nicht mehr schlafen und nichts mehr essen.«
Letzten Endes blieben zwei Namen übrig, auf mehr konnten sie sich nicht einigen. Lasar beschloss, einen Teil der Kompositionen zusammen mit den größeren Ikonen weiterhin in der Kirche versteckt zu halten. Er würde sie in die Kiste zurücklegen und den Altar wieder an seine Stelle rücken. Da Lasar auf jeden Fall verfolgt werden würde, sollten Anisja und Maxim je einen Teil der Noten zu den beiden Adressen schaffen.
Anisja war bereit. »Ich gehe als Erste.«
Maxim schüttelte den Kopf. »Nein, ich.«
Sie erriet, warum er das vorschlug. Wenn Maxim entwischte, dann gab es eine gute Chance, dass auch sie davonkommen würde.
Sie hoben den schweren Balken, der die Haupttür verriegelte, weg. Anisja spürte, wie Maxim zögerte. Bestimmt hatte er Angst, jetzt wo ihm seine gefährliche Lage klar wurde.
Lasar schüttelte ihm die Hand. Über die Schultern ihres Mannes hinweg sah Maxim sie an. Als Lasar sich verabschiedet hatte, trat Maxim zu ihr.
Sie umarmte ihn und sah ihm nach, wie er in der Nacht verschwand.
Lasar verriegelte die Tür wieder, dann ging er nochmals den Plan durch. »Warte zehn Minuten.«
Allein mit ihrem Mann, stand sie ein wenig hilflos vor der Ikonostase. Er kam zu ihr. Doch zu ihrer Überraschung betete er nicht etwa, sondern nahm stattdessen ihre Hand.
Die zehn Minuten waren vergangen, und sie gingen wieder zur Tür. Lasar schob den Balken weg. Die Noten befanden sich in einer Tasche, die Anisja sich über die Schulter geworfen hatte. Sie hatten sich schon verabschiedet. Draußen blieb sie stehen, wandte sich noch einmal um und sah schweigend zu, wie Lasar die Tür hinter ihr schloss. Sie hörte, wie der Balken wieder vorgelegt wurde. Während sie in Richtung der Straße ging, suchte sie nach Gesichtern in den Fenstern und irgendwelchen Bewegungen im Schatten. Eine Hand umfasste ihr Armgelenk. Sie wirbelte herum.
»Maxim?«
Was machte er hier? Wo waren die Noten, die er bei sich gehabt hatte? Von irgendwo hinter der Kirche rief eine barsche, ungeduldige Stimme: »Leo?«
Anisja sah einen Mann in dunkler Uniform – ein MGB-Agent. Weitere Männer folgten ihm, zusammengerottet wie Kakerlaken. All ihre Fragen schmolzen dahin, sie konzentrierte sich nur noch auf den Namen, den der Mann gerufen hatte: Leo. Mit einem einzigen Wort löste sich das ganze Lügengespinst auf. Deshalb also hatte er keine Freunde oder Verwandten in der Stadt und war in seinen Stunden mit Lasar so schweigsam gewesen. Deshalb kannte er sich in der Heiligen Schrift und Philosophie nicht aus. Deshalb hatte er auch die Kirche als Erster verlassen wollen – nicht etwa, um sie zu beschützen, sondern um ihre Beschatter zu alarmieren, die Mannschaft zusammenzutrommeln und sich für ihre Verhaftung bereitzuhalten. Er war ein Tschekist, ein Beamter der Geheimpolizei. Er hatte sie und ihren Mann getäuscht, hatte sich in ihrer beider Leben geschlichen, um so viele Informationen wie möglich zu bekommen, nicht nur von ihnen, sondern auch von den Leuten, die mit ihnen sympathisierten.
Er hatte einen Schlag gegen die restlichen Widerstandsnester innerhalb der Kirche vorbereitet. War der Versuch, sie zu verführen, auch im Auftrag seiner Vorgesetzten geschehen? Hatten die sie als schwach und leichtgläubig eingeschätzt und diesem gut aussehenden Beamten befohlen, in die Rolle des Maxim zu schlüpfen, um sie zu manipulieren?
Maxim sprach leise und vertraulich, so als habe sich nichts zwischen ihnen geändert. »Anisja, ich gebe dir noch eine Chance. Komm mit mir. Ich habe Vorbereitungen getroffen. An dir ist keiner interessiert. Sie wollen Lasar.«
Der Tonfall in seiner Stimme, so sanft und besorgt, widerte sie an. Als er ihr vorgeschlagen hatte, mit ihm wegzugehen, war das gar keine naive Träumerei gewesen, keine romantische Verliebtheit. Es war die kühl kalkulierte Taktik eines Agenten.
Er fuhr fort: »Ich gebe dir denselben Rat, den ihr mir gegeben habt: Denunziere Lasar. Ich kann für dich lügen. Ich kann dich beschützen. Er ist es, den sie wollen. Mit deiner Loyalität erreichst du gar nichts. Bitte!«
Leo wurde die Zeit knapp. Sie musste doch begreifen, dass er ihre einzige Chance war zu überleben, was auch immer sie von ihm hielt. Es würde ihr nichts einbringen, an ihren Prinzipien festzuhalten. Sein Vorgesetzter Nikolai Borissow kam auf sie zu. Er war vierzig Jahre alt und hatte den Körperbau eines in die Jahre gekommenen Gewichthebers, immer noch stark, aber von zu viel Alkohol aufgeschwemmt. »Kooperiert sie?«
Leo streckte die Hand aus, seine Augen flehten sie an, ihm die Tasche zu geben. »Bitte!«
Statt einer Antwort schrie sie, so laut sie konnte: »Lasar!«
Nikolai trat vor und schlug sie mit dem Handrücken. Seinen Männern rief er zu: »Los!«
Mit Äxten machten sie sich über die Kirchentür her.
Leo sah den Hass in Anisjas Blick. Nikolai entriss ihr die Tasche. »Er hat nur versucht, dich zu retten, du undankbares Miststück.«
Sie lehnte sich vor und flüsterte Leo ins Ohr: »Hast du ernsthaft geglaubt, dass ich mich in dich verlieben könnte?«
Beamte packten sie an den Armen und rissen sie zurück.
Sie grinste ihn an, ein teuflisches Grinsen. »Niemand wird dich jemals lieben. Niemand.«
Leo wandte sich von ihr ab und hoffte, dass man sie nur schnell fortschaffte.
Tröstend legte ihm Nikolai eine Hand auf die Schulter. »Es wäre ohnehin schwierig genug geworden, plausibel zu machen, dass sie keine Verräterin war. Schwierig für dich, meine ich. So ist es besser, besser für dich. Es gibt auch noch andere Frauen, Leo. Es gibt immer andere.«
Leo hatte seine erste Verhaftung durchgeführt.
Anisja hatte unrecht. Denn es gab ja schon jemanden, der ihn liebte – den Staat. Von einer Verräterin wollte er nicht geliebt werden, das war ja gar keine Liebe. Täuschung und Betrug waren die Waffen eines Agenten, es war sein Recht, sich ihrer zu bedienen. Sein Land war angewiesen auf Betrug. Bevor er Agent beim MGB geworden war, hatte er als Soldat erfahren, wie notwendig Brutalität bei der Bezwingung des Faschismus gewesen war. Selbst die schrecklichsten Dinge konnte man mit dem Wohl des Ganzen rechtfertigen, dem sie letztendlich dienten.
Er betrat die Kirche. Statt zu versuchen zu fliehen, kniete Lasar vor einer Ikone und erwartete betend sein Schicksal. Als er Leo sah, fiel sein trotziger Stolz von ihm ab. Im Moment des Verstehens schien er um Jahre zu altern.
»Maxim?« Zum ersten Mal, seit sie sich kannten, musste nun er seinen Schützling um Erklärungen bitten.
»Mein Name ist Leo Stepanowitsch Demidow.«
Einige Sekunden lang schwieg Lasar. Schließlich murmelte er: »Aber du wurdest mir doch vom Patriarchen empfohlen.«
»Der Patriarch Krassikow ist ein guter Bürger.«
Lasar schüttelte den Kopf, er konnte es einfach nicht fassen. Der Patriarch ein Informant? Sein Schützling ein Spion, den ihm der höchste kirchliche Würdenträger ins Haus geschickt hatte? Man hatte ihn dem Staat ebenso geopfert wie die Kirche der Heiligen Sophia. Er war ein Narr gewesen, der andere gewarnt hatte, sich vorzusehen, und Umsicht gepredigt hatte, während direkt neben ihm ein Beamter des MGB gestanden und alles aufgeschrieben hatte.
Nikolai trat heran. »Wo sind die restlichen Papiere?«
Leo führte sie hinter die Ikonostase und deutete auf den Altar. »Da drunter.«
Drei Agenten schoben den Altar beiseite und brachten die Kiste zum Vorschein. »Hat er noch weitere Namen genannt?«, fragte Nikolai.
Leo antwortete: »Martemjan Systow, Artjom Nachajew, Njura Dmitrijewa, Moissei Semaschko.«
Er erhaschte einen Blick auf Lasars Gesicht, auf dem Entsetzen sich in Abscheu verwandelte. Leo trat zu ihm. »Augen nach unten!«
Lasar wandte den Blick nicht ab.
Leo drückte seinen Kopf hinunter. »Augen nach unten, habe ich gesagt!«
Lasar hob den Kopf wieder. Diesmal versetzte Leo ihm einen Faustschlag. Langsam, mit geplatzter Lippe, hob Lasar den Kopf erneut. Blut tropfte herab, doch er sah Leo an, in seinem Gesicht standen Ekel und Trotz.
Als ob Lasar ihm eine Frage gestellt hätte, antwortete Leo: »Ich bin ein guter Mensch.«
Leo hielt seinen Mentor an den Haaren und prügelte immer weiter auf ihn ein, Schlag auf Schlag, mechanisch wie eine aufziehbare Soldatenpuppe. Immer wieder dieselben Schläge, bis ihm die Fingerknöchel wehtaten und die Arme schmerzten und Lasars eine Gesichtshälfte ganz geschwollen war. Als er schließlich aufhörte und ihn losließ, fiel Lasar zu Boden, um seinen Mund herum bildete sich eine Blutlache.
Nikolai legte Leo einen Arm über die Schulter und sah zu, wie Lasar hinausgetragen wurde und eine Blutspur vom Altar bis hin zur Tür hinterließ. Er zündete sich eine Zigarette an. »Leo, der Staat braucht Leute wie dich und mich.«
Benommen wischte sich Leo das Blut an den Hosenbeinen ab, dann antwortete er: »Bevor wir abziehen, würde ich gerne noch kurz die Kirche durchsuchen.«
Ohne einen Hauch von Misstrauen ging Nikolai auf den Vorschlag ein. »Du bist ein Perfektionist, das gefällt mir. Aber beeil dich. Heute Abend betrinken wir uns. Du hast schon zwei Monate keinen mehr gehoben. Hast ja gelebt wie ein Mönch.«
Nikolai lachte über seinen eigenen Witz und klopfte Leo auf den Rücken, dann marschierte er hinaus. Als Leo allein war, trat er zu dem weggeschobenen Altar und starrte in das Loch. Eingeklemmt zwischen der Kiste und der Erdausschachtung hing ein einzelnes Blatt Papier. Er beugte sich hinab und fischte es heraus. Es war ein Notenblatt. Besser, wenn man gar nicht erfuhr, was hier verloren gegangen war. Er hob das Blatt an die Flamme einer nahe stehenden Kerze und sah zu, wie es sich schwarz färbte.
Sieben Jahre danach
Moskau
12. MÄRZ 1956
Als Leiter eines kleinen akademischen Druckereiverlags war Suren Moskwin dafür bekannt, dass er Fachbücher von erbärmlichster Qualität druckte. Er verwendete schmierende Druckerschwärze und das dünnste Papier, zusammengehalten wurde das Ganze von einem Buchrücken aus Leim, aus dem sich schon wenige Stunden nach dem Öffnen des Buches die ersten Blätter lösten. Nicht, dass er faul oder inkompetent gewesen wäre, ganz im Gegenteil, er begann frühmorgens mit der Arbeit und hörte erst spätabends auf. Es lag an den Materialien, dass die Bücher so schäbig waren, an Materialien, die der Staat ihm zuteilte. Zwar wurden die Inhalte akademischer Publikationen akribisch überwacht, bei der Bewilligung von Produktionsmitteln jedoch nicht gerade bevorzugt. So kam es, dass Suren in der Systemfalle der Quotierung steckte und gezwungen war, in kürzester Zeit dem schlechtesten Papier eine große Stückzahl von Büchern abzuringen.
Dieses Missverhältnis änderte sich nie, er war ihm ausgeliefert und äußerst beschämt, wie schlecht sein Ruf geworden war. Man machte sich über ihn lustig. Mit von Druckerschwärze verschmierten Fingern witzelten die Studenten und Professoren, dass aus Moskwins Büchern wirklich etwas haften blieb. Derart lächerlich gemacht, fand Moskwin es zunehmend schwierig, morgens überhaupt noch aufzustehen. Er aß nicht ordentlich und trank sich stattdessen durch den Tag, die Flaschen verstaute er in Schubladen und hinter Bücherregalen. Mit fünfundfünfzig Jahren hatte er noch einmal etwas Neues an sich entdeckt – dass er nämlich öffentliche Demütigungen nur schwer verdauen konnte.
Als er jetzt seine Linotype-Setzmaschinen inspizierte und dabei über sein Versagen brütete, bemerkte er einen jungen Mann, der in der Tür stand. Misstrauisch sprach Suren ihn an: »Ja? Was gibt es? Ist das normal, dass man einfach unangekündigt so dasteht?«
In typischer Studentenkluft, einem langen Mantel und einem billigen schwarzen Schal, trat der Mann vor. Er hielt Suren ein Buch hin. Suren riss es ihm aus den Händen und machte sich auf eine weitere Beschwerde gefasst. Er warf einen flüchtigen Blick auf den Einband: Lenins Staat und Revolution. Letzte Woche hatten sie eine neue Ausgabe gedruckt und erst gestern oder vorgestern ausgeliefert. Dieser Mann da war offenbar der Erste, dem aufgefallen war, dass irgendetwas nicht stimmte. Ein Fehler in einem solch grundlegenden Werk war eine ernste Sache, unter Stalin hätte das ausgereicht, um verhaftet zu werden. Der Student beugte sich vor, öffnete das Buch und blätterte vor. Auf dem Innentitel war ein Schwarzweißfoto abgedruckt.
Der Student bemerkte: »Die Bildunterschrift besagt, dass dies ein Foto von Lenin sei. Aber wie Sie sehen können …«
Das Foto zeigte einen Mann, der Lenin nicht im Entferntesten ähnlich sah. Er stand vor einer Mauer, einer kalkweißen Mauer. Die Haare standen ihm zu Berge, und sein Blick war gehetzt.
Geräuschvoll schlug Suren das Buch zu und wandte sich dann an den Studenten: »Glauben Sie etwa, ich hätte Tausende Exemplare dieses Buches mit einem falschen Foto gedruckt? Wer sind Sie überhaupt? Wie heißen Sie? Warum tun Sie das? Mein Problem ist die Materialknappheit, nicht Schludrigkeit!«
Er schubste den Studenten zurück und schlug ihm das Buch gegen die Brust. Der Schal um dessen Hals löste sich und entblößte Teile einer Tätowierung. Dieser Anblick ließ Suren innehalten. Eine Tätowierung passte so gar nicht zu der studentischen Aufmachung. Niemand außer den wory, den Berufsverbrechern, hätte seine Haut derart gezeichnet.
Surens Entrüstung war die Wucht genommen, und der Mann nutzte sein Zaudern und eilte hinaus. Immer noch das Buch in der Hand lief Suren ihm halbherzig nach und sah, wie er in der Nacht verschwand.
Mit einem mulmigen Gefühl schloss er die Tür und verriegelte sie. Etwas beunruhigte ihn: das Foto. Er kramte seine Brille hervor, öffnete das Buch und studierte das Gesicht etwas eingehender: diese angstgeweiteten Augen! So wie ein Geisterschiff aus dem dichten Nebel des Meeres auftaucht, fing Suren an zu dämmern, wer dieser Mann war. Er kannte ihn, das Gesicht war ihm vertraut. Seine Haare waren so zerzaust und sein Blick so gehetzt, weil man ihn aus dem Bett gezerrt und verhaftet hatte. Suren erkannte die Fotografie, weil er sie selbst aufgenommen hatte.
Suren hatte nicht immer eine Druckerei geleitet. Zuvor war er beim MGB gewesen. In zwanzig Jahren treuer Dienste hatte er viele seiner Vorgesetzten überdauert. Er hatte die verschiedensten banalen Pflichten übernommen, Zellen gesäubert oder Gefangene fotografiert. Sein niedriger Rang war ihm zustattengekommen, und er hatte genügend Grips besessen, nicht nach Höherem zu streben. Weil er nie auffiel, entging er auch den Säuberungsaktionen, denen die höheren Befehlsebenen regelmäßig anheimfielen. Man hatte ihm unangenehme Sachen abverlangt, und er hatte seine Pflicht unerschütterlich erfüllt. Damals war er ein Mann gewesen, den man fürchten musste. Keiner hatte Witze über ihn gerissen. Das hätte keiner gewagt. Seine angegriffene Gesundheit hatte ihn dazu gezwungen, den Posten aufzugeben. Doch obwohl man ihn fürstlich entlohnt hatte und es ihm an nichts fehlte, die Untätigkeit war nichts für ihn. Wenn er ohne tägliche Aufgabe einfach nur im Bett liegen blieb, machten sich seine Gedanken selbstständig. Sie wanderten zurück in die Vergangenheit und erinnerten ihn an Gesichter wie das, das jetzt in diesem Buch klebte. Deshalb musste er sich beschäftigen und unter Leute kommen. Er brauchte eine Arbeit, damit er sich nicht in seinen Erinnerungen verlor.
Suren klappte das Buch zu und schob es sich in die Jackentasche. Warum passierte das ausgerechnet heute? Das konnte doch kein bloßer Zufall sein. Denn obwohl er es nicht fertigbrachte, ein einigermaßen anständiges Buch oder Magazin abzuliefern, hatte man ihn unerwartet gebeten, ein wichtiges Staatsdokument zu drucken. Um was es sich dabei handelte, hatte man ihm nicht eröffnet. Doch das Prestige dieses Auftrags bedeutete, dass man ihm hochwertige Materialien zur Verfügung stellen würde, gutes Papier und gute Druckerfarbe. Endlich hatte er Gelegenheit, etwas herzustellen, auf das er stolz sein konnte. Heute Abend sollte das Dokument vorbeigebracht werden. Doch irgendjemand, der etwas gegen ihn hatte, wollte offenbar verhindern, dass sein Schicksal sich wendete.
Suren verließ die Druckhalle und eilte in sein Büro, wo er sorgfältig sein dünnes graues Haar scheitelte. Heute trug er seinen besten Anzug – er besaß nur zwei, einen für den täglichen Gebrauch und einen für besondere Anlässe. Das hier war ein besonderer Anlass. Heute hatte man ihm nicht aus dem Bett helfen müssen, er war vor seiner Frau wach gewesen und hatte beim Rasieren vor sich hingesummt. Zum ersten Mal seit Wochen hatte er ordentlich gefrühstückt. Früh war er in der Druckerei angekommen, hatte als Erstes die Flasche aus der Schublade geholt und den Wodka ins Spülbecken gekippt. Dann hatte er den ganzen Tag über saubergemacht, den Boden gescheuert und alles abgestaubt, hatte die Ölflecken von den Linotype-Maschinen gewischt. Seine Söhne, die beide an der Universität studierten, hatten ihn besucht und über die Verwandlung gestaunt. Suren hatte sie daran erinnert, dass es eine Frage des Prinzips war, seinen Arbeitsplatz makellos sauber zu halten. Der Arbeitsplatz war es schließlich, der einem Menschen Identität und Selbstwertgefühl verlieh. Zum Abschied hatten sie ihn geküsst und ihm bei seinem neuen Auftrag Glück gewünscht. Nach all den Jahren der Geheimniskrämerei und den letzten des Misserfolgs waren sie endlich einmal stolz auf ihn.
Er schaute auf die Uhr. Es war sieben Uhr abends. Sie konnten jeden Augenblick da sein. Er musste diesen Fremden und das Foto einfach vergessen, das war doch nicht wichtig. Er durfte sich davon nicht ablenken lassen. Plötzlich wünschte er sich, er hätte den Wodka nicht weggegossen. Ein Schlückchen hätte ihn jetzt beruhigt. Aber wahrscheinlich hätte man das gerochen. Lieber keinen heben, lieber nervös sein, das zeigte, dass man die Arbeit ernst nahm. Suren griff nach der Flasche Kwass, einem alkoholfreien Brottrunk. Der musste reichen.
In der ganzen Aufregung und weil der Alkoholentzug ihn zittrig gemacht hatte, stieß er gegen einen Druckstock mit stählernen Matrizen für die Buchstaben. Der Druckstock fiel vom Schreibtisch, und alles purzelte heraus, die Buchstaben lagen über den gesamten Fußboden verstreut.
Klong, klong!
Suren erstarrte. Urplötzlich war er nicht mehr in seinem Büro, sondern stand in einem schmalen Backsteinflur, von dem zu beiden Seiten Eisentüren abgingen. Er kannte den Ort genau: Das Orjoler Gefängnis, wo er beim Ausbruch des Großen Vaterländischen Krieges Wärter gewesen war. Weil sie gezwungen gewesen waren, sich vor der rasch vorrückenden deutschen Armee zurückzuziehen, hatte man ihm und den anderen Wärtern befohlen, sämtliche Häftlinge zu liquidieren, um bloß keine Sympathisanten als mögliche Rekruten für die Nazi-Invasoren zurückzulassen. Da bereits Stukas ihre Tieffliegerangriffe flogen und die Gebäude in Schussweite der Panzer lagen, war es logistisch gesehen eine ziemlich knifflige Angelegenheit, wie man in ein paar Minuten zwanzig Zellen voll mit Hunderten politischer Gefangener eliminieren sollte. Für Kugeln oder Schlingen hatten sie keine Zeit mehr. Es war seine Idee gewesen, Handgranaten zu benutzen, zwei für jede Zelle. Er war zum Ende des Flurs gegangen, hatte den Sicherungsstift herausgezogen und sie hineingeschleudert. Klong, klong! – so hatte es sich angehört, als die Handgranaten über den Betonboden schepperten. Dann hatte er die Gitterfenster zugeknallt, damit man sie nicht wieder herauswerfen konnte, und war durch den Flur zurückgelaufen, um der Explosion zu entgehen. Dabei hatte er sich vorgestellt, wie die Männer an den Handgranaten herumnestelten und sie ihnen aus den schmuddeligen Fingern glitten bei dem Versuch, sie durch die verschlossenen Gitterfenster zu werfen.
Suren presste seine Hände fest gegen die Ohren, so als ob er damit die Erinnerung verbannen könnte. Aber das Lärmen hielt an, immer lauter, Handgranaten auf dem Betonboden, eine Zelle nach der anderen.
Klong, klong, klong, klong!
»Aufhören!«, schrie er. Als er die Hände von den Ohren nahm, merkte er, dass jemand an der Tür klopfte.
13. MÄRZ
Die Kehle des Opfers war durch eine Reihe tiefer, dilettantischer Schnitte zerfetzt worden. Oberhalb und unterhalb dessen, was vom Hals des Mannes noch übrig war, gab es keine Verletzungen, was gleichermaßen nach Raserei und Überlegung aussah. Gemessen an der Grausamkeit des Angriffs war rund um die Einschnitte nur wenig Blut ausgetreten. Offenbar hatte der Mörder das Opfer niedergeschlagen, es zu Boden gedrückt und ihm selbst dann noch Schnitt auf Schnitt zugefügt, als Suren Moskwin, der fünfundfünfzigjährige Leiter einer kleinen Druckerei für Lehrbücher, schon längst tot gewesen war.
Seine Leiche war am frühen Morgen gefunden worden, als seine Söhne Wsewolod und Awksenti besorgt in die Firma gegangen waren, weil ihr Vater nicht nach Hause gekommen war. Verstört hatten sie die Miliz verständigt. Die hatte das Büro vollkommen durchwühlt vorgefunden, die Schreibtischschubladen waren herausgezogen, der Boden mit Papieren übersät, die Aktenschränke waren aufgebrochen worden. Daraus hatte man geschlossen, dass es sich um einen Einbruch handelte, der schiefgegangen war. Erst am späten Nachmittag, etwa sieben Stunden nach dem Fund der Leiche, hatte die Miliz schließlich das Morddezernat verständigt, das vom ehemaligen MGB-Agenten Leo Stepanowitsch Demidow geleitet wurde.
An derlei Verzögerungen war Leo gewöhnt. Vor drei Jahren hatte er Kapital aus der Tatsache geschlagen, dass ihm die Aufklärung einer Mordserie an über vierundvierzig Kindern gelungen war, und das Morddezernat gegründet. Von Anfang an war das Verhältnis zur regulären Miliz belastet gewesen und Kooperation nicht gerade an der Tagesordnung. Viele Beamte der Miliz und KGB-Offiziere fassten schon die schiere Existenz einer solchen Behörde als Kritik an der eigenen Arbeit und am Staat auf. Und eigentlich hatten sie damit sogar recht. Denn Leos Motive bei der Gründung dieses Dezernats waren eine unmittelbare Reaktion auf seine Arbeit als Agent gewesen. In seiner früheren Laufbahn hatte er viele Zivilisten verhaftet, und das nur aufgrund von Namenslisten, die seine Vorgesetzten ihm ausgehändigt hatten. Das Morddezernat dagegen war ausschließlich an bewiesenen Sachverhalten interessiert, nicht an politisch motivierten. Leo hatte in jedem einzelnen Fall die Ermittlungsergebnisse seinen Vorgesetzten zu präsentieren. Was die mit der Wahrheit dann anstellten, war deren Angelegenheit. Insgeheim hoffte Leo, dass sich das Konto seiner Verhaftungen eines Tages ausgleichen und mehr Schuldige als Unschuldige dabei herauskommen würden. Selbst bei vorsichtiger Schätzung hatte er da noch einen weiten Weg vor sich.
Die Freiheiten, die dem Morddezernat gewährt wurden, beruhten darauf, dass seine Arbeit der strengsten Geheimhaltungsstufe unterworfen war. Er und seine Leute berichteten direkt an die höchsten Stellen im Innenministerium und arbeiteten als verdeckte Unterabteilung des Hauptbüros für Verbrechensbekämpfung. Die normale Bevölkerung sollte immer noch an die Weiterentwicklung der Gesellschaft glauben. Sinkende Verbrechensraten waren ein Dogma dieses Glaubens, und Fakten, die auf das Gegenteil hindeuteten, wurden aus dem nationalen Bewusstsein getilgt. Kein Bürger konnte sich an das Morddezernat wenden, weil gar keiner wusste, dass es überhaupt existierte. Aus diesem Grund konnte Leo auch nicht im Radio zur Mithilfe aufrufen oder Zeugen bitten, sich zu melden. So etwas wäre gleichbedeutend gewesen mit der öffentlichen Bekanntmachung, dass es tatsächlich Verbrechen gab. Die Freiheit, die man Leo zugestanden hatte, war ziemlich relativ, und nachdem er alles in seiner Macht Stehende unternommen hatte, um seine frühere Laufbahn bei der Geheimpolizei hinter sich zu lassen, stellte er nun fest, dass er wieder eine geheime Polizeieinheit leitete, allerdings eine ganz andere.
Die rasche Erklärung von Moskwins Tod hatte ihn misstrauisch gemacht. Leo untersuchte den Schauplatz des Verbrechens. Sein Blick blieb an dem windschiefen Stuhl haften, der unauffällig vor dem Schreibtisch stand. Leo trat näher, hockte sich hin und fuhr mit dem Finger über eine dünne Bruchstelle an einem der Holzbeine. Vorsichtig stützte er sich auf die Lehne, drückte zu und sofort brach das Bein entzwei. Der Stuhl war kaputt. Sobald sich jemand auf ihn gesetzt hätte, wäre er zusammengebrochen. Trotzdem hatte er so vor dem Tisch gestanden, als sei er in Ordnung.
Leo richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Leiche und betrachtete die Hände des Opfers. Keine Wunden, keine Kratzer, kein Zeichen, dass der Mann sich verteidigt hatte. Er kniete sich hin und beugte sich zum Hals des Opfers hinunter. Außer im Nacken, der auf dem Boden gelegen und vor den Messerhieben geschützt gewesen war, war kaum noch heile Haut übrig. Leo holte ein Messer hervor, schob es dem Opfer unter den Nacken, und als er die Klinge anhob, kam ein Stückchen Haut zum Vorschein, die nicht aufgeschlitzt war, allerdings aufgescheuert. Er ließ den Hautlappen wieder sinken und zog das Messer zurück. Gerade wollte er aufstehen, da entdeckte er ein schmales Büchlein in der Anzugtasche des Mannes. Er griff hinein und holte es heraus – Lenins Staat und Revolution. Schon bevor er es aufschlug, konnte er sehen, dass etwas an der Bindung ungewöhnlich war. Man hatte ein Blatt eingeklebt. Als er die betreffende Seite aufschlug, sah er das Bild eines mitgenommen aussehenden Mannes. Leo hatte zwar keine Ahnung, wer er war, doch diese Art von Fotografie kannte er gut – der grellweiße Hintergrund, der verwirrte Gesichtsausdruck des Verdächtigen: Das hier war ein Verhaftungsfoto.
Überrascht über diese Absonderlichkeit stand Leo auf. Nesterow betrat den Raum und warf einen Blick auf das Buch. »Was Bemerkenswertes?«
»Ich bin mir nicht sicher.«
Timur war Leos engster Kollege und Freund. Sie machten aus der Freundschaft, die sie zueinander entwickelt hatten, kein großes Gewese. Sie tranken nicht zusammen oder alberten herum und redeten noch nicht einmal viel miteinander, außer über die Arbeit. Eine Partnerschaft, die nicht viele Worte brauchte. Zyniker hätten gar Feindseligkeiten aus dem Verhältnis der beiden herausgelesen. Obwohl fast zehn Jahre jünger, war Leo jetzt Timurs Vorgesetzter, nachdem er zuvor sein Untergebener gewesen war und ihn förmlich mit »General Nesterow« angeredet hatte. Objektiv betrachtet hatte Leo mehr von ihrem gemeinsamen Erfolg profitiert. Manche Leute hatten auch angedeutet, er sei ein karrieresüchtiger und nur auf den eigenen Vorteil bedachter Einzelkämpfer. Aber Timur zeigte keinen Neid, ihm war der Rang Nebensache. Er war stolz auf seine Arbeit, konnte seine Familie versorgen, und nach endlosem Dahindümpeln auf irgendwelchen Wartelisten hatte man ihm bei seinem Umzug nach Moskau nun sogar eine moderne Wohnung mit fließendem Wasser und elektrischem Strom rund um die Uhr zugewiesen. Ganz gleich, wie das Verhältnis der beiden von außen gesehen wirken mochte, sie vertrauten einander auf Leben und Tod.
Timur machte eine Geste zum Betriebsraum hin, wo die gewaltigen Linotype-Maschinen standen wie riesige mechanische Insekten. »Die Söhne sind gerade gekommen.«
»Bring sie rein.«
»Obwohl die Leiche ihres Vaters noch im Raum ist?«
»Ja.«
Die Miliz hatte den Söhnen gestattet, nach Hause zu gehen, bevor Leo sie am Ort des Verbrechens hatte befragen können. Leo hatte nicht die Absicht, sich auf Informationen zu verlassen, die er aus zweiter Hand von der Miliz bekam, also würde er sich bei den beiden entschuldigen, dass sie ihren toten Vater noch einmal sehen mussten. Außerdem war er neugierig auf ihre Reaktion.
Die beiden Vorgeladenen Wsewolod und Awksenti, beide Anfang zwanzig, erschienen in der Tür.
Leo stellte sich vor. »Ich bin der Ermittlungsbeamte Leo Demidow. Mir ist klar, dass das hier unangenehm für Sie ist.«
Keiner der beiden sah den toten Vater an, sie hielten ihre Augen auf Leo gerichtet. Der Ältere, Wsewolod, sagte: »Wir haben schon die Fragen der Miliz beantwortet.«
»Meine Fragen werden nicht lange dauern. Ist dieser Raum noch in dem Zustand, wie Sie ihn heute morgen angetroffen haben?«
»Ja, alles ist so wie vorhin.«
Das Reden übernahm ausschließlich Wsewolod. Awksenti blieb stumm, nur die Augen schlug er gelegentlich hoch. Leo fuhr fort. »Stand da auch dieser Stuhl vor dem Tisch? Vielleicht ist er ja bei einem Kampf umgestoßen worden.
»Was für ein Kampf?«
»Zwischen Ihrem Vater und dem Mörder.«
Schweigen. Leo fuhr fort.
»Der Stuhl ist kaputt. Wenn man sich auf ihn gesetzt hätte, wäre er zusammengebrochen. Ist doch komisch, dass jemand einen kaputten Stuhl vor seinem Schreibtisch stehen hat. Man kann gar nicht darauf sitzen.«
Die beiden Söhne warfen einen Blick auf den Stuhl. Wsewolod antwortete. »Haben Sie uns nur noch einmal kommen lassen, um über einen Stuhl zu reden?«
»Der Stuhl ist wichtig. Ich glaube, dass Ihr Vater ihn dazu benutzt hat, sich zu erhängen.«
Eigentlich war es eine groteske Behauptung. Sie hätten empört sein sollen, doch sie blieben stumm. Leo spürte, dass er mit seiner Vermutung ins Schwarze getroffen hatte, und fuhr mit seiner Theorie fort.
»Ich glaube, dass Ihr Vater sich erhängt hat, vielleicht von einem der Deckenbalken in der Druckerei. Er hat sich auf den Stuhl gestellt und ihn dann weggetreten. Sie beide haben heute Morgen die Leiche gefunden. Sie haben ihn hierhergeschleift und den Stuhl wieder aufgestellt, ohne zu bemerken, dass er beschädigt war. Einer von Ihnen oder vielleicht auch Sie beide haben ihm die Kehle durchgeschnitten in dem Bemühen, die Abschürfungen durch die Schlinge zu vertuschen. Das Büro haben Sie dann so hergerichtet, als sei eingebrochen worden.«
Die beiden waren vielversprechende Studenten. Der Selbstmord ihres Vaters konnte ihre akademische Laufbahn beenden und all ihre Aussichten zerstören. Selbstmord, versuchter Selbstmord, Depressionen, selbst eine Andeutung darüber, dass man nicht mehr leben wollte – all das wurde als Verunglimpfung des Staates interpretiert. Selbstmord hatte ebenso wenig wie Mord einen Platz in der Entwicklung zu einer besseren Gesellschaft.
Die Söhne wogen offensichtlich ab, ob es oder ob es nicht möglich war, die Beschuldigung abzustreiten.
Leo sprach leiser weiter. »Eine Autopsie wird erweisen, dass seine Wirbelsäule gebrochen ist. Ich muss seinen Selbstmord ebenso rigoros verfolgen, wie ich den Mord an ihm verfolgen würde. Woran ich interessiert bin, ist der Grund für den Selbstmord, nicht Ihr verständlicher Wunsch, ihn zu vertuschen.«
Der jüngere Sohn, Awksenti, machte zum ersten Mal den Mund auf und antwortete. »Ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten.«
Der junge Mann fuhr fort. »Ich habe seinen Körper vom Strick genommen. Da ist mir klar geworden, was er für unser Leben angerichtet hat.«
»Haben Sie irgendeine Ahnung, warum er sich umgebracht hat?«
»Er hat getrunken. Er hat unter seiner Arbeit gelitten.«
Sie sagten die Wahrheit, doch es war nicht die ganze Wahrheit, ob nun aus Ahnungslosigkeit oder Berechnung. Leo fühlte ihnen weiter auf den Zahn. »Ein fünfundfünfzigjähriger Mann bringt sich nicht um, weil seine Leser Druckerschwärze an den Fingern haben. Ihr Vater hat schon viel Schlimmeres überlebt.«
Der Ältere wurde wütend. »Vier Jahre habe ich dafür studiert, Arzt zu werden. Alles umsonst, kein Krankenhaus nimmt mich jetzt mehr.«
Leo führte sie aus dem Büro hinunter in die Druckerei, weg vom Anblick der Leiche ihres Vaters.





























