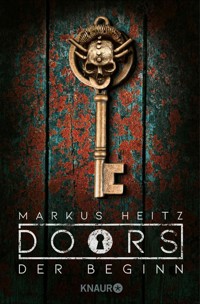2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was hält uns, wenn das eigene Leben in Gefahr ist? Nichts. Der internationale Bestsellerautor Markus Heitz nimmt sich in vier politischen Erzählungen gesellschaftlichen Themen sowie der aktuellen Flüchtlingsproblematik an und bringt den Leser in gewohnt unterhaltsamer, aber auch sozialkritischer Form zum Nachdenken. Als die ersten Geschichten entstanden, schrieb er noch von Fiktion - inzwischen hat ihn und unsere Gesellschaft die Realität eingeholt. Egal wie brutal und überspitzt Heitz erzählt, so ist das Leben und oft auch der Mitmensch neben uns im Handeln und Denken ungleich brutaler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch:
Was hält uns, wenn das eigene Leben in Gefahr ist? Nichts.
Markus Heitz
Kommando Flächenbrand
Erzählungen
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
https://www.edel.com/de/home/https://edelelements.de/https://www.facebook.com/EdelElements/
Copyright © 2015 by Markus Heitzwww.mahet.dewww.facebook.com/Markus-Heitz-170607349688167/twitter.com/markus_heitz
Covergestaltung: Guter Punkt Lektorat: Bernd Stratthaus Korrektorat: Vera Baschlakow Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
INHALT
Der Nachbar
Kommando Flächenbrand
Germany's Next Auswanderer
Die Letzte
Im Gespräch mit dem Autor
Un-utopische kurzgeschichtliche Streitschrift, teil-satirisch
Der Nachbar
(erweiterte Version; Original: 2008)
Zweitausendjederzeit, Brüssel, Europaparlament, Sondersitzung des Ausschusses Entwicklung (DEVE) zur Nahrungsmittelknappheit in Zentral- und Südafrika
Aufgaben des DEVE (Quelle: Homepage des Europäischen Parlaments, 2008):
1. die Förderung, Anwendung und Überwachung der Politik der Union in den Bereichen Entwicklung und Zusammenarbeit, insbesondere:
a. den politischen Dialog mit den Entwicklungsländern, bilateral sowie in den einschlägigen internationalen Organisationen und interparlamentarischen Gremien,
b. die Hilfe für die Entwicklungsländer und die Kooperationsabkommen mit ihnen,
c. die Förderung demokratischer Werte, der verantwortungsvollen Regierungsführung und der Menschenrechte in den Entwicklungsländern;
2. Fragen im Zusammenhang mit dem AKP-EU-Partnerschaftsabkommen und die Beziehungen zu den zuständigen Organen;
3. die Beteiligung des Parlaments an Wahlbeobachtungsmissionen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Ausschüssen und Delegationen.
Ghandi King Zulu stand am Rednerpult und sah über die vielen leeren Plätze hinweg.
Er musste nicht einmal überschlagen, um die Zahl der Zuhörer zu ermitteln, ein simples Durchzählen genügte. Er kam auf fünf von weit über fünfzig möglichen: jeweils ein Vertreter Frankreichs, Deutschlands, Spaniens, Luxemburgs und der Niederlande aus irgendwelchen sogenannten Volksparteien.
Die meisten Menschen in den Ländern, aus denen die Abgeordneten stammten, kannten nicht mal die Namen derer, welche sie vor und für Europa vertraten. Oder wussten, was sie machten. Wie absurd manche Abstimmungen verliefen und wie widersprüchlich Politik gemacht wurde. Welcher normale Mensch kümmerte sich politisch um Europa? Brüssel war für die meisten ein abstraktes Wort ohne Inhalt. Oder sie dachten an Pralinen, Waffeln oder das Atomium.
Ghandi King Zulu dagegen wusste sehr viel über das politische System.
Fünf. Das war kein gutes Zeichen.
Noch bevor er seinen Appell vorbringen konnte, fühlte er Wut in sich aufsteigen.
Wut über die Ignoranz, über die Arroganz. Nicht mal über die Länder, die nicht erschienen waren, sondern über deren Abgeordneten, die oftmals mehr verdienten als die Staatsoberhäupter ihrer Ursprungsländer. Über die Abgeordneten, die Sitzungsgelder kassierten, ohne anwesend zu sein. Die freitags nach Hause fuhren und sich vorher mit gepackten Koffern in Anwesenheitslisten eintrugen, um noch mehr Sitzungsgelder zu kassieren.
Ja, er hatte sich informiert.
Nein, er hatte es nicht glauben wollen, dass Europas Vertreter sich so verhielten.
Bis er den Saal betreten hatte.
Fünf. Seine Finger klammerten sich Hilfe suchend an die glatt geschliffenen Pultseiten, er zwang sich zur Ruhe.
Ghandi King Zulu, dreiundvierzig Jahre alt, gebürtiger Brite mit einem deutschen und einem englischen Pass, war Sohn eines kenianischen Einwanderers und einer indischstämmigen Britin.
Er hatte lange warten müssen, bis er als Redner für die Organisation Ärzte ohne Grenzen vor dem Ausschuss des hohen europäischen Hauses auftreten durfte.
Eigentlich hatte er vor dem Plenum sprechen wollen, aber man hatte ihm nur den Ausschuss zugebilligt. Als Erklärung diente der Hinweis, dass dort die Experten säßen.
Fünf.
Ghandi King Zulu wunderte sich, warum man bei dem sehr einfachen, logischen Thema Spezialisten benötigte. Wo jemand hungerte, musste geholfen werden. Und zwar schnell, sonst brauchte man gar nicht mehr zu helfen.
Er hatte einen Professorentitel in Medizin, Fachgebiet Innere Medizin, einen Lehrauftrag an der Universität Cambridge und seine Abschlüsse mit summa cum laude gemacht.
Seinen Urlaub verbrachte er immer dort, wo er in Afrika am dringendsten für Ärzte ohne Grenzen gebraucht wurde, und er spendete alles, was er nicht zum Leben brauchte, den Menschen vor Ort. Es gab eine Bibliothek, eine Nähschule, eine Grundwasseraufbereitungsanlage und eine Dorfschule, die seinen Namen trugen.
Ghandi King Zulu sah sich nicht als notorischen Samariter, den Religion oder gesellschaftlicher Zwang dazu brachten, Zeit und Geld ins Seelenheil oder öffentliches Ansehen zu investieren.
Aus der Kirche war er ausgetreten, weil er keinen vorgeschriebenen Gott benötigte, um glücklich zu sein und gute Taten zu vollbringen. Er benötigte nicht die Drohgebärden eines himmlischen Herrschers, um sich durch Gebete und Buße in ein angenommenes Paradies zu bringen, für dessen Existenz es keinen Beweis gab. Glauben bedeutete noch immer „nicht wissen“.
Er hatte studiert, kannte die Werte der alten Philosophen, die ohne Gott auskamen, und einiger Religionen, die für gegenseitige Freundlichkeit sowie Freiheit plädierten. Seinen unentwegten humanitären Einsatz hängte er nicht an die große Glocke.
Er tat, weil er es wollte. Nicht, weil man es von ihm verlangte.
Heute jedoch musste er andere dazu bringen, etwas zu spenden. Er kam sich merkwürdig vor, um etwas zu bitten, was bei den europäischen Nationen im Vergleich zu Afrika im Überfluss vorhanden war: Nahrungsmittel.
Ihm kam eine Liedzeile des deutschen Liedermachers Reinhard Mey aus den 70ern in den Sinn, die ihm ein Freund geschickt hatte, falls er sie in seiner Rede nutzen wollte:
Das war die Schlacht am kalten Büfett
Und von dem vereinnahmten Geld
Geh’n zehn Prozent, welch noble Idee,
Als Spende an „Brot für die Welt“ – hurra!
Als Spende an „Brot für die Welt“
„Sehr geehrte Damen und Herren“, sagte er und stellte sich vor und lächelte in die kleine Runde. „Ich bin von verschiedenen afrikanischen Staaten gebeten worden, in Europa vorzusprechen und um unbürokratische Hilfe zu bitten. Die Nahrungsmittellieferungen der privaten und staatlichen Hilfsorganisationen genügen nicht mehr, um die einfachen Menschen mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Selbst die Brot-, Milch- und Getreidepreise in den reicheren nordafrikanischen Ländern sind horrend, sodass es schon zu heftigen Unruhen gekommen ist.“ Während er sprach, beobachtete er die Vertreterinnen und Vertreter.
Deutschland bohrte in der Nase, aber hörte zu. Niederlande las etwas, was Zulu nicht einsehen konnte. An seinem Platz stand ein Trolley, der lange Griff war ausgezogen, ein Mantel lag darüber, als wollte er gleich aufstehen und gehen. Frankreich hatte den Laptop geöffnet und schrieb. Spanien fielen immer wieder die Augen zu, nur Luxemburg saß hellwach an ihrem Platz.
Spezialisten sehen anders aus. Ghandi King Zulu startete voller böser Vorahnungen dennoch seine Folien, die er zum täglichen Bedarf und zum Istzustand erstellt hatte, über die Gesundheit der einfachen Menschen in Zaire, Angola und Somalia, aber auch darüber, welche Unruhen es in Algerien, in Tunesien und sogar Ägypten sowie Südafrika gegeben hatte, da viele Flüchtlinge vor dem Hunger aus Zentralafrika nach Süden und Norden zogen. Völkerwanderungen. Exodus überall, auf der Suche nach dem Gelobten Land. Dem besseren Land.
Er verzichtete auf reißerische Fotos mit verhungerten Menschen und weinenden Kindern. Jeder Europäer kannte sie und war mittlerweile abgestumpft.
Seine Zahlen sollten überzeugen, durch unbestechliches, rechnerisches Grauen. Nüchterne Zahlen, die Tragödien schrieben.
Dagegen setzte er die Zahlen der Hoffnung, Tonnen an Soforthilfe, mit der Leben gerettet werden konnten.
„Der Welternährungsgipfel der UN hatte im Jahr 2008 festgeschrieben, dass bis 2015 die Zahl der Hungernden um die Hälfte reduziert sein muss“, kam er zum Ende seines appellierenden Vortrags, ohne den Blick von seiner Rede zu heben. „Milliarden von Euro sollen dazu bereitgestellt werden. Während diese noch gesammelt werden, sterben in Afrika Menschen. Tausende jeden Tag. An den Folgen des Hungers. Ich bitte Sie daher dringendst, die notwendigen Tonnen an Nahrungsmitteln schon jetzt bereitzustellen. Wir steuern auf eine Katastrophe zu, die Menschen zum Äußersten bringen kann.“ Er hielt einen Moment inne. „Bitte, Europa, helfen Sie Afrika! Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.“
Er hatte sich in seinen Vortrag, an dem er einen Monat lang gefeilt hatte, immer mehr hineingesteigert.
Das einsame Klatschen ließ ihn sich umschauen.
Spanien war eingeschlafen, das Kinn auf die Handballen gestützt. Frankreich hackte noch immer auf die Tastatur ein, Deutschland telefonierte. Luxemburg war es, die begeistert geklatscht hatte. Holland war in der Zwischenzeit gegangen. Es war ja Freitag.
Ghandi King Zulu wollte noch nicht gehen. Er fühlte, dass es größerer Überzeugung bedurfte. „Wenn es noch Fragen gibt?“
Deutschland hob zögernd die Hand. „Verstehen Sie die Frage richtig, Herr Zulu. Wir sind auch bereit, einige Tonnen Nahrung und Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Aber woher sollen wir denn Ihrer Meinung nach das viele Essen für sämtliche Brennpunkte nehmen?“
Zulu lächelte nachsichtig. „Wie ich in meinem Vortrag ausführte, lagern die Streitkräfte Europas immense Vorräte an konservierten Nahrungsmitteln, von Trockenmilch bis Dosenbrot. Gleichzeitig werden die Mannstärken der Heere immer weiter verkleinert. Das sind tote Rationen. Bevor man sie wegwirft, sollten sie besser dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden. Das wäre nur ein Ansatz von vielen.“
„Vertragen denn Afrikaner Schwarzbrot?“, fragte Luxemburg spontan und errötete, weil sie merkte, dass ihre Frage mindestens komisch war.
Zulu tat ihr den Gefallen, sie richtig zu deuten. „Sicherlich ist es nicht die Standardnahrung beispielsweise in Somalia, aber die Verdauung wird sich anpassen. Hauptsache, der Magen bekommt etwas zu tun, denken Sie nicht?“
„Und wenn wir die Nahrungsmittel runtergeflogen haben, was dann?“, warf Frankreich über den Rand des Laptops hinweg ein. „Es wird reichen bis zur nächsten Hungersnot, oder? Die afrikanischen Staaten müssen bessere Vorsorge für solche Fälle treffen. Ich meine, es trifft die Staaten nicht unvorbereitet. Meistens sieht man das Elend ja kommen. Silospeicher sind eine nützliche Erfindung.“
Zulu atmete tief ein. „Ich verstehe, was Sie meinen, und kann Ihnen versichern, dass die afrikanische Bevölkerung liebend gerne Vorsorge treffen und himmelhohe Speicher bauen würde“, gab er zurück und klang harscher als geplant. „Wenn sie etwas hätte oder es keinen Krieg gäbe, der sie von den Feldern treibt.“
„Es gibt afrikanische Länder, bei denen es funktioniert“, erwiderte Frankreich schnippisch. „Man muss eben haushalten mit dem Getreide. Dann kann man auch einen Teil wieder aussäen und ernten.“
„Sie wollen mir und den Millionen afrikanischer Bauern nicht ernsthaft erklären, wie man Landwirtschaft betreibt? Ich denke nicht, dass sie zu blöd zum Anpflanzen sind“, entgegnete er scharf. „Zum einen unterstützen internationale Regierungen afrikanische Despoten oder Pseudodemokraten mit Geldern und wundern sich dann, warum von der ausgezahlten Entwicklungshilfe nichts ankommt. Zum anderen subventioniert Europa die eigenen Bauern, wenn es um den Export geht. Billiges Getreide aus Europa vernichtet die Preise in Afrika und zerstört jeglichen Anreiz, dass ein normaler Landwirt in Afrika etwas anbaut. Das gleiche Spiel wird bei Fleisch betrieben. Das wissen Sie doch sehr genau!“
„Unsere Subventionen müssen sein, sonst können unsere Bauern mit dem internationalen Markt nicht mithalten“, kam es sofort von Deutschland.
Zulu merkte, dass aus dem speziellen Thema eine Grundsatzdiskussion wurde.
Von ihm aus sehr gerne. Er war vorbereitet.
„Subventionen sind in dieser Form Unsinn. Subventionen verzerren sämtliche Marktregeln der Wirtschaft. Es gibt genügend Experten, die sagen: Deutschland sollte sämtliche landwirtschaftlichen Betriebe auf Bio umstellen und nur noch Deutschland beliefern. Komplettversorgung mit gesunden Lebensmitteln zu vernünftigen Preisen.“
„Wenn das alle machen würden, gäbe es kaum noch Überkapazitäten für den Export. Dann könnten wir Afrika jetzt nicht mit unserem Getreide aushelfen“, merkte Frankreich an.
„Falsch! Denn die europäischen Erzeugnisse blieben in Europa. Afrika hätte schon lange seinen eigenen Anbau hochziehen können und wäre in der Lage, sich selbst zu helfen.“ Zulu sah Unverständnis. „Sie wollen ein Beispiel für weitere sinnlose Subventionen? Gut: Tabak. Die EU bezahlte europäischen Tabakbauern eine Milliarde Euro im Jahr, im Jahr, um gegen ausländische Ware mithalten zu können. Gleichzeitig will die EU das Rauchen verbieten und die Gesundheit der Menschen fördern. Wo ist da die Logik? Warum nicht gleich die Subventionen für Umschulungsmaßnahmen der europäischen Tabakbauern nutzen und auf den Feldern etwas Unschädliches, Nachhaltiges in Bioqualität anbauen?“
„Zurück zum Thema“, sagte Deutschland unwirsch. Man sah ihm und allen anderen Abgeordneten an, dass es keinen Spaß machte, mit dem selbst fabrizierten Unsinn konfrontiert zu werden. Weil es die Wahrheit war. „Es geht um Afrika und nicht um EU-Politik.“
„Richtig“, sagte Frankreich, nun wieder tippend. „Auch Frankreich wird einige Tonnen zur Soforthilfe bereitstellen, das habe ich mit meiner Regierung bereits abgesprochen.“
Zulu nickte. „Das ist sehr schön, und ich bin dankbar dafür. Aber Afrika benötigt die Gesamthilfe Europas, nicht die einzelner Länder.“
„Wir können das nicht entscheiden. Dafür sind wir nicht das passende Gremium“, sagte Deutschland. „Wir können nur Empfehlungen aussprechen.“
„Dann empfehlen Sie das bitte dem Plenum!“, sagte Zulu und fühlte sich zunehmend ohnmächtiger. Es nahm kafkaeske Züge an, im europäischen Parlament zu sprechen und Hilfe zu erwarten.
„Wir haben Afrika doch schon was geschickt. Nehmen Sie Simbabwe …“, sagte Luxemburg.
Zulu lachte auf und flüchtete in Sarkasmus. „Entschuldigen Sie bitte, aber in dem Land bekommt die einfache Bevölkerung gar nichts von dem, was Sie dorthin schicken. Weder Geld noch Lebensmittel. Und lassen Sie mich hinzufügen: Schade, wirklich schade, dass Simbabwe kein Öl oder ein Terroristennetzwerk besitzt. Sonst wäre es schon lange im Namen der UNO, der NATO, der USA oder vielleicht der Russen, was mal was Neues wäre, befreit worden. Tschetschenen in Simbabwe sind aber zu unwahrscheinlich. Was wäre wohl los, wenn der Präsident Al Kaida oder den IS unterstützte?“
Nun empörten sich alle. Außer Spanien, das schlief immer noch.
Zulu war in Rage. „Sage ich denn etwas Falsches? Zählen Sie die Länder, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo gemordet und gefoltert wird, wo vor laufender Kamera tausendfaches Unrecht geschieht und dann, meine Damen und Herren, zählen Sie nach, wohin sich die Heere der Welt oder eines großen Landes zur Rettung in Bewegung gesetzt haben.“ Er hob den Zeigefinger. „Nordkorea? Immer noch ein Unrechtsland!“ Der Mittelfinger schnellte nach oben. „Simbabwe? Tausende umgebracht, und nichts ist passiert.“ Der Ringfinger folgte. „Sierra Leone – Kinder sterben in den Minen, und dennoch werden die Diamanten auf der ganzen Welt gekauft. Erzähle mir keiner, dass die Geheimdienste und zivilisierten Länder nichts davon wissen!“ Er hob beide Arme in die Luft. „Ich habe nicht so viele Finger, wie es Länder gibt, in denen man auf der Stelle einmarschieren müsste, um die Menschenrechte durchzusetzen! Aber wo sind sie, die großen Freiheitsverteidiger der Welt?“
Europa lachte ihn übertrieben aus. Es war das Lachen, wie man es aus Fernsehübertragungen kannte: laut, geschauspielert, falsch und provozierend. Das bis eben schlafende Spanien schrak zusammen und öffnete die Augen.
„Europa engagiert sich in Afrika nicht“, rief Ghandi King Zulu und sah den Saaldiener auf sich zukommen, „weil das Mittelmeer euch von Afrika trennt! Auf dem Balkan, in Serbien, in Bosnien, habt ihr eingegriffen, weil ihr Angst hattet, die Unruhen und Morde würden ein Feuer entfachen, das sich bis zu euch durchbrennt und Italien und Österreich erfasst! Kaum ging es in Georgien los, waren alle da, wollten vermitteln und ihre Meinung sagen. Oder im Krimkonflikt zwischen der Ukraine und Russland.“ Zulu senkte die Stimme. „Verzeihen Sie mir meine lauten Worte. Aber es ist die Wahrheit. Ich flehe Sie nochmals an: Unterstützen Sie Afrika! Lesen Sie meine Aufstellungen und lassen Sie Ihre Regierungen von meinem Anliegen wissen.“ Er sah Spanien an. „Europa fühlt sich wegen des Meeres sicher, auf dessen afrikanischer Seite Flüchtlinge in Nussschalen steigen und beim Versuch ums Leben kommen, ins Paradies zu gelangen. Wenn eines Tages ein zweiter Moses kommt und das Volk ins Gelobte Land führt, wird es gefährlich.“
Durch das Gelächter hörte er Spanien herablassend sagen: „War das eine Drohung, Herr Zulu?“
„Nein“, antwortete er ruhig, sammelte seine Unterlagen ein, schaltete das Mikrofon aus und trat vom Pult weg, bevor ihn der Saaldiener mit Gewalt entfernen würde. „Eine letzte Hoffnung“, murmelte er unhörbar.
Die brauchte Afrika dringend.
* * *
Zweitausendjederzeit, drei Meilen vor der Südküste Siziliens, an Bord der Mari
Es war nicht unbedingt das, was man einen heftigen Sturm nannte, der an diesem frühen Abend auf dem Mittelmeer tobte.
Der Südwind trieb die Wellen vor sich her, die sich mit recht hoher Geschwindigkeit, aber ohne sich weit aufzutürmen, bewegten.
Capitano Ernesto Panna stand auf der Brücke des Küstenwacheschiffs und trank einen Cappuccino. Die Mannschaft hatte ihm zum Geburtstag eine Profi-Kaffeemaschine geschenkt, und sie lief nun ununterbrochen. Niemand an Bord war wacher als der Kommandant der Mari.
Einer der Offiziere, die ihre Schicht im Kommandostand schoben und die Instrumente immer im Auge behielten, sah auf den Radarschirm. „Capitano, ich habe hier was. Sieht aus wie einer der üblichen Seelenverkäufer.“
„Bei dem Wetter?“ Panna nippte an seinem Cappuccino. „Prüfen Sie, ob es kein Wellenecho ist.“
Der Mann drückte auf verschiedenen Tasten an dem Gerät herum.
Laut prasselte der Regen gegen die Fenster der Brücke, die Scheibenwischer schufen sekundenkurze Klarheit auf dem Glas, ehe sich die Tropfen dagegenwarfen und die Dunkelheit zum Verschwimmen brachten.
Es fiepte mehrmals.
„Capitano, ich habe jetzt sieben Meldungen auf dem Schirm“, rapportierte die Wache am Radar. „Sie sind etwa eine Meile von uns entfernt. Sie sind im Schutz des Containerschiffs gekommen. Es hat unsere Signale gestört.“
„Die müssen doch gesehen haben, dass die Seelenverkäufer an ihnen hängen.“ Panna trank seinen Cappuccino leer. Seelenverkäufer. Eine bessere Bezeichnung für die fragilen Boote, die mehr Wracks waren als alles andere, konnte es kaum geben. Die verzweifelten Leute zahlten mehrere Tausend Euro für die Fahrt mit unsicherem Ausgang. „Sieben, ja?“
Es fiepte, und der grüne Monitor hatte neue Punkte bekommen.
„Ich korrigiere: fünfzehn“, sagte der Mann aufgeregt. „Siebzehn … nein, einundzwanzig …“
„Porca miseria!“ Panna griff nach dem Hörer und nahm den Kontakt zur Station an Land auf. „Hier Korvette Mari, Capitano Panna. Wir haben Ortungen, mindestens zwanzig Seelenverkäufer, die auf die Küste zuhalten. Sie müssen sich an ein Containerschiff gehängt und es als Schutz gegen unser Radar benutzt haben.“ Er winkte einer Wache zu, dass sie ihm den nächsten Kaffee brachte, dieses Mal einen doppelten Espresso. Er musste wacher sein. „Ich brauche Verstärkung. Die Mari kann unmöglich so viele Menschen aufnehmen. Der Sturm wird an Intensität vielleicht noch zunehmen und …“ Er lauschte. „Überall?“ Er wechselte einen Blick mit dem ersten Offizier neben sich. „Wir haben überall Seelenverkäufer entlang der Südküste? Porca miseria!“ Panna legte auf. „Beide Maschinen volle Kraft voraus, Ruder hart Steuerbord. Wir fangen das erste Boot ab und sehen zu, dass wir die anderen so gut es geht abdrängen können.“
„Siebenunddreißig …“, meldete der Mann am Radar entsetzt. „… Zweiundvierzig.“
„Eine Invasion“, sagte der Erste Offizier und wurde bleich. „Die Seelenverkäufer haben sich abgesprochen und landen gleichzeitig!“
„Ja. Sieht so aus. Die Station hat mir gemeldet, dass sie identische Meldungen auch von anderen Küstenwacheschiffen bekommen hat.“ Er ließ die Mari in Alarmbereitschaft versetzen und die Bordgeschütze klarmachen. „Nur für alle Fälle“, sagte er zu seinem Ersten Offizier und nahm den Espresso entgegen.
„Ist das jetzt eine Invasion oder nicht?“, hakte der Mann nach.
Panna lachte. „Ich denke nicht, dass halb verhungerte Afrikaner eine Gefahr für Italien bedeuten.“
„Fünfundfünfzig“, kam die Radarmeldung.
Der Erste Offizier machte einen Schritt nach vorne. „Capitano! Wenn jeder Kahn mit hundert Mann besetzt ist, dann …“
„Ich weiß. Wir werden sie nicht aufhalten.“ Panna stellte sich neben den Monitor und starrte auf die Punkte, die mit jedem Kreis des hellen Lichtstrahls zahlreicher wurden. Die eingeblendete Zahl der erfassten Objekte stand bei „77“.
„Meine Güte“, stöhnte der Erste Offizier auf.
Panna lehnte sich nach vorne und tippte auf das Symbol, das für das Containerschiff stand. „Den schnappen wir uns. Er muss etwas gewusst haben. Ich denke, dass sie sich darin versteckt haben und die Boote nach und nach zu Wasser lassen.“
Die Mari nahm Fahrt auf und verfolgte das Containerschiff. Dabei passierte sie die afrikanische Armada und fuhr schließlich mit halber Kraft mitten durch sie hindurch, um sich einen Eindruck zu verschaffen.
Panna stand am Fenster, eine Hand hielt den Espresso, die andere die Untertasse, während die Boote vorbeizogen.
Es waren inzwischen zweihundertsiebenundvierzig, von Schlauchbooten bis zu kleinen Fischerkähnen, alle bis an die Bordkante mit Menschen beladen.
Jedes Gefährt, das über die Wellen torkelte oder souverän ritt, hatte als Zeichen seiner Friedfertigkeit eine weiße Fahne gehisst oder am Bug befestigt. Sie zogen rechts und links an der Mari vorbei. Das Meer wimmelte von ihnen.
Panna stellte die Untertasse ab und nahm das Fernglas.
Die schwarzen, dunkel- und hellbraunen Gesichter, die er dicht vor Augen hatte, sahen glücklich und zuversichtlich aus. Viele von ihnen lachten, andere von ihnen fürchteten sich vor dem wirbelnden, wogenden dunklen Wasser.
Etwas suchte der Capitano vergebens: Waffen.
„Sie sind alle unbewaffnet“, sagte er dem Ersten Offizier erleichtert. „Melden Sie das der Station. Es gibt keine Anzeichen für gewalttätige Absichten. Aber die Bürgermeister der Küstendörfer sollten unbedingt informiert werden. Es darf nicht zu Blutvergießen kommen.“ Panna schwenkte die geschliffenen Linsen nach rechts und nach links.
Die Schar der Boote und Kähne wollte einfach nicht kleiner werden. Ohne den Einsatz der Armee würden sie die Menschenflut nicht unter Kontrolle bringen.
„Capitano“, rief der Erste Offizier. „Die Station meldet, dass die Regierung bereits eine Sondersitzung einberufen hat.“
Panna sah die Umrisse des Containerschiffs größer werden. „Bereit machen zum Entern“, sagte er.
* * *
Zweitausendjederzeit, Malta, Valletta (Hauptstadt)
Mitschnitt aus dem Funkverkehr zwischen dem Frischwasser-Tankschiff Aqua und der Hafenmeisterei (Hm)
Aqua: Passt mal auf. Wir haben Schwierigkeiten mit der Steueranlage.
Hm: Ist das ein Problem?
Aqua: Geht so. Der Kahn ist schwer zu manövrieren. Gibt es eine Möglichkeit anzulegen, wo weniger Schiffe sind? Sonst machen wir noch was kaputt.
Hm: Nee.
Aqua: Dann erklärst du aber, warum der Hafen eine neue Kaimauer braucht und die Anlage für die Frischwasseraufnahme im Eimer ist. Los, gebt uns einen Platz, wo es ruhiger ist. Schlepper können uns ja zu den Tankanlagen ziehen.
Hm: Okay, von mir aus. Position wird elektronisch übermittelt, der Lotse weiß Bescheid.
Aqua: Alles klar. Over.
Hm: Nein, Stopp. Gib ihn mir mal.
Aqua: Wen?
Hm: Den Lotsen. Ich sage es ihm selbst, er kennt sich ja gut genug aus.
Aqua: Der ist gerade auf dem Klo.
Hm: Okay, dann warte ich so lange.
Kurze Stille.
Hm: Aqua, euer Tiefgang, der ist nicht korrekt, sehe ich gerade. Habt ihr zu wenig Wasser dabei?
Aqua: Uns ist ein Tank leer gelaufen.
Hm: Warte mal, ich habe gerade die Markierungen an eurem Bug gezählt, und wenn ich mich nicht vertan habe, seid ihr so gut wie leer! Was soll das denn?
Aqua: Ist nicht so einfach zu erklären. Geschrei im Hintergrund, jemand ruft deutlich auf Maltesisch „Überfall“.
Hm: Was ist denn bei euch los?
Aqua: Blinder Passagier, den wir geschnappt haben. Nix Wichtiges.
Hm: Klang für mich aber wie der Lotse. Das war doch Maltesisch!
Aqua: Nee, war er nicht. Ich melde mich wieder, sobald wir angelegt haben. Zehn Minuten später.
Hm: Tankschiff Aqua, bitte melden.
Aqua: Was gibt es?
Hm: Wo ist der Lotse? Ihr habt angelegt und die Gangway und die Rampe ausgelegt, ohne uns zu informieren. Was wird das? Die Schlepper warten … Scheiße, was ist das denn? Was machen die ganzen Leute da?
Aqua: Lacht. Keine Angst. Das sind ein paar Nachbarn, die sich ein bisschen Zucker borgen wollen.
Hm: Das hört ja gar nicht mehr auf! Wie viele Afrikaner habt ihr mitgebracht? Seid ihr verrückt geworden?
Aqua: Also, wenn ich richtig gezählt habe, dann waren das siebentausend. Ungefähr. Können auch ein paar mehr sein. Wenn das zweite Tankschiff anlegt, sind es etwa fünfzehntausend.
* * *
Zweitausendjederzeit, UN Hauptquartier, New York
Ghandi King Zulu hatte seinen nächsten Auftritt vor sich.
Dieses Mal jedoch vor einem Plenum.
Vor einem Plenum, das ihn anhören musste, nachdem nun Tatsachen geschaffen worden waren.
Ein Saaldiener kam auf ihn zu. „Mister Zulu? Sie sind an der Reihe.“
Er atmete tief durch, prüfte den Sitz von Sakko und Krawatte, dann betrat er das Plenum der UN-Vollversammlung.
Die Augen der Welt ruhten endlich auf ihm und damit auf seinen Belangen. Zwangsweise.
Aber das spielte für ihn keine Rolle. Afrika hatte sich Gehör verschafft, nachdem die Appelle jahrelang verhallt waren, die Tränen übersehen und die Toten nur bedauert worden waren.
Er wurde zum Rednerpult geleitet, es gab ein neues Glas und frisches Wasser für ihn.
Noch bevor er etwas sagte, wurde er vom Präsidenten der Vollversammlung angesprochen. „Mister Zulu, danke, dass Sie nach New York gekommen sind, um als Vermittler tätig zu sein.“
„Er ist der Anstifter“, rief der Vertreter Italiens erbost und bekam Applaus von Frankreich, Griechenland, Malta, Monaco und Spanien. „Ihm verdanken wir die konzertierte Aktion! Man sollte ihn festnehmen, anstatt ihn anzuhören!“
Zulu blieb gelassen und erhob mit der Erlaubnis des Sitzungspräsidenten die Stimme. „Ich bin kein Anstifter. Ich bin der Mann, der die friedliche Demonstration initiiert hat. Die Afrikaner, denen es schlecht geht, haben vom Recht Gebrauch gemacht, dagegen zu protestieren. Vorläufig unbefristet.“
„Demonstration kann man das wohl kaum nennen!“, schrie Italien. „Ganze Landstriche in Sizilien und Süditalien sind besetzt, Sardinien ist beinahe vollständig okkupiert. Das ist ein Kriegsakt!“
„Eben“, rief Malta. „Unsere Insel ist nicht mehr in unserer Hand.“
„Wir fordern den sofortigen Rückzug von folgenden unserer Inseln“, bat Griechenland und setzte an, eine Liste vorzulesen, wurde aber von Frankreich unterbrochen.
„Wir verstehen den Willen nach Freiheit und einem guten Leben“, sagte die Grande Nation. „Wer, wenn nicht wir? Aber es darf nicht sein, dass Korsika besetzt ist! Ebenso insistieren wir auf dem Rückzug aus Monaco.“
Zulu ließ die Wortmeldungen auf sich niedergehen und schaute freundlich zu jedem einzelnen Sprecher.