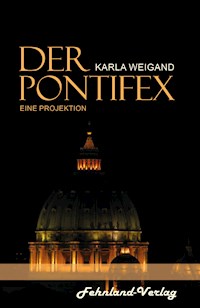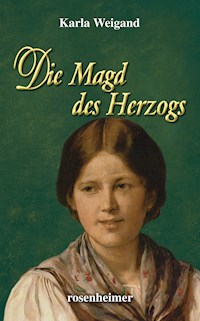Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Rein privat geht es Kommissar Lavalle gut. Seine Frau Ginette und er haben wieder zueinandergefunden, worüber er sehr glücklich ist. Beruflich sieht es anders aus. Etliche Fälle von verschwundenen Kindern – einige werden nur noch als Leichen gefunden – geben Lavalle Rätsel auf. Es handelt sich um Sprösslinge aus bitterarmen Familien, die ihren Nachwuchs vermögenden Leuten gegen Geld überlassen und sie gut aufgehoben wähnen. Als Vermittler dienen dabei ein Nonnenkloster und dessen dubioser Hausmeister. Lavalle fehlen jedoch die Beweise, um gegen diese Praxis des »Menschenhandels« vorzugehen. Die Frage, wer die Kinder auf dem Gewissen hat, interessiert allerdings Lavalles Vorgesetzte kaum. Nach der Absetzung des Königs herrschen einigermaßen »normale« Verhältnisse und auch der Adel braucht den Volkszorn nicht mehr zu fürchten. Neuerdings jedoch werden vermögende Herren der oberen Stände ermordet aufgefunden – und diese Taten zügig aufzuklären, hat natürlich Vorrang … So bleibt Kommissar Lavalle wenig Zeit, um sich um den Fall »Verschwundene Kinder« zu kümmern. Lange Zeit tappt er daher im Dunkeln. Aber zuletzt erhält er Hilfe –von einer Seite, mit der er keineswegs gerechnet hat …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karla Weigand
Kommissar Lavalle
und die verschwundenen Kinder
Historischer Roman aus der Zeit der Französischen Revolution – nach wahren Fällen
Karla Weigand
KOMMISSAR LAVALLE
UND DIE VERSCHWUNDENEN KINDER
Historischer Roman aus der Zeit der Französischen Revolution – nach wahren Fällen
Zwischen den Stühlen 17
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: November 2025
Zwischen den Stühlen @ p.machinery
Kai Beisswenger & Michael Haitel
Die Urheberrechtsinhaber behalten sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
Titelbild: Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1735–1813), Blick in eine Zelle der Bastille zum Zeitpunkt der Entlassung der Gefangenen am 17. Juli 1789
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Kai Beisswenger
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Zwischen den Stühlen
im Verlag der p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.zds.li
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 484 7
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 674 2
Prolog
2. Januar 1792
»Dem HERRN sei’s gedankt! Endlich wieder einmal ein Neuzugang! Ich befürchtete schon, diese wunderbare Quelle unserer Einnahmen könnte versiegen, Ehrwürdige Mutter! Wenn Ihr Euch erinnert, hatte ich vorausgesagt, dass es mal eine Flaute geben könnte, dass aber der Brunnen nie gänzlich versiegen würde! In der letzten Zeit hatte ich jedoch gewisse Bedenken!«
Schwester Philomena, eine kleine dicke Nonne in mittleren Jahren, ihres Zeichens Finanzverwalterin des Klosters »Zur Guten Hirtin«, am Ende der »Rue de Bretagne«, wieselte um ihre Vorgesetzte, Mater Maria Immaculata, herum, wobei sie heftig mit ihren Patschhändchen gestikulierte, um das Gesagte zu unterstreichen.
»Und Ihr hattet Recht, Schwester! So Gott will, werden wir unser dem HERRN wohlgefälliges Werk weiterführen können – dank Eurer brillanten Idee!«
Die Äbtissin dieses altehrwürdigen Klosters, das im 14. Jahrhundert im damals noch sumpfigen, nahezu unbewohnten Marais-Viertel erbaut worden war, war sichtlich erleichtert. Innerlich frohlockend beglückwünschte sie sich zu ihrem Entschluss: Sie hatte der derb-plumpen Klosterfrau, die allerdings gut rechnen konnte, eine schöne Schrift hatte und über großen Arbeitseifer verfügte, ansonsten aber nicht durch übergroße Intelligenz, dafür eher durch raffinierte Skrupellosigkeit auffiel, die Verwaltung des Klosters mit allem, was dazugehörte, übertragen.
Schrieb man seit den politischen Unruhen in Paris rote Zahlen, hatte sich dies nach Philomenas Dienstantritt nun grundlegend geändert; das Kloster »Zur Guten Hirtin« stand geradezu prächtig da!
Wodurch die Sanierung der reichlich desolaten finanziellen Schieflage so überzeugend gelungen war, darüber wollte die Ehrwürdige Mutter gar nicht allzu genau Bescheid wissen.
Es hatte etwas mit Kindern zu tun – war demnach unter dem schönen christlichen Begriff »gutes Werk« zu verbuchen – und die Verwalterin der Ein- und Ausgaben des Klosters genoss das vollste Vertrauen ihrer Äbtissin.
Die war keineswegs naiv und traute ihrer Mitschwester durchaus zu, »krumme Dinger zu drehen«. Aber wenn sie nichts davon wusste, konnte man sie im Fall, dass unappetitliche Details offenkundig würden, keiner Mitschuld verdächtigen.
So könnte sie guten Gewissens in aller Unschuld bei allen Heiligen schwören, von Unkorrektheiten nichts gewusst zu haben, und kriminelle Machenschaften aufs Schärfste verurteilen. Alles bliebe demnach an Schwester Philomena hängen …
7. Januar 1792
Das vergangene Jahr hatte sich mit eisigem Wind und beißender Kälte verabschiedet. Und das neue hatte nicht besser angefangen – im Gegenteil: Am Tag der Heiligen Drei Könige waren Unmengen Schnee auf die Stadt Paris herniedergefallen.
Die weiße Pracht bedeckte alles Schmutzige, Verrottete und Halbverfallene mit einem blütenweißen Überzug. Als sich gar noch die Wintersonne blicken ließ, schmerzte der gleißende Panzer beinahe in den Augen und erlaubte einen geradezu märchenhaften Blick auf Gebäude, Straßen und Plätze.
Die Bürger von Paris genossen das seltene Schauspiel, indem sie aus den Fenstern lugten; ins Freie wagte sich nur, wer unbedingt musste. Für erholsame Spaziergänge war es einfach zu kalt; jeder Atemzug erzeugte weiße Dampfwolken und die Kälte biss in Nasen und Wangen.
Nicht einmal Diebe, Einbrecher, Räuber und revolutionäres Gesindel aller Art wagten sich auf die Straße, sondern warteten in diversen warmen Schlupfwinkeln auf Tauwetter, um ihrer jeweiligen »Profession« erneut nachgehen zu können.
Für die Police de Commune de Paris bedeutete das ebenfalls eine Atempause und der oberste Chef der Behörde, CommandantGénéral Guy Laroche, hatte über die Hälfte seiner Männer in den Urlaub geschickt. Auch Kommissar Armand Lavalle gehörte zu den Glücklichen, sodass er sich die nächste Zeit seiner kleinen Familie voll und ganz widmen konnte.
Etwas, das er sehr genoss – hatte er doch lange Zeit auf Frau und Kind verzichten müssen. Denn seine Ginette war gegen seinen Willen mit dem Baby Lucille-Marie zu ihrer Tante Claire-Sophie auf deren Weingut in der Champagne geflohen. Verbrecher hatten am helllichten Tag versucht, ihr Töchterchen zu entführen.
Die Kleine, die sich an Lavalle natürlich nicht mehr erinnern konnte, würde in einem guten Vierteljahr bereits ihren zweiten Geburtstag feiern und sollte nun endlich ihren Vater richtig kennenlernen.
Die Eheleute Armand und Ginette mussten auch wieder zueinanderfinden. Die Trennung hatte ziemlich lange gedauert; für beide hatte es Versuchungen gegeben – denen sie auch prompt erlegen waren. Nun galt es, den Faden der Liebe an der Stelle wieder festzuknüpfen, an welcher er durchtrennt worden war.
Wie der Kommissar beglückt feststellte, schien es ihnen auch zu gelingen, denn beide waren guten Willens, ihrer einstigen großen Liebe eine zweite Chance zu gegeben. Armand blühte geradezu auf in seinem Bemühen, seine schöne Frau erneut zu umwerben und zu erobern.
Zum Glück hatten beide darauf verzichtet, ihren Neuanfang durch »Geständnisse« zu belasten, die zu nichts führten – außer zu Schmerz, Verletzung, Eifersucht und dauerhaftem Misstrauen.
Der Kommissar hatte von sich aus nicht den Drang verspürt, über seine Liaison mit Claudine, einem hübschen jungen Schankmädchen, zu plaudern. Ginette hingegen hörte auf den vernünftigen Rat ihrer Großmutter, die sie ernsthaft davor gewarnt hatte, der Versuchung, »reinen Tisch zu machen«, nachzugeben. Das möge sich zwar gut und edel anhören, sei aber völliger Blödsinn, weil nachträgliches Eingestehen ehelicher Verfehlungen noch nie Gutes bewirkt hätte – im Gegenteil!
»Deckel drauf und ein für alle Male Schwamm drüber!«, hatte die lebenskluge alte Frau gesagt.
In Lavalles Wohnung in der Rue Dauphine war es während und nach den Weihnachtstagen recht lebhaft zugegangen. Zu den momentanen Bewohnern gehörte im Augenblick auch Ginettes Großmutter, Grandmère Céléstine Madrier, die bei der lausigen Kälte ihren Blumenstand auf dem Marché aux Fleurs, wie die meisten anderen Händler auch, geschlossen hielt und bei den winterlichen Temperaturen in der eigenen Unterkunft die Heizung sparen wollte …
Und über Weihnachten und Neujahr war noch Ginettes jüngerer Bruder Luc, siebzehn Jahre und Lehrling bei Maître Philippe Danube, einem renommierten Rechtsanwalt und Notar, dazu gestoßen. Sein Chef hatte nach Weihnachten für einige Wochen die Kanzlei geschlossen, weil er die ungemütlichen Pariser Wintertage hinter sich lassen und mit seiner Frau lieber die um vieles angenehmere Wärme des französischen Südens genießen wollte und nach Cannes gefahren war.
Wenn dann noch Nachbarn vorbeischauten, um Glückwünsche fürs neue Jahr auszusprechen und Lucs junge Freunde ihn besuchten, dann ging’s richtig rund bei der Familie.
»Was für ein Leben in der Bude!«, freute sich Armand Lavalle.
»Ohne dich, mein Schatz, so ganz allein, war’s meistens furchtbar öde! Da bin ich lieber im Kommissariat geblieben, habe noch spät nachts über den Akten gesessen, oder bin freiwillig wie ein einfacher Gendarm in den Straßen Streife gelaufen. Daheim hat mich ja niemand vermisst!«
»Dann hast du dir jetzt die paar freien Tage aber wahrlich verdient, mein Lieber!« Grandmaman Céléstine sah das Ganze sehr pragmatisch und Lavalle stimmte der alten Frau zu.
In den Nächten holten er und Ginette das allzu lang Versäumte voll Temperament und mit zärtlicher Hingabe nach und der Kommissar rechnete jeden Tag damit, dass seine Liebste ihn mit der frohen Botschaft überraschen würde, erneut schwanger zu sein.
Beide fanden, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für weiteren Nachwuchs. Lucille-Marie sollte nicht als verzärteltes Einzelkind aufwachsen und der zeitliche Abstand zu einem Geschwisterchen nicht zu groß werden.
Aber das Beste und Wichtigste war: Lavalles Gehalt erlaubte eine Vergrößerung seiner Familie. Nach der Aufklärung der schrecklichen »Mädchenmorde« hatte ihm sein oberster Chef eine weitere ordentliche Gehaltsaufbesserung zugebilligt.
Alles stand zum Besten; jeder in der Familie war gesund. Auch die mit fast sechzig schon ziemlich betagte Großmutter erfreute sich eines tadellosen Allgemeinzustandes, Luc hatte endlich »die Kurve gekriegt«, indem er eine vernünftige Ausbildung machte, von seinem Lehrherrn gelobt wurde und sich mit anständigen jungen Kerlen herumtrieb und nicht mit irgendwelchen Strolchen, deren es in Paris leider zu viele gab.
Lavalle selbst fühlte sich, als wäre er in einen »Jungbrunnen« gefallen, seine schöne Ginette strahlte wie ein junges Mädchen und Lucille-Marie war ein wahrer Sonnenschein, ein Schätzchen, das auf strammen Beinchen durch die Gegend stapfte, mit wachen Augen alles in sich aufnahm, schon recht gut sprechen konnte, genau wusste, was es wollte, seinen Papa um den Finger wickelte und in Kürze jedermann, und sei er auch der größte Griesgram, für sich einzunehmen verstand.
»Den Charme hat die Kleine von meiner Enkelin Régine geerbt«, ließ Grandmaman alle wissen, die das niedliche Kind bewunderten.
Bei der ärgsten Kälte blieben die Frauen zu Hause im Warmen und Armand und Luc erledigten, dick eingemummelt, die nötigen Einkäufe.
Dem Kommissar war klar, dass die Idylle nicht mehr sehr lange von Dauer sein würde. In einigen Tagen war erneut Dienstbeginn und dann würde wieder »ein anderer Wind wehen …«
Teil 1
12. Januar 1792
Vor zwei Tagen hatte Tauwetter eingesetzt und das viele Eis und die Schneemengen lösten sich in Wasser auf, das nun durch die Straßen schwappte, weil der Rinnstein gar nicht alles aufnehmen konnte und allerhand Dreck und Unrat mit sich riss, der nach dem Abfließen am Rand der Geh- und Fahrwege in eklig schmutzigen Haufen liegen blieb.
Der Abtransport würde Tage dauern. Weil sich unter all dem Müll neben verfaulten Gemüseresten auch tote Tiere befanden – Mäuse, Hühner und Katzen – würde es in Kürze bestialisch stinken und jeder wäre darauf bedacht, die Fenster geschlossen zu halten.
»Ausgerechnet jetzt, wo wir alle uns danach sehnen, wieder frische Luft zu atmen und ein paar Sonnenstrahlen zu genießen, müssen wir uns wieder in den Häusern verschanzen, weil man es vor lauter widerlichem Gestank im Freien kaum aushält!«
Hubert Aubriac, Armand Lavalles Freund und Sekretär seiner beiden Chefs – Commandant Général Guy Laroche, wie auch ihres direkten Vorgesetzten, Capitaine Émile Béguin – schaute missmutig aus dem natürlich geschlossenen Fenster in Lavalles kleinem Büro auf die Gasse.
»Reg dich nicht auf, mein Lieber! Sei froh, dass du nicht raus musst in das Schmuddelwetter und du dir die Schuhe nicht nass machen brauchst!«, tröstete ihn sein Freund Armand. »Mir ist grade mitgeteilt worden, dass über die Weihnachtsfeiertage mehrere Anzeigen über verschwundene Kinder bei der Polizei eingegangen sind.
Eins dieser armen Geschöpfe ist jetzt leider tot aufgefunden worden. Es lag bestimmt schon Wochen begraben unter einem der riesigen Schneehaufen und ist jetzt erst durch das Tauwetter wieder zum Vorschein gekommen. Ich werde mit Jacques oder, falls der noch in Urlaub sein sollte, mit Jean-Baptiste in die Salpêtrière gehen und mir das arme Würmchen anschauen müssen!«
Jean-Baptiste Morlais und Jacques Fanfan waren seine besten Mitarbeiter, die er am häufigsten mitnahm, falls er außer Haus zu tun hatte.
»Oh, mein Gott! Schon wieder so ein Fall, der einem ans Herz geht, Armand! Bestimmt handelt es sich um das Kind armer Leute!«
Hubert schüttelte betrübt den Kopf und ging zurück in sein kleines Arbeitszimmer, das sich zwischen dem edel ausgestatteten Büro des Commandant Général und dem des einfacheren, aber immer noch recht noblen Arbeitszimmers des Polizeichefs, befand.
Das Gebäude am Quai des Orfèvres, dem ehemaligen Kai der Goldschmiede, mochte zwar alt und verwinkelt sein, aber das einstige königliche Palais war zumindest sehr solide gebaut, trotzte Sturm und Regen und war – in aller Regel – einigermaßen gut heizbar. Letzteres konnte man weiß Gott nicht von allen städtischen Ämtern behaupten. In einigen zog es im Winter sehr stark; in manchen musste man Kübel aufstellen, um das Regen- oder Schmelzwasser aufzufangen, das durch das schadhafte Dach tröpfelte …
Armand Lavalle und Jacques machten es recht kurz in der Salpêtrière, einer früheren Salpeterfabrik und jetzt größtes Krankenhaus der Stadt. Der zuständige Mediziner, der die armselige Kindsleiche untersucht hatte, konnte ihnen leider zur Todesursache nichts mehr Konkretes sagen. Der kleine, extrem magere Körper des Jungen war bereits stark verwest. Immerhin konnte man zumindest vermuten, der Tod wäre durch Unterernährung eingetreten.
»Das einzige Auffallende ist«, meinte der Doktor, »dass der Kleine, den ich, mit aller Vorsicht auf fünf oder sechs Jahre schätze, von Geburt an unter einem verkürzten rechten Bein gelitten hat!«
»Er hat demnach beim Gehen stark gehumpelt«, stellte Lavalle fest. »Das könnte uns dabei helfen, ihn zu identifizieren. Soviel ich weiß, wurde das Kind nicht als vermisst gemeldet!«
Der noch sehr junge Arzt schüttelte angewidert den Kopf. »Unglaublich! Was sind denn das für Eltern?«
»Wahrscheinlich bitter Arme, die froh waren, einen Esser weniger am Tisch zu haben!«, gab ihm Jacques Fanfan trocken zur Antwort. Worauf ihm der Doktor einen empört ungläubigen Blick zuwarf. Er wandte sich an den Kommissar: »Sehen Sie das etwa genauso, Monsieur le Commissaire? Das darf doch wohl nicht wahr sein!«
Lavalle hatte gleich erkannt, dass es sich bei dem jungen Mediziner um einen etwas naiven Sprössling wohlhabender Leute handeln musste, der bisher noch wenig Kontakt zu den ärmeren, geschweige zu den allerärmsten Schichten der Bevölkerung gehabt hatte. Sollte er länger in diesem Krankenhaus, das vorwiegend die Unterprivilegierten aufsuchten, tätig sein, würden ihm die Illusionen bald vergehen …
»Nun, Monsieur le Docteur, es ist nicht unüblich, dass sich Eltern mit wenig Geld und vielen Kindern dazu entscheiden, eines oder mehrere ihrer Sprösslinge in die Obhut von reichen Wohltätern oder Klöstern zu geben. Sie tun dies, weil sie möchten, dass ihre Kinder es besser haben und gut ernährt, gekleidet und überhaupt versorgt werden, als sie es ihnen aufgrund ihrer eigenen Mittellosigkeit ermöglichen könnten.
Ich vermute, dass die Eltern dieses armen toten Knaben gar keine Kenntnis vom Ableben ihres Kindes haben. Sie verlassen sich wahrscheinlich darauf, dass es ihm gut geht. Bei diesem armen Jungen ist offenbar irgendetwas gewaltig schief gegangen!«
Das schien den entsetzten Arzt ein wenig zu beruhigen, wenngleich er trotz allem nicht verstehen konnte, dass Eltern es fertigbrachten, ihr Kind an Fremde abzuschieben.
Draußen auf der Straße schüttelte Fanfan den Kopf. »Was für ein Naivling dieser Arzt doch ist!«
»Naja, er ist noch jung, vermutlich wohl behütet aufgewachsen und noch recht unerfahren. Das wird sich aber bald legen. Du darfst nicht vergessen, Jacques, wir in unserem Beruf haben Kontakt zu ganz anderen Schichten, auch zum Bodensatz der Bevölkerung; und von daher wurde uns schon gleich zu Beginn unserer Polizistentätigkeit jegliche Naivität ausgetrieben!«
»Ja, du hast recht, Armand!«, gab Jacques nach kurzem Nachdenken zu. »Wenn ich mir überlege, mit wie viel Elend, Not, Schlechtigkeit und Verbrechen ich in kurzer Zeit schon konfrontiert wurde, bin ich gelegentlich versucht, die ganze chose hinzuschmeißen! Es deprimiert mich manchmal zutiefst. Vor allem, weil es nie aufhört und ich mich oft frage, warum wir uns überhaupt darum kümmern!«
Ein Gefühl, das Armand Lavalle leider nur zu gut kannte.
15. Januar 1792
Bisher war man mit der Recherche nach der Identität der Kindesleiche noch keinen Schritt weitergekommen.
Der Junge blieb namenlos, keiner vermisste ihn …
Da niemand Anspruch auf die Leiche erhob, um sie ordentlich zu bestatten, erhielt der kleine Tote das übliche Armenbegräbnis auf dem »CimetièrePère Lachaise«. Dort gab es eine separate Ecke für Fälle, in denen keine Verwandten ausfindig gemacht werden konnten, um auch diese Verstorbenen ohne jeglichen Aufwand und ohne Blumenschmuck, nur im Beisein eines Armenpriesters und des Totengräbers, rasch unter die Erde zu bringen.
Ganz gegen seine Gewohnheit hatte Lavalle darauf bestanden, persönlich der kümmerlichen Zeremonie beizuwohnen; außerdem nahm er Jean-Baptiste Morlais mit. Sein Vorgesetzter, Emile Béguin, hatte zwar die Nase gerümpft, aber dann doch achselzuckend zugestimmt: »Wenn es Sie glücklich macht …«
Beide Kommissare empfanden die Trostlosigkeit der ziemlich schnell und lieblos abgespulten Angelegenheit als geradezu niederschmetternd. Morlais fragte auf dem Rückweg ins Kommissariat seinen Freund und Vorgesetzten, warum ihm dieses Mal so viel daran gelegen war, dem traurigen Spektakel beizuwohnen.
»Ganz ehrlich, mon Ami, ich weiß es selbst nicht! Aber ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, als ob gerade dieses vermutlich verhungerte Kind, dessen Existenz oder Nichtexistenz offenbar keinen Menschen schert, uns einen kleinen Schritt weiterbringen könnte. Wenngleich ich keinen Schimmer habe, wie das zugehen mag!«
»Ja, du und deine Gefühle!« Morlais musste unwillkürlich grinsen. »Na gut! Meistens liegst du dabei ja richtig. Lassen wir uns also überraschen!«
Keine Überraschung war hingegen, dass sich Jean Paul Marats Skandalblättchen »Ami du Peuple« (»Volksfreund«) geradezu mit Feuereifer auf die alarmierenden, aber noch spärlichen Nachrichten über derzeit abgängige Kinder stürzte.
Obwohl in keinem Fall ein Verbrechen vorlag – soweit bekannt jedenfalls – erregten die Fälle, in denen Kinder einfach von der Bildfläche verschwanden, allmählich auch bei der daran eher uninteressierten Pariser Bevölkerung Aufsehen.
Es hatte ein Weilchen gedauert, bis die Tiraden eines Marat in seinem »Amidu Peuple« oder Hébérts (Letzterer war der Herausgeber des üblen Hetzblattes »Père Duchesne«), den Nerv der Leute trafen, die eigentlich genügend eigene Sorgen zu bewältigen hatten.
Kindern und den Umständen, unter denen sie aufwuchsen, wurde im Allgemeinen nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt; vor allem die Sprösslinge aus der Unterschicht wurden kaum beachtet. Es gab ja genügend von ihnen …
Allein die Tatsache sprach Bände, dass bisher die Anzeigen über abgängige Kinder nicht von den Eltern, sondern von aufmerksamen Nachbarn bei der Polizei eingegangen waren …
Denen mochte gelegentlich aufgefallen sein, dass sie eines der Kinder längere Zeit nicht mehr gesehen hatten. Aber sie nahmen in aller Regel an, man habe sie zu Verwandten aufs Land geschickt, um sie von der heimischen Suppenschüssel fernzuhalten und verloren kein Wort darüber.
»Durch Marat und Hébért scheint sich da neuerdings etwas zu ändern«, meinte Lavalle. »Auf einmal vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine oder mehrere Anzeigen über verschwundene Kinder bei uns eintrudeln. Ich werde mich mal zu den Markthallen aufmachen, um mich dort umzuhören!«
Die Idee war nicht schlecht; tatsächlich hatte der jüngste Leichenfund eines unbekannten Knaben und die Tatsache, dass allmählich mehr Leute über plötzlich verschwundene Kinder redeten, einige aufgerüttelt, sodass sie genauer hinschauten oder nachfragten.
Zum Glück waren sie auch bereit, mit einem Polizeibeamten über gewisse einschlägige Vorkommnisse zu sprechen. Mord an einem Kind, »das bereits denken konnte«, wurde allgemein verabscheut; damit wollte man nichts zu tun haben! Anders verhielt es sich bei in der Seine entsorgten Säuglingen. Da überwog das Mitgefühl mit der offensichtlich überforderten und verzweifelten Mutter, die sich ein Kind nicht leisten konnte.
»Ich finde es gut und richtig, dass die Polizei sich dieser Sache annimmt!«, sagten viele der in Les Halles tätigen Händler und Händlerinnen. Bereitwillig packten sie aus und der Kommissar erfuhr eine Reihe Namen von Familien, bei denen unerwartete Abgänge von Sprösslingen aufgefallen waren. Aber mehr wussten die von Lavalle Angesprochenen auch nicht.
Von Mère Brassens, der ehemaligen Hure »mit dem goldenen Herzen«, die ihm schon oft mit Hinweisen bei der Aufklärung von Straftaten hatte helfen können, erfuhr er dieses Mal leider auch nichts Konkretes. Außer vagen Berichten über arme Familien, die eines oder zwei ihrer Kinder aus der Schar ihrer Nachkommen »zu Onkel und Tante aufs Land« geschickt hatten, damit sie wenigstens besseres Essen bekamen, hatte die alte Frau nichts Erhellendes beizutragen.
»Na ja, einen Versuch war’s wert«, murmelte Lavalle vor sich hin.
Interessanter waren da die Ausführungen zweier Hausfrauen an einem Käsestand gewesen, die von sich aus an den Kommissar herangetreten waren, »um dem Monsieur vonder Polizei Wichtiges mitzuteilen«.
»Mir und meiner Freundin Laurette ist aufgefallen, dass bei einer unserer Nachbarinnen, die jedes Jahr Nachwuchs kriegt, obwohl sie und ihr nichtsnutziger Kerl von Ehemann kaum selber genug zum Beißen haben, ungefähr ein halbes Jahr nach der Geburt von dem zur Welt gekommenen bébé nichts mehr zu sehen und zu hören ist!« Die Frau redete ohne Punkt und Komma.
»Da haben wir mal energisch nachgefragt, wohin die kleinen Kinder denn gebracht worden wären, denn gestorben wäre ja keines. Das hätten wir in der Nachbarschaft ja wohl mitbekommen!
›Und erzähl’ uns nix von Verwandten auf dem Land‹, hab' ich ihr gesagt. ›Wir wissen, dass du keine hast! Und dein Mann auch nicht.‹
Da ist die Mutter mit der Wahrheit rausgerückt!«
Erwartungsvoll sahen die biederen Hausfrauen den Kommissar an. Der tat ihnen den Gefallen und fragte ganz aufgeregt: »Nun, Mesdames, machen Sie es bitte nicht so spannend! Die Polizei ist für jeden Hinweis dankbar! Was hat denn nun Ihre Nachbarin geantwortet und wie heißt diese Frau überhaupt?«
»Die angeblich verschwundenen Kinder von Louise Murat, so heißt sie nämlich, werden jeweils einem Mann übergeben!« Triumphierend blickten die Frauen auf Lavalle.
Den beschlich prompt ein mehr als ungutes Gefühl. Ehe er weiter bohren konnte, fiel die zweite Freundin ein: »Non, non, Monsieurle Commissaire! Nicht, was Sie jetzt denken! Dieser Mann ist sehr respektabel und steht in Diensten eines hiesigen Nonnenklosters!
Es heißt ›Zur Guten Hirtin‹ und nimmt Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu zwölf Jahren auf, versorgt sie ordentlich, unterweist sie im Glauben, bringt ihnen Lesen, Schreiben und etwas Rechnen bei und vermittelt sie später an wohlhabende Bürger- oder Adelsfamilien. Dort werden sie dann als Zofen, Gärtner, Erzieherinnen oder gar als Verwalter angestellt.«
»Ja, und angeblich reißen sich die gut betuchten Leute um diese Zöglinge aus dem Kloster, denn sie seien besonders gut erzogen, gebildet und fleißig. Und die nicht ganz so schlauen finden immerhin Anstellungen als Dienstmädchen oder Stallburschen. Jedes findet seinen Weg, jedes ist raus aus dem armseligen Milieu, in welches es hineingeboren worden ist, und muss keine Angst vor der Zukunft haben!«
»Wahre Wohltäterinnen, diese Klosterfrauen!«, stellte Lavalle mit leiser Ironie fest. Er bedankte sich höflich bei den Bürgerinnen und beschloss, sich in diesem Konvent ›Zur Guten Hirtin‹ selbst ein Bild von den famos-vorbildlichen Zuständen zu machen.
Sein Besuch in diesem Kloster in der Rue de Bretagne im Stadtviertel Marais musste indes leider warten. Straßenkrawalle mit Verletzten und einem Toten beschäftigten die Kommissare und ihre Polizeikollegen noch die ganze folgende Woche.
Jeden Abend nahm er sich (zunehmend halbherziger) vor, den Besuch dieses ominösen Klosters nicht länger hinauszuschieben, obwohl er mittlerweile mehr oder weniger davon ausging, dass ihm der Ausflug in das ehemalige Sumpfgebiet – jetzt aber nach seiner Trockenlegung ein sehr gefragtes Wohnviertel – auch nichts Neues bringen würde …
Wie so oft schon, war es dann wieder einmal »Kommissar Zufall«, der ihm den entscheidenden Anstoß gab, den frommen Frauen dann doch energisch auf die Pelle zu rücken.
22. Januar 1792
Ginettes Bruder Luc hatte sich wieder mal selbst zum Abendessen eingeladen, worüber sein Schwager Armand wie seine Schwester keineswegs traurig waren, sondern sich im Gegenteil ehrlich freuten. Der junge Bursche hatte sich prächtig entwickelt, nachdem es eine ganze Weile so ausgesehen hatte, als würde er eher in Richtung »Taugenichts« abdriften.
Sein Lehrherr, bei dem sich der Kommissar nun regelmäßig nach ihm erkundigte, war nach wie vor voll des Lobes über ihn.
»Wenn Ihr junger Schwager so weiter macht, Monsieur le Commissaire, könnte er in wenigen Jahren vom einfachen Anwaltsgehilfen aufsteigen, sofern er sich dem Studium der Jurisprudenz zuwenden würde. Und, vielleicht in späteren Jahren, wenn ich selbst mich zur Ruhe setzen möchte, könnte er sogar meine Kanzlei übernehmen! Einen eigenen Sohn oder Neffen habe ich ja nicht, der einmal in meine Fußstapfen treten würde!«
Das waren immerhin großartige Aussichten, aber bisher eben nur Zukunftsmusik.
»Anwaltsgehilfe zu bleiben, ist ja auch nicht das Schlechteste«, meinte Ginette. »Grandmaman und ich sind jedenfalls froh, dass der Junge sich anscheinend gefangen hat!«
Am Abendbrottisch wurde natürlich auch neben Lavalles Fällen die verworrene politische Lage diskutiert. Wie es den Anschein hatte, brachten auch die illustren Mitglieder der »Nationalversammlung« nichts Rechtes zustande.
Nachdem die Menschenrechte, die für alle gelten sollten,verkündet waren, ein Verwaltungssystem mit Départements eingeführt wurde, alle Standesvorrechte (angeblich) beseitigt waren, das Kirchengut vom Staat eingezogen worden war und der Klerus eine Zivilverfassung erhalten hatte, war nichts Wesentliches mehr geschehen. Der Unmut in der Bevölkerung wuchs.
»Außer heißer Luft ist da wenig, was dem französischen Volk dienlich sein könnte!« Darin waren sich alle Erwachsenen am Tisch einig, zu denen jetzt auch der siebzehnjährige Luc Madrier zählte.
Natürlich waren auch »die verschwundenen Kinder«, wie die Presse neuerdings reißerisch titelte, ein Thema bei den Lavalles.
Ginette und ihre Großmutter konnten allerdings die riesige Aufregung darüber nicht so ganz nachvollziehen.
»Endlich macht die Kirche mal etwas, das sinnvoll ist!«, sagte die alte Frau und Ginette meinte: »Wenn die Nonnen den armen Familien die überzähligen Kinder abnehmen, um diese gut zu versorgen, ist das doch sehr löblich. Ja, eigentlich nur folgerichtig! Die Kirche ist es doch, die jede Art von Geburtenbeschränkung verbietet. Dann soll sie auch den armen Leuten helfen, die darunter leiden, dass ihre Familien von Jahr zu Jahr größer werden!«
Armand vermochte dieser logischen Argumentation wenig entgegenzusetzen. Immerhin, gab er zu bedenken, dass eins dieser Kinder, vermutlich verhungert, kürzlich tot aufgefunden worden wäre und …
Ginette widersprach sofort. »Soweit ich mich erinnere, mein Schatz, hast du selbst gesagt, man wisse nicht, um wen es sich handele und wer die Eltern dieses armen Jungen gewesen seien. Der Hinweis, der Knabe habe vermutlich stark gehinkt aufgrund eines verkrüppelten Beins, hat die Polizei doch auch nicht weitergebracht!«
Das Letztere ließ Luc aufhorchen.
»Das Kind hat demnach gehumpelt? Oh, dann weiß ich vielleicht etwas, das weiterhelfen könnte bei der Frage, um welchen Kleinen es sich gehandelt hat!«, sagte er aufgeregt. »Mein Freund Pierre Dupont hat gemeint, dass er die Leute, zu denen der Knabe vielleicht gehört, vermutlich kennt! Sie sind quasi die nächsten Nachbarn seiner eigenen Familie und bitterarm.« Herr im Himmel, darauf hatte ihn doch der junge Mediziner in der Salpêtrière hingewiesen! Er hatte das glatt vergessen, weil so viele andere ungelösten Fälle zu bearbeiten waren. »Weißt du noch etwas mehr darüber?«, wandte er sich an seine Frau Ginette, nachdem Luc nichts weiter zu sagen hatte.
»Einer Bekannten von mir ist angeblich schon im vergangenen November aufgefallen, dass man den kleinen Jeanot Meuron schon länger nicht mehr gesehen hatte. Also hat sie nachgefragt, ob der Junge womöglich krank geworden wäre. Madame Meuron, im Augenblick mit dem neunten Kind schwanger und völlig verzweifelt, hat meiner Bekannten dann anvertraut, dass die frommen Schwestern des Klosters ›Zur Guten Hirtin‹ ihr den Kleinen mit dem Hinkebein abgenommen hätten, um ihn im Kloster aufzuziehen. Worüber sie und ihr Mann ungeheuer froh gewesen wären.
›Bei den Klosterfrauen ist er gut versorgt und das ist uns das Wichtigste! Aufgrund seiner starken Gehbehinderung hätte er niemals für sich selbst den Lebensunterhalt verdienen können‹, meinte sie. ›Drum waren wir glücklich, als man ihn uns abgekauft hat!‹«
Lavalle riss es beinahe vom Stuhl. »Abgekauft?«, rief er aus. »Hat die Mutter des Jungen das tatsächlich so gesagt?«
»Ja! Es sei zwar nicht viel gewesen, aber immerhin ein paar Scheinchen und sie wären doch für jeden einzelnen Sou dankbar!«
»Also, ich will ja nicht unken«, murmelte der Kommissar. »Aber für mich hört sich das irgendwie verdammt nach Kinderhandel an!«
Da widersprachen ihm jedoch alle anderen am Tisch. Es sei doch nicht verwerflich, sondern eher vorbildlich, wenn das Kloster die arme Familie unterstütze, indem sie ihnen eine große Last abgenommen und nebenbei ein bisschen Geld locker gemacht habe.
»Die Kirche hat’s doch«, fügte Grandmère Céléstine hinzu, »und dem Kloster wird’s nicht wehtun! Endlich einmal handeln die Kuttenträger wirklich aus christlicher Nächstenliebe!«
Lavalle hatte keine Lust, die gute Stimmung bei Tisch zu zerstören, aber seine Gedanken liefen in eine ganz andere Richtung. Was er gerade gehört hatte, bestärkte ihn im Gegenteil in seiner Meinung, dass hier etwas ganz gewaltig faul war.
Wieso war das behinderte Kind in einem derart erbärmlich abgemagerten Zustand, in einem ganz anderen Stadtviertel als dem Marais, unter einem Schneehaufen, wie eine verendete Katze entsorgt worden? Wer hatte so etwas getan, wo sich der Junge doch angeblich in der Obhut der Nonnen befand? Dieser Spur würde er nachgehen, sobald es seine anderen Aufgaben, die er zu erledigen hatte, zuließen.
Lavalle war sich bewusst, dass der Sachverhalt, dass immer wieder armer Leute Kinder »angeblich« verschwanden und eines davon jetzt tot aufgefunden worden war, für seine Vorgesetzten nicht unbedingt zu den Fällen mit besonderer Priorität gehörte …
›Trotzdem, selbst wenn ich mich zur Untersuchung dieses Falls mit dem Zeitungsmacher Jean-Paul Marat zusammensetzen müsste, werde ich mich der Sache annehmen‹, nahm er sich vor. ›Vielleicht hat der für gewöhnlich jede Menge Gift verspritzende Schreiberling gar nicht so Unrecht mit seinem Verdacht, es könnte sich um eine große Schweinerei handeln, die da mit Kindern aus ärmlichen Verhältnissen betrieben wird!‹
Obwohl erst im vergangenen Herbst 1791 nach dem gescheiterten Fluchtversuch der königlichen Familie am 14. September die Nationalversammlung die konstitutionelle Monarchie verkündet hatte – also den Abschied vom Absolutismus – strebten nun die politischen Klubs die Errichtung einer Republik an, also das endgültige Aus für die Monarchie.
»Weg mit sämtlichen Königen!«, lautete ihre Devise.
In der neu gewählten »Gesetzgebenden Nationalversammlung« hatten jetzt die Girondisten die Führung inne. Und weil deren Mitglieder mit Sorge auf das Kaiserreich Österreich blickten, dessen Führung wiederum gegen die Behandlung Marie Antoinettes und ihres Gemahls Ludwigs XVI. protestierte (sie waren jetzt praktisch Gefangene!), plädierten die Girondisten dafür, den Österreichern den Krieg zu erklären. Wobei sie sich im Falle eines Erstschlags gute Chancen für eine »Republik Frankreich« ausrechneten. Aber noch regte sich dagegen beträchtlicher Widerstand …
Was sich wiederum auf den Straßen von Paris bemerkbar machte, indem erneut bewaffnete Volkshaufen für oder gegen die Girondisten die öffentlichen Plätze der Hauptstadt unsicher machten.
In nächster Zeit würden Lavalle und seine Kollegen genug anderes zu tun haben, als sich um Kinder zu kümmern, die ohnehin, sollte man den wenigen Eltern, die man ermittelt hatte, Glauben schenken, von den »Guten Hirtinnen« liebevoll umsorgt wurden …
31. Januar 1792
Kommissar Lavalle hatte es endlich geschafft, sich ein paar Stunden freizuschaufeln, die er dazu benutzen wollte, sich mal in diesem Kloster »Á Bonnes Bergères« umzuschauen.
»Mit eigenen Augen will ich mich davon überzeugen, was es mit den Gerüchten auf sich hat, die netten und frommen Klosterfrauen würden sich ihres christlich-humanitären Auftrags erinnern und sich tatsächlich um die überzähligen Kinder der katholischen Gemeinde kümmern. Und sie nicht nur im Glauben unterweisen – was sie ja nichts kostet – sondern sich angeblich auch ganz allgemein um deren seelisches und leibliches Wohl verantwortlich fühlen.«
»Da begleite ich dich«, bot ihm sein Freund Hubert Aubriac an. »Nach Dienstschluss als Sekretär unserer beiden Chefs nehme ich mir gerne die Zeit, um dich zu unterstützen, mon Ami!«, betonte er.
Lavalle grinste. »Na, ja! Die frommen Damen sind nicht gerade als männermordende Vampire bekannt! Aber ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist! Vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei!«
Gegen Abend machten sich die beiden auf den Weg ins Marais-Viertel, um den frommen Frauen einen »rein freundschaftlichen Besuch« abzustatten. Lavalle war sicher, dass es klüger war, nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern es zu Anfang mit naiver Bewunderung für das »große soziale Engagement« des Klosters zu versuchen.
»Mal schauen, wie weit wir damit kommen, mon Cher!«Hubert war skeptisch. Er hielt nicht viel von Klosterfrauen; er hielt sie für verlogen, verdorben, verschlagen, mannstoll, geldgierig und für Gott weiß was noch …
Der Weg zum Kloster führte die beiden Freunde durch Straßen, die erst vor kurzem erneut Schauplatz schlimmster Unruhen des revoltierendes »Volkes« gewesen sein mussten. Überall waren noch die Spuren der Verwüstung erkennbar: rußgeschwärzte Häuserfassaden, eingeschlagene, nur notdürftig mit Brettern vernagelte Haustüren, schadhafte Hausdächer, eingeschlagene Fensterscheiben, deren Scherben teilweise immer noch das Pflaster bedeckten, zerschlissene Fahnen, die jetzt im Dreck lagen, zerrissene Fetzen von Kleidung und abgeholzte oder angekokelte Alleebäume.
An einer Straßenkreuzung versperrten auch noch die traurigen Überreste einer demolierten Kutsche den Fahrweg …
»Aha! Der Terror der Franzosen geht also wieder los! Wusstest du davon?«, erkundigte sich Aubriac.
Lavalle nickte. »Ja, leider! Die Ruhe auf den Straßen ist anscheinend vorbei, genauso wie die schlimmste Kälte des Winters. Jetzt kriechen die verdammten Krawallmacher wieder aus ihren Löchern und erwarten, dass die Polizei sie mit Samthandschuhen anfasst!
Übrigens ganz im Sinne unseres Königs, der für die Franzosen, seine ›lieben Kinder‹, großes Verständnis hat – so als handele es sich bei diesem Verbrecherpack um unartige kleine Hosenscheißer, denen man nur mit dem erhobenen Zeigefinger drohen müsste, um sie wieder dazu zu bringen, ganz liebe Kinderchen zu sein!«
Hubert Aubriac brach daraufhin in helles Gelächter aus. »Und das aus deinem Munde, mon Cher! Geht dir anscheinend unser lahmarschiger Ludwig auch allmählich gegen den Strich? Das will ja was heißen!«
Darauf wollte der Kommissar jetzt nicht weiter eingehen. Seine Haltung war gespalten. Einerseits empfand er durchaus Sympathien und Respekt für das Königshaus, andererseits konnte er sich auch eine vernünftige und gerechte Volksrepublik vorstellen …
»Wir sollten uns eine Art von Strategie überlegen, wie wir in dem Kloster auftreten wollen, Hubert!«, wechselte er das Thema. »Ich denke, mit ruhiger Gelassenheit und vor allem mit Höflichkeit werden wir bei den frommen Frauen am meisten erreichen!«
»Da hast du vermutlich recht! Gegen diese Weibsbilder haben wir ja noch nichts Konkretes in der Hand, womit wir sie festnageln könnten. Leider! Aber allzu freundlich sollten wir auch nicht sein, sonst denken die am Ende noch, sie könnten uns zum Narren halten! Ein bisschen Angst sollten wir ihnen schon einjagen!«
»Unser Problem ist ja bereits die passende Anrede der Äbtissin!« Lavalle verzog das Gesicht. »Ich habe mir überlegt, dass es am besten sein wird, wir sprechen diese Mater Maria Immaculata mit ›Madame‹ an. Das klingt nicht so unterwürfig wie ›Ehrwürdige Mutter‹ und andererseits nicht so trocken wie das heute übliche ›Bürgerin‹, womit wir auch eine Bettlerin titulieren würden. Was meinst du dazu?«
»Von mir aus! Du kennst ja meine Vorbehalte gegenüber allem, was irgendwie mit Kirche, Talaren oder Kutten zu tun hat. Wichtig ist vor allem, dass wir die Kinder zu sehen bekommen, die sie angeblich so großartig betreuen!«
Das sah Lavalle genauso.
»Ich würde mich auch gerne mit einigen von ihnen unterhalten – und zwar allein, ohne dass eine von den Klosterschwestern als Aufpasserin danebensitzt.«
Beide waren gespannt, wie der unangekündigte Besuch von den »Guten Hirtinnen« aufgenommen werden würde.
Die schon etwas ältere Schwester Pförtnerin schien unangenehm berührt, als gleich zwei Herren der Police de Commune de Paris freundlich, aber bestimmt, durch ein Fensterchen mit Sprechgitter in der geschlossenen Pforte, ihren Besuch bei der Äbtissin des Klosters ankündigten.
»Hat die Ehrwürdige Mutter Sie denn tatsächlich eingeladen, Messieurs?«, erkundigte sie sich schmallippig und zog dabei ungläubig dichte graue Augenbrauen in die Höhe. Ihre Stimme klang dabei etwas aufsässig und ihre Miene blieb abweisend, obwohl sie sich Mühe gab, ihre Abneigung gegen die beiden Männer zu verbergen.
›Als ob die Polizei eine Einladung bräuchte‹, lag Lavalle auf der Zunge, aber er vermied eine direkte Antwort, sondern forderte die Nonne ruhig auf, ihre Oberin umgehend darüber zu informieren, dass zwei Commissaires Supérieursde Police de Commune de Paris sie dringend, in einer sehr wichtigen Angelegenheit zu sprechen wünschten. Aubriac verbiss sich ein Grinsen, dass sein Freund ihn kurzerhand vom Sekretär zum Kriminaloberkommissar befördert hatte …
Nachdem sich die Schwester Pförtnerin, wenn auch sehr widerwillig, zu ihrer Oberin auf den Weg gemacht hatte – wobei sie die unerwünschten Besucher wie lästige Bittsteller vor dem geschlossenen Tor des Klosters stehen ließ – murmelte Armand:
»So ganz falsch ist das ja durchaus nicht, mein Lieber! Ehe unser damaliger oberster Chef, der Comte de Belfort, nachdem er dein diesbezügliches Talent erkannt hatte, dich in sein Vorzimmer versetzt hatte, bist du ein Commissaire gewesen, genau wie ich. Und inzwischen hätte man dich mit Sicherheit ebenso befördert wie mich. Was ich damit sagen will: Du verstehst dich auf Polizeiarbeit auch genauso gut wie ich! Deswegen bin ich auch sehr froh, dass du mich heute Abend begleitest.«
Ehe Hubert, der sich über Armands Worte ungeheuer freute, sich dazu äußern konnte, kehrte, um einiges schneller als erwartet, der mürrische Pforten-Zerberus zurück.
Welch’ ein Gegensatz in ihrem jetzigen Verhalten zu ihrem anfänglichen Gebaren! Ein breites Lächeln verzog nun ihr pausbackiges Gesicht und sie beeilte sich, die bis dato verschlossene Pforte weit aufzureißen und mit scheinheiliger Herzlichkeit die Herren von der Polizei willkommen zu heißen in ihren bescheidenen Mauern.
»Gott zum Gruße! Bitte treten Sie näher, Messieurs! Seien Sie versichert, dass unsere ehrwürdige Mutter Oberin, Mater Maria Immaculata, sich von Herzen freut, die Herren empfangen zu dürfen! Mein Name lautet übrigens Schwester Bonaventura und ich stehe selbstverständlich gleichfalls zu Ihren Diensten!«
Lavalle und Aubriac empfanden die Kehrtwende in der Behandlung, die man ihnen auf einmal angedeihen ließ, recht bemerkenswert, äußerten sich jedoch nicht dazu. Sie marschierten hinter der behäbigen, aber äußerst flink dahinschreitenden Nonne her.
So bescheiden und nichtssagend das Klostergebäude von außen erscheinen mochte, so bemerkenswert bot sich sein Inneres den Augen fremder Besucher dar. Sie durchschritten eine pompöse Wandelhalle, deren dicht aneinandergereihte spitzbogige Fenster den Blick auf einen sehr geräumigen und teilweise überdachten, sehr gepflegten Innenhof boten.
Die zahlreichen großen, zu dieser Jahreszeit allerdings leeren Pflanzkübel würden in den wärmeren Monaten, zusammen mit einer Reihe von marmornen Ruhebänken um einen runden Brunnen, einen bezaubernden und angenehm kühlen Aufenthaltsort bieten. Sogar ein paar Mandelbäumchen konnte Lavalle erkennen, sowie zwei Zitronenbäumchen und einen riesigen, knorrigen, alten Walnussbaum, der bei Hitze genügend Schatten böte …
An den Wänden des langen Ganges standen in kurzen Abständen lebensgroße Marmorfiguren, die vermutlich Heilige darstellten.
Zwischen den Skulpturen, die ein bedeutender Künstler geschaffen haben mochte, waren jeweils große bemalte antike Vasen aufgestellt, die jetzt im Winter allerdings nicht mit Blumen, sondern mit Tannenzweigen bestückt waren.
Bisher deutete nichts auf Kinder hin. Außer Schwester Bonaventura war auch keine der anderen Bewohnerinnen des Klosters zu sehen. Auf Lavalles Nachfrage erhielten sie die Auskunft, die Schwestern säßen um diese Zeit im Refektorium bei der abendlichen Mahlzeit.
»Aber unsere verehrte Mutter Oberin nimmt sich sehr gerne die Zeit, um die Herren von der städtischen Polizeibehörde in ihrem Salon zu empfangen!«
Sie bog um eine Ecke und wies auf eine große, mit feinen Schnitzereien versehene Eichenholztüre, die Szenen aus dem »Alten Testament« darstellten und die bereits einladend weit offenstand. Aus dem Augenwinkel heraus hatte der Kommissar noch einen raschen Blick auf Noah und seine Arche werfen können …
Nachdem sie die Schwelle überschritten hatten, sahen sich Lavalle und Aubriac einer großen, schlanken, gut aussehenden und noch ziemlich jugendlich erscheinenden Frau im schwarzen Habit, mit ausladender weißer Flügelhaube und weißem Spitzenkragen gegenüber.
Die Äbtissin schritt auf ihre Gäste mit ausgebreiteten Armen und einem Lächeln zu, als habe sie vor, die beiden gleich zu umarmen.
Das Ganze wirkte auf Lavalle geradezu grotesk; eher wie eine sorgfältig einstudierte Theaterrolle und dazu passte auch die schmeichlerische, gekünstelt wirkende Stimme, die sie aufs Herzlichste willkommen hieß.
Ein Außenstehender hätte vielleicht vermutet, es handele sich bei den Männern um lang ersehnte liebe Verwandte oder zumindest um gute Freunde …
»Nehmen Sie doch bitte Platz, Messieurs! Wie schön, dass Sie den weiten Weg vom Kommissariat bis zu unserem bescheidenen Heim der ›Guten Hirtinnen‹ auf sich genommen haben!«
Aubriac musste sich arg zusammenreißen, um keine sarkastische Bemerkung zu machen. Aber ein scharfer Blick seines Freundes, der das zu ahnen schien, ließ ihn davon Abstand nehmen. Beide Herren bedankten sich artig und wiesen sogleich das Angebot einer »Erfrischung« dankend zurück. Sie wollten nicht lange stören, behauptete Lavalle, und Madame nicht vom Abendessen im Kreise ihrer Mitschwestern fernhalten.
Mit einer kurzen Handbewegung hatte die Äbtissin, die an der allgemein gehaltenen Anrede keinerlei Anstoß zu nehmen schien, die Schwester Pförtnerin wieder an deren Arbeitsplatz an der Klosterpforte zurückgescheucht.
Auch Hubert Aubriac war aufgefallen, dass die Oberin bei der legeren Anrede »Madame« mit keiner Wimper gezuckt hatte. Aber er ließ sich davon nicht täuschen. Er schätzte sie im Gegenteil für höchst raffiniert und äußerst verschlagen ein. Sie auszufragen würde kein leichtes Unterfangen sein …
»Wir wollen es kurz machen, Madame«, begann Armand Lavalle, nachdem alle sich gesetzt hatten und die Herren Kommissare noch einmal auf das Angebot, sich etwas kredenzen zu lassen, verzichtet hatten.
Als Erstes bedankte sich Lavalle, dass man ihm und seinem Kollegen Aubriac den »Überfall« nicht krumm nähme, und lobte im gleichen Atemzug in den höchsten Tönen das Engagement der edlen Damen, Kindern aus prekären Verhältnissen so großzügig Aufnahme zu gewähren und ihnen ein Leben in Würde und Anstand zu ermöglichen.
»Die Eltern dieser armen Geschöpfe werden Sie vermutlich dafür preisen und sogar heiligsprechen, dass Sie ihnen die schwere Bürde, welche die kostspielige Aufzucht eines Kindes für Menschen in prekären Verhältnissen bedeuten mag, abgenommen haben!
Auch die Polizeibehörde von Paris dankt Ihnen ausdrücklich dafür, Madame! Ihnen und Ihren verehrten Mitschwestern natürlich! Möge es Ihnen einst der HERR vergelten, was Sie Gutes an diesen Menschenkindern getan haben, die sonst womöglich im Sumpf der Großstadt mit ihrem Potenzial an Sünde und Verbrechen versunken wären!«
Immer noch 31. Januar 1792
Aubriac fand, sein Freund habe der Äbtissin nun ›genug Honig ums Maul geschmiert‹, und dieser kam auch jetzt abrupt zur Sache.
»Warum wir eigentlich hier sind, ist die Nachfrage nach einem etwa sechsjährigen Knaben mit einem verkürzten Bein, namens Jeanot Meuron, Madame! Wir wissen, dass seine armen Eltern ihn vor etlichen Monaten, da die Mutter erneut Nachwuchs erwartet, Ihrem Kloster zur Erziehung übergeben haben.
Sie waren so gütig, Madame, dem Elternpaar ihre große Sorge gegen einen gewissen Obolus abzunehmen! Nun aber machen in der Nachbarschaft der Familie Meuron Gerüchte die Runde, die den Leuten einreden, der Junge befände sich überhaupt nicht in Ihrer Obhut! Die Eltern stehen sogar unter dem Verdacht, ihrem Kind etwas angetan zu haben, da Jeanot ihnen durch sein beschädigtes Bein zusätzliche Beschwernisse einbrächte. Die Bürger Meuron haben sich nun an die Polizei gewandt, damit diese Verdächtigungen ein Ende finden.
Ich persönlich habe mich bei der Familie dafür verbürgt, der Sache nachzugehen und mich selbst vom Zustand ihres Sohnes, der sich, wovon ich felsenfest überzeugt bin, bei ausgesprochen guter Gesundheit – abgesehen von seiner Körperbehinderung – seines Lebens erfreut.
Mein Kollege und ich bitten darum, uns jetzt persönlich davon überzeugen zu dürfen. Ein ganz kurzes Gespräch mit dem Kind genügt uns vollkommen. Dann werden wir Sie auch nicht mehr länger belästigen, Madame!«
Während seiner langen, kunstvoll gedrechselten Erklärung hatte Lavalle die Äbtissin genau beobachtet. Wie von ihm erwartet, hatte sie auch reagiert: völlig gelassen, kühl, distanziert und gleichzeitig Verständnis mimend.
Er spürte es überdeutlich: Aubriac hatte recht und auch seine Ahnung hatte ihn nicht getrogen! Diese Frau war raffiniert und verschlagen und hatte sich wahrscheinlich längst eine Strategie zurechtgelegt, die es ihr, falls es hart auf hart ginge, erlaubte, einem wie immer gearteten Schlamassel zu entkommen. An Mater Maria Immaculata würde keinesfalls ein Schmutzfleck zurückbleiben: Etwaige Schuld würde sie auf andere abwälzen und sich einfach unwissend und dazu dementsprechend betroffen zeigen.
»Das hört sich nicht gut an, Monsieur le Commissaire!«, hörte er die Oberin sagen. »Leider kenne ich mich in dieser Sache nicht besonders gut aus! Ich habe das Ganze zwar initiiert, aber die Einzelheiten müssen sie mit meiner Mitschwester, Schwester Philomena, besprechen.
Sie weiß über alle Vorgänge, die mit unseren aufgenommenen Kindern zusammenhängen, Bescheid. Ich kenne ja nicht einmal die Namen der Betroffenen. Schwester Philomena, unsere Bibliothekarin, ist ein wahres Organisationstalent und hat alles im Griff. Sie kümmert sich auch darum, dass unsere kleinen Zöglinge, sobald sichergestellt ist, dass sie gesund und wohlgenährt sind, sowie eine religiöse Erziehung und gewisse Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen besitzen, an wohlhabende Familien als Ziehsöhne und Ziehtöchter vermittelt werden.
Es handelt sich dabei selbstverständlich um ausgesucht anständige, gottesfürchtige und königstreue Familien«, fügte die Äbtissin mit scheinheilig frommer Miene hinzu. Aubriac und sogar Lavalle hatten Mühe, sich eine ironische Bemerkung zu verkneifen.
Sie betätigte eine kleine Tischglocke und alsbald tauchte eine junge Schwester auf, der die Oberin auftrug, besagte Schwester Philomena sogleich zu ihr zu schicken. Es sei dringend.
Armand Lavalle bedankte sich artig, aber äußerst knapp. Es wurde allmählich Zeit, dass er etwas schärfer auftrat. Dass die Person, die ihnen im Augenblick gegenübersaß, heuchlerisch versuchte, die Polizei der Stadt Paris zum Narren zu halten, war ihm nur allzu bewusst.
Die Nonne, die kurz darauf nach angedeutetem Anklopfen an der Tür auftauchte, war den beiden Freunden auf Anhieb äußerst unsympathisch. Nachdem sie sich vor ihrer Oberin respektvoll verneigt hatte, wandte sie sich den beiden Männern zu, die ihr als Oberkommissare der Pariser Ordnungsmacht vorgestellt worden waren; wobei ihr Blick, wie Armand Lavalle fand, ausgesprochen von oben herab wirkte.
»Was wünschen die Herren denn ausgerechnet von mir?«, fragte sie kurz und etwas schnippisch.
»Da wir von Ihrer Mutter Oberin wissen, dass Sie mit der Aufnahme, Betreuung und Weitergabe der Kinder aus armen Familien, verzweifelten alleinerziehenden Müttern oder Waisenkindern befasst sind, möchten wir umgehend ein paar Worte mit einem gewissen Jeanot Meuron wechseln, um uns persönlich davon zu überzeugen, dass es dem Knaben gut geht!«
»Warum?«, lautete die eiskalte Gegenfrage der Klosterfrau, einer stämmigen Frau mittleren Alters mit teigigem Gesicht.
»Es gibt Gerüchte …«, wollte Lavalle beginnen, aber Hubert Aubriac reichte es jetzt offensichtlich.
»Weil unserer Behörde zugetragen wurde, dass besagter Junge, ein Kind mit einem verkrüppelten Bein, bei Ihnen schlecht versorgt worden und tot unter einem Schneehaufen abgelegt worden sei, wo man ihn nach der kürzlich erfolgten Schneeschmelze gefunden hat. Dieser schrecklichen Angelegenheit gehen wir nun nach. Also bitte: Her mit dem Jungen und zwar zügig!«
Das hatte offenbar gesessen. Sowohl die Äbtissin wie ihre Mitschwester waren bei Aubriacs Worten unwillkürlich zusammengezuckt; beide Frauen waren blass geworden.
»Gewiss handelt es sich bei Ihren Informationen um einen bedauerlichen Irrtum!«, versuchte Maria Immaculata abzuwiegeln. Sie entschuldigte sich jedoch im gleichen Augenblick mit einer unaufschiebbaren Pflicht, die sie leider zu erledigen habe, und verließ nach kurzem Gruß ihren luxuriösen Arbeitsraum. Was sie damit ausdrücken wollte, war klar. Mit irgendwelchen Schwierigkeiten bezüglich der aufgenommenen Kinder hatte sie nichts zu schaffen. Das war allein Sache ihrer Mitschwester.
Jetzt waren Lavalle und Aubriac allein mit der abweisenden unfreundlichen Schwester Philomena.
Die hatte sich mittlerweile anscheinend gefasst und sah die zwei Kommissare ganz offen an, während sie ihnen dreist ins Gesicht log.
»Besagten Jeanot Meuron kenne ich natürlich sehr gut – wie alle unsere Zöglinge – und ich kann Ihnen versichern, meine Herren, dass dieser Junge nicht das Geringste mit dem von Ihnen erwähnten toten Kind gemein hat!
Der kleine Jeanot wurde von unserem Kloster bereits lange vor Weihnachten an eine äußerst ehrenwerte Familie übergeben, die es sich zur Aufgabe macht, genau wie wir, solche arme Wesen auch medizinisch gut zu versorgen, zu betreuen und ebenfalls für ihr späteres Fortkommen Sorge zu tragen.
Gerade dieser gebrechliche Knabe lag mir persönlich sehr am Herzen«, behauptete die Nonne, ohne rot zu werden. »Wie ich neulich erfahren habe, haben ihn seine Zieheltern nach Übersee, nämlich nach New York, mitgenommen, wo die Familie die nächsten Jahre zu leben gedenkt.«
Lavalle und Aubriac war klar, dass damit auf den Kleinen keinerlei Zugriff der Pariser Ordnungsmacht mehr möglich wäre. Dass die Klosterfrau ganz offensichtlich Lügen verbreitete, davon waren beide Freunde überzeugt.
»Im Übrigen beherbergt unser Haus im Augenblick überhaupt kein Kind. Alle sind bestens untergebracht. Ich sage Ihnen das, Messieurs, falls sie sich wundern sollten, dass man bei uns nichts hört, was gemeinhin auf die Anwesenheit von Kindern schließen lässt!«
So, das war es dann also.
Sie verabschiedeten sich auch kurz darauf – ohne sich für die »Mithilfe« der Nonne zu bedanken. Dazu bestand ja auch keinerlei Anlass.
Das Einzige, worauf Armand Lavalle noch zu pochen versucht hatte, war die Herausgabe des Namens dieser angeblich so vorbildlichen Familie, die den Jungen adoptiert hatte.
Aber auch damit war er gescheitert. Schwester Philomena behauptete, daran könne sie sich nicht mehr erinnern. Vielleicht könne den Herren ja der Hausmeister des Klosters, der Bürger Pierre Bavement, behilflich sein. Der übernehme in aller Regel die Abholung der Kinder von ihren Eltern, sowie die Übergabe an die neue Familie, die sich liebenswürdigerweise für eines der armen Würmchen entschieden habe. Er wäre auch für die Notierung der Namen und Daten der aufnehmenden Personen zuständig.
Leider befände er sich derzeit nicht im Kloster. Aus familiären Gründen habe er um Urlaub gebeten. Seine alte Mutter sei schwer krank und er als liebender Sohn müsse sich um sie kümmern. Die Mutter Oberin habe ihm das natürlich gestattet …
»Wir Schwestern hoffen alle, dass unser tüchtiger Monsieur Bavement bald zurückkehrt. Er ist sozusagen das Bindeglied zwischen uns zurückgezogen lebenden Klosterfrauen und der Welt da draußen!«
»Na, das war ja vielleicht ein Reinfall!«
Lavalle knirschte förmlich mit den Zähnen, als sie kurz danach auf der Straße standen. Sein Freund konnte sich vor unterdrückter Wut kaum beruhigen.
»Diese verfluchten Weibsbilder haben uns ganz schön auflaufen lassen! Besser hätte es für das verdammte Kloster doch gar nicht laufen können. Indem sie uns das Märchen von der Reise nach Amerika aufgetischt haben, sind diese ach so frommen Weiber aus dem Schneider!«
»Klar! Damit würde auch eine Durchsuchung des Klosters nichts bringen! Der Kleine ist so oder so nicht mehr da. Und der Name besagter angeblicher ›Zieheltern‹ würde uns wohl gar nichts nützen, weil die sich längst aus dem Staub gemacht haben werden – oder der Name ist schlichtweg falsch und alles ist eine einzige große Lügengeschichte!«
»Was man dem Kloster auch nicht anlasten könnte, denn dann würden die Schwestern behaupten, selbst getäuscht worden zu sein. Es ist zum Haareausraufen!«
Beide waren froh, dass der nächste Tag ein Sonntag war. So hatten sie Zeit, sich bis Montag früh zu überlegen, wie Lavalle die Schlappe seinem direkten Vorgesetzten, Émile Béguin, am besten beibringen sollte. An die anschließende Unterredung mit dem Commandant Général, immerhin dem obersten Beamten der Pariser Polizeibehörde, wollte er gar nicht erst denken. Er wusste genau, dass ihm dieser strikt untersagen würde, sich noch länger mit dieser Bagatelle zu befassen …
Er konnte ihn förmlich reden hören: »Kinder aus den Armenvierteln verschwinden doch ständig – und tauchen auch meistens wieder auf. In dem speziellen Fall des toten Knaben ist nicht einmal eine Vermisstenanzeige von den Eltern erfolgt. Also ist es auch nicht unsere Aufgabe, damit Zeit und Ressourcen zu vergeuden, die wir an anderer Stelle dringender benötigen! Was Sie über den Fall (so es denn überhaupt einer ist!) wissen oder zu wissen glauben, stammt doch nur vom Hörensagen!«
Lavalle würde natürlich versuchen, dagegenzuhalten. Inzwischen war die Identität des ermordeten Kindes sehr wohl bekannt – und es gab auch eine sehr vielversprechende Spur, die in ein Kloster in der Stadt führte. Aber der Kommissar war sich darüber im Klaren, dass das seinem obersten Vorgesetzten nicht genügen würde.
»Alles nur Mutmaßungen, keinerlei Beweise!«, würde er ihm um die Ohren hauen – womit er leider recht hätte.
2. Februar 1792
Als der Kommissar sich am darauffolgenden Montag bei seinem direkten Vorgesetzten zum Rapport melden wollte, fing ihn sein Freund Hubert bereits im Flur vor dem betreffenden Amtszimmer ab.
»Béguin ist heute nicht da! Das heißt, er war zwar hier, ist aber schon wieder weg, da er unsere ›Hochherrlichkeit‹ zu einer Audienz bei unserem geliebten König begleiten musste.«
Nach dem gescheiterten Fluchtversuch der königlichen Familie am 21. Juni 1791, tat man so, als wäre alles beim Alten geblieben – obwohl Ludwig XVI. natürlich unter strenger Beobachtung stand …
Alle zwei, drei Monate war dieser Besuch bei Seiner Majestät fällig, wobei sich König Ludwig beim Polizeichef von Paris in gewohnt leutseliger Manier nach den wichtigsten Kriminalfällen erkundigte, die sich derzeit in der Hauptstadt ereigneten und was die Ordnungsmacht dagegen unternehme.
In aller Regel unterzog sich Guy Laroche dieser Pflichtübung alleine. Warum er dieses Mal Émile Béguin hatte dabeihaben wollen, darüber ließ sich nur spekulieren.
Ehe Lavalle sich anschicken konnte, aufzuatmen, dass der Kelch an ihm vorübergegangen war, holte ihn sein Freund gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Ehe du glaubst, mon Ami, in aller Seelenruhe weitermachen zu können mit den Ermittlungen im Fall der verschwundenen Kinder, muss ich dich enttäuschen! Auf deinem Schreibtisch liegt ein vom Chef eigenhändig verfasster Wisch, dass du dich ab heute wieder anderen, wichtigeren Dingen, zuwenden musst!«
»Aha! Und was ist wichtiger als verschacherte Kinder? Gott weiß, was mit denen passiert! Wer garantiert denn, dass diese sogenannten ›Zieheltern‹ wirklich nur das Wohl dieser armen Teufel im Sinn haben? Was, wenn es sich dabei um pure Ausbeutung, um Sklavenhaltung handelt? Oder vielleicht fallen sie gar Perversen zum Opfer, die auf diese Weise ganz einfach an ihre ›Lustobjekte‹ kommen?«
»Niemand garantiert das, Armand!«, bestätigte ihm Hubert. »Aber man muss ja auch nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen, n’est-ce pas? Es hat sich jedenfalls ein Mordfall ereignet, der gewaltigen Staub aufwirbeln wird, in den sogenannten ›besseren Kreisen‹!
Wie mir Béguin kurz vor seinem Abmarsch in die Tuilerien berichtet hat, hat selbst der Bürgermeister von Paris sein dringendstes Interesse daran bekundet, dass der Täter so schnell wie möglich aufgespürt und seiner gerechten Strafe zugeführt wird!
Angeblich handelt es sich bei dem Ermordeten nämlich um den Sohn des Bruders seines Schwiegervaters – oder so ähnlich … Und Maire Silvain Bailly liegt eine Menge daran, dass das Verbrechen an diesem Mitglied seiner Familie baldmöglichst aufgeklärt und gesühnt wird.
Also, geh nur in dein Büro und lies dir die nötigen, bis dato bekannten Erkenntnisse über den Fall durch! Die Tat scheint sich in der Nacht von Samstag auf den gestrigen Sonntag ereignet zu haben. Viel Spaß beim Ermitteln!«
Lavalle zog ein langes Gesicht und sein Freund tröstete ihn: »Falls ich dir in irgendeiner Weise helfen kann, sag mir Bescheid!«
Die bisherigen Erkenntnisse über den Toten und das Verbrechen, dem er zum Opfer gefallen war, waren nicht sonderlich hilfreich; vor allem wies nichts weder auf ein Motiv, noch auf einen Täter hin.
Arbeiter hatten die übel zugerichtete Leiche eines etwa vierzigjährigen Mannes in einer elenden, längst baufälligen Bruchbude gefunden, die abgerissen werden sollte, damit der Eigentümer das Grundstück in der Rue des Écoles zum Wiederverkauf anbieten konnte. Man befand sich im Quartier Latin, einem durchaus, hauptsächlich von Intellektuellen, gefragten Wohnviertel.
Der Verdacht lag nahe, war zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, der Hausbesitzer selbst hätte sein veraltetes und abgewohntes Eigentum absichtlich verrotten lassen und kürzlich noch zusätzlich versucht, es in Brand zu stecken.
Der junge Handwerker, der als erster auf den nackten und verstümmelten Körper gestoßen war, hatte dem Vernehmen nach einen regelrechten Schock erlitten.
Nachdem Lavalle persönlich die Leiche in der Salpêtrière in Augenschein genommen hatte, verstand er auch, warum.
Beim Täter musste es sich, in Anbetracht seines ebenfalls sehr muskulösen und wehrhaft wirkenden, getöteten Gegners, um einen sehr kräftigen Kerl gehandelt haben, der sich offenbar in einen regelrechten Mordrausch hineingesteigert hatte. Die Art der Verletzungen ließ auf ein gerütteltes Maß an Sadismus schließen, zumindest aber auf ungeheure und maßlose Wut.