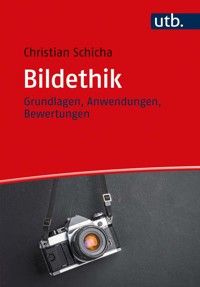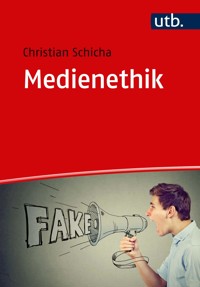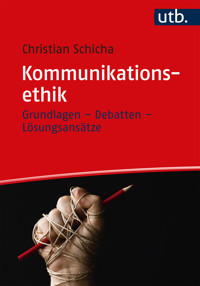
28,99 €
Mehr erfahren.
In den Grundlagen dieses Bandes werden Kommunikationsmodelle skizziert sowie ethische Anforderungen an Kommunikationsprozesse wie Öffentlichkeit, Demokratie, Freiheit und Wahrheit aufgezeigt. Es folgen Hinweise auf Normverletzungen in Form von Propaganda, Populismus, Desinformation und Antisemitismus. Im Abschnitt über Kontroversen geht es um die Reflexion von Meinungsverschiedenheiten u.a. anhand der Debatten über Cancel Culture und kulturelle Aneignung. Zudem werden Debattenräume in Form von Talkshows und Boulevardformaten thematisiert, in denen diese Kontroversen diskutiert werden. Im letzten Teil werden Wege zu einer konstruktiven Debattenkultur aufgezeigt und Initiativen vorgestellt, die darüber berichten und Menschen unterstützen, die durch menschenfeindliche Handlungen betroffen sind. Das Buch richtet sich an Studierende der Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie der Sozialwissenschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 6469
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Dr. Christian Schicha ist Professor für Medienethik am Institut für Theater- und Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Christian Schicha
Kommunikationsethik
Grundlagen – Debatten – Lösungsansätze
Umschlagabbildung: © simarik · iStockphoto
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564692
© UVK Verlag 2025
‒ Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6469
ISBN 978-3-8252-6469-7 (Print)
ISBN 978-3-8385-6469-2 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-6469-7 (ePub)
Inhalt
1Einleitung
1.1Aktuelle Publikationen und Studien
1.2Zum Aufbau des Bandes
IGrundlagen
2Kommunikationsethik
2.1Kommunikation
2.2Ethik
3Normen
3.1Demokratie
3.2Kommunikationsfreiheit
3.3Öffentlichkeit
3.4Argumentationsfähigkeit
3.5Wahrheit
3.6Streitkultur
3.7Misstrauen
3.8Widerspruch
3.9Haltung
3.10Authentizität
3.11Respekt
3.12Sensibilität
4Normverletzungen
4.1Sexismus
4.2Ableismus
4.3Antiziganismus
4.4Rassismus
4.5Klassismus
4.6Digitale Gewalt
4.7Täuschende Sprachverwendung
4.8Hassrede
4.9Scheinargumentation
4.10Stereotypisierung
4.11Inszenierung
4.12Desinformation
4.13Propaganda
4.14Populismus
4.15Antisemitismus
4.16Verschwörungserzählung
4.17Zensur
IIKontroversen
5Meinungsverschiedenheiten
5.1Wokeness
5.2Cancel Culture
5.3Kulturelle Aneignung
5.4Gendern
5.5Satire
IIIDebattenräume
6Talkshows
6.1Typen
6.2Sendungen
6.3Skandale
6.4Kritik
6.5Podcast-Formate
7Bildzeitung
7.1Merkmale
7.2Studien
7.3Kritik
IVLösungsansätze
8Wege zu einer konstruktiven Debattenkultur
9Initiativen
Anhang
Kommentierte Auswahlbibliografie
Kommentierte Filmauswahl
Verwendete Literatur
Weiterführende Literatur
Abbildungsverzeichnis
Zum Autor
1Einleitung
„Algorithmisch geformte Filterblasen erzeugen einseitige Diskussionsforen und fördern die Segmentierung von gesellschaftlichen Milieus und politischen Denkhorizonten. Phänomene wie Trolle, Shitstorms, strategische Manipulation und Hassbotschaften können die Kultur einer demokratischen Meinungsbildung unterlaufen. Polarisierung, Diffamierungen, Anfeindungen, Verleumdungen und Entgleisungen von Minderheiten prägen zusätzlich den öffentlichen Diskurs. Auch Politiker:innen nutzen eigene Social-Media-Accounts, um politische Gegner zu diskreditieren. Die von Habermas formulierten Geltungsansprüche auf Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit scheinen an Relevanz zu verlieren, gut begründete und vernünftige wissenschaftliche Erkenntnisse werden in Frage gestellt. Viele akzeptieren Kirchen, Medien und Politik, die lange Zeit maßgeblich Orientierung geboten haben, nicht mehr als Autoritäten.“ (Gürtler/Prinzing/Zeilinger 2022, S. 12)
Dieses Zitat fasst die Problematik zusammen, die aktuell vor allem digitale Kommunikationsformen umfasst. Zu den Aufregerthemen gehören u.a. Diskussionen über eine inklusive Sprache, Cancel Culture, Zensurmaßnahmen und kulturelle Aneignungen, die auch in diesem Band erörtert werden. Kontroversen entstehen weiterhin im Zusammenhang um die Aufrüstung, ein Tempolimit beim Autofahren, bei Argumenten für oder gegen eine vegetarische oder vegane Ernährung, über den Umgang mit Geflüchteten oder hinsichtlich einer nachhaltigen und bezahlbaren Energieversorgung. Debatten werden über flugschamloses Reiseverhalten ebenso geführt wie über fair gehandelte Produkte, den Umgang mit Straßennamen und Denkmälern politisch belasteter Persönlichkeiten und das richtige Impfverhalten (vgl. Neuhäuser/Seidel 2022). Während der Corona-Pandemie fanden sich sogenannte Querdenker:innen1 zum Protest zusammen. Auf Demonstrationen trafen sich u.a. Impfgegner:innen, Esoteriker:innen, Reichsbürger:innen, AfD-Anhänger:innen und Verschwörungserzähler:innen, um gegen die politischen Gesundheitsmaßnahmen des Staates zu demonstrieren. Rechtsextreme Agitator:innen nutzen die Ängste der Bürger:innen, um gegen staatliche Maßnahmen zu protestieren. Auch Hass und Aufruhr prägten die aufgeheizte Atmosphäre, in der auch Gewaltaufrufe artikuliert worden sind (vgl. Benz 2022). An Universitäten werden Vorträge abgesagt und Wissenschaftler:innen ausgeladen, weil sie angeblich eine problematische politische Haltung vertreten. Aus angeblichen Sicherheitsbedenken können sie nicht sprechen, weil sie zu pro-israelisch seien. Andere Hochschullehrer:innen dürfen nicht sprechen, weil sie vermeintlich zu israelkritisch sind. Diese Entwicklung wird von Ronen Steinke (2025, S. 41) kritisiert:
„Ein freier Austausch, eine offene Debatte in einem Forum: für diese Tageslichtkultur ist die Pressefreiheit erfunden worden. Ebenso wie die Wissenschafts- und die Kunstfreiheit. Eine Zeitung hat im Idealfall keine Meinung. Sie hat Meinungen. Eine Uni genauso. Was man hier sucht, suchen sollte, um daran zu wachsen, ist die Konfrontation, die Reibung. Und sei sie nur, um zu begreifen, wie Menschen zu ihrer Gegenmeinung kommen.“
Derartige Entwicklungen sorgen für ein belastendes Klima, das sich von den Regeln eines angemessenen Diskurses auf der Basis von rationaler Argumentation verabschiedet hat. Emotionalisierung, Ideologisierung und Moralisierung prägen den konfrontativen Austausch zulasten einer lösungsorientierten Entscheidungsfindung (vgl. Mennillo 2024). Derartige Diskussionsräume und kommunikative Konflikte sowie konstruktive Modelle und Initiationen werden in diesem Buch aus einer kommunikationsethischen Perspektive vorgestellt und reflektiert.
1.1Aktuelle Publikationen und Studien
In einer pluralisierten und differenzierten Gesellschaft mit der Auflösung traditioneller Bindungen an Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Vereine sind Orientierungen abhanden gekommen. Weder die Tradition noch die Religion oder Politik liefern allgemein akzeptierte Vorgaben hinsichtlich konkreter Wertvorstellungen und Lebensstile. Die dadurch gewonnene Mündigkeit und Freiheit hinsichtlich eigener Entscheidungsspielräume sind zwar gestiegen. Die gesellschaftlichen Probleme, Konfliktlagen und daraus resultierenden Sorgen und Ängste von Bürger:innen sind aber gleichermaßen vorhanden.
„Die Liste der angehäuften Krisenindikatoren aus den vergangenen Jahren ist lang: die Corona-Pandemie und ihre Folgen für das Gesundheits- wie Bildungssystem, damit einhergehend hohe soziale Belastungen, auch die neue Einsamkeit, die viele Menschen erlebt haben und noch immer erleben. Dazu gehören ferner Teuerungen und die Inflation, der Klimawandel mit den Klimaprotesten (hauptsächlich, aber nicht nur) junger Menschen. Schließlich: Rechtsextremer Terror, rechtsextreme Agitation, […] Aktionen des Rechtsextremismus, Hasstaten, eine wachsende Zahl von Reichsbürgern, menschenverachtender Rechtspopulismus und Angriffe auf die Demokratie durch sogenannte ‚Querdenker‘ dürfen als Krisenindikatoren genannt werden. Und angeführt wird die Krisenliste aktuell durch den Krieg Russlands in der Ukraine. Er geht in Deutschland mit Protesten und überraschenden Allianzen zwischen Rechten und Linken, Menschen der Mitte sowie neuen ‚besorgten Bürgern‘ einher.“ (Zick 2023, S. 19)
Diese Einschätzung in der von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie Die distanzierte Mitte, die rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland von 2022 bis 2023 untersucht hat, fasst zentrale Krisenphänomene zusammen.
Beim Blick in die Bücher von Philosoph:innen, Soziolog:innen, Internetexpert:innen und Kommunikationswissenschaftler:innen entsteht der Eindruck, dass viele Bürger:innen ebenfalls das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen verloren haben. Ihnen wird nicht mehr zugetraut, Probleme zu lösen. Neben einer Parteien-, Politik- und Politiker:innenverdrossenheit zweifeln viele an der Glaubwürdigkeit der Justiz, der Wissenschaft, der Kirchen und den Medien (vgl. Lessenich 2019). Aufgrund des Klimawandels, sich verändernden Arbeitswelten durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und dem Zerfall von demokratischen Ordnungen verschwinden Gewissheiten und Orientierungen, die zu Verlusterfahrungen und Verlustängsten führen können (vgl. Reckwitz 2024).
Zudem werden Konfliktlinien identifiziert, die angeblich für eine Spaltung der Gesellschaft stehen. Diese und weitere Aspekte werden in folgenden Büchern aufgegriffen:
Philipp Hübl weist in seiner Monografie Moralspektakel. Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht, darauf hin, dass Krisen und Kriege Herausforderungen für die Gesellschaft sind und eine Verständigung erforderlich ist, wie damit umzugehen ist. Es geht dabei zentral auch um normative Aspekte.
„In solchen Diskussionen in Talkshows, Zeitungen, Radiosendungen, in den sozialen Medien und dem Privatleben geht es nicht nur um Fakten, sondern vor allem um Moral im weitesten Sinne: um unsere Werte und Normen, um das, was wir für richtig oder falsch halten, und um die Frage, was wir tun sollten, um eine gerechte Gesellschaft und Weltordnung zu erschaffen und dann ein erfülltes Leben zu führen.“ (Hübl 2024, S. 9)
Das Spektrum der Themen und die Qualität des Diskussionsniveaus sind vielfältig. Es wird debattiert, ob rassistische Begriffe in Büchern gelöscht werden sollten, ob Menschen mit bestimmten politischen Auffassungen nicht mehr öffentlich auftreten dürfen und Verdachtsfälle krimineller Handlungen bereits ausreichen, um Personen mit einem Arbeitsverbot zu versehen. Derartige Debatten können zum Spektakel geraten, wenn es nicht darum geht, Probleme zu lösen und Missstände zu beseitigen oder gar für Gerechtigkeit zu sorgen. Dann geht es beim sogenannten Moralspektakel nicht um die Sache, sondern um die Selbstdarstellung. Der Status und die Gruppenzugehörigkeit werden dabei eingesetzt, um Macht und Einfluss auszuüben und andere zu diskreditieren (vgl. Hübl 2024).
Die große Gereiztheit. Wege aus einer kollektiven Erregung ist der Titel der Monografie von Bernhard Pörksen (2018). Er konstatiert eine Verschlechterung des Kommunikationsklimas und einen Wandel von einer Mediendemokratie zu einer Empörungsdemokratie. Die Wahrheitskrise erzeugt ihm zufolge Angst vor dem postfaktischen Zeitalter. Pörksen sieht neben den klassischen drei Gewalten der Exekutive, der Judikative und der Legislative, die für eine Demokratie konstituiered sind, zunächst die vierte Gewalt des traditionellen Journalismus, der die Mächtigen kontrollieren sollte. Im Internetzeitalter hat sich eine weitere Gewalt herausgebildet.
„Diese fünfte Gewalt der vernetzten Vielen ist schön und hässlich, sensibel und grausam; manchmal agiert sie äußerst brutal und manchmal zeigt sie sich auf eine berührende Weise moralisch engagiert. Sie initiiert Kampagnen und schafft Gegenöffentlichkeiten. Sie orientiert sich nicht an einer einzigen Ideologie, sie hat kein verbindendes Großthema, wohl aber gemeinsam genutzte Plattformen und Instrumente sozialer Netzwerke, Wikis, Websites, Smartphones, leistungsstarke Computer, eben das gesamte Spektrum digitaler Medien.“ (Pörksen 2018, S. 83f.)
Durch die digitalen Veränderungen ist die klassische Gatekeeping-Funktion der traditionellen Medien mit auf eine redaktionelle Gesellschaft übergegangen. Publizität und Meinungsartikulation findet nun auch durch die Bürger:innen in der Zivilgesellschaft statt, sofern sie sich z.B. über soziale Netzwerke an öffentlichen Debatten beteiligen. Daraus ergeben sich auch neue Herausforderungen aus einer normativen Perspektive. Die Maximen einer redaktionellen Gesellschaft
„müssen lediglich aus ihrer allzu engen Bindung an eine einzige Profession gelöst und als Elemente einer allgemeinen Kommunikationsethik vorstellbar gemacht werden. Sie dienen dann nicht mehr nur der Orientierung von Journalistinnen und Journalisten, sondern einem größeren, übergeordneten Ziel: sie sollen es der Gesellschaft erlauben, sich auf eine möglichst direkte, schonungslose und wahrheitsorientierte Art und Weise selber zu beschreiben, ihre vielschichtigen und verstreuten Interessen zu sortieren und auszudrücken und auch ohnmächtigen und marginalisierten Stimmen Sichtbarkeit verschaffen, deren Einsichten und Ansichten sonst öffentlich nicht verfügbar wären. In diesem Sinne sind sie für eine lebendige Demokratie unverzichtbar.“ (Pörksen 2018, S. 190)
Richard David Precht und Harald Welzer kritisieren (2022) in ihrem Buch Die vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist Teile der Berichterstattung in den Leitmedien. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie bei Krisen und Konflikten eine eher einheitliche Sichtweise vermitteln, die wenig Spielraum für alternative Positionen zulässt. Es wird daraufhingewiesen, dass Menschen in Umfragen angeben, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei äußern könnten. Die Autoren konstatieren:
„Für die Demokratie ist es gefährlich, Pluralismus zu verhindern, Meinungen zu monopolisieren und Einwände zu diskreditieren. Nicht nur schießen politische Journalisten weit über ihre Aufgabe und Legitimation hinaus, sie unterspülen damit auch […] das Vertrauen in die Leitmedien. Ungezügelter Aktivismus durch die amtierenden Massenmedien ist nicht nur Treibmittel für ihren eigenen mittelfristigen Untergang. Er ist auch die Erosion einer funktionierenden Öffentlichkeit in Deutschland. Und ohne diese bröckelt […] die Demokratie.“ (Precht/Welzer 2022, S. 37f.)
Teilen der Berichterstatter:innen wird vorgeworfen, Polarisierung und Diffamierung zu betreiben sowie konträre Meinungen auszublenden, die von Minderheiten artikuliert werden. Exemplarisch wird in diesem Zusammenhang auf gleichlautende Meldungen über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verwiesen:
„Wenn, wie beim Ukrainekrieg, sogar sämtliche Leitmedien die gleiche weltanschaulich-ethische Haltung einnehmen […] geschieht eine kollektive Pluralitätsverengung. Gegenteilige Überzeugungen finden nur noch als abständige Randpositionen ihren Platz, wenn überhaupt. Und Appelle an die Geschlossenheit der Bevölkerung widersprechen zutiefst dem Integrationsauftrag. Denn Integration im liberalen Staat bedeutet nicht Anpassung und auf Linie bringen, sondern im Gegenteil: die Aufnahme des Widerspruchs in das Gesamtbild.“ (Precht/Welzer 2022, S. 65f.)
Nun stellt sich die Frage, ob die skizzierten Einschätzungen und Befürchtungen begründet sind. Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser (2023, S. 7) vertreten in ihrem Buch Triggerpunkte, das Konsense und Konflikte in der Gegenwartsgesellschaft analysiert, aus einer soziologischen Perspektive folgende Auffassung:
„Spaltungsdiagnosen sind in den letzten Jahren zu einem Masternarrativ geworden, mit dem sich die Gesellschaft ihren Wandel erklärt. Mit Besorgnis registriert man soziale und politische Fliehkräfte, die das Zentrum in entgegengesetzte Richtungen zerren, hin zu den wachsenden Rändern. Wo man sich früher einig war oder Differenzen sachlich austrug und friedlich weiterlebte, so die Wahrnehmung, herrschen heute nur noch Streit und Hysterie, Rechthaberei und Abgrenzung. Der allgemeine Begriff der Polarisierung wird zur Chiffre einer Erosion des Zusammenhalts und einer Bedrohung der Demokratie.“
Beim Blick auf aktuelle Studien kommen die Autoren jedoch zu der Erkenntnis, dass sich derartige Entwicklungen empirisch nicht belegen lassen. Es sei weder eine Lagerbindung zu beobachten noch eine zunehmende Polarisierung oder gar Spaltung der Gesellschaft. Sie räumen aber ein, dass Konflikte gesellschaftlich hergestellt werden können, indem sie angeheizt werden. Dabei spielen politische und mediale Dynamiken eine zentrale Rolle. Sofern Kontroversen und Auseinandersetzungen in der Berichterstattung auftauchen, werden sie auf die öffentliche Debatte übertragen.
„Ob und wie wir die Gesellschaft als konfliktreich erleben, hat auch damit zu tun, wie Meinungsverschiedenheiten aufbereitet und kommuniziert werden. Themen, Konjunkturen, Mobilisierungsressourcen und neue Deutungshorizonte können einen Streit ‚groß‘ machen.“ (Mau/Lux/Westheuser 2023, S. 23)
Insgesamt spielen sich den Autoren zufolge die meisten Auseinandersetzungen nicht zwischen zwei unversöhnlichen Lagern mit unvereinbaren Zielvorstellungen ab. Konflikte sind nicht automatisch desintegrativ. Sie können den Zusammenhalt einer Gesellschaft stärken, sofern von beiden Seiten eine Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, um Kompromisse auszuhandeln. Gleichwohl gibt es bestimmte Themen, die zu Aufregung und destruktivem Streit führen können, wenn sie einen sogenannten Triggereffekt besitzen.
„Trigger sind Sollbruchstellen der Debatte, an denen sich Empörung und Widerspruch, aber auch empathische Zustimmung artikuliert und die durch eine besondere Emotionalität gezeichnet sind. Sie finden sich vor allem dort, wo ungerechte Ungleichbehandlungen als Bruch des Gleichheitsgebotes wahrgenommen werden, wo bestimmte Erwartungen von ‚Normalität‘ herausgefordert oder unterlaufen werden, wo Menschen Entgrenzung und Kontrollverlust fürchten und wo sie politische Maßnahmen als übergriffige Zumutungen empfinden.“ (Mau/Lux/ Westheuser 2023, S. 387f)
Gleichwohl können Befriedungsmöglichkeiten gefunden werden. Die Voraussetzung hierfür liegt darin, dass die Konfliktparteien bereit sind, sich zu verständigen, indem sie konträre Positionen respektieren und auf der Basis begründeter Argumente agieren, um sich wechselseitig zu überzeugen.
Sascha Lobo (2023) gibt seinem Band den Titel Die große Vertrauenskrise. Nach der Corona-Pandemie ist die Welt durch Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten dem Autor zufolge instabiler geworden. Die Klimakrise bedroht die Existenz der Menschheit. Angesichts dieser Entwicklungen ist es nicht überraschend, dass die Ängste der Menschen gestiegen sind. Populistische Parteien agitieren provokativ, statt zu argumentieren. Sie versprechen einfache Lösungen bei komplexen Problemen und erhalten hohe Zustimmungswerte, obwohl sie keine konstruktive Politik betreiben. Insofern ist es wichtig, Behauptungen gründlich zu prüfen sowie seriöse Belege und Quellen zu suchen. Gerüchte, Meinungen, Gefühle und Argumente sind bei der Bewertung von Aussagen zu trennen, um eine angemessene Orientierung und Vertrauen generieren zu können. Lobo fordert Eigeninitiative und eine positive Einstellung:
„Denn trotz des Anspruchs, eine harte und ungeschönte Analyse der Gegenwart zu liefern, ist mir aktive Zuversicht mindestens ebenso wichtig. Es gibt viel mehr als die etwas passiv daherkommende Hoffnung.“ (Lobo 2023, S. 15)
Der Autor plädiert dafür, dass die Bürger:innen selbst engagiert an einer positiven Gestaltung der Zukunft mitwirken, um die Vertrauenskrise zu bekämpfen. Kritische Reflexion sowie konstruktives Handeln werden neben der Berücksichtigung von relevanten Normen und Werten dabei als notwendige Voraussetzungen angesehen, um Probleme bewältigen zu können.
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey (2022) beschäftigen sich in ihrem Buch Gekränkte Freiheit mit Aspekten des libertären Autoritarismus. Sie identifizieren verschiedene Typen wie Corona-Kritiker:innen, die mit Blumenketten demonstrieren, Künstler:innen, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen und Journalist:innen, die sich gegen angebliche Sprachverbote aussprechen. Diese Gruppen treten in einer komplexen Welt mit Krisen und Bedrohungen lautstark für individuelle Freiheiten ohne gesellschaftliche Zwänge ein. In diesen Gemeinschaften finden sich demokratiefeindliche Tendenzen, die zur Unterstützung populistischer Parteien führen können.
„Oft handelt es sich bei den entsprechenden Personen um Menschen, die sich selbst als aufgeklärt und liberal beschreiben und die nicht selten über eine umfassende Bildung verfügen. Ihre Sorge gilt nicht autoritären Populisten, weder Donald Trump noch Wladimir Putin und auch nicht den rechtspopulistischen Parteien wie der AfD. Sie wähnen sich eingeschnürt von einer Vielzahl von Regeln, Vorschriften und Verboten.“ (Amlinger/Nachtwey 2022, S. 9f.)
Im Rahmen der Analyse der Soziolog:innen sind 45 Interviews mit Personen aus der Querdenker-Szene sowie zivilgesellschaftlich aktiven AfD-Anhänger:innen geführt worden. Es wurden Demonstrationen beobachtet und Telegram-Kanäle analysiert. Weiterhin wurde eine Online-Umfrage mit 1150 Querdenker:innen durchgeführt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass zwar faktisch eine Reihe von gesellschaftlichen Freiheiten und Formen der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen inzwischen in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft umgesetzt worden sind. Gleichwohl nehmen viele Menschen ein Gefühl der Ohnmacht wahr, das als gekränkte Freiheit klassifiziert wird.
„Ob sie gegen eine imaginäre Diktatur auf die Straße gehen, ob sie ihren Hang zum Verschwörungsdenken ausleben oder ihre Ressentiments gegen Minderheiten, immer sind sie es, die die Zumutung der Spätmoderne durchschaut haben, ihre Energie erschöpft sich praktisch nie, sie sehen sich als Freiheitskämpfer:innen oder als Avantgarde eines neuen Grundsatzkonfliktes.“ (Amlinger/Nachtwey 2022, S. 15)
Eine Unterwürfigkeit ist dieser Gruppe der libertären Autoritären fremd. Sie rebellieren gegen staatliche Autoritäten und gegen jede Form der Einschränkung individueller Freiheiten. Dabei verfolgen sie ihre Interessen ohne die Bereitschaft zum Dialog: „Für diese libertären Autoritären kann es keine räsonierende Aushandlung geben, schließlich folgen die anderen stets finsteren Absichten und geheimen Plänen.“ (Amlinger/Nachtwey 2022, S. 17). Ein Teil dieser Gruppe folgt sogenannten Verschwörungstheorien. Es gibt Verbindungen zu Rechtspopulist:innen und Rechtsextremen, die fremdenfeindliche Positionen vertreten.
„Ihre Neigung zum Extremen, Exzessiven, Subversiven ist in jüngster Vergangenheit in ein destruktives Fahrwasser geraten. Sie wettern gegen Geflüchtete, Muslim:innen oder Jüd:innen und steigern sich bisweilen in Gewaltfantasien hinein. Die meisten haben in ihrem Leben existenzielle Brüche oder Krisen erfahren, für die sie ein korrumpiertes System verantwortlich machen, das sie in ihren Freiheiten einschränkt und ‚Fremde‘ bevorteilt.“ (Amlinger/Nachtwey 2022, S. 24f.)
Die klassischen Medien wie die ARD-Tagesschau oder überregionale Tageszeitungen stehen für die libertären Autoritären unter dem Generalverdacht einer verzerrten Berichterstattung, vor allem über die AfD und in migrationspolitischen Fragen.
„Statt am Diskurs als kritische Stimme zu partizipieren, verweigern sie ihn und wenden sich einer alternativen Öffentlichkeit zu: sie sind in sozialen Medien aktiv oder schauen YouTube-Videos. Ähnlich wie bei den Querdenker:innen spielt bei den Rebellen die Berufung auf Gegenwissen und klandestine Wissensbestände eine zentrale Rolle.“ (Amlinger/Nachtwey 2022, S. 329)
Es werden vermeintliche Geheimnisse auf Seiten der Eliten vermutet, die der Bevölkerung angeblich vorenthalten werden. Darüber hinaus werden der Staat und wissenschaftliche Expert:innen als Autoritäten weniger akzeptiert. Die Demokratie als Staatsform wird teilweise infrage gestellt. Der Glaube an Gerüchte, „Fake News“ und die eigene Gefühlslage prägt die Haltung der libertären Autoritaristen:innen.
Amlinger und Nachtwey fordern, dass die Politik auf diese Entwicklungen reagiert, indem den Bürger:innen Entscheidungen erläutert werden, statt Sachzwänge zu behaupten. Zudem könnte Selbstreflexion und Selbstkritik einen konstruktiven Beitrag dazu leisten, dass die Verständigung sich auf beiden Seiten verbessert. Bürger:innen sollten frühzeitig in Planungen und alternative Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden, wenn politische, soziale und ökonomische Gestaltungsprozesse anstehen. Dafür ist aber eine wechselseitige Anerkennung erforderlich, die dann Freiheiten zur Entfaltung bringen kann.
1.2Zum Aufbau des Bandes
I Grundlagen
In dem zweiten Kapitel zur Kommunikationsethik werden als Rahmung zunächst allgemeine Kommunikationsmodelle aus verschiedenen Fachperspektiven vorgestellt und eingeordnet.
Das Spektrum reicht von psychologischen Ansätzen bei Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson (1971) sowie Carl Rogers (1991) über soziologische Positionierungen bei George Herbert Mead (1991) bis hin zu philosophischen Konzeptionen von Paul Grice (1989) und Jürgen Habermas (1985), die normative Implikationen in ihre Konzeptionen mit einbeziehen.
Im Anschluss daran werden grundlegende Ansprüche und Probleme in Bezug auf die digitale Kommunikation erörtert.
Es folgen grundlegende Anmerkungen und Hinweise zur Aufgabe und zum Spektrum der angewandten Ethik.
Kapitel 3 setzt sich mit Normen auseinander, die aus einer kommunikationsethischen Perspektive relevant sind. Dabei wird auf das Konzept einer freiheitlich demokratischen Grundordnung vom Typ der Bundesrepublik Deutschland hingewiesen, die die Voraussetzung für eine funktionierende Debattenkultur darstellt. Die Demokratie bildet die Basis, in der die verfassungsrechtlich verankerten Kommunikationsfreiheiten im Grundgesetz verankert worden sind. Darüber hinaus können sich freie und unabhängige Kommunikationsprozesse nur in funktionierenden Öffentlichkeiten herausbilden. Unter diesen Rahmenbedingungen können Diskurse entwickelt werden, die auf der Basis gut begründeter Argumente mit dem Ziel einer Verständigung vonstatten gehen. Die Orientierung an der Wahrheit ist dabei eine notwendige Voraussetzung.
Streit, Misstrauen und Widerspruch sind nicht automatisch kontraproduktiv, sofern die Debatten auf der Basis eines wechselseitigen Respektes vollzogen werden. Ob dafür eine Haltung erforderlich ist, wird diskutiert.
Weiterhin wird reflektiert, inwiefern Authentizität ein normatives Leitbild sein kann und warum Sensibilität für kommunikationsethische Austauschprozesse unverzichtbar ist.
Im vierten Kapitel werden Normverletzungen problematisiert, um das Problemfeld darzulegen, das kommunikationsethischen Maximen widerspricht. Dabei geht es um Faktoren einer grundlegenden Menschenfeindlichkeit, die vom Sexismus über den Ableismus bis hin zum Rassismus und Klassizismus reichen kann. Es werden Formen digitaler Gewalt problematisiert. Darunter fallen menschenverachtende Handlungen, die u.a. unter den Überschriften Doxing, Happy Slapping und Cybermobbing klassifiziert werden. Es schließen sich Ausführungen zur täuschenden Sprachverwendung an, die sowohl Beschönigungen als auch Verharmlosungen reflektieren.
Daran anknüpfend geht es um den Themenkomplex der sogenannten Hassrede, bei der gewalttätige Sprechakte, Minderheitenbeschimpfungen und diskriminierende Botschaften angeführt werden, bevor die Differenz zwischen dem Gebrauch und dem Erwähnen problematischer Begriffe dargelegt wird.
Es folgen Hinweise auf Formen und Ausprägungen sogenannter Scheinargumentationen. Weiterhin wird auf die Problematik der Stereotypisierung hingewiesen, bevor der aus der Theaterwissenschaft stammende Begriff der Inszenierung behandelt und bewertet wird. Hierbei wird erörtert, ob z.B. politische Inszenierungen aus einer normativen Perspektive problematisch sein können.
Das sich anschließende Teilkapitel widmet sich der Desinformation. Dabei werden verschiedene Ausprägungen von der Lüge über die Postfaktizität bis hin zu den „Fake News“ problematisiert. Es folgen Ausführungen zur Propaganda, zum Populismus, zum Antisemitismus und zu Verschwörungserzählungen, die als demokratiefeindlich klassifiziert werden können. Anmerkungen zur Zensur in der Kunst am Beispiel von Filmen und Büchern runden dieses Kapitel ab.
II Kontroversen
Im fünften Kapitel werden kontroverse Auseinandersetzungen erörtert. Es wird reflektiert, über welche Themen, auf welchen Ebenen und mit welchen Inhalten Debatten um die sogenannte Wokeness (Wachheit) geführt werden. Die eine Position vertritt einerseits die Auffassung, dass es erforderlich ist, Minderheiten besonders intensiv zu schützen, um Unterdrückung und Diskriminierung zu verhindern. Konträre Haltungen sehen andererseits in diesem Aufruf eine unbegründete Überempfindlichkeit, die mit Denk- und Sprachverboten einhergeht.
Beim Themenkomplex Cancel Culture wird diskutiert, ob es moralisch angemessen sein kann, bestimmten Personen oder Gruppen öffentliche Auftritte und Publikationsmöglichkeiten zu verbieten, sofern sie menschenfeindliche Auffassungen artikulieren oder verdächtigt werden, Straftaten begangen zu haben. Dabei wird auf die juristische Relevanz der Unschuldsvermutung ebenso hingewiesen wie auf die Bedeutung der grundgesetzlich geschützten Kunst- und Meinungsfreiheit.
Es wird weiterhin erörtert, ob es Formen und Ausprägungen einer kulturellen Aneignung gibt, die verboten oder eingeschränkt werden sollten. Dabei reicht das Spektrum von äußerlichen Merkmalen in Form von Frisuren bis hin zu bestimmten Musikstilen, die über eine lange kulturelle Tradition verfügen und z.T. übernommen worden sind.
Die Debatte um das sogenannte Gendern stellt ein weiteres Thema dar, das kontrovers diskutiert. Es werden Argumente für und gegen den Gebrauch einer geschlechtersensiblen Sprache benannt und eingeordnet.
Abschließend werden die Aufgaben und Grenzen der Satire aufgegriffen und analysiert. Dabei geht es auch darum, welche Beiträge problematisch sein können und welche Kriterien hierfür ausschlaggebend sind.
III Debattenräume
Im sechsten Kapitel werden ausgewählte Diskursräume in der Medienberichterstattung problematisiert. Es werden Formen und Beispiele von Typen deutscher Fernseh-Talkshows sowie weiterer Gesprächsformate über Politik und Unterhaltung vorgestellt. Dabei wird diskutiert, welche Möglichkeiten und Probleme sich im Rahmen dieser Sendungen ergeben, wo Skandale aufgetreten sind und welche Kritikpunkte und normative Ansprüche an die Formate aus einer kommunikationsethischen Perspektive gerichtet werden.
Kapitel 7 setzt sich mit dem Boulevardblatt Bild auseinander. Die Zeitung gehört zu den umstrittensten Formaten der Presselandschaft in Deutschland. Um eine Beurteilung vornehmen zu können, werden Merkmale, Inhalte, Kritikpunkte sowie vorliegende Studien mit Verweis auf konkrete Beispiele zur Berichterstattung der Zeitung eingeordnet und reflektiert.
IV Lösungsansätze
Das achte Kapitel diskutiert Wege für eine konstruktive Diskurskultur. Es werden kommunikationsethische Herausforderungen skizziert, die auch das Recht betreffen und Maßnahmen des Fakten-Checks bei der Prüfung von Medieninhalten aufgezeigt.
Kapitel 9 stellt ausgewählte Initiativen vor, bei denen Hilfe für Menschen angeboten wird, die durch menschenfeindliche Angriffe betroffen sind. Dabei wird u.a. auf Maßnahmen der Politik, der Berichterstattung und der Zivilgesellschaft sowie der Bildung und Wissenschaft eingegangen. Zudem werden Impulse von Verlagen vorgestellt, die sich für eine aufklärende Diskurskultur einsetzen.
Abschließende Empfehlungen erfolgen durch Hinweise auf eine kommentierte Auswahlbibliografie und Filmauswahl zu kommunikationsethischen Themenfeldern, bevor Angaben zum Autor gemacht werden.
Zielgruppe
Der Band richtet sich u.a. an Studierende und Lehrende der Medien- und Kommunikationswissenschaft, Journalistik, Politikwissenschaft, Medienpsychologie, Medienpädagogik, Soziologie, Philosophie und Kulturwissenschaft. Dabei werden Inhalte vermittelt, die auch für Journalist:innen relevant sein können, um die Reflexion und Sensibilität im Umgang mit kontroversen Debatten im Rahmen der Berichterstattung zu fördern.
Danksagung
Nachdem ich 2019 in der utb-Reihe bereits die Monografien Medienethik Grundlagen – Anwendungen – Ressourcen sowie 2021 die Publikation Bildethik. Grundlagen – Anwendungen – Bewertungen veröffentlichen durfte, möchte ich mich bei Dr. Jürgen Schechler vom UVK-Verlag für die gewohnt gute Zusammenarbeit bei dem vorliegenden Band bedanken.
Wertvolle inhaltliche Anregungen zum Manuskript habe ich von Madlen Geidel (M.A.), Prof. Dr. Florian Höhne, Prof. Dr. Olga Moskatova, Prof. Dr. Thomas Zeilinger und Prof. Dr. Oliver Zöllner erhalten.
Ich bedanke mich auch bei meinen Kolleg:innen PD Dr. Sven Grampp, Prof. Dr. Florian Mundhenke, Prof. Dr. Lars Nowak und Dr. Nicole Wiedenmann vom Institut für Theater- und Medienwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg für ihre konstruktive Kritik an dem Text.
Mein besonderer Dank für die Korrekturen und Unterstützung gilt meiner lieben Frau Lisa Glagow-Schicha.
Erlangen, im April 2025
Christian Schicha
1 In diesem Band sind Pluralformen mit dem Doppelpunkt (Leser:innen) gewählt worden. Es wäre auch möglich gewesen, immer beide Geschlechter auszuschreiben (Leserinnen und Leser), die im Duden erwähnte Variante mit dem Gendersternchen zu nehmen (Leser*innen), den Unterstrich (Leser_innen), einen Punkt (Leser.innen) oder eine Lücke (Leser innen) oder das Binnen-I zu verwenden. Es hätte im Text auch ein Wechsel zwischen der männlichen und weiblichen Form vorgenommen werden können. Die gegenderten und nicht gegenderten Zitate aus anderen Quellen sind unverändert übernommen worden.
IGrundlagen
2Kommunikationsethik
„Kommunikationsethik (ist, C.S.) diejenige Ethik […], die sich mit moralischen Phänomenen der humanen Kommunikation befasst. Der ethisch zu reflektierende Bereich, nämlich ‚Kommunikation‘, umfasst alle Formen des Kommunikationshandels, vor allem in Form von bild- und verbalsprachlichen Äußerungen und bewertet deren Ziele, Wirkungen und Umstände. Ferner beschreibt Kommunikationsethik Tugenden und Haltungen, die sich im Kommunikationshandeln zeigen, wie Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit, und beschreibt schließlich Voraussetzungen für gelingende Kommunikation, zum Beispiel Sprachkompetenz, Achtung des Kommunikationspartners oder Fähigkeit zur Selbstkritik.“ (Wunden 2006, S. 128)
Im Gegensatz zu den normativen Leitlinien einer Kommunikationsethik in dem Zitat von Wolfgang Wunden beobachten Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun (2021) in öffentlichen Debatten eine große Gereiztheit sowie Hass und Wut, die das Kommunikationsklima ruinieren können. Aufgrund der Gefährdung der Kommunikationskultur fordern die Autoren dem Titel ihres Buches zufolge Die Kunst des öffentlichen Miteinander-Redens. Es geht darum, auf unterschiedlichen Ebenen konstruktiv zu diskutieren, um folgende Entwicklungen zu vermeiden:
„Mal unterstellt man einer einzelnen skrupellosen Person (z.B. Donald Trump), mal einem einzelnen polarisierungsanfälligen Medium (z.B. dem Netz), mal einem einzelnen spektakelaffinen Genre oder Format (z.B. der Talkshow) die Kraft der Diskurszerstörung und kritisiert und attackiert entsprechend heftig.“ (Pörksen/Schulz von Thun 2021, S. 10)
Um eine umfassende Analyse und Bewertung des Diskursklimas vornehmen zu können, müssen Personen, Medienangebote und spezifische Genres in einem übergreifenden gesellschaftlichen und politischen Rahmen analysiert werden. Es geht hierbei um ein Wechselspiel zwischen dem Verhalten der Individuen und Gruppen unter den spezifischen Bedingungen in konkreten Situationen bei Beachtung der entsprechenden Rahmenbedingungen, in denen Debatten geführt werden.
Öffentliche Kommunikation ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Recht, das sich erst mit der Aufklärung durchgesetzt hat. Sie sollte frei von öffentlichen Zwängen sein und die Möglichkeit umfassen, sich ohne Störungen artikulieren zu können und dabei auf die Vernunft und Argumentation zu setzen, statt einem traditionellen Regelwerk aus Gehorsam und Glauben folgen zu müssen. Nur durch diesen Fortschritt können Kommunikationsprozesse in den verschiedenen Teilöffentlichkeiten ohne Zwang auf der Basis diskursiver Verfahren vonstatten gehen (vgl. Klaus 2017). Dabei sollten hierbei weder politische Willkür noch religiöser Fundamentalismus eine Rolle spielen (vgl. Hartmann 2008).
Grundsätzlich vertritt die Kommunikationsethik als Teilbereich der angewandten Ethik den Anspruch auf Allgemeingültigkeit (Universalisierung). Politische oder religiöse Autoritäten sind dabei kein Maßstab für die Beurteilung ethischer Begründungen. Dafür gibt es gute Gründe:
„In allen Bereichen gibt es jedoch auch falsche Autoritäten, die Fähigkeiten oder Befugnisse vorgaukeln, die sie tatsächlich nicht haben. Im politischen Bereich spricht man dann von einem ‚Demagogen‘, im Alltag von einem ‚Blender‘ und in moralischen Kontexten von einem ‚Scharlatan‘. […] Insgesamt sind Autoritätsargumente jedoch eher mit Vorsicht zu genießen, weil aus der Tatsache, dass sich eine Person oder Instanz als Autorität behauptet, noch lange nicht folgt, dass man ihr tatsächlich alles glauben sollte oder dass man gar tun sollte, was sie sagt.“ (Raters 2020, S. 112f.)
Vielmehr geht es darum, auf der Basis fundierter Argumente und Begründungen Regeln zu entwickeln, die das zwischenmenschliche Zusammenleben positiv verändern. Dabei sind eine Reihe von Normen und Werten erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Es geht u.a. um die Beachtung der Menschenwürde und des Persönlichkeitsschutzes unter Einschluss der informationellen Selbstbestimmung im Verständnis einer digitalen Souveränität sowie einer Orientierung an der Wahrheit (vgl. Geier/Rosengrün 2023).
Kommunikationsethische Debatten sollten besonnen und präzise geführt werden sowie reflektiert und selbstkritisch vonstatten gehen. Begründete Zweifel und Widersprüche sollten in allen Phasen der Diskurse zugelassen werden (vgl. Brosda/Schicha 2010, Horster 2013, Schicha 2019a, Menasse 2023, Frenzel 2024).
In der Kommunikationsethik geht es primär um strittige Fragen, die im Rahmen kontroverser Diskurse thematisiert werden. Dabei werden Verantwortungshorizonte diskutiert und Kriterien erarbeitet, die Orientierung bieten sollen (vgl. Schicha 2022e, Kirchschläger 2024).
Verantwortung dient der Selbstverpflichtung und wird mit Sensibilität und Engagement in Verbindung gebracht. Es gibt zugeschriebene und übernommene Verantwortung, die mit der jeweiligen Zuständigkeit verbunden wird (vgl. Funiok 2024). Dennoch gibt es Grenzen der Verantwortung.
„Prinzipiell sind Menschen dann verantwortlich, wenn wir sie als Urheber von folgenreichen Handlungen auffassen. Jedoch konstituiert nicht jede Urheberschaft eine Verantwortlichkeit. Wir kennen zahlreiche Fälle, in denen wir wohl sehen, dass Menschen etwas tun, es uns aber nicht in den Sinn käme, diese für die Folgen ihrer Taten zur Verantwortung zu ziehen – etwa bei Unmündigen, Unzurechnungsfähigen und Beeinträchtigten, bei Handlungen, die einem Zufall entspringen, bei Notlagen oder Unglücksfällen.“ (Liessmann 2023b, S. 13f.)
In der Regel ist es aber möglich, Individuen, Gruppen oder Organisationen für bestimmte Handlungen oder Unterlassungen zur Verantwortung zu ziehen, sofern es eine klare Urheberschaft gibt, die entsprechend zugeordnet werden kann (vgl. Schicha 2011b).
2.1Kommunikation
„Im allgemeinen Verständnis geht es bei der Kommunikation um eine Mitteilung, eine Verbindung oder einen Austausch über Sprache, Texte oder Bilder. Es geht dabei um Informationen, Inhalte, Botschaften, Gedanken, Gefühle, Bedeutungen oder Aussagen […].“ (Beck 2007, S. 15)
Kommunikation verfügt in seiner fach- und alltagssprachlichen Begrifflichkeit über zahlreiche Bedeutungen. Obwohl Kommunikation und Interaktion gelegentlich synonym verwendet werden, ist eine Differenzierung erforderlich. Kommunikation bezieht sich eher auf Verständigung, während die Interaktion sich primär auf den Charakter und Handlungsablauf sozialer Beziehungen ausrichtet. Dabei handelt es sich in beiden Fällen um wechselseitige Austauschprozesse (vgl. Pürer 2003).
Das Wort Communicatio besitzt eine lateinische Herkunft und umfasst Bedeutungen, die mit Begriffen wie „Mitteilung, Gewährung, Verbindung, Austausch, Verkehr, Umgang, Gemeinschaft“ (Baecker 2005, S. 7) assoziiert werden.
Ursprünglich wurde Kommunikation als Prozess der Zeichenübertragung angesehen. Eine Botschaft wird von einem Sender über einen Kanal auf einen Sender übertragen. Hierbei wird ein technischer Vorgang unabhängig vom Inhalt beschrieben. Dieser Ansatz enthält keine normativen Implikationen, sondern konzentriert sich auf technische Vorgänge. Unter Kommunikation kann hierbei nahezu jeder beliebige Austausch von Daten und Mitteilungen verstanden werden (vgl. Merten 1999, Burkhart/Hömberg 2007).
Kommunikation zwischen Menschen findet auf unterschiedlichen Kanälen statt. Das Spektrum reicht von der unmittelbaren persönlichen Kommunikation zwischen zwei Personen bis hin zu globalen Austauschprozessen großer Gruppen auf sozialen Netzwerken (vgl. Beck 2007). Es handelt sich bei der Kommunikation um einen flüchtigen Vorgang, der abhängig von den technischen Möglichkeiten dauerhaft gespeichert werden kann. So kann davon ausgegangen werden, dass die Inhalte, die ins Internet gestellt werden, permanent verfügbar und abrufbar sind. Gelöschte Inhalte können wieder eingestellt werden.
Kommunikation kann als ein verhältnismäßiges Ereignis klassifiziert werden. Es handelt sich um eine Relationalität, die im Idealfall einen symmetrischen Austausch von Informationen zwischen mindestens zwei Menschen erlaubt (vgl. Faßler 1997). Dabei geht es um eine reflexive, auf Gegenseitigkeit beruhende Wahrnehmung, die im Rahmen des Kommunikationsverlaufs spezifische Erwartungen generiert.
Kommunikation, die über Sprache, Bilder oder Texte erzeugt wird, verfügt über eine Sach- und Sozialdimension. Es geht um Inhalte und Themen sowie um die Beziehung der Diskutant:innen. Die Qualität dieser Beziehungen ist wichtig in Bezug auf das Vertrauensverhältnis und die Glaubwürdigkeit der beteiligen Protagonist:innen (vgl. Schmidt/Zurstiege 2007).
Kommunikation kann zwischen zwei oder mehreren Personen als flüchtige Begegnung oder als spontane oder geplante Versammlung vonstatten gehen. Sie kann verbal oder nonverbal in Erscheinung treten und tritt in öffentlichen, privaten und intimen Situationen in Erscheinung. Haarkötter (2024) spricht in seiner Publikation Küssen in diesem Kontext von einer berührenden Kommunikationsform, die als öffentliches Begrüßungsritual ebenso erfolgen kann wie in einer intimen Paarbeziehung. Das Küssen kann die liebevolle Verbindung zwischen zwei Menschen kennzeichnen, aber auch als Unterwerfungsgeste fungieren, wenn z.B. der Ring eines kirchlichen Würdenträgers geküsst wird.
Wer kommuniziert, teilt anderen etwas mit. Insofern handelt es sich um ein Verhalten, das zugleich eine zwischenmenschliche Partizipation impliziert und unterschiedlichen Zielen folgen kann. „Manche wollen sich nur informieren, andere wollen zusätzlich am eigenen Interesse orientierte Wissensbestände aufbauen und pflegen, so wie andere sich informieren und überzeugen möchten.“ (Winter 2010, S. 90)
Wenn Menschen miteinander kommunizieren, handelt es sich um eine Gemeinschaftsbildung, die im optimalen Fall Verständigung herstellt.
Kommunikation kann weiterhin als Auseinandersetzung agieren. Dann geht es um unterschiedliche Auffassungen bis hin zum Streit. So können Konflikte in der Partnerschaft, im Beruf, in der Politik, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft auftreten. Wechselseitige Vorwürfe prägen dann zwischenmenschliche Auseinandersetzungen bis hin zur aggressiven Boshaftigkeit (vgl. Schmidt/Zurstiege 2000).
In derartigen Fällen wird eine gewaltfreie Kommunikation als Möglichkeit angesehen, um Konflikte zu lösen. Die Grundlage hierfür besteht aber zunächst darin, die Bedürfnisse des Gegenübers zu erkennen und ihm mit Respekt, Wertschätzung und Empathie zu begegnen. Es sollte der Versuch unternommen werden, die andere Person zu verstehen, indem ihre Perspektive übernommen wird. Dies schließt aber nicht aus, dass eine respektvolle Konfrontation mit der Position des anderen vorgenommen wird. Der Kommunikationsabbruch sollte vermieden werden. Eine persönliche Ächtung und Hetze sind untersagt. Das Ziel der Debatte sollte darin liegen, über das Verstehen eine Verständigung zu erzielen. Als Basis für einen konstruktiven Dialog sollte ein prinzipielles Einverständnis zumindest als regulative Idee vorhanden sein. Dabei ist es legitim, die Position der oder des anderen zu kritisieren, ohne ihn oder sie als Person abzuwerten (vgl. Rosenberg 2007, Pörksen 2025). Die Einflussfaktoren derartiger Kommunikationsprozesse hängen von der jeweiligen Umgebung ab. Neben den spezifischen Merkmalen der Situation in Form des Gesprächsanlasses und möglichen weiteren Teilnehmer:innen geht es auch um Persönlichkeitseigenschaften, Kompetenzen und Befindlichkeiten (vgl. Röhner/Schütz 2012). Hierzu ist eine Reihe von Ansätzen entwickelt worden, die nachfolgend skizziert werden.
Konzepte
„Die Kommunikationsethik gründet auf der Informations- und Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) und dem damit verbundenen Wertekatalog hinsichtlich Öffentlichkeit, demokratischer Willensbildung und individueller Selbstverwirklichung. Weitere wichtige Aspekte dieses Grundrechts, die mit dem Aufkommen des Internets ins Zentrum rücken, sind freie Informationsbeschaffung, Zugangsfreiheit und das Recht zu kommunizieren.“ (Thomaß u.a. 2024a, S. 233)
Im Artikel 19 der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 wird in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darauf verwiesen, dass jede Person in die Lage versetzt werden sollte, über Medien jeder Art ohne Rücksicht auf irgendwelche Grenzen Informationen suchen sollte, die dann empfangen und verbreitet werden dürfen. Neben diesen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen gibt es eine Reihe von wissenschaftlichen Ansätzen und Modellen, die Kommunikationsprozesse beschreiben und bewerten. Psychologische Konzepte richten den Blick auf zwischenmenschliche Kommunikationsprozesse. Dabei wird davon ausgegangen, dass jedes Verhalten Kommunikation bedeutet.
„Wenn man also akzeptiert, dass alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situationen Mitteilungscharakter hat, das heißt Kommunikation ist, so folgt daraus, dass man, wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren kann. Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben alle einen Mitteilungscharakter: sie beeinflussen andere, und diese anderen können ihrerseits nicht nicht auf diese Kommunikation reagieren und kommunizieren damit selbst.“ (Watzlawick/Beavin/Jackson 1971, S. 51)
Dieser verhaltenspsychologische Ansatz fasst Kommunikation sehr weit (vgl. Burkhart 2002). Um zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe angemessen beurteilen zu können, ist es zentral, sich auf intentional angelegte Mitteilungsprozesse zu konzentrieren. Des Weiteren sind die Kontexte zu berücksichtigen, in denen Kommunikationsprozesse vonstatten gehen (vgl. Stöber 2008). Wichtig ist weiterhin die Einsicht, dass der Beziehungsaspekt wichtiger ist als der Inhaltsaspekt. Zwischenmenschlicher Austausch kann nur dann angemessen funktionieren, wenn wechselseitiges Vertrauen und Erfahrungssicherheit dazu beitragen, dass eine konstruktive Kommunikationskultur entstehen kann (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1971).
Friedemann Schulz von Thun (2000) differenziert bei der Beschreibung und Beurteilung von Kommunikationsverläufen in seinem Kommunikationsmodell zwischen vier unterschiedlichen Perspektiven:
Eine Nachricht enthält Sachinformationen, die die sendende Person an die Empfänger:innen vermitteln möchte.
Darüber hinaus gibt es eine Selbstoffenbarung, bei der neben der Selbstdarstellung eine Selbstenthüllung persönlicher Eigenschaften preisgegeben wird.
Die Beziehungsaussage richtet sich auf das Verhältnis zwischen dem Sendenden und dem Empfangenden.
Der Appell kann eine Handlungsaufforderung für den Rezipierenden beinhalten, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen.
Als Bild lässt sich dieses Modell wie folgt darstellen:
Abbildung 1: Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun
Dabei sind diese vier verschiedenen Perspektiven bei der Bewertung von Kommunikationsprozessen voneinander zu trennen.
Soziologische Ansätze des symbolischen Interaktionismus wie bei George Herbert Mead (1991) gehen davon aus, dass zwischenmenschliche Kommunikation eng mit der Reflexionsfähigkeit gegenüber den Bedürfnissen und Wissensbeständen anderer Menschen verbunden sind. Es kommt zentral auf die Kategorie der Rollenübernahme (role taking) an. Sie ist gegeben, wenn die Sprecher:innen sich in die Lage der Hörer:innen hineinversetzen können. Nur dann kann eine angemessene Form des Austausches erfolgen. Schließlich ist es zentral, dass die gemachte Aussage auch verstanden wird. Dabei sind Empathie und Sensibilität gegenüber anderen Menschen eine notwendige Voraussetzung, um ein Verständnis für die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Gegenübers entwickeln zu können.
Die Maximen der Kommunikation nach Paul Grice (1989) stellen ein normatives Konzept dar, das einem Kommunikationsideal folgt, das auf der Basis gemeinsamer Interessen basiert und den Maximen der Quantität, Qualität, Relevanz und Klarheit folgt. So sollen Informationen vermittelt und ausschließlich wahre Informationen dargelegt werden. Es sollen diesem Idealtyp zufolge nur relevante Aussagen gemacht werden. Auf unklare, vage und mehrdeutige Ausdrücke sollte der Modellvorstellung zufolge verzichtet werden.
Carl Rogers (1991) hat Regeln für eine gelingende Kommunikation entwickelt, die für die klientenzentrierte Gesprächsführung und -therapie entwickelt worden sind, sich aber auch auf andere soziale Beziehungsformen übertragen lassen. Diese Basismerkmale werden als einfühlendes Verstehen (Empathie), Echtheit (Kongruenz) und emotionale positive Wertschätzung klassifiziert. Dabei kommt es ebenfalls darauf an, die Perspektive anderer zu übernehmen.
Einer der bedeutendsten Vertreter der Diskursethik ist der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas. Seine normativen Leitlinien für Kommunikationsverfahren umfassen:
die Verständlichkeit der Äußerungen,
die Glaubwürdigkeit der Aussagen,
den wechselseitigen Respekt (Verbot der Beleidigung und Degradierung),
die Wahl rationaler und begründeter Argumentationsverfahren sowie
die Ausschöpfung aller Argumente, um Entscheidungen zu legitimieren (vgl. Habermas 1984).
Habermas nimmt eine Unterscheidung zwischen einer verständigungsorientierten und einer strategischen Kommunikation vor. Während die verständigungsorientierte Kommunikation als normatives Leitbild auf der Basis gemeinsamer Überzeugungen ein rational motiviertes Einverständnis erreichen sollte, kann die strategische Kommunikation mit Drohungen, Täuschungen, und Manipulationen arbeiten. Das Ziel der Debatte liegt in einer Kommunikations- und Verständigungsfähigkeit, die als kommunikative Kompetenz klassifiziert wird. Als Ergebnis sollte eine zwanglos erzielte Einigung auf der Basis konsensstiftender Argumente erreicht werden.
„In Diskursen suchen wir ein problematisiertes Einverständnis, das im kommunikativen Handeln bestanden hat, durch Begründung wiederherzustellen: in diesem Sinne spreche ich fortan von diskursiver Verständigung.“ (Habermas 1971b, S. 115)
Beim Blick auf die regulative Idee einer vernunftbasierten Kommunikation in Diskursen gilt ideal typischerweise: „Die Logik der Argumentation erfordert einen begrifflichen Rahmen, der dem Phänomen des eigentümlich zwanglosen Zwangs des besseren Arguments Rechnung zu tragen erlaubt.“ (Habermas 1985, S. 52f.). Im Diskurs erfolgt die Begründung problematisierter Geltungsansprüche von Meinungen und Normen.
„Um sinnvoll miteinander sprechen zu können, so seine (Habermas, C.S.) weitreichende Erkenntnis, müssen wir wie kontrafaktisch auch immer, davon ausgehen, dass Verständigung – und alles das, was mit ihr zusammenhängt, nämlich Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit – mit sprachlichen Mitteln prinzipiell erklärt werden kann. Wir müssen, zumindest, wenn wir aus unseren alltäglichen Interaktionen in eine klärende Argumentation eintreten, so tun, als hätten wir es mit ebenbürtigen, ernsthaften, vernünftigen […] Gesprächspartnern zu tun, die ihre Positionen und Präferenzen jederzeit begründen können und ebenso bereit sind, auf unsere Gründe zu hören.“ (Felsch 2024, S. 70)
Dieser sogenannte herrschaftsfreie Diskurs proklamiert eine ideale Sprechsituation als regulative Idee. In der Praxis geht es hingegen um Kompromisse und Mehrheitsentscheidungen, wobei die Machtverhältnisse zentral dazu beitragen können, welche Ergebnisse erzielt werden. Druck und Gewalt können dabei eine Rolle spielen. Grundsätzlich verfolgt das diskursethische Konzept des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas keine normativen Theoriekonzeptionen, die sich an Pflichten wie bei Immanuel Kant (Deontologie), den Gerechtigkeitsidealen von John Rawls (Gerechtigkeitsethik) oder den Nutzenidealen bei John Stuart Mill (Utilitarismus) orientieren. Es gibt nur die Regel, sich an gut begründete Argumente mit fundierten Begründungen innerhalb von Debatten zu halten, um einen Konsens oder Kompromiss unter Einbeziehung der Positionen aller Betroffenen oder deren Stellvertreter:innen zu erreichen (vgl. Schicha 2019a).
Nachdem bislang ausgewählte Kommunikationsmodelle skizziert worden sind, die sich zunächst an direkte zwischenmenschliche Austauschprozesse bei persönlichen Begegnungen gerichtet haben, geht es im Folgenden um Formen und Ausprägungen einer internetbasierten Kommunikation und den daraus resultierenden kommunikationsethischen Implikationen.
Online-Kommunikation
„Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können, ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Rasse, Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft. Wir erschaffen eine Welt, in der jeder einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen.“ (Barlow 1995, S. 138)
Diese Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace postuliert eine aktive kommunikative Beteiligung im Internet mit utopischen Hoffnungen auf eine Demokratisierung des öffentlichen Diskurses in hierarchiefreien Räumen mit direkten Partizipationsmöglichkeiten. „Die Hoffnung war, dass im Internet das rationale, herrschaftsemanzipierte Ressentiment gefördert und die Demokratie gestärkt würde.“ (Eisenegger/Udris 2019, S. 75). Diese Euphorie hinsichtlich der Neustrukturierung digitaler Öffentlichkeiten hat sich aufgrund der Entwicklungen und Ausprägungen in digitalen Diskursräumen jedoch nicht bestätigt.
„Schlagworte wie Filterblasen, Echokammern und Fake News dominieren mittlerweile die Debatten über den Einfluss von Intermediären. Die Bandbreite der Kritik reicht von der Verrohung des öffentlichen Diskurses über die Begünstigung des Aufstiegs populistischer Parteien bis hin zur unmittelbaren Bedrohung für die liberale Demokratie.“ (Gahntz u.a. 2021, S. 6)
Dabei wurde die ethisch-normative Debatte in Bezug auf die digitale Kommunikation in den Kommunikations- und Medienwissenschaften primär durch das Aufkommen der sozialen Medien in Gang gesetzt. Die Krise des Journalismus steht hier die Emanzipation des Publikums gegenüber, das sich aktiv an öffentlichen Debatten über digitale Kanäle beteiligt. Der Berichterstattung wird darüber hinaus von neuen Anbieter:innen bestimmt, die ein primär kommerzielles Interesse verfolgen (vgl. Thomaß u.a. 2024a). Als Intermediäre werden Suchmaschinen, soziale Netzwerke und Instant-Messaging-Dienste klassifiziert, die online als wesentliche Elemente des Kommunikations- und Informationsverhaltens in Erscheinung treten. Sie fungieren als Intermediäre, da sie den Rezipient:innen die Inhalte aus zahlreichen verschiedenen Quellen erschließen und filtern sowie daraus personalisierte Angebote an die einzelnen Nutzer:innen liefern. Sie
„sehen sich selbst aber in der Regel in der Rolle eines neutralen Vermittlers ohne Verantwortung für Inhalte. Diese Position ist umstritten, weil Dienstanbieter (wie Facebook, TikTok oder X) selbst dann, wenn sie keine eigenen Inhalte produzieren, öffentliche Kommunikation formen. Sie entscheiden, zumeist mit der Unterstützung automatisierte algorithmischer Systeme, welche Inhalte wie weitergegeben und präsentiert werden.“ (Heesen 2024, S. 165)
Bei den Intermediären stehen die Geschäftsmodelle im Mittelpunkt des Interesses. Hinsichtlich der Empfehlung und Sortierung von Inhalten werden dort Algorithmen verwendet, um Muster zur Vorhersage des Verhaltens der Nutzer:innen erkennen zu können. Dabei werden zuvor vollzogene Interaktionen mit Hilfe der Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz beobachtet und ausgewertet. Das Ziel besteht darin, das Publikum möglichst lange auf den Plattformen zu halten (vgl. Schicha 2018b). Die Algorithmen strukturieren Öffentlichkeiten, da sie die Sichtbarkeit von Inhalten zentral beeinflussen.
„Um die Interaktion der Nutzer:innen zu messen, haben Plattformen den kommunikativen Austausch quantifiziert: mittels Metriken wie der Zahl der Follower, Klicks, Shares oder Likes wird (politische und gesellschaftliche) Relevanz gemessen.“ (Rademacher/Kokoschka 2024, S. 461)
Kommerzielle Plattformen übernehmen keine öffentlichen Aufgaben. Sie werden auf keine Auswahl- sowie Bereitstellungsregeln verpflichtet und streben keine allgemeine Öffentlichkeit an. Plattformen verfügen im Gegensatz zu journalistischen Formaten über keine Reaktion und haben keinen festen Kreis von Abonent:innen.
„Sie behaupten zwar Dienstleister ihrer Nutzer:innen zu sein, denen sie Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten gewähren, verwerten aber deren Inhalte und die erhobenen Nutzungsdatum für ihre ökonomischen Ziele. Tatsächlich agieren sie als Dienstleister für jene (webetreibenden) Akteure, die sie bezahlen. Deshalb nehmen Plattformen Zufälligkeit und Beliebigkeit von Meinungen und oder Mitteilungen nicht nur in Kauf, sondern fördern diese, weil es für Traffic (Klicks) besorgt und sich ökonomisch auszahlt.“ (Jarren/Fischer 2023, S. 16)
Um eine möglichst große Reichweite zu erreichen, werden vor allem die Inhalte ins Netz gestellt, die provozieren und negative Meldungen in den Vordergrund rücken. Rationale Diskurse mit guten Begründungen, die auf fundierten Argumenten basieren, spielen eine untergeordnete Rolle.
„Dabei belohnen Algorithmen nicht nur jene, die ständig interagieren, sondern insbesondere jene Beiträge, die skandalisieren, emotionalisieren und provozieren. Damit sind diese Logiken vor allem populistischen, radikalen und extremistischen Kräften zuträglich. (Reuschenbach/Frenzel 2024, S. 193)
Plattformen werden insgesamt für eine Reihe von Problemen der digitalen Öffentlichkeit verantwortlich gemacht, u.a.
„für die Verrohung des öffentlichen Diskurses und die Polarisierung des Streits,
für Mängel in der Informationsqualität wie Falschinformationen, die oft absichtlich in die Welt gesetzt werden, um anderen zu schaden („Fake News“),
für Verstöße gegen den Datenschutz und die Verletzung der Privatsphäre,
für die algorithmische Manipulation der Meinungsbildung und
für das Auseinanderfallen der Öffentlichkeit (in Echokammern und Filterblasen.“ (Neuberger/Thiel 2022, S. 33)
Es wird im digitalen Zeitalter immer einfacher, Informationen zu verbreiten und zu nutzen. Dabei gilt zu prüfen, inwiefern derartige Diskurse den normativen Anforderungen eines respektvollen Miteinanders genügen, wo Grenzverletzungen der sogenannten guten Sitten zu beobachten sind, inwiefern Akteur:innen sich auf Medienforen öffentlich artikulieren und welche Folgen dies aus einer kommunikationsethischen Perspektive haben kann.
Die Online-Kommunikation liefert potenziell bessere Möglichkeiten zur wechselseitigen Interaktion. Durch die diskursive Dialogstruktur ist ein Austausch von Argumenten und Positionen möglich. Die technische Infrastruktur ermöglicht eine Feedbackorientierung, die ein zielgruppenorientiertes Beziehungsmanagement ermöglicht.
Insgesamt werden an die Online-Kommunikation die gleichen normativen Ansprüche gestellt, die auch über die klassischen Medienkanäle vermittelt werden sollten. Allerdings steht bei den Kommunikationsprozessen in den sogenannten neuen Medien die kommerzielle Verwertung im Mittelpunkt. Während traditionelle Qualitätsmedien im Rundfunk und Printbereich sich der Information und Aufklärung der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet sehen und eine Kontroll- und Kritikfunktion gegenüber den Mächtigen wahrnehmen sollten, stehen ökonomische Ziele im Mittelpunkt sozialer Onlinemedien. Journalistische Formate werden reguliert und bei Verfehlungen von Medienselbstkontrollinstanzen wie dem Deutschen Presserat sanktioniert. Die Maßnahmen zur Regulierung der Netzkommunikation sind hingegen noch ausbaufähig.
Beck (2024b, S. 535) befürchtet, dass die kommerziellen Interessen der Internetanbieter nicht dazu beitragen, normative Kriterien zu beachten.
„Aus plattformökonomischer Sicht sind die ethisch eher problematischen Kommunikationsepisoden sogar die ertragreichen, weil sie Häufigkeit, Dauer und Gesamtumfang der Kommunikation auf der Plattform besonders stark wachsen lassen. Plattformen verhalten sich rational, wenn sie gegenüber Inhalt und Form der Kommunikation indifferent bleiben.“
Im Web 2.0 existiert zwar eine diskursive Dialogstruktur, die den Austausch von Interaktionen und Argumenten und daraus resultierend die öffentliche Meinungs- und Willensbildung ideal typischerweise fördern kann, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzubauen (vgl. Zerfaß/Pleil 2012, Prinzing 2021). Häufig geht es aber bei derartigen Onlineangeboten primär um Unterhaltung und Selbstdarstellung. Sogenannte YouTube-Berühmtheiten präsentieren im Internet im Rahmen einer „narzisstischen Selbstdarstellung“ (Habermas 2022, S. 58) selbst produzierte Videos und suchen Anerkennung durch eine möglichst hohe Klickrate und positive Kommentare.
„Die zu Autoren ermächtigten Nutzer provozieren mit ihren Botschaften Aufmerksamkeit, weil die unstrukturierte Öffentlichkeit durch die Kommentare der Leser und die ‚Likes‘ der Follower erst hergestellt wird. Soweit sich daraus selbsttragende Echoräume bilden, teilen diese Blasen mit der klassischen Gestalt der Öffentlichkeit den porösen Charakter der Offenheit für weitere Vernetzungen.“ (Habermas 2022, S. 62f.)
Aufgrund der kommerziellen Ausrichtung digitaler Angebote erzielen unterhaltende und triviale Inhalte im Netz eine hohe Resonanz. Kaum etwas wird in den sozialen Medien so regelmäßig angeklickt wie niedliche Katzenbilder.
„Catcontent gibt es für jeden Geschmack, ob witzig, gefährlich, rührend oder süß. Die Tiere sind facettenreich und legen häufig ein für den Menschen unerklärliches Verhalten an den Tag, das eine niedliche Seltsamkeit (cute weirdo) suggeriert und dafür prädestiniert ist, in Internetblogs und Sozialen Medien geteilt zu werden.“ (Korowin 2024, S. 8f.)
Die Kommunikation im Internet „in vernetzten Welten“ (Grimm/Keber/ Zöllner 2019) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie stellt eine ideale Plattform für Verschwörungserzählungen, Gerüchte, Lügen, falsche Anschuldigungen und Skandalisierungen dar (vgl. Schicha 2019a, Schicha/Stapf/Sell 2021). Dort besteht die Möglichkeit, anonyme Einträge einzustellen. Es werden negative Bewertungen vorgenommen, die auch dann kaum zu entfernen sind, wenn sie sich als haltlos herausstellen.
Vertreter:innen neuer sozialer Bewegungen, wie ‚normale‘ Bürger:innen können ihrem Ärger über Blogs im Internet Raum geben, sich mit Gleichgesinnten via X vernetzen und damit eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erreichen, die dazu führen kann, dass der Reputation von fälschlicherweise Beschuldigtem ungerechtfertigtem Schaden zugeführt werden kann.
Im Gegensatz zu den klassischen Medien zeichnet sich die Online-Kommunikation durch einen höheren Beschleunigungsgrad aus. Es ist technisch kein Problem, Mitteilungen in Echtzeit an ein breites Publikum kostenlos zu verschicken, welches direkt darauf reagieren kann. Somit ist ein rasches Feedback möglich. Statusmeldungen werden bei Facebook gepostet. Die Selbstdarstellung findet sich bei Xing wieder. Wikipedia-Einträge dienen der Wissensvermittlung und Eigenwerbung. Online-Communities bieten als Beziehungsnetzwerke einen Raum für Diskussionen, können aber aus kommerziellen Gründen zur Datenverwertung genutzt werden (vgl. Deutschlandradio 2013).
Zwar lassen sich konstruktive Merkmale aufzeigen, die unter dem Stichwort Schwarmintelligenz subsumiert werden können. Gleichwohl lassen sich destruktive Entwicklungen benennen, die Personen oder Gruppen massiv schaden können. Dies hängt damit zusammen, dass sich durch die Neuen Medien die Geschwindigkeit der Informationsübertragung rasant erhöht hat, was oftmals dazu führt, dass die Maxime Schnelligkeit vor Gründlichkeit im Online-Journalismus eine höhere Priorität erlangt. In diesem Fall werden dann Informationen ohne ausreichende Recherche weitergegeben.
Die Anzahl der Beschimpfungen gegenüber Personen, Organisationen und Institutionen nimmt schon aufgrund des quantitativ wachsenden Anteils an Diskursteilnehmer:innen stetig zu. Daraus ergeben sich eine Reihe von Problemen, die auch auf internationaler Ebene zu beobachten sind.
„Fake News, Filterblasen, Hetz- und Hasskommunikation, Mobbing auf der einen Seite und die Formierung eines historisch erstmalig perfekten totalitären Überwachungsstaates im Falle Chinas zeigen an, dass die Universalisierung von Kriterien der redaktionellen Prüfung von Fakten und Tatbeständen qualifizierter Berichterstattung, von einer Balancewirkung der vierten Gewalt, von demokratischer Partizipation an eine Grenze gekommen ist, jenseits derer sie sich erst mal nicht weiter ausbreiten wird.“ (Welzer 2020, S. 24)
Infrastrukturen wie Blogs, Videoportale und Online-Diskussionsgruppen haben zu großen Veränderungen der Kommunikation geführt. Durch derartige Onlinetechnologien haben sich Verschiebungen im Öffentlichkeitsgefüge ergeben, indem weitere Teilöffentlichkeiten entstanden sind, die sich in einem ständigen diskursiven Austausch befinden und dabei Kontrollfunktionen übernehmen, wie das Beispiel des computerunterstützten Plagiatfinders im Falle des ehemaligen CSU-Ministers Karl Theodor zu Guttenberg und anderen Politiker:innen zeigt (vgl. Schicha 2011a, Schrape 2015).
Faktisch haben sich soziale Netzwerke zu lukrativen Geschäftsmodellen entwickelt. Aufgrund der Reichweite und der Folgen derartiger Aktivitäten hat die öffentliche Debatte um die Veränderung von Privatheit durch die auf Werbeeinnahmen angewiesenen sozialen Netzwerke wie Facebook in den letzten Jahren rasant zugenommen. Einstmals geschützte Kommunikationsräume werden geöffnet. Daten können somit weltweit abgerufen und verbreitet werden.
Grundsätzlich sind Daten im Internet weltweit für jeden und jede abrufbar und dauerhaft verfügbar. Theoretisch kann jede Person beobachtet werden und wird ggf. selbst zum Objekt eines Skandals (vgl. Pörksen/Detel 2012). Es werden enorme Datenmengen mit skandalösem Inhalt durch Organisationen wie Wikileaks in Kooperation mit internationalen Qualitätsmedien ins Netz gestellt, die Skandale und Missstände deutlich machen und so für die breite Öffentlichkeit sichtbar sind. Insofern werden hier auch wichtige Aufgaben der Kontrolle und Kritik übernommen (vgl. Burkhardt 2011 und 2019, Schicha 2012).
„Aufzeichnungsmedien wie Handys, Digitalkameras, leistungsstarke Computer, Verbreitungsmedien im Social Web, also Netzwerk- und Multimediaplattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube, persönliche Websites und Wikis sind die neuartigen Instrumente solcher Skandalisierungsprozesse. Sie liegen heute potenziell in den Händen aller.“ (Detel 2013, S. 57)
Private Daten sind gegen Missbrauch zu schützen. Faktisch nutzen kommerzielle Anbieter die Möglichkeit, Kund:innendaten zu sammeln, um Kaufprofile zu erstellen. Doch es gibt auch Formen der freiwilligen Offenbarung, wenn Personen private Informationen ins Netz stellen. Sie artikulieren ihre politische Meinung, berichten über ihre Krankengeschichte und haben keine Hemmungen, sich online zu präsentieren. Offensichtlich ist in solchen Fällen die Hemmschwelle gesunken, Privates und Intimes mit anderen zu teilen. Dabei setzen sich diese Personen dem Risiko aus, persönlich bewertet und angegriffen zu werden. Zu viel Transparenz kann demzufolge auch negative Konsequenzen haben.
Die Kommunikation über digitale Kanäle verändert massiv die öffentliche Diskurskultur. Grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, dass verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten an gesellschaftlichen Diskursen sowie an der politischen Willens- und Meinungsbildung für weite Teile der Öffentlichkeit dadurch möglich sind. Dies zeigt sich unter anderem im Umgang mit Nutzer:innenkommentaren zu Veröffentlichungen im Internet. Dabei stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien die Prüfung und Freischaltung von Kommentaren zu bewerkstelligen ist, die einerseits das Recht auf eine freie Meinungsäußerung beachtet, gleichzeitig aber Falschmeldungen und Hetze unterbindet. „Zugleich birgt diese Debattenkultur auch Risiken für die demokratische Diskursrationalität, wenn destruktive oder emotionsgeladene Kommunikationspraktiken in den Vordergrund treten.“ (Kramp/Weichert 2020, S. 537).
Neben der professionellen journalistischen Berichterstattung hat sich im Internetzeitalter der Kreis der Akteur:innen erweitert, die sich an öffentlichen Diskursen beteiligen. Personen aus der Zivilgesellschaft posten ihre Beiträge auf diversen sozialen Netzwerken, die keiner redaktionellen Kontrolle unterworfen sind. Somit erweitert sich das Diskurspektrum, das einerseits neue Debattenräume eröffnet und größere Partizipationsmöglichkeiten schafft.
Während professionelle Journalist:innen lange die Inszenierungsdominanz bei der Auswahl, Vermittlung und Einordnung von Themen und Meldungen innehatten, beteiligen sich durch die neuen Medien an derartigen Debatten nun auch Bürger:innen ohne einen journalistischen Hintergrund. So hat es der YouTuber Rezo mit seinem am 18. Mai 2019 publizierten Video Die Zerstörung der CDU geschafft, innerhalb einer Woche fünf Millionen Aufrufe zu generieren. In dem fast einstündigen Film wurde die Politik der Union massiv angegriffen. Hier wurden aber nicht nur Meinungen geäußert, sondern Zahlen, Daten und Fakten präsentiert, die die vorgebrachte Kritik stützten. Es gab Reaktionen der damaligen Parteivorsitzenden und des Generalsekretärs der CDU sowie mediale Anschlussdiskurse (vgl. Wegener/Heider 2019).
Individuelle wie kollektive Akteur:innen können ohne Umweg über journalistische Formate Inhalte veröffentlichen oder mit ihren Bezugsgruppen (Politiker:innen, Verbände etc.) direkt interagieren. Über soziale Netzwerke werden Informationen und Fotos z.T. anonym geschaltet. Ein Impressum ist oftmals nicht mehr vorhanden. Jeder und jede, der oder die über die technische Infrastruktur und ein entsprechendes Wissen verfügt, kann sich an öffentlichen Debatten beteiligen (Pentzold/Katzenbach/Fraas 2014). Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, an Diskursen über das Internet zu partizipieren und dabei z.B. Memes als kommunikative Praktik in alternativen Öffentlichkeiten einzusetzen (Hammer 2019; Osterroth 2019; von Gehlen 2020). Insgesamt ergeben sich also zahlreiche Veränderungen durch den digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit.
„In mediatisierten Lebenswelten wird ein Großteil der Kommunikation strategisch. Die Kommunikationswelten einer digitalen Gesellschaft verstärken die Notwendigkeit der Identifikation von Strategien zur Gewinnung von Aufmerksamkeit und Medienmacht. Anders als eine redaktionell moderierte öffentliche Meinungsbildung durch Rundfunk/Fernsehen und etablierte Presse zeichnet sich die neue Kommunikation durch einen Wettstreit der Partikularinteressen aus.“ (Thomaß u.a. 2024a, S. 248)
Es ist eine größere und leichter zugängliche Medienvielfalt auch durch soziale Netzwerke entstanden. Dadurch wird die Aufmerksamkeit breiter gestreut. Klassische Medienangebote verlieren an Reichweite. Dadurch kann die Qualität leiden. Die Fokussierung auf populäre Angebote, die dem Marktmodell folgen, kann dazu führen, dass relevante Themen, die für die öffentliche Meinungs- und Willensbildung bedeutsam sind und einen Wissensgewinn versprechen, in den Hintergrund treten.
„Und der digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit droht generell, die für die liberale Demokratie vitalen Funktionen der Öffentlichkeit zu beeinträchtigen. Bedrohlich sind auch durch jenen Strukturwandel zusätzlich begünstigte hybride Angriffe, die die prinzipielle Zugangsoffenheit und Freiheit der demokratischen Öffentlichkeit in strategisch antidemokratischer Absicht ausbeuten, etwa durch die Verbreitung von Desinformationen, Propaganda und Hetze.“ (Stulpe 2024, S. 9)
Das Beziehungs-, Identitäts-, und Informationsmanagement konzentriert sich zunehmend auf intermediäre Plattformanbieter wie Facebook und Google. Die Medienrezeption richtet sich dort stärker auf Berichte, die auf Polarisierung, Emotionalisierung und negative Formen der Meinungsbildung setzen (vgl. Lischka/Müller-Eiselt 2017). Eine große Gefahr geht von radikalen Gruppierungen aus, die mit Unterstützung digitaler Techniken Desinformationskampagnen und Wahlmanipulationen verbreiten (vgl. Ebner 2019).
„Die Filter der sozialen Medien sind so eingestellt, dass antisoziale Typen sich austoben können, Trittbrettfahrer schwer zu enttarnen sind und Online-Mobs dazu angestachelt werden, Einschüchterungskampagnen zu fahren.“ (Hübl 2024, S. 192)
Um derartige Entwicklungen angemessen einordnen und beurteilen zu können, ist ein normatives Fundament auf der Basis ethischer Kriterien erforderlich.
2.2Ethik
Wenn von Ethik und Moral die Rede ist, gibt es Assoziationen, die mit Arroganz in Form von moralischer Überlegenheit oder Besserwisserei bis hin zur Bevormundung reichen. Es fallen Begriffe wie Prinzipienreiterei, Rigorismus und Oberlehrertum. Derartige Ausprägungen können aber eher als Moralismus klassifiziert werden, der eine moralische Überreaktion darstellt (vgl. Neuhäuser/Seidel 2022).
Bei der Ethik oder Moralphilosophie geht es nicht darum, Menschen zu bevormunden, zu überwachen oder gar auszuspähen, sondern um eine gut begründete Form der Handreichung von normativen Kriterien, um das zwischenmenschliche Zusammenleben besser zu machen. Die Ethik ist relevant für das Leben von Menschen, da sie Hilfestellung und Orientierung gibt und als wissenschaftliche Disziplin eine Reflexionstheorie der Moral darstellt, um das Verhalten in eine wünschenswerte Richtung zu steuern. Sie formuliert Werte in Form von Vorstellungen, Ideen und Idealen. Dabei werden wünschenswerte Handlungen und Einstellungen erarbeitet, die einen Beitrag dazu leisten sollen, dass das Zusammenleben in der Gesellschaft besser gelingen kann. Werte „steuern unsere Handlungen, beeinflussen unsere Wahrnehmung und Wirklichkeitskonstruktion und sie stellen Motive für unser Handeln dar.“ (Grimm/Keber/Zöllner 2019, S. 20) Hierbei kann die Einordnung von Werten und Normen wie folgt getroffen werden:
„Während Werte und Wertvorstellungen als erstrebenswerte, wertvolle Eigenschaften oder Qualitäten definieren können, die Ideen, Objekten, Sachverhalten, aber auch Handlungsmustern oder Charaktereigenschaften zugeordnet werden, lassen sich (soziale) Normen eher als Vorschriften, als Handlungsmaximen oder Verhaltensregeln verstehen. Viele Phänomene, von denen wir auch in der öffentlichen Kommunikation sprechen, wie z.B. Wahrheit, Fairness, Objektivität, Transparenz, Offenheit etc. können sowohl als Normen, wie auch als Werte fungieren.“ (Bentele 2021, S. 63f.)
Ethik gilt als der wissenschaftliche Terminus für das moralische und sittliche Handeln, wobei Ethik und Moralphilosophie synonym gebraucht werden.
Es lassen sich unterschiedliche Bereiche und Reichweiten innerhalb der normativen Konzeptionen aufzeigen (vgl. Heise 2013, Schicha/Brosda 2010, Schicha 2019a).
Die Metaethik beschäftigt sich mit der abstrakten Bedeutung und Begründung von Ethik.
Ethische Theorien verfolgen unterschiedliche Zugänge und setzen sich mit Begründungen auseinander, die z.B. den Nutzen (Utilitarismus), die Pflicht (Deontologie), Debattenverfahren (Diskursethik), Gerechtigkeitsaspekte (Gerechtigkeitsethik) oder Gemeinschaftsbildung (Kommunitarismus) präferieren.
Ethische Prinzipien setzen auf generelle Normen wie Menschenwürde, Vertrauen, Handlungsautonomie, Selbstbestimmung und Wahrhaftigkeit.
Ethische Richtlinien und Regeln orientieren sich an Standards, die zum Beispiel Grundsätze eines guten wissenschaftlichen Arbeitens umfassen.
Die Alltagsmoral greift auf erlernte Vorstellungen und Kompetenzen zurück, um moralische Urteile anhand konkreter Einzelfälle vornehmen zu können.
Das ethische Instrumentarium auf Basis philosophischer Theoriemodelle wird eingesetzt, wenn ein moralisches Dilemma auftritt und normative Fragen des richtigen Tuns oder Unterlassens zu entscheiden sind. Moralische Ansprüche können eine Einschränkung menschlicher Bedürfnisse zur Folge haben, da Respekt und Rücksicht gegenüber den Mitmenschen einen Verzicht bedeuten können, egoistische Motive auszuleben.
Die Ethik reflektiert ihre Formen und Prinzipien ohne Berufung auf politische und religiöse Aussagen oder in Bezug auf althergebrachte Gewohnheiten. Moralische Aussagen sind begründungsbedürftig. Dabei sollte die Bildung und Begründung eines Urteils in einem emotionslosen Zustand erfolgen, um rationale Entscheidungen treffen zu können. Es muss begrifflich klar formuliert werden und es sollte Kenntnis über alle relevanten Umstände für die Bildung des Urteils vorhanden sein. Grundsätzlich gilt für ethische Urteile das Prinzip der Unabhängigkeit. Sie sind kategorisch und bewerten Handlungen unabhängig davon, inwiefern diese den Zwecken oder Interessen der Akteur:innen entsprechen (vgl. Schicha 2010a).
Insgesamt lassen sich Birnbacher (2003) zufolge vier gesellschaftliche Funktionen der Moral voneinander unterscheiden.
Verhaltensorientierung und Erwartungssicherheit: Moralische Selbstverständlichkeiten sorgen dafür, dass der einzelne Mensch sich im Alltag gewohnheitsmäßig an bestimmten Normen orientiert und andere dies in ihre Verhaltenserwartungen aufnehmen.
Soziales Vertrauen und Angstminderung: Moralische Normen setzen Übergriffen Anderer Grenzen und mindern die Angst vor Aggressivität und Übervorteilung.
Ermöglichung gewaltloser Konfliktbewältigung: Moralische Normen erlauben es, Interessen und Normkonflikte nach Regeln statt nach dem Gesetz des Stärkeren zu lösen.