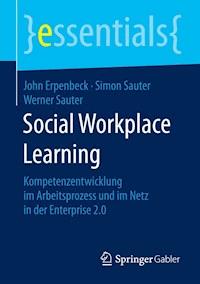Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Unsere Ansätze basieren auf der Analyse der aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft, den veränderten Zielsetzungen der Unternehmen in der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung und auf einem grundlegend veränderten Verständnis der Rollen der Lerner und der Lernprozessbegleiter. Lerner organisieren ihre Lernprozesse, ähnlich wie ihre Arbeitsprozesse, zunehmend selbst. Diese Entwicklung korrespondiert mit der Revolution im Internet, die der Spiegel trefflich mit "Wir sind das Netz" gekennzeichnet hat. Danach wandeln die Nutzer des Internets ihre Rolle vom suchenden Konsumenten ( Web 1.0) zum mitgestaltenden Akteur in Communities (Web 2.0).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Erpenbeck und Werner Sauter
KOMPETENZENTWICKLUNG
IM NETZ
New Blended Learning mit Web 2.0
Imprint
Kompetenzentwicklung im Netz Copyright: © 2014 John Erpenbeck, Werner Sauter All rights reserved Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
1. Bedingungen der Möglichkeit von Kompetenzentwicklung im Netz
Lernen, lernen, nochmals lernen…
Warum beschleicht uns ein ungutes Gefühl, wenn wir uns diese Worte laut und gewichtig vorlesen? Warum erfüllt uns das Reden, zuweilen das Gerede vom lebenslangen Lernen nicht mit fröhlicher Genugtuung, sondern mit der bedrückenden Assoziation des Lebenslänglichen? Warum haben wir uns nach eingehenden Beratungen entschlossen, dieses Buch nicht „Kompetenzlernen im Netz“, sondern „Kompetenzentwicklung im Netz“ zu betiteln?
Die Fragen so zu stellen heißt, sie schon halb zu beantworten. Entgegen den tiefgründigen Untersuchungen von Neurobiologen, Psychologen, Pädagogen und Soziologen, die den Gesamtzusammenhang von Information und Verhalten, Wissen und Werten, Wollen und Handeln seit langem im Blick haben, verstehen wir noch oft genug das Lernen als individuellen Erwerb von Kenntnissen, von geistigen und körperlichen Fertigkeiten, auch von Fähigkeiten in einem ganz funktionalen, lehrbaren, reproduzierbaren und abprüfbaren Sinne. „Lernen kann als systematische Änderung des Verhaltens aufgrund gewonnener und durchdachter Informationen, also Wissen, durch Wahrnehmung von Veränderungen in der Umwelt bezeichnet werden“, teilt uns das Web 2.0 Vorzeigeprojekt Wikipedia dazu lakonisch mit. Und was ist mit den Verhaltensänderungen, die durch Hoffen und Glauben, durch veränderte Werte und Normen, durch gewandelte Emotionen und Motivationen zustande kommen? Sind das auch „gewonnene und durchdachte Informationen“, handelt es sich dabei auch um Wissen? Haben wir es nicht vielmehr mit Wissen in einem viel weiteren, viel tiefer gehenden Sinne zu tun?
Die gedankliche Verkürzung des Lernens auf die Aneignung von Sach- und Fachwissen, von Fertigkeiten und Qualifikationen ist eine folgenschwere Bürde für unser heutiges Lern- und Zukunftsverständnis. Sie entstand im großen Umfang mit der hoch arbeitsteiligen industriellen Produktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und mit der „Zurichtung“ des Menschen für diese Produktion, als Rädchen im industriellen Getriebe, bis hin zum Handgriffautomaten im Taylorismus. Trotz aller reformpädagogischen Bestrebungen, aller wahrlich kompetenzorientierten Ansätze der Montessori und Co. blieb dieses verkürzte Lernverständnis lange, ja weitgehend bis heute erhalten: Der Lehrer füttert die Lernenden mit Wissensbröckchen bis zur Übersättigung; vieles davon wird unverdaut ausgeschieden, einiges davon als Wissensspeck abgespeichert. Auf Vorrat, sozusagen. So funktioniert schulische und universitäre Bildung weitgehend bis heute. Die eigentliche Handlungsfähigkeit erwerben Schüler und Studenten ganz anders und weitgehend woanders: In der Freizeit, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein oder im Ehrenamt, vor allem aber später - im Prozess der Arbeit selbst.
Doch es gab und gibt eine Gegenbewegung. Seit den siebziger Jahren, verstärkt seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wurde immer deutlicher, dass informationelles Wissen als Vorratsspeck für künftiges Handeln nicht ausreicht. Die immer schneller ablaufenden kulturellen, politischen und ökonomischen Prozesse, die zunehmenden Regionalisierungs- und Globalisierungsprozesse erfordern Fähigkeiten zu einem kreativen und wirkungsvollen Handeln auch da, wo keine zureichenden Informationen vorhanden und zeitnah zu erwarten sind. Sie fordern von den Handelnden hohen persönlichen Einsatz, große Aktivität, lebendiges, handlungsverwobenes, fachlich-methodisches Wissen und ausgeprägte sozial – kommunikative Anstrengungen.
Es hat sich durchgesetzt, solche Fähigkeiten zum selbstorganisierten, kreativen Handeln unter Unsicherheit, in eine offene Zukunft hinein, als Kompetenzen zu bezeichnen. Dem entsprechend sind profilierte personale, aktivitätsbezogene, fachlich-methodische und sozial-kommunikative Kompetenzen zur Bewältigung dieser Zukunft gefragt.
Das wurde zuerst und schmerzhaft im Bereich der beruflichen Bildung offenbar, der von der massiven sozialen Beschleunigung als Erstes betroffen war und getroffen wurde. Es setzte sich in all jenen akademischen Disziplinen fort, die mit den ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Beschleunigung zu tun haben: Ökonomie, Soziologie, Politikwissenschaften. Es wird, so viel ist gewiss, alle akademischen Sparten und zuletzt auch die Schule treffen.
Alle Bereiche müssen sich also Gedanken machen, wie zukunftsnotwendige Kompetenzen handlungswirksam zu vermitteln sind. Der Begriff des Kompetenzlernens könnte Falsches assoziieren: Dass man Kompetenzen wie Wissen weitergeben, auch sie als Wissensbröckchen verfüttern könne. In Wahrheit ist die Aneignung von Kompetenzen mit der so genannten Interiorisation von Regeln, Werten und Normen zu eigenen Emotionen und Motivationen verbunden. Das geschieht nur im unmittelbaren geistigen oder körperlichen Handeln, unter der Notwendigkeit, Widersprüche, Konflikte, Verunsicherungen auszuhalten, die dadurch entstehenden Dissonanzen und Labilisierungen schöpferisch zu verarbeiten und so zu neuen Emotionen und Motivationen zu gelangen. Regeln, Werte und Normen bilden die Kerne von Kompetenzen. Werden sie interiorisiert - während zugleich das notwendige Sachwissen erworben wird - sprechen wir von Kompetenzentwicklung. Um sie geht es in unserem Buch.
Das besagte Kompetenzverständnis und das angedeutete Interiorisationsverständnis bilden die Basis, auf der alle unseren weiteren Überlegungen ruhen. Sie wurden in früheren Arbeiten entwickelt und stehen uns hier originär zur Verfügung.
Neu ist hingegen das hier entwickelte Raster, um die unterschiedlichsten Methoden beabsichtigter, „intendierter“ Kompetenzentwicklung zu ordnen. Am Beginn dieser Überlegungen stand die Bitte eines Bildungsökonomen, den inzwischen umfangreich zusammengetragenen und dokumentierten Kompetenzmessungen nun doch endlich die kompetenzentwickelnden Taten folgen zu lassen und mal eben einen Überblick über die wichtigsten Kompetenzentwicklungsmethoden zu geben. Schlagartig wurde klar, dass ein solcher nicht einmal in Ansätzen existierte. Das Resultat unserer Überraschung liegt hier vor und bildet den Ausgangspunkt, um später die in Kompetenzentwicklungsprozesse einbezogenen Web 2.0 – Methoden einzuordnen.
Neu und bislang einzigartig ist auch die Analyse der so genannten Social Software, des metapherhaft als Web 2.0 bezeichneten Softwareinstrumentariums aus der Kompetenzsicht - und umgekehrt, die Analyse von Kompetenzentwicklung aus der Softwaresicht des Web 2.0. Basishypothese des gesamten Buches ist die resultierende Behauptung: Im Gegensatz zu den traditionellen E-Learning – Instrumenten, die vornehmlich zur Vermittlung von Sachwissen und Informationen taugen, sind die Instrumente des Web 2.0 hervorragend zur Kompetenzvermittlung geeignet. Diese Behauptung wird detailliert und beispielreich belegt.
Aus Kompetenz- und Interiorisationsverständnis, methodischem Kompetenzentwicklungsraster und kompetenzbezogenem Social-Software-Verstehen wird schließlich ein neuartiges Einsatzfeld des Blended Learning kreiert, das den Zusatz „New“ zu Recht verdient. Er wäre kaum zu verteidigen, wenn es sich nur um eine Fortschreibung klassischen Blended Learnings handelte. Das hier betrachtete New Blended Learning fungiert jedoch als Brücke zwischen den innovativen Bereichen Kompetenzentwicklung und Social Software. Es ist neu, indem es Neues verbindet.
Bei dieser Brückenkonstruktion bleibt unser Buch nicht stehen. Es entwickelt vielmehr einen eigenständigen Verfahrensvorschlag: „Kompetenzentwicklung mit Blended Learning und Social Software“ (KOBLESS), der methodisch so weit untersetzt ist, dass er sich sofort in konkrete praktisch – pädagogische Verfahrensschritte überführen lässt.
Man kann den Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden, wusste schon Galileo Galilei. Diese Einsicht verdichteten moderne Menschenbildner zum Grundprinzip der Ermöglichungsdidaktik. Alle von uns vorgeschlagenen Verfahrensschritte haben einen solchen Ermöglichungscharakter. Sie setzen, wie es Immanuel Kant formulierte, „Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung“ und versuchen nicht, Erfahrungen und Kompetenzen wissensförmig weiterzugeben.
Unsere Vorschläge haben, so hoffen wir zuversichtlich, die Gegenwart auf ihrer Seite und die Zukunft im Blick.
John Erpenbeck und Werner Sauter
Berlin 2007
2. Kompetenz, Kompetenzerfassung und Kompetenzentwicklung
Ein siedend heißer Sommertag. Mitglieder der „Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung“ debattieren über die Zukunft beruflicher Kompetenzentwicklung und reden sich die Köpfe heiß. „Können wir nicht die Fenster öffnen, trotz des Verkehrslärms draußen?“ fragt jemand und als alle zustimmend nicken, reißt er die Fenster weit auf. Draußen fährt ein riesiger Kühlwagen vorbei. „Unser Job: Frischekompetenz“ ist dort blau auf weißer Plane zu lesen. Alle stürzen zum Fenster, lachen – gequält und befreit. „Diese Kompetenz hat uns noch gefehlt …“
Vor mehr als dreißig Jahren neu in sozialwissenschaftlichen Diskursen verwendet, vor etwa zwanzig Jahren breiter in die wissenschaftliche Diskussion aufgenommen, vor zirka zehn Jahren intensiv in Bereichen von Psychologie, Pädagogik und Personalwirtschaft genutzt, hat sich der Begriff Kompetenz zum Allerweltswort, zum Schlagwort entwickelt. Keiner, der keine Kompetenz hat, keine Kompetenz, die es nicht gibt. Also ein nutzloser Begriff?
Keineswegs, so machen Karlheinz Geißler und Frank Michael Orthey klar – es ist „ein Begriff für das verwertbare Ungefähre“: „Kompetenz wurde zur semantischen Projektionsfläche für Zuschreibungen, die etwas mit Fähigkeiten zu tun haben, die im Lebens- und Arbeitsvollzug gebraucht werden und deren Erwerb möglich ist… Alltagssprachlich wird kalkuliert, dass mit Kompetenz bestimmte Fähigkeiten gemeint sind, die ein besseres, hochwertigeres, angemesseneres Handeln zur Erreichung von vorgegebenen Zielen ermöglichen – und dies immer wieder neu. Kompetenz ist nicht aufzubrauchen…[Der Begriff] scheint auch deshalb besonders attraktiv, weil Kompetenz, im Gegensatz zu Qualifikation, an das Subjekt gekoppelt wird. Verstanden wird insofern unter Kompetenz oft eine Kombination von Fähigkeiten, Kenntnissen und Haltungen…[Kompetenzentwicklung bedeutet] Formen zu entwickeln, mit Nichtwissen zurechtzukommen, und dennoch anschlussfähige und problemorientierte Handlungen zu aktualisieren bzw. zu ermöglichen.“ Das setzt biografisch erworbene Selbstorganisationsfähigkeit und Reflexionsfähigkeit voraus.
Diese kritisch gemeinten Anmerkungen stoßen – vielleicht gerade der kritischen Haltung wegen – zum Kern der Begriffskarriere vor. Tut man sie nicht als bloße Wortmode ab, sondern sucht die materiell-ökonomische Basis des begrifflich-modischen Überbaus, stellt man fest:
Es bedarf eines besonderen Begriffs,
um besondere, immer notwendiger werdende Fähigkeiten zu erfassen, angesichts einer zunehmend komplexen, zunehmend problematischen, immer mehr unsicheren Umgebung (Risikogesellschaft), angesichts wachsenden Nichtwissens zurechtzukommen, gleichsam „ins Offene“ zukünftiger Ziele hinein kreativ zu handeln. Das setzt voraus, die eigenen Denk- und Handlungsschritte zu reflektieren und selbstorganisiert immer neue zu entwickeln. Es bedarf also einer Möglichkeit, biografisch entstandene, sich lebenslang weiterentwickelnde Selbstorganisationsfähigkeiten oder Selbstorganisationsdispositionen des gedanklichen und gegenständlichen menschlichen Handelns auf den Begriff zu bringen;
um diese Selbstorganisationsfähigkeiten als solche zu kennzeichnen, die, anders als die oft sehr stabilen Persönlichkeitseigenschaften, in Lebens- und Arbeitsvollzügen erworben – und damit auch trainiert – werden können, wodurch auch ein immer besseres, angemesseneres Handeln zur Erreichung immer neuer, insbesondere offener Ziele ermöglicht wird;
um die Abgrenzung zu den Qualifikationen herauszustellen, die nicht an das Subjekt, sondern an objektive Ziele gekoppelt und dadurch leichter objektiv messbar sind; dabei ist aber zu berücksichtigen, dass es sehr wohl Qualifikationen ohne Kompetenzen, aber keine Kompetenzen ohne Qualifikationen gibt;
um das im komplexen, oft chaotischen Alltags- und Arbeitshandeln untrennbare und unaufhebbare Zusammenspiel von Fertigkeiten, einfachen Fähigkeiten, Kenntnissen und Qualifikationen einerseits mit Haltungen, also zu eigenen Emotionen und Motivationen verinnerlichten Regeln, Werten und Normen, zu erfassen;
um zu betonen, dass die soeben umrissenen „weichen“ Faktoren, obwohl viel schwerer objektiv messbar, viel entscheidender für das Humankapital eines Unternehmens und damit, thematisiert unter dem Stichwort des Kompetenzkapitals
[1]
, für die Verwertbarkeit kreativer menschlicher Handlungsfähigkeiten viel wichtiger sind, als bloße Fertigkeiten, Kenntnisse oder Qualifikationen.
Diese fünf Gesichtspunkte spiegeln also objektive Bedingungen der Gesellschaft und Arbeitswelt am Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts wieder.
Abb. 1 Objektive Bedingungen und Anforderungen der Arbeitswelt im 21. Jahrhundert
Sprachliche Begriffe sind Bezeichnungen für verhaltens- und handlungsrelevante Sachverhalte. Während solche Sachverhalte im Handeln aus der Realität herausgefiltert werden können, wie beispielsweise die genannten fünf Gesichtspunkte, sind die sprachlichen Bezeichnungen selbst in hohem Maße willkürlich, zufällig, „kontingent“, wie der Ausdruck für den kreativen Zufall lautet. Auch wenn wir andere sprachliche Begriffe, etwa Schlüsselqualifikationen, oder Soft Skills, verwenden, stehen doch die gleichen handlungswichtigen Sachverhalte dahinter.
Kompetenz ist also tatsächlich ein Begriff für das verwertbare Ungefähre. Denn für jeden der fünf Gesichtspunkte gibt es unterschiedliche Gewichtungen und unterschiedliche Betrachtungsweisen. Dennoch sind die von solchen Betrachtungsweisen ausgehenden Schlussfolgerungen wichtig und verwertbar, denn sie knüpfen an reale Verwertungsbedingungen des Menschen unter den heutigen sozialökonomischen Bedingungen an. Der Kompetenzbegriff wird in der Tat zu einer „ökonomisierten Variante des klassischen Bildungsbegriffs“. [2] Wir werden später versuchen, das Ungefähre weniger ungefähr zu machen, es genauer begrifflich und praktisch zu umreißen.
So erklärt sich zwanglos die Fülle von Kompetenzdefinitionen. Zugleich grenzen die genannten Gesichtspunkte aber auch Typen von Kompetenzdefinitionen aus, die generalistisch nahezu jedes Produkt menschlicher Tätigkeit - Fertigkeiten, Kenntnisse, Qualifikationen, z.B. simpelste Lese- und Rechenfertigkeiten, für Prüfungen auswendig gelerntes Fachwissen, elementare Qualifikationen - zu Kompetenzen erklären. [3] Aber auch solche, die versuchen, Kompetenzen kognitivistisch als Leistungsdispositionen zu definieren, welche sich eng funktional auf bestimmte Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen im Sinne von spezifischen Lern- und Handlungsbereichen beziehen. [4] Dabei werden die in Unternehmen und Organisationen ganz besonders nachgefragten Kompetenzen – etwa personale oder sozial-kommunikative - einfach ausgegrenzt. [5]
Der Konkurrenzkampf der Zukunft wird als Kompetenzkampf geführt. [6] Das verdeutlichen zahlreiche Bemerkungen und Untersuchungen zum aktuellen Kompetenzbedarf in Unternehmen und Organisationen.
Aktueller Kompetenzbedarf in Unternehmen und Organisationen – einige Beispiele
Was sich Unternehmen von Schulabgängern wünschen, haben die IHK in Baden-Württemberg 2005 ermitteln lassen. Dort spielen, neben fachlich-methodischen Kompetenzen, der grundlegenden Beherrschung der deutschen Sprache, einigen Fremdsprachenkenntnissen, der Beherrschung einfacher Rechenmethoden und Grundkenntnissen im IT-Bereich sowie Grundkenntnissen im naturwissenschaftlichen und ökonomischen Bereich, vor allem personale Kompetenzen, wie Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Kritik- und Selbstkritikfähigkeit oder Kreativität, aktivitätsbezogene Kompetenzen, wie Ausdauer, Durchhaltevermögen, Belastbarkeit oder Flexibilität, die allerdings nicht gesondert ausgewiesen werden und sozial-kommunikative Kompetenzen, wie Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Höflichkeit, Freundlichkeit, Konfliktfähigkeit oder Toleranz, eine Rolle. Ja, „die Unternehmen erwarten, dass am Ende der Schulausbildung die Grundlagen für eine stabile Persönlichkeit, für Gemeinschaftsfähigkeit, für Lern- und Leistungsbereitschaft gelegt sind.“ Wir halten es für vermessen, wenn sich Pädagogen diesen Anforderungen durch eine kognitivistische Kompetenzauffassung verschließen. [7]Wie wichtig individuelle Kompetenzen für den Erfolg eines Unternehmens sind, macht 2004 eine Umfrage bei DIHK-Betrieben zu Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen klar. Erschreckend sei, so der DIHK-Hauptgeschäftsführer, "wie groß offenbar die Defizite bei den persönlichen und sozialen Kompetenzen sind. Hier zeigen die Ergebnisse akuten Handlungsbedarf auf." Die Umfrage ermittelt soziale und personale Kompetenzen als den Bereich, „worin Unternehmen die größten Defizite sehen“ und resümierte als wichtigstes Ergebnis: „Fachwissen ist nicht alles – Persönlichkeit ist gefragt. Neben Fachwissen und Analyse- und Entscheidungsfähigkeit erwarten Firmen von heutigen Hochschulabsolventen Leistungswillen, die Fähigkeit, selbständig zu arbeiten, Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit.“ Die so genannten soft skills - hier also klar Kompetenzen - scheinen sich in der Bewertung der Unternehmen immer mehr zu Key Skills zu entwickeln, offenbar weil hier die größten Defizite ausgemacht werden. [8]Eine Umfrage nach Wertvorstellungen deutscher Führungskräfte 2006 bestätigt die Bedeutung von individuellen Kompetenzen. Sie halten neben den Fachkompetenzen (60,7%) vor allem die personalen Kompetenzen Verantwortungsbewusstsein (59%), Ehrlichkeit (35%), Kreativität (27,4%) und Loyalität (15,9%), die sozialen Kompetenzen insgesamt (37,8%) insbesondere die Kooperationsbereitschaft (23,4%) sowie die aktivitätsbezogenen Kompetenzen Ehrgeiz (13,9%) und Mut (12,4%) für in beruflicher Hinsicht von größter Bedeutung. [9]Im internationalen Maßstab wird von Führungskräften 2006 die Nachfrage nach Kompetenzen ebenfalls betont. Auch hier wird der Fachkompetenz das Primat zugewiesen, dicht gefolgt von personaler Kompetenz (Kreativität, Ehrlichkeit, Rationalität, Verantwortung, Loyalität), aktivitätsbezogener Kompetenz (Ehrgeiz, Mut) und sozialer Kompetenz (Kooperation, Hilfsbereitschaft). Allerdings mit hoch interessanten Länderunterschieden: Während Fachkompetenz in allen Ländern ähnlich wichtig genommen wird, landet soziale Verantwortung nur bei den Deutschen auf Platz 2, bei allen anderen EU-Ländern wesentlich dahinter. Dafür messen deutsche Manager der Kooperationsfähigkeit einen sehr niedrigen Wert zu, während britische Manager ihr den 2. Platz zuweisen. Solche Unterschiede sind vor allem mit Blick auf interkulturelle Kompetenzen interessant. [10]Eine Mitteilung aus der Produktionsinnovationserhebung des ISI (Fraunhofer Institut System- und Innovationserforschung) von 2005 zeigt, dass die individuellen Kompetenzen für die Innovationsfähigkeit insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen entscheidend sind: „Die Fähigkeit, neue Produkte auf den Markt zu bringen und innovative technische und organisatorische Prozesse zu implementieren, hängt bei etwa zwei Drittel der Betriebe [n=1.450] an einzelnen oder wenigen Mitarbeitern. Deren Ausfall beschwört dann zwangsläufig Engpässe herauf. Selbst in größeren Unternehmen existiert diese Problematik, vor allem bei Reorganisationsmaßnahmen. Die für solch sensiblen Aufgaben notwendigen sozialen bzw. persönlichen Kompetenzen sind offenbar besonders rar. Die Innovationskompetenz vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen steht auf dünnem personellen Eis. Noch scheint Wissensmanagement ein Mythos und Kompetenzmanagement oft kaum bekannt. Eine breite, systematische Entwicklung vorhandener individueller Kompetenzen ist in der deutschen Industrie bislang die Ausnahme.“ [11]Dass die Kompetenzentwicklung in den Unternehmen im breiten Maße „angekommen“ ist, bekräftigt eine Untersuchung an der Universität Hannover von 2005. Dabei wird deutlich, dass Kompetenzentwicklung eher auf die Personalentwicklung als auf andere Bereiche bezogen ist, dass sie eher Führungskräfte als Mitarbeiter betrifft, dass sie nur vereinzelt mit wissenschaftlichen, umfassend aber mit selbstgestrickten Modellen erfasst wird und dass zu wenig Ansätze zur Entwicklung und Förderung von Kompetenzen bestehen. Bemühungen zur systematischen Kompetenzentwicklung „befinden sich zumeist noch in Vor- oder Versuchsphasen.“ Das hängt auch mit den hohen Aufwendungen für echte Kompetenzentwicklungsmaßnahmen zusammen. [12] Hier tut sich eine breite Schneise für die Kompetenzentwicklung im Netz auf.Der zunehmende Einsatz von Persönlichkeitstypologien in der deutschen Wirtschaft, insbesondere im Führungsbereich zur Potenzialanalyse und zum Führungsverhalten, aber auch, obgleich in geringerem Maße, im Mitarbeiterbereich, überlappt sich stark mit Bemühungen zur Kompetenzerfassung, wie eine Untersuchung von 2004 deutlich macht. Denn es sollen ja Verhaltensweisen prognostiziert und, wo möglich, auch verändert werden. Das ist eigentlich nur für Kompetenzen wirklich möglich, denen allerdings solche Persönlichkeitsmerkmale zugrunde liegen können, welche auch generalisierend als Kompetenzen gedeutet werden können (MBTI®,DISG®, INSIGHTS®, LIFO® und andere). Allerdings wird von denjenigen Unternehmen, die bislang keine Persönlichkeitstypologien einsetzen, oft eine Präferenz für situations- und kompetenzorientiertes Verhaltenstraining ins Feld geführt. Sie begründen den Verzicht auf Persönlichkeitstypologien u.a. damit, dass sie situations- und kompetenzorientierte Verhaltenstrainings den typenorientierten Ansätzen vorziehen. [13]Auf die Notwendigkeit, in der beruflichen Bildung nicht ein kognitivistisch verengtes, sondern ein handlungstheoretisch breiter untermauertes Verständnis im Blick zu haben, wird 2005 von Sloane und Dilger hingewiesen. Während schon am Beginn berufspädagogischer Kompetenzbetrachtungen die Unterteilung in gegenstandsbezogene, selbstbezogene und sozialbezogene Fähigkeiten stand, [14] während der Altmeister deutscher Kompetenzforschung, F.Weinert neben den kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten auch motivationale, willensmäßige und soziale Handlungsdispositionen einschloss, um eine problemlösende Performanz zu erreichen, wird von kognitivistischen Ansätzen „Wissen als ‚im Kopf vorhandene Fakten und Regeln“ gedeutet. Damit werden die zu eigenen Emotionen und Motivationen aus Regeln, Normen und Werten interiorisierten wichtigsten Bestandteile von Kompetenzen ausgeklammert. Die meisten Untersuchungen, die sich mit Kompetenzentwicklung im Bereich von Schule, beruflicher Aus- und Weitebildung, universitärer Bildung, Personalwirtschaft und Führungstraining befassen, gehen, wie hier demonstriert wird, genau den umgekehrten Weg. [15]In der betrieblichen Weiterbildung spielt die Kompetenzentwicklung eine immer größere Rolle. Charakteristisch dafür ist, einer Mitteilung des Instituts der deutschen Wirtschaft von 2006 folgend, dass das Lernen in Arbeitssituationen und das selbstorganisierte Arbeiten mit Medien immer mehr zunimmt, während Informationsveranstaltungen, vor allem aber Lehr- und Schulungsmaßnahmen immer weiter abnehmen. [16]Mit den nachfolgenden Beispielen wird der Denkweg der folgenden Abschnitte angedeutet:
Erstens
muss, wo Fähigkeiten zum selbstorganisierten Handeln und nicht nur eingelernte Fertigkeiten und Kenntnisse gefragt sind, deutlich unterschieden werden zwischen Wissensaspekten (kognitiven Aspekten) im engeren Sinne und zwischen regel-, wert- und normbezogenen Resultaten wie Erfahrungen, Haltungen, Überzeugungen, Expertise usw. sowie, dies einschließend, eben Kompetenzen.
Was „ist“ Wissen und wie wird es vermittelt?
So lautet also die erste Frage.
Zweitens
kann dann die nächste Frage nur lauten:
Was „sind“ Werte und wie werden sie vermittelt?
Jedem ist intuitiv klar, dass Werte etwas ganz anderes als Wissen sind. Gegensätzliches? Komplementäres? Wo streben wir nach „wertfreiem“ Wissen, wo nach stets kulturell eingebetteten Werten? Und wie gelingt es, Werte, die nur wirksam werden, wenn sie von einzelnen Menschen verinnerlicht, interiorisiert, zu eigenen Emotionen und Motivationen umgewandelt wurden, wirksam weiterzugeben? Was ist die eigentliche „Drehscheibe“ des Wertlernens, und damit des Kompetenzlernens? Das soll uns anschließend beschäftigen.
Drittens
ist die Frage nach Wissen und Werten natürlich kein Selbstzweck. Wir gehen von der Überzeugung aus, dass Werte auf eine genauer zu beschreibende Weise die Kerne von Kompetenzen bilden.
Was „sind“ Kompetenzen und wie werden sie vermittelt?
So müssen wir nun fragen. Haben wir bisher nur angedeutet, welche grundlegenden Gesichtspunkte die neue Begrifflichkeit unvermeidbar machen und wie das Kompetenzdenken wichtige Lern- und Lebenssphären, etwa berufliche Aus- und Weiterbildung, universitäre Bildung, Unternehmen und Organisationen durchdringt, so wollen wir dann ein eigenes und praktisch erprobtes Kompetenzkonzept umreißen, davon ausgehend Methoden der Kompetenzerfassung charakterisieren und Wege der Kompetenzentwicklung andeuten. Die Kompetenzentwicklung im Netz ist einer davon – ein zunehmend wichtig werdender. Einer, der im Mittelpunkt unseres Nachdenkens steht.
Viertens
kann man dann und mit Hilfe dessen herausfinden, wie Kompetenzentwicklung mittels elektronischer Medien und geeigneter Software möglich werden kann. Es handelt sich insbesondere um die
Software des so genannten Web 2.0
, auch als
Social Software
bezeichnet. Sie ermöglicht, so eine zentrale These unseres Buches, jene grundlegenden Interiorisationsmechanismen, die einen Kompetenzerwerb erst möglich machen.
Fünftens
können wir auf dieser Basis die
E-Kompetenzentwicklung im Web 2.0
genauer beschreiben, ihre Einbindung in Lernarrangements untersuchen und schließlich Implementierungsprozesse für Kompetenzentwicklungs mit Blended Learning und Social Software (KOBLESS) vorschlagen, wobei auch auf neuere Ansätze des Netzlernens, des Konnektivismus zurückgegriffen wird.
Eine Lernrevolution ist im Gange. Ihr Ausgang ist, wie bei allen Revolutionen, die diesen Namen verdienen, ungewiss. Dazu, dass es ein gangbarer, guter, zukunftsweisender Ausgang sei, will unser Buch beitragen.
[1] vgl. Arbeitsgemeinschaft QUEM (Hrg.) (2006)
[2] Vonken, M. (2001), S.520
[3] so im englischen NVQ – System.
[4] DFG Projekt (2006)
[5] Klieme et al. (2003), S. 22
[6] Council of Competitiveness (1998)
[7] Baden-Württembergische Industrie-und Handelskammer (Hrg.)(2005)
[8] Rose, A.., Heintz, B. (2004), S.4
[9] Hedetmann, V., Bechert (2006), S.9
[10] EMA (2006), S.8
[11] Armbruster, H., Kinkel, S., Kirner, E., Wengel, J. (2005), S.11
[12] Tenberg, R., Hess, B. (2005)
[13] Klimmer, M., Neef, M. (2004), S.10
[14] Roth, H. (1971)
[15] Sloane, P. F., Dilger, B. (2005), S.6
[16] Institut der deutschen Wirtschaft (2006)
2.1 Was „ist“ Wissen und wie wird es vermittelt?
Unendlich ist die Zahl der Wissensdefinitionen. Im Zeitalter der „Wissensgesellschaft“, des „Wissensmanagements“ haben viele Wissenschaftler, Wirtschaftler, Politiker und Philosophen versucht, Schneisen ins Wissensdickicht zu schlagen. Auch Wissen ist ein „Begriff für das verwertbare Ungefähre“. Vielleicht bleibt im sozialwissenschaftlichen Bereich, was sich verwerten lässt, stets im Ungefähren und lässt sich, was exakt definierbar ist, kaum verwerten?
2.1.1 Wissensverständnis
Wir maßen uns nicht an darzustellen, was Wissen „ist“ – deshalb die Anführungszeichen. Worauf wir hinaus wollen, ist etwas anderes, für den Einsatz von Lernsoftware, insbesondere für die Unterscheidung von Lernsoftware des Web 1.0 und des Web 2.0 Entscheidendes. Unabhängig von Definitionsnuancen, so wird sich zeigen, gibt es Wissensbegriffe im engeren – Regeln, Werte und Normen, Emotionen und Motivationen ausschließenden – Sinne und Wissensbegriffe in einem weiteren Sinne, alle Bewusstseinsresultate, auch die vagen, wertenden wie Glauben und Meinen, und die damit verbundenen Emotionen und Motivationen einschließend. Das wäre kein Problem, liefen diese beiden Begriffe nicht so oft über- und ineinander. Das Management von Wissen im engeren Sinne läuft beispielsweise auf ein Informationsmanagement hinaus. Das Management von Wissen im weiteren Sinne ist in der Regel mit einem Kompetenzmanagement identisch. [1]
Hinter dieser Unterscheidung steckt allerdings viel mehr, als terminologischer Wirrwarr. Es geht vielmehr darum, zu verstehen, wie wir Menschen in unserem individuellen und sozialen Handeln bestimmte Bereiche unserer Bewusstseinsresultate als das, „was wir zu wissen glauben“, [2] als Wissen, ausgliedern und andere Bereiche in höchst kunstvoll wertverwobene, erfahrungsgesättigte und tief emotionsgetränkte, symbolisch unterlegte, vielfältig ritualisierte Kulturbezüge, in die Welt der „symbolischen Formen“ eingliedern. Dazu wird uns ein Ansatz von Siegfried J. Schmidt den entscheidenden Schlüssel liefern.
Wissen, so umreißt es die Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie ist „ebenso wie Erkenntnis und die mit diesem Begriff verbundenen Unterscheidungen …
im
weiteren
Sinne eine Bezeichnung für allgemein verfügbare Orientierungen im Rahmen alltäglicher Handlungs- und Sachzusammenhänge (Alltagswissen);
im
engeren,
philosophischen und wissenschaftlichen Sinne für die auf Begründungen bezogene und strengen Überprüfungspostulaten unterliegende Kenntnis, institutionalisiert im Rahmen der Wissenschaft.“
[3]
Damit unterscheidet sich dieser Begriff von Meinen (Meinung) und Glauben (Glaube).
Diese Doppelsicht findet sich in vielen Erklärungen wieder. Der engere Wissensbegriff wird benutzt, wenn erklärt wird: „Wissen ist das Ergebnis der Verarbeitung von Informationen durch das Bewusstsein und kann als verstandene Information bezeichnet werden. Wissen ist die Vernetzung von Informationen, welche es dem Träger ermöglicht, Handlungsvermögen aufzubauen und Aktionen in Gang zu setzen. Es ist das Resultat einer Verarbeitung der Information durch das Bewusstsein.“ [4] Damit gehören zum Wissen im engeren Sinne:
Die Kerngegenstände der Logik: Termini, Aussagen und Operatoren.
Daten:
Als Einzelinformationen innerhalb umfassenderer Informationssysteme, die Bezugsinformationen in Gestalt von geordnetem Datennetzen und Theorien voraussetzen.
Informationen.
Als kontextbezogen verknüpfte Daten, wobei Kontexte alle explizit fassbaren physischen oder geistigen Dinge, Eigenschaften, Relationen und Prozesse sein können.
Sachwissen, Methodenwissen und
Kenntnisse.
Vorsichtiger erklärt der „Europäische Leitfaden zur erfolgreichen Praxis im Wissensmanagement“: “Wissen ist die Kombination von Daten und Information, unter Einbeziehung von Expertenmeinungen, Fähigkeiten und Erfahrung, mit dem Ergebnis einer verbesserten Entscheidungsfindung. Wissen kann explizit und/oder implizit, persönlich und/oder kollektiv sein.“ [5] Mit der berühmten Unterteilung in explizites Wissen[6] und implizites Wissen[7] werden Werte in den Wissensbereich hineingeholt. Das erschwert die Beschreibung, erhöht aber ihren Realismus. [8]
Der enge Wissensbegriff versteht unter Wissen nur das gleichsam positive Sachwissen von der Wirklichkeit, also Kenntnisse, die von Regeln, Werten, Normen, Kompetenzen und Erfahrungen, von Emotionen und Motivationen strikt abgehoben, gleichsam wertfrei sind. [9] Am genauesten wird - obwohl wissenschaftstheoretisch nach wie vor stark umstritten - der Wertfreiheitsbegriff bei Max Weber eingeführt. Ihm geht es darum, Wertung, Bedeutung, Sinn in das Vorfeld der gesetzeswissenschaftlichen Analyse naturwissenschaftlicher und sozialer Erscheinungen zu verweisen. Zwischen der logisch - vergleichenden Beziehung der Wirklichkeit mittels Kategorien und der wertenden Beurteilung dieser Wirklichkeit liegt ein scharfer Schnitt: "Die Beziehung der Wirklichkeit auf Wertideen, die ihr Bedeutung verleihen, und die Heraushebung und Ordnung der dadurch gefärbten Bestandteile des Wirklichen unter dem Gesichtspunkt ihrer Kulturbedeutung ist ein gänzlich heterogener und disparater Gesichtspunkt gegenüber der Analyse der Wirklichkeit auf Gesetze und ihrer Ordnung in generellen Begriffen." [10] Wissenschaftlichkeit bedeutet in dieser Sicht also eine Beseitigung von Werturteilen aus den Erkenntnisresultaten. In einem solchen Denkrahmen lässt sich dann das Verhältnis von Wissen einerseits und Regeln, Werten, Normen, Kompetenzen, Erfahrungen, Emotionen und Motivationen andererseits diskutieren.
Wissensmanagement reduziert sich auf Informationsmanagement, das die gerichtete Wissensweitergabe an Arbeitnehmer und Manager in einem bildungstechnologischen Sinne einschließt. Informationen werden dann meist so bereitgestellt und aufgearbeitet, wie es lange Zeit das traditionelle Bildungssystem organisiert hat und wie es aus der Sicht von Bildung als Bringschuld auch sinnvoll ist: Auswahl, Reihenfolge und Art der Darbietung werden vom Lehrenden geleistet. Auf Basis dieser Inputorientierung wird die Information dem Lernenden angeboten. Das gilt auch für viele netz- und multimediagestützten Lehrangebote. Feinheiten der Vermittlung dieses Wissens im engeren Sinne sollen uns hier nicht weiter interessieren; jeder, der einst Schule oder Universität durchlief, kennt eine solche Art der Wissensvermittlung.
Deutlich auf Wissen im weiteren Sinne bezogen ist dagegen der Hinweis: „Wissen entsteht in den Köpfen der Menschen, indem Informationen wahrgenommen, bewertet und mit subjektiven Erfahrungen in Beziehung gesetzt werden.“ [11] Noch umfassender die Erklärung der Kognitionsphilosophen Mario Bunge und Ruben Ardila: „Wir wissen alles, was wir je gelernt (und nicht vergessen) haben. Das schließt auch einige Fertigkeiten ein, wie Gehen und Essen, die zwar in Instinkten wurzeln, jedoch geübt und kontrolliert werden müssen, um beherrscht zu werden. Nicht zum Wissen gehören dagegen die angeborenen Reflexe...Kurz, das Gesamtwissen eines Lebewesens besteht in dem, was es gelernt hat. Und das Wissen einer Spezies besteht in der Gesamtheit alles dessen, was sich ihre Angehörigen zu eigen gemacht haben.“ [12]
Dieser weite Wissensbegriff ist auf das gesamte - stets wertende, in Kompetenzen und Erfahrungen eingebundene - Tun und Lassen, auf das geistige und physische Handeln des oder der Lernenden bezogen. Dann gehören Werte, Kompetenzen, Erfahrungen usw. natürlich zum Wissen hinzu. Im Bereich des modernen Wissensmanagements lässt sich eine Fülle umfassender Versuche kennzeichnen, Wissen in einer so breiten Dimension zu charakterisieren und entsprechende Wissensformen zu differenzieren. [13] Oft wird ein spezifischer Selbstorganisationsansatz – der radikale Konstruktivismus – zum Ausgangspunkt für das Verständnis von Wissen und Wissensmanagement gewählt. [14] Von einem solchen ausgehend plädieren Reinmann-Rothmeier und Mandl ausdrücklich für eine Höherbewertung von Gefühl, Intuition und Kreativität beim Umgang mit Information und Wissen. Wissen muss ihrer Ansicht nach mit Werthaltungen verknüpft werden. [15] Noch weitergehendere Vorschläge wollen Werte zum eigentlichen Kern von Wissens- und Unternehmensmanagement (Managing by Values) machen. [16]
In ähnlicher Allgemeinheit wie Bunge und Ardila stellt Guido Franke, die wissenszentrierte Perspektive von Kompetenzen analysierend, fest: „Wissen ist ursprünglich immer etwas im Gedächtnis eines Individuums Gespeichertes. Bei dem Wissen handelt es sich um im Gedächtnis eingetragene Resultate psychophysischer Prozesse, insbesondere von sensorischen, motorischen und kognitiven Operationen.“ Indem er auf die in den Kognitionswissenschaften weit verbreitete Unterscheidung zwischen deklarativem Wissen (=“wissen, dass“) und prozeduralem Wissen (=“wissen, wie“) hinweist, zieht er ebenfalls die Trennungslinie zwischen Wissen im engeren und weiteren Sinne und konstatiert, dass natürlich deklaratives zu prozeduralem Wissen werden kann und umgekehrt. Allerdings bestehe dabei das Problem, das Regeln, Werte und Normen, die das prozedurale Wissen durchdringen, meist nicht rückstandslos herausgefiltert werden können. Eine analoge Unterteilung finde sich bei Ryle, der bewusstseinsfähiges und verbal oder grafisch ausdrückbares Wissen („knowing that“) von Wissen unterscheidet, das nicht bewusstseinsfähig ist und sich nur in der Ausführung einer Handlung, einer Operation zeigt („knowing how“).
Franke selbst geht, eingedenk der enormen Vielgestaltigkeit von Wissen, in der Absicht, eine handlungsrelevante Wissenskategorisierung vorzulegen, von drei grundlegenden Wissensarten aus:
Sachwissen:
Dinge, Sachverhalte, Ereignisse, Vorgänge, Entwicklungen, Bedingungen, Regel- und Gesetzmäßigkeiten repräsentierend.
Motivatorisches
Wissen
: Eigene Verhaltenstendenzen, Bedürfnisse, Absichten, Wertvorstellungen betreffend.
Prozedurales
Wissen
: Eigene Operationen und Programme unterschiedlicher Komplexität betreffend.
[17]
Während prozedurales Wissen sowohl als Wissen im engeren wie im weiteren Sinne auftreten kann, ist die Unterteilung in Sach- und motivatorisches Wissen ein weiterer Versuch, Wissen in engerem und weiterem Sinne auseinander zu halten. Angemerkt sei, dass sich diese Unterteilung natürlich nur und stets auf die Resultate von Erkenntnis- und Lernprozessen bezieht. Innerhalb dieser Prozesse selbst sind sachbezogene, motivatorisch-wertende und prozedurale Aspekte natürlich unauflöslich miteinander verschweißt.
Dennoch ist es sinnvoll, zu fragen, ob und wie die unterschiedlichen Wissensarten angeeignet und vermittelt werden. Schon ein grober Blick auf die Speicherorte von Wissen, wie ihn Franke anregt, zeigt, dass man neben dem rein sensorischen Gedächtnis zumindest drei große Wissensbereiche unterscheiden muss, die sich nach Gedächtnistyp, Wissensinhalt und Speicherort unterscheiden:
das
motorisch – prozedurale
Gedächtnis, das Fertigkeiten und zugehörige Handlungsabläufe in den sogenannten Basalganglien
[18]
und im Kleinhirn speichert,
das
episodische und das semantische
Gedächtnis, das Orte und Handlungen sowie sprachliche, also bewusstseinsfähige Inhalte in der rechten und linken Sphäre des Großhirns speichert,
und das
emotionale
Gedächtnis, das emotional-motivationale Wertungen im Thalamus
[19]
und der Amygdala
[20]
speichert.
Selbst in diesem wahrlich groben Raster ist klar, dass Fertigkeiten anders als episodisches und semantisches Wissen im engeren Sinne vermittelt werden müssen, und dass sich die Vermittlung von emotional-motivationalen Inhalten davon völlig unterscheidet, weil gänzlich andere Speicherorte und Speichermechanismen angesprochen sind. Wir werden dies kurz im Abschnitt zur Vermittlung von Wissen (im engeren Sinne), und ausführlicher im Abschnitt zur Vermittlung von Werten behandeln. Dabei ist das Wort Vermittlung durchaus mit Vorsicht zu gebrauchen. Es erinnert an die traditionelle Aus- und Weiterbildung, die ja beim Wertlernen so gerade nicht funktioniert, wie wir mehrfach zeigen werden. Deshalb benutzen wir Wertvermittlung synonym zum Ausdruck intendierte Kompetenzentwicklung, [21] Kompetenzentwicklung wird durchgehend als selbstorganisativer Prozess aufgefasst.
[1] vgl. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (1999)
[2] Schmidt, S.J. (2003), S. 11-26
[3] Mittelstraß, J. (1996), S.719
[4] Bullinger, H.-J.; Wörner, K.; Prieto, J. (1997)
[5] Heisig, P., Krisper-Ullyett, L., Ortner, J., Will, M.. (2004), S.10
[6] (1) standardisiert, methodisch und systematisch in Systemen, Strukturen, Prozessen, Technologien, in Dokumentationen, Bibliotheken und Datenbanken, Marken, Patenten angelegt; (2) in formaler Sprache artikulierbar und beschreibbar, z.B. in grammatikalischen oder mathematischen Ausdrücken; (3) prinzipiell allgemein verfügbar; zeitlich stabil
[7] (1) subjektive Fähigkeiten und Kompetenzen, nach denen die eine Person oder ein System handelt; (2) meist um Regeln, Werte und Normen zentriert, ohne dass sie vollständig beschreibbar sind; (3) mentale Modelle, Glaubens-/Rechtfertigungssysteme, die unser Bild der Realität bestimmen; (4) Besitzer können Personen, Gruppen, Firmen, Netze usw. sein
[8] Nonaka, I., Takeuchi, H. (1997)
[9] H.Keuth (1989)
[10] Weber, M. (1989), S.79
[11] Fraunhofer ISST (1998): Jahresbericht 1998
[12] Bunge, M., Ardila, R (1990), S. 294
[13] Romhardt, K. (1998)
[14] vgl. Götz, K.(1999)
[15] Reinmann-Rothmeier, G., Mandl, H.(1999),: S.12 ff.
[16] Blanchard, K.(1997)
[17] Franke, G. (2005), S.73 ff
[18] Basalganglien sind unterhalb der Großhirnrinde gelegene Kerne bzw. Kerngebiete, die für wichtige funktionelle Aspekte motorischer, kognitiver und limbischer Regelungen von großer Bedeutung sind.
[19] Thalamus: Größter Teil des Zwischenhirns, der bei der Modulation der ein- und ausgehenden Informationen zum Großhirn eine wichtige Rolle spielt.
[20] Die Amygdala (Mandelkern) ist ein Kerngebiet des Gehirns im medialen Teil des Temporallappens. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Entstehen von Emotionen.
[21] Arnold, R. (2005), S.170 f
2.1.2 Wissensvermittlung
Wissen im engeren Sinne kann prinzipiell – wenngleich pädagogisch zuweilen wenig vorteilhaft – instruktional in Form von Information oder kognitivistisch in Form von (lösbaren) Aufgaben und Problemen weitergegeben werden. Der fachlich-sachliche Input ist hier durchaus ein Maß für das Ergebnis, wenn man darunter die Menge reproduzierter und abfragbarer Kenntnisse versteht. Eine mathematische Ableitung, eine physikalische Theorie, eine chemische Formel kann man emotionslos lernen. Wie weit in das Verständnis der Grundbegrifflichkeiten dieser und anderer Wissenschaften bereits Erfahrungen, also lebensgeschichtlich erworbenes und bewertetes Wissen im weiteren Sinne eingeht, sei hier nicht erörtert.
Allein eine konstruktivistische, also selbstorganisationstheoretisch fundierte Form des Lehr-Lernens, die den Wissenserwerb als kenntis- und wertgesteuerten, zieloffenen Prozess beschreibt, kann die Vermittlung auch von Wissen im weiteren Sinne erfassen. Sie ist damit auch in der Lage, die Vermittlung von Kompetenzen, als Selbstorganisationsdispositionen, zu erfassen. Wir gehen später im Zusammenhang des E-Learning auf diese Grundtypen von Lerntheorien ausführlicher ein, und stellen hier nur kurz die zentralen lerntheoretischen Modelle nebeneinander [1]:
Tab. 1 Kernelemente lerntheoretischer Modelle
Wie Wissen pädagogisch vernünftig weitergegeben werden kann ist Gegenstand einer ganzen Disziplin, der Didaktik, die allerdings ebenso Wertvermittlungsprozesse beschreibt und operationalisiert. [2] Für unsere Fragestellung hier ist jedoch entscheidend, dass Emotionen und Motivationen, also verinnerlichte Werte, nicht Gegenstand, sondern nur Vehikel bei der Vermittlung von Wissen im engeren Sinne sind. Sie kommen erst beim konstruktivistisch - selbstorganisationstheoretischen Lernen ins Spiel.
Greifen wir ein beliebiges Beispiel aus dem Blended-Learning- Learning Programm einer Bank heraus. In einem spezifischen Programm für Bankmitarbeiter lauten die ersten beiden Schritte:
1. „Wissensvermittlung: Fachinhalte werden mit Hilfe [des Programms] vom Lerner erarbeitet, zum Beispiel Lesen der Lernhefte, Bearbeiten der Fallstudien, Üben mit den Fragen aus ‚Test it’.
2. Wissenskontrolle: Abgeben der „Superbuttons“ bzw. Weiterleitung der Lerndaten an den Ausbilder / Trainer. Hiermit wird gewährleistet, dass alle Lerner auf einen einheitlichen Wissensstand zurückgreifen können.“ [3]
Hier ist tatsächlich Wissen im engeren Sinne gefragt! Erst in weiteren Schritten der Wissensanwendung und Wissensvertiefung kommen dann Kompetenzen wie Selbstsicherheit, Selbständigkeit und Eigeninitiative ins Spiel.
Dabei reden wir keinesfalls der Ablösung von Wissensvermittlung durch Kompetenzvermittlung das Wort. Es gibt weite Bereiche, wo die schnelle, effektive Weitergabe von Sachwissen höchste Priorität genießt, wie etwa beim Wechsel einer Softwareversion, bei Einführung neuer Technik, bei Inkrafttreten neuer juristischer Regelungen, bei Erarbeitung von neuen Erkenntnissen, die man für die eigene Arbeit benötigt. Hier zählt vor allem die Kürze und Präzision der Weitergabe, die ja auch eine wirtschaftliche Dimension besitzt, die mnemotechnisch nachhaltige Gestaltung des Weitergabeprozesses, die Anbindung des dargebotenen Stoffes an die eigenen Emotionen. Wir glauben, dass mit der anwachsenden Flut des Wissens im engeren Sinne derartige Vermittlungsformen sogar noch zunehmen werden. Weniger in Formen von Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen als in solchen des – oft netzgestützten – Selbststudiums, des Besuchs von Messen und Fachveranstaltungen, des kollegialen Fachgesprächs, der Beteiligung an Projekten, die neue Sachkenntnisse erfordern. [4]
Benutzt man hingegen einen weiten Wissensbegriff, sind Kompetenzen natürlich ein Teil des Wissens und man muss ihre Besonderheiten von anderen Wissensformen abheben. Dabei ist klar, dass das Wissen im engeren Sinne eine Grundlage der Kompetenzen bildet. Es gibt Wissen im engeren Sinne ohne Kompetenzen und ihre Wertekerne, es gibt aber keine Kompetenzen und Werte ohne Wissen im engeren Sinne. Darüber hinaus schließen Kompetenzen aber Werte und Erfahrungen ein, die sich nur teilweise oder überhaupt nicht auf Wissen im engeren Sinne, auf explizites Sach- und Methodenwissen gründen und statt dessen zu verdeutlichendes Wissen oder deutende Werte einbeziehen. Das geht hin bis zum Glauben als bewertetem Nichtwissen. Wissensmanagement wird in diesem Falle weitgehend zum Kompetenzmanagement. [5] Kompetenzmanagement erfordert Wertvermittlung.
Aber was sind Werte? Und wie werden sie vermittelt? Ohne das zu begreifen, kann es unserer Ansicht nach keine praktikable Darstellung von Kompetenzentwicklung und Kompetenzmanagement geben, kann Kompetenzentwicklung im Netz nicht verstanden und beschrieben werden.
[1] Mair, D. (2005).
[2] Kahlert, J. (2005)
[3] Graf, J. (2006), S.51
[4] Erpenbeck, J., Heyse, V. (2007)
[5] Probst, G. J., Deussen, A., Eppler, M., Raub, S. P. (2000)
2.2 Was „sind“ Werte und wie werden sie vermittelt?
Wir versuchen, zunächst ein breit akzeptierbares Wertverständnis aufzubauen, bevor wir uns der zentralen „Drehscheibe“ der Kompetenzentwicklung, der Wertaneignung (Interiorisation) zuwenden.
2.2.1 Wertverständnis
Ehe wir auf die Frage antworten, was Werte „sind“, gilt es, mit einem weit verbreiteten Urteil, ja Vorurteil aufzuräumen. Die folgende Abbildung zeigt eine ziemlich typische Unternehmenssicht.
Abb. 2 Typische Unternehmenssicht von Werten
Werte sind hier ausschließlich in der oberen Etage der normativen Leitlinien, Visionen und Grundsätze angesiedelt. Sie erscheinen als etwas Hehres, Entrücktes, aber auch schnell Veränderbares. Also auch als etwas, worauf man in der „niedrigen“, alltäglichen Praxis nicht unbedingt zu achten braucht. Auch in unserem sonstigen Leben denken wir oft ausschließlich an hehre Ideale, wenn wir über Werte sprechen: Eine saubere Umwelt, gute Entlohnung, Rechtssicherheit, soziale Sicherheit, Arbeit, Gesundheit, Partnerschaft, Demokratie, Freizeit, Bildung, Freunde, Wohlstand usw.
Eine solche Sicht ist aus zwei Gründen problematisch. Die substantivierte Form zeigt schon an, dass man sich solche Werte gleichsam als „Gegenstände“, als etwas Objektives vorstellt. Um diese Frage wurde ein langer Kampf in der philosophischen Werttheorie geführt (Wertsubjektivismus contra Wertobjektivismus [1] ), heute besteht weitgehende Übereinstimmung, dass Werte immer eine Relation darstellen: Ein Subjekt, d.h. ein Mensch, eine Gruppe, ein Unternehmen oder eine Nation, bewertet ein Objekt, ein Ding, eine Eigenschaft, einen Sachverhalt oder eine Beziehung auf der Grundlage von früherem Wissen und früher angeeigneten Werten und anhand von sozial erarbeiteten Wertmaßstäben. [2] Produkte von so ablaufenden Wertungsprozessen sind Wertungsresultate – kurz: Werte.
Damit ist klar, dass Werte unser gesamtes Denken und Handeln durchdringen, dass es großer Anstrengungen bedarf, sie für bestimmte analytische, algorithmische Entscheidungsprozesse auszuschließen. Jeder Mensch wertet in nahezu jedem Augenblick seines Handelns. Er richtet sich, oft mehr ahnend als wissend, danach, welchen Genuss oder Nutzen, welches ethische Gefühl oder welche politische Bestärkung ihm sein Handeln zu vermitteln vermag. Ohne Werte wäre der Mensch nur ein wissensgesteuerter Automat.
Davon ausgehend können wir einige Essentials formulieren, welche die Bedeutung von Werten umreißen, und ihre große Bedeutung für unser Verständnis von Kompetenzen sichtbar machen. Es sind dies:
Die allgemeinste Bestimmung von Werten
Werte sind Bezeichnungen dafür, “was aus verschiedenen Gründen aus der Wirklichkeit hervorgehoben wird und als wünschenswert und notwendig für den auftritt, der die Wertung vornimmt, sei es ein Individuum, eine Gesellschaftsgruppe oder eine Institution, die einzelne Individuen oder Gruppen repräsentiert.”
[3]
Werte sind damit stets das geistig-symbolische Resultat von Wertungsprozessen (= Wertungen), also Wertungsresultate.
Die Struktur von Werten
Sie verknüpft das Beziehungsfeld Subjekt der Wertung, Objekt der Wertung, Grundlagen der Wertung (wozu auch alle Kenntnisse und bisherigen Werte gehören) und Maßstäbe der Wertung mit Prädikaten zu Wertaussagen.
[4]
Abb. 3 Struktur der Werte
Die Fülle von Werten
Wir knüpfen hier an die Feststellung an, jeder Mensch werte in nahezu jedem Augenblick seines Handelns und stellen fest, dass zu dieser Fülle alle sprachlich gefassten oder sprachlich fassbaren Wertungsresultate gehören, die explizit Empfindungen, Gefühle, Wünsche, Vermutungen, Zweifel, Befürchtungen, Hoffnungen, Bedürfnisse, Interessen, Einstellungen, Meinungen, Haltungen, Ansichten, Überzeugungen, Vorurteile, Ablehnungen usw. enthalten. Sie können von einzelnen Menschen oder Menschengruppen (Individuen, Familien, Arbeitsgruppen, Gemeinschaften, Schichten, Klassen, Völker, Nationen, Staaten usw.) hervorgebracht werden und sich z.B. auf die Wertung von Genuss (hedonistische Werte), Nützlichkeit (utilitaristische Werte), Schönheit (ästhetische Werte), Moral (ethisch - moralische Werte), Politik (politisch - weltanschauliche Werte) usw. beziehen.
Die grundlegende Funktion von Werten
Sie besteht in der Ermöglichung von Handeln in einer unüberschaubaren, hochkomplexen, selbstorganisativen Welt. Die Zukunft ist objektiv offen. Von ihr sind unter keinen Umständen vollständige Kenntnisse zu gewinnen. Werte ermöglichen ein Handeln unter der daraus resultierenden prinzipiellen erkenntnismäßigen Unsicherheit. Sie “überbrücken” oder ersetzen fehlende Kenntnisse, schließen die Lücke zwischen Kenntnissen einerseits und dem Handeln andererseits. Sie haben zuweilen den Charakter extrapolativen Scheinwissens, abergläubischer Gewissheit. Das reicht bis zum Glauben als bewertetem Nichtwissen.
Die systemische Erklärung von Werten
Werte können besonders gut von den heute breit anerkannten Selbstorganisationstheorien, dem Konstruktivismus und der Synergetik, beschrieben werden. Die Synergetik fasst Werte als Ordnungsparameter (Ordner) individuellen und sozialen Handelns unter der dargelegten prinzipiellen kognitiven Unsicherheit.
[5]
Kurzum: Es gibt kein kompetentes Handeln ohne Werte – Werte konstituieren kompetentes Handeln. Wenn wir verstehen, wie Werte angeeignet werden, verstehen wir, wie Kompetenzen angeeignet werden. Wenn wir verstehen, wie Kompetenzen angeeignet werden können wir beurteilen, welche netzvermittelten Lernmethoden sich zu diesem Zweck besser und welche sich weniger eignen. Das ist unser Ziel.
[1] Erpenbeck, J. (1984), S.305 ff
[2] Iwin,A.A. (1975).
[3] Baran,P.(1990), S.805
[4] Iwin, A.A. (1975)
[5] Haken, H.(1996), S.588
2.2.2 Wissen, Werte, Kompetenzen – ein Modell
Wissen im engeren Sinne und Werte haben wir aus guten Gründen begrifflich getrennt. Andererseits sind sie natürlich im alltäglichen Denken und Arbeiten unzertrennlich verbunden. Nur wenn wir wissenschaftlich denken, wissenschaftlich arbeiten, sind wir gezwungen, sie ziemlich scharf auseinander zu halten. Der wirkliche Zusammenhang wird über die menschliche Kultur gestiftet. Wir benutzen ein Modell von Siegfried J. Schmidt, um diesen Zusammenhang begreifbar zu machen.
Wenn wir Menschen über die Realität, über die Wirklichkeit reden, so reden wir immer auch über eine sprachlich verfasste, gedachte, beschriebene, analysierte, bewertete Wirklichkeit. Unsere sprachlichen Wirklichkeitsmodelle schieben sich wie ein gigantischer Apparat zwischen unser Wollen und unser Tun. Wenn wir über Realität und Wirklichkeit reden, dann immer von solchen Wirklichkeitsmodellen aus. Die Wirklichkeit selbst, die „Dinge an sich“ , sind für uns, wie Kant bleibend nachwies, gedanklich nicht erreichbar. Nimmt man diesen Standpunkt ein, so ergibt sich ein sehr einleuchtendes, weiterführendes Bild dessen, was wir Kultur nennen. Zugleich gestattet dieses Bild, die Rolle des Wertens und der Werte in kulturellen Prozessen zu beschreiben. Da diese Werte zugleich die Grundlage der menschlichen Kompetenzen, also der Dispositionen für das selbstorganisierte Handeln von Menschen, Gruppen, Teams, Unternehmen, Organisationen, Regionen usf. darstellen, muss hier eine enge Verbindung bestehen.
Alles, was wir erkennen, können wir nur in Form von Identität und Unterschied erkennen. Wir nehmen die Identität von „Dingen“ nur wahr in Abgrenzung von anderen Dingen, von der Umgebung. Dabei sind die Dinge nicht „naturgegeben“, sondern stets Produkte einer geistigen Operation, einer „Invariantenbildung“ im menschlichen Denken und Handeln. [1] Die entsprechend entworfene „Realität“ ist in der Tat eine Wirklichkeitskonstruktion um handeln zu können, nicht ein Wirklichkeitsabbild. Das Schmidt’sche Kulturkonzept, das uns zum Verhältnis von Wissen, Werten und Kompetenzen führen soll, beruht auf einer spezifischen „Distinktionstheorie“. [2]Distinktionen sind Verschiedenheitsfeststellungen an umfassenderen Identitäten. Sie können in zwei Formen auftreten: Als Differenzenkonstatieren sie Verschiedenheiten an Identitäten (z.B. das Bügeleisen, als immer identischer Gegenstand, kann im Sinne einer Differenz heiß oder kalt sein); als Unterscheidungenbewerten sie die konstatierten Differenzen (nur das heiße Bügeleisen ist nützlich). Wenn man Distinktionen als Bestandteile eines – stets sozial entwickelten – Wirklichkeitsmodells deutet, betritt man den Bereich des menschlichen Handelns, Erfahrens und Denkens. Im Handlungs- und Kommunikationsprozess werden immer weitere Operationen der Differenzbildens, Unterscheidens und Benennens vorgenommen.
Analytisch kann man nun die Resultate dieser Operationen in zwei grundlegende Bereiche trennen. Die Gesamtheit der wertneutralen Differenzen konstituiert ein sozial erarbeitetes Wirklichkeitsmodell (W), eine sozusagen „wertfreie“, auf Wissen im engeren Sinne gestützte Beschreibung dessen, wie die Wirklichkeit oder Wirklichkeitsausschnitte gedacht werden. Ein solches Wirklichkeitsmodell ist die Voraussetzung jeden sinnvollen Handelns.
Davon ausgehend können Handlungen in wertenden Unterscheidungsakten zum Beispiel als mehr oder weniger genussvoll (hedonistisch), nützlich oder schädlich (utilitaristisch), Schönes oder Hässliches hervorbringend (ästhetisch), moralisch oder unmoralisch (ethisch), soziale Strukturen, sozialen Fortschritt fördernd oder hemmend (politisch) unterschieden und beurteilt werden. Die Gesamtheit der die Differenzenseiten bewertenden Unterscheidungen spannt ein sozial erarbeitetes Kulturprogramm (K) auf. Während das Wirklichkeitsmodell die Basis des Handelns darstellt, ist das Kulturprogramm ein Ordner des Tuns, des Handelns.
Wirklichkeitsmodell und Kulturprogramm bedingen einander: Differenziert wird nur, was verhaltens- und handlungsmäßig wichtig ist, gehandelt werden kann nur angesichts bewerteter, kulturell eingebetteter Differenzen. Wirklichkeitsmodell und Kulturprogramm entwickeln sich aufeinander bezogen. Sie bilden einen Wirkungszusammenhang (W&K).
Während zahlreiche Wirklichkeitsmodelle vielen Menschen gemeinsam und oft unstrittig sind, unterscheiden sich die Kulturprogramme oft radikal. Sie sind die kulturelle Identität stiftenden Bestandteile des Wirkungszusammenhangs W&K.
Abb. 4 Wirkungszusammenhang W & K
Nicht was Unternehmen und was ihre wesentlichsten Aktivitäten sind, ist beispielsweise umstritten, sondern was ein gutes und erfolgreiches Unternehmen ausmacht und wie dieses optimal am Markt agieren, also welcher Unternehmenskultur es folgen sollte.
Was Lernen ist und welche Lernorte, Lernprozesse, Lernresultate es gibt, lässt sich heute ziemlich widerspruchslos umreißen; welche Lernorte, Lernprozesse und Lernresultate jedoch die wichtigsten, zukunftssichernden sind, wie wir sie also bewerten und dementsprechend eine künftige Lernkultur gestalten müssen, ist weitgehend offen und wird sehr kontrovers diskutiert.
Wirklichkeitsmodell und Kulturprogramm sind durch das geistige, physische und kommunikative Handeln des Menschen unauflöslich miteinander verwoben. Zwischen dem Wirklichkeitsmodell und dem Kulturprogramm vermittelt ein ständiger, die Unterscheidungsseiten entwertender Erkenntnisprozess und ein die Differenzseiten hervorhebender Wertungsprozess. Die Resultate des ersteren sind Termini, Aussagen, Operatoren und daraus zusammengesetzte Gebilde wie Beschreibungen, Theorien, Metatheorien, also Wissen im engeren Sinne. Die Resultate des letzteren sind Regeln, Werte und Normen, die in das Kulturprogramm eingehen und die sich in verschiedensten kommunikativen Formen wie Bräuchen, Ritualen, und materialisierten Formen wie Kunstwerken, Architekturen, Moden usw. materialisieren. In der Tat: „Kultur ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens… Der Begriff der Kultur ist ein Wertbegriff...”. [3]
Hier sollen allerdings nicht die vielfältigen Formen von Wirklichkeitsmodellen, Kulturprogrammen, Erkenntnis‑ und Wertungsprozessen untersucht werden. Stattdessen wollen wir uns der entscheidenden, für die Kompetenzaneignung zentralen Frage zuwenden: Wie werden Regeln, Werte und Normen für uns zu etwas Eigenem, Handlungsleitenden, zu eigenen Emotionen und Motivationen? Es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als die Drehscheibe jeder Kompetenzentwicklung, auch und vor allem der Kompetenzentwicklung im Netz.
[1] Erpenbeck, J. (1980)
[2] Jokisch, R. (1996)
[3] Weber, M. (1989), S.78
2.2.3 Wertvermittlung
Werte lassen sich nicht instruktional vermitteln. Lydia Boshowitsch unterscheidet, anknüpfend an Bluma Zeigarnik "bloß bekannte", gelernte und "unmittelbar wirksame" interiorisierte Werte. [1] Auch der Mörder weiß, dass man nicht töten darf. Jedem Kind bringen wir die zehn Gebote, oder zumindest einige davon, in der einen oder anderen Form bei. Oft kann es diese auswendig hersagen. Deshalb hat es sich diese noch lange nicht angeeignet, zu Emotionen und Motiven seines eigenen Handelns gemacht.
Es ist, wie mit den eigenen Erfahrungen. Dabei handelt es sich ebenfalls um Wissen im weiteren, emotions- und motivationsgestützten Sinne, das durch die Menschen in ihrem eigenen geistigen oder gegenständlichen Handeln selbst gewonnen wurde und unmittelbar auf einzelne Erlebnisse dieser Menschen zurückgeht. In diesem selbst Gewonnen- und unmittelbar Erlebtsein liegt ganz offenbar die bildungsrelevante Pointe der Erfahrung. Natürlich lassen sich Erfahrungen vermitteln - aber nur in Form von Wissen im engeren Sinne, von Kenntnissen, nicht als Erfahrungen desjenigen, dem sie vermittelt werden sollen.
Erfahrung kann man nur selbst machen. Sie können nur selbst handelnd, selbstorganisiert gewonnen werden. Jedes selbst und unmittelbar gewonnene Wissen eines Menschen ist durch die in Lebens- und Erlebensprozessen vor sich gehende Ausbildung von Emotionen, Motivationen, Willensentscheidungen, Werten und individuellen Kompetenzen flankiert. Jeder von Gruppen, Unternehmen, Organisationen usw. erzielte Wissensgewinn ist von einer in Lebens- und Erlebensprozessen gegründeten Ausbildung von Werten, Normen, Regeln und überindividuellen Kompetenzen, beispielsweise Team-, Unternehmens- oder Organisationskompetenzen, begleitet. Erfahrungen sind stets Komplexe von Wissen und Werten, zu eigenem Gedächtnisbesitz und zu eigenen Emotionen und Motivationen „verinnerlicht“. „Erfahrung nennt die Subjektivität des Subjekts" [2] heißt es kurz und bündig bei Heidegger.
Auch Werte werden durch die Menschen in ihrem eigenen geistigen oder gegenständlichen Handeln selbst angeeignet und gehen unmittelbar in die einzelnen Erlebnisse dieser Menschen ein. Auch bei ihnen lässt sich nur das den Werten zugrunde liegende Wissen im engeren Sinne, lassen sich nur die begründenden Kenntnisse vermitteln, aber nicht als Werte für denjenigen, dem sie vermittelt werden sollen. Werte können nur selbst handelnd, selbstorganisiert angeeignet werden. Dieser Aneignungsprozess wird psychologisch als Interiorisation (oft auch Internalisation) bezeichnet.
Es gibt drei Bereiche, in denen man aus unterschiedlichen Gründen Interiorisationsprozesse von Werten untersucht:
1. Die Emotions- und Motivationspsychologie analysiert generell, wie Emotionen und Motivationen in Wertungsprozessen entstehen, gedächtnismäßig verankert und im Handeln wirksam werden.
2. Die Psychotherapieforschung behandelt verschiedenen Therapieformen zugrunde liegende Prozesse als emotional-motivationales „Umlernen“ von Wertungen.
3. Beschreibungen von Gruppendynamik schildern die emotional-motivational wertenden Veränderungen der Gruppenmitglieder innerhalb dynamischer Gruppenprozesse.
Die Darstellungen in allen drei Bereichen weisen zentrale strukturelle Gemeinsamkeiten auf, welche uns ermöglichen, den „Mechanismus“ der Wertinteriorisation sehr generalisierend abzuheben und auf das Wert- und Kompetenzlernen im Netz zu übertragen.
[1] Boshowitsch, L. I.. (1970), S.276
[2] Heidegger, M. (1980), S.176
2.2.4 Wertaneignung nach der Emotions- und Motivationspsychologie
„Ach die Werte“ kann man mit Hartmut von Henting seufzen[1]. Immer wenn in den moder-nen Gesellschaften die alte Frage nach dem Sinn des Lebens neu gestellt wird, wenn Sinnkrise und Orientierungsverlust in der Ego- und Ellenbogengesellschaft gegeißelt und ein generelles Unbehagen an der Kälte des Kapitalismus artikuliert wird, erklingt der Ruf nach Werten. Es erhebt sich ein immer wieder auftönender Klagegesang, der den Verlust von Werten betrauert und teils die Rückbesinnung auf alte, traditionelle, oder die Entwicklung neuer, menschheitsbessernder Werte fordert.[2]
Da die überkommenen, vor allem von den christlichen Religionen vermittelten Wertvorstellungen zunehmend obsolet werden und immer weniger dem individuumzentrierten Lebensgefühl der Menschen in modernen Industriegesellschaften entsprechen, werden Wertkonstrukte und Methoden der Wertvermittlung aus anderen religiösen oder zweifelhaft kultigen Quellen geschöpft. Die oft vergessenen Sphären von Herz, Seele und Gemüt, von Emotionen und Motivationen machen zugleich die individuell -subjektiven Seite von Werten und Wertewandel zum Thema.
[1] Von Henting, H. (1999)
[2] Sperry, R.(1985); Cummings, W.K., Gopinathan, S., Yasumada T. (Editors) (1988); Wickert,U.(1994); Küng,.H. (1994)
2.2.4.1 Emotionen und Motivationen
“Emotionen stellen einfach strukturierte Gefühle dar, die Umweltereignisse und Objekte, also Erfahrungen und Wahrnehmungen des Menschen erst einmal in einer ganz bestimmten Art bewerten; sie geben den Dingen um uns herum sozusagen ihre Bedeutung für uns und unsere innere Bedürfnislage”. [1] Dabei wollen wir uns nicht mit den teilweise beckmesserischen Unterscheidungen zwischen Emotion und Gefühl auseinander setzen. Wir benutzen die Anschauung, Gefühle seien nicht identisch mit Emotionen, sondern „bezeichnen das subjektive Erleben in emotionalen Zuständen“, bezeichnen psychophysische Zustände. [2] Da uns aber wenig mit einer Unterscheidung von hedonalgischem Differenzial (s.u.) und dem Erleben dieses Differenzials gedient ist und uns vielmehr die Verankerung des Gefühls in diesem Differenzial interessiert, werden wir Emotionen und einfach strukturierte Gefühle gleichsetzen, ohne andere Begriffe zu negieren. „Im Folgenden wird…dem Begriff <Emotion> der Vorzug gegeben. Gegenüber den Begriffen Gefühl (Betonung der Komponente der subjektiven Wahrnehmung), Affekt (Beiklang des Heftigen, Unkontrollierbaren), und Stimmung oder Gemütsbewegung hat er den Vorteil, dass er zur umfassenden Beschreibung emotionaler Prozesse benutzt werden kann.“ [3]
Etwas anderes, aber prinzipiell in ähnlicher Stoßrichtung wie in diesem Buch geht Luc Ciompi vor. Er hat seine Grundanschauung auf fünf Thesen komprimiert, die auch als Kernsätze für unser Herangehen gelten können. Auch er bedauert die breite Überlappung von Begriffen wie Affekt, Emotion, Gefühl und Stimmung. Er setzt Affekt als „umfassende körperlich-seelische Gestimmtheit oder Befindlichkeit von unterschiedlicher Qualität, Bewusstseinsnähe und Dauer“ als Oberbegriff über alle genannten, bewussten wie unbewussten gefühlsartigen Erscheinungen. [4]
Seine
erste
These besagt dann dass „Fühlen und Denken – oder Emotion und Kognition, Affektivität und Logik im weiten Sinn – in sämtlichen psychischen Leistungen untrennbar zusammenwirken.“
[5]
Die Wissenschaft gehe grundsätzlich von einer Rückführung der ganzen Affektvielfalt auf bloß positive und negative Gefühle im Sinne von Lust und Unlust aus (ganz analog dem nachfolgend erläuterten hedonalgischen Differenzial!), zumindest aber immer eindeutiger von einer kleinen Zahl von genetisch verankerten so genannten Grundgefühlen wie Neugier / Interesse, Angst, Wut, Freude, Trauer, bei einigen Autoren zusätzlich Schreck, Ekel und Scham. Die enorme Zahl von Nuancen dagegen ergibt sich aus der kognitiven und kulturellen Abwandlung von Grundgefühlen, wobei der Kognitionsbegriff allerdings ebenso wenig einheitlich verwendet wird und von den „kognitiven Neurowissenschaften“ auch auf den Bereich des Emotionalen ausgeweitet wird. Ciompi benutzt deshalb, wie auch hier vorgeschlagen, einen engen Kognitionsbegriff, wonach Kognition definiert wird als „die Fähigkeit, sensorische Unterschiede wahrzunehmen und weiter zu verarbeiten.“
[6]
Die
zweite
These besagt, dass Affekte im definierten Sinne „alles Denken und Verhalten nicht nur andauernd begleiten, sondern zu einem guten Teil auch regelrecht leiten.“ Emotionale, „affektive Wertungen teilen die begegnende Wirklichkeit aufgrund der Erfahrung in potenziell Angenehmes und Unangenehmes, Harmloses und Gefährliches etc. ein; und weitgehend unbewusste Operatoren sorgen auf dieser Basis dafür, dass Aufmerksamkeit und Gedächtnis, Denken und Verhalten sich diesen Wertungen selbstorganisatorisch anpassen. Alles in allem stellen Affekte … die bei weitem wirksamsten Komplexitätsreduktoren dar über die wir verfügen.“
[7]
Dies entspricht der Anschauung, Werte als Ordner selbstorganisierten Handelns im Sinne der Synergetik zu beschreiben.
Ciompis
dritte
These bildet in gewissen Sinne den Kern aller unserer Überlegungen, formuliert sie doch, warum ohne emotional – motivationale Verankerung, ohne Interiorisation (Internalisation) von Werten kein Kompetenzerwerb und kein kompetentes Handeln möglich sind „Meine dritte These besagt, dass situativ zusammengehörige Gefühle, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen sich im Gedächtnis zu funktionellen Einheiten im Sinne von integrierten Fühl-, Denk- und Verhaltensprogrammen (abgekürzt FDV – Programmen) verbinden, die sich in ähnlichen Situationen immer wieder neu aktualisieren, differenzieren und gegebenenfalls auch modifizieren.“
[8]
Die
vierte
These erklärt, dass emotionale Energien das kollektive Denken und Handeln ganz ähnlich wie das individuelle wecken, steuern und organisieren.
Und die
fünfte
These fasst zusammen: „Affekte sind die entscheidenden Motoren und Organisatoren aller psychischen und sozialen Entwicklung.“
[9]
Theorien sozialer Systeme, die individuelle Werte, Emotionen, Motivation und Kompetenzen marginalisieren, führen zu einem untauglichen Sozial- und Weltverständnis.
Kompliziert ist, dass Emotionen auf eine ganze Reihe von psychischen Zuständen und Prozessen einwirken, diese umgekehrt aber die Emotionen selbst beeinflussen oder verändern. Emotionen bewerten Zustände und Ereignisse, sie erzeugen Handlungsbereitschaft, positiv bewertete Zustände und Ereignisse herbeizuführen, sie werden vom Handelnden erlebt, zuweilen mit heftigen körperlichen Begleiterscheinungen. [10]Komponenten von Emotionen sind die kognitive (Reizbewertung), die neurophysiologische (Systemregulation), die motivationale (Handlungsvorbereitung), die ausdrucksbezogene (Kommunikation) und die gefühlsbezogene (Kontroll-) Komponente. [11] Die Motivation spielt hier also eine Rolle als eigene, zentrale Komponente, während Emotionen Motivationen grundieren und Handlungsbereitschaft initiieren.
Motivationen stellen kompliziert strukturierte Gefühle dar, die Umweltereignisse und Objekte, also Erfahrungen und Wahrnehmungen des Menschen in einer ganz bestimmten Art bewerten. Der Unterschied liegt wohl vor allem darin, dass Motivationen künftige Handlungen und Handlungsergebnisse in eher konkretisierter, mit konkretem Wissen „unterfütterter“ Form antizipieren, während Emotionen wertgesteuerte künftige Handlungen und Handlungsergebnisse in eher generalisierter Form antizipieren . [12] Motivationen greifen immer auch auf Emotionen zurück, lassen sich nicht unabhängig von ihnen begreifen; Emotionen münden in aller Regel in umfassendere Motivationen. Insofern handelt es sich meist um emotional-motivale Voraussetzungen von Handeln, die nicht auseinander zu trennen sind.
[1] Rost, W.(1990), S.42
[2] Arnold, R. (2005), S.140
[3] Merten, J. (2003), S. 12
[4] Ciompi, L. (2002),S. 18f
[5] ebenda, S.16
[6] ebenda, S.22
[7] ebenda, S.23 und 27
[8] ebenda, S.31
[9] ebenda, S.37
[10] Oatley, K., Jenkins, K. M. (1996)
[11] Scherer, K.R., Wallbott, H. (1990)
[12] Holzkamp-Osterkamp (1981); Erpenbeck,J.,(1984)
2.2.4.2 Prozesse des Wertewandels
Philosophen, Psychologen, Politiker, Soziologen, Manager und Pädagogen stehen vor den beiden zentralen Fragen:
- Wie ist der Prozess sozialen Wertewandels begreifbar, wie überlagern oder ersetzen neue Werte die alten, wie werden sie sozial erarbeitet; wie individuell verarbeitet und angeeignet. Das heißt: Wie werden sie zu freiwillig akzeptierten handlungsleitenden Emotionen und Motivationen des Einzelnen interiorisiert (internalisiert).
- Wie sind die psychischen “Mechanismen” individuellen Wertwandels beschaffen, auf deren Basis sich solche Aneignung vollzieht. Das heißt: Wie vollziehen sich die dazu notwendigen psychischen Abläufe der Interiorisation (Internalisation).
Auf die zweite Frage möchten wir uns hier konzentrieren, während zur ersten einige skizzierende Umrisse genügen mögen. Dies vor allem, weil es zu sozialen Wertwandelprozessen und ihrer Verflechtungen mit individuellem Wertewandel im Rahmen der Wertphilosophie und der Soziologie des Wertewandels bereits weiterreichende Arbeiten von uns [1] wie von anderen gibt [2] , während die zugrunde liegenden psychischen “Mechanismen” oft ausgespart blieben.
Die psychischen “Mechanismen” individuellen Wertwandels, der Aneignung von Werten (Rezeption, Interiorisation) und der Verständigung über sie (Kommunikation; Exteriorisation) bilden den entscheidenden Angelpunkt zwischen zwei Disziplinen, die, zu sehr unterschiedlichen Zeiten entstanden, traditionell sehr wenig miteinander zu tun haben: der soziologischen Wertwandelsforschung und der philosophischen Werttheorie, der Wertphilosophie.
Die soziologische Wertwandelsforschung erhielt ihren Anschub aus dem Werteumbruch, der sich in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts in nahezu allen wirtschaftlich und politisch entwickelten Ländern vollzog. In diesen Jahren wurde die “Revolution der Werkzeuge” von einer “Revolution der Denkzeuge” abgelöst. Die Computerwelt entstand, und mit ihr neue, auf Selbstentfaltung gerichtete Wertvorstellungen. Die Wertwandelsforschung entwickelte sich unter anderem, weil die traditionelle Wertphilosophie keine einzelwissenschaftlich verwertbaren Lösungen anbot und empirische Analysen kaum förderte, oder zur Kenntnis nahm. Die neue Disziplin untersucht, wie sich Einstellungen, Werturteile, Präferenzen usw. in Gruppen und größeren sozialen Einheiten verändern. Daraus versucht sie Regularitäten und tieferliegende Zusammenhänge zu ermitteln. Allerdings wird man in entsprechenden Arbeiten selten den Versuch finden, psychologisch zu begreifen, wie Werte interiorisiert und kommuniziert werden. [3]
Die philosophische Werttheorie, eigenständig seit der Entwicklung einer Wertphilosophie durch Lotze in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ihrer Weiterentwicklung durch Nietzsche, von Ehrenfels, von Meinong, Münsterberg, Ostwald, Kraft, Husserl, Rickert, Scheler, Messer und viele andere Denker ist Frucht einer Entwicklung, darin der Zeitraum des gesellschaftlichen Wertewandels aufgrund der beschleunigten wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Entwicklung deutlich kürzer als die mittlere durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen wird. Von diesem Punkt an beginnt sich der menschliche Zeithorizont von der Vergangenheit auf die Zukunft zu verlagern. Nicht mehr die abgeschlossene und deshalb gewisse Vergangenheit, sondern eine ungewisse, aber vorgeblich wissenschaftlich zu erschließende Zukunft bildet mehr und mehr den Orientierungsmaßstab für gegenwärtiges Handeln. [4] Je ungewisser die Zukunft, desto lauter wird der Ruf nach neuen Werten. Wertphilosophie ist Krisenphilosophie.
Jenseits von Wertobjektivismus und Wertrelativismus bietet eine genetische Werttheorie heute an, das Werten als grundlegende, in der bio - psycho - sozialen Entwicklung entstandene Potenz zu begreifen, die komplementär zur Aneignung von Wissen im engeren Sinne - und damit unauflöslich zusammenwirkend - das menschliche Handeln überhaupt erst ermöglicht. Sie hält die Notwendigkeit, dass Werte ein Entscheiden und Handeln trotz mangelnder oder fehlender Kenntnisse, unter kognitiver Unsicherheit ermöglichen und fehlende Informationen gleichsam “überbrücken” für den biotischen, psychischen, sozialen Normalfall. Sie analysiert, wie im Laufe der bio - psycho - sozialen Entwicklung immer neue, eng zusammenwirkende Formen des Wertens entstehen und via Überformung, Überschichtung und Parallelentwicklung miteinander zusammenhängen. [5]
Im Bereich der Verhaltensbiologie lässt sich die Entwicklung des Wertungsvermögens bis hin zu moral- und politikanalogem Verhalten verfolgen. [6] Im Bereich des Psychischen kann man der phylogenetischen, ontogenetischen und aktualgenetischen Entwicklung von Emotionen und Motivationen als den wichtigsten Wertungsinstanzen des konkreten Individuums nachspüren. [7] Insbesondere Luc Ciompis integratives psycho-sozio-biologisches Modell einer Affektlogik zeichnet bis heute vielleicht am eindruckvollsten die getrennt-untrennbare Wechselwirkung von wertend qualifizierendem Emotionssystem und quantifizierendem Kognitionssystem, komplementär zueinander wirkend, nach. [8] Im Bereich des Sozialen ließe sich eine Entwicklungsgeschichte des menschlichen Wertens und der entsprechenden sozial organisierenden Wertungen - etwa ästhetischer, religiöser, ethischer, politischer Werte und Wertsysteme - entwerfen. Wertentwicklung ist darin - wie jeder als Selbstorganisation beschreibbare Entwicklungsprozess [9] - zur Zukunft hin offen und kontingent; Menschen besitzen erhebliche Freiheitsgrade, ihre Werte selbst zu setzen, bis hin zum eigenen Untergang. Künftige Werte lassen sich deshalb prinzipiell nicht voraussehen und vorhersagen. Andererseits lassen sich, rückwärts betrachtet, immer objektive historische, ökonomische, soziale und geistige Determinanten der Wertentwicklung finden. Eine solche Asymmetrie zwischen Vergangenheit und Zukunft gilt für alle als Selbstorganisation beschreibbaren Entwicklungsprozesse.
Gehirnforscher postulieren ein eigenes emotionales Gedächtnis, wonach emotional-motivationale Wertungen im Thalamus34 und der Amygdala 35 gespeichert werden. Tiefer betrachtet, ist das eine der aufregendsten und für unsere Fragestellung wichtigsten Beobachtungen, die Friedhart Klix in einem Abschnitt seines „Erwachenden Denkens“ unter der Überschrift „Die Bewertungsfunktion tiefliegender Hirnstrukturen und die motivationale Basis kognitiver und kommunikativer Prozesse“ genauer beschreibt. Zunächst stellt er fest, dass das limbische System (u.a. Septum [10] , Amygdala, Hippocampus [11]