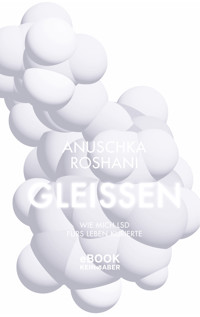11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alt sind immer nur die anderen, denkt man, bis man miterlebt, wie die eigenen Eltern, scheinbar auf ewig jung und schön, gebrechlich werden. Mit großem Staunen und Liebe, aber ohne Pathos erzählt Anuschka Roshani von den Lebenskapriolen ihrer ungewöhnlichen Eltern und klärt zugleich die Frage, wie sie selbst wurde, was sie ist.
»Das Buch ist so schön, so klug, so warm, so liebevoll, so melancholisch und komisch: Es hat ALLES. Es liest sich süchtig machend, und man liebt alles darin und daran.« Elke Heidenreich
»Man muss weder in der Mitte seines Lebens stehen noch mit der Krankheit der Eltern konfrontiert sein, um dieses Buch und seine Protagonisten gern zu haben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Anuschka Roshani sind bezaubernde Erinnerungen gelungen, an sehr ungewöhnliche Eltern, ein sprühend lebensfrohes Familienalbum.« Neue Zürcher Zeitung
»Ein wirklich gutes, gescheites Buch.« Tages-Anzeiger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Anuschka Roshani ist 1966 in Westberlin geboren, studierte Verhaltensbiologie und besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule, bevor sie viele Jahre Redakteurin und Reporterin beim Spiegel war. Seit 2002 lebt sie mit ihrer Familie in Zürich, wo sie für Das Magazin arbeitet. Bei Kein & Aber hat sie Truman Capotes Gesamtwerk herausgegeben.
ÜBER DAS BUCH
Die Eltern von Anuschka Roshani sind das genaue Gegenteil von lauen Seelen. Ihr Vater kam 1955 von Teheran nach Freiburg und wurde ein passionierter Chirurg, Frauenheld und Autofahrer. Ihre Mutter, ein Fotomodell, war nicht nur mit großer Schönheit, sondern auch mit einem großen Herzen gesegnet.
Sie sind die Protagonisten dieser außergewöhnlichen Familiengeschichte, die nicht nur eine Zeitreise in die Vergangenheit ist, sondern auch die Gegenwart einer Frau mittleren Alters beleuchtet.
1
Manchmal staune ich über mich. Darüber, dass ich, obwohl nur durchschnittlich hübsch, das Alter als einzige Belästigung betrachte, während sich meine bildschönen Eltern so viel leichter mit dem sichtbaren Älterwerden taten, als sie so alt waren wie ich.
Mir dagegen fällt jedes neue Fältchen unmittelbar nach seinem Entstehen auf. Dem Plissee unter meinen Augen widme ich mich mit wissenschaftlicher Akribie und einem Vergrößerungsspiegel für den Heimgebrauch – und bei diesen Untersuchungen meine ich sogar, eindeutig festgestellt zu haben, dass meine rechte Körperhälfte wie durch eine besondere Form von schwarzer Magie schneller altert als die linke. Außerdem nerve ich meinen Mann in regelmäßigen Abständen mit der Frage, ob ich jünger aussehe als die gleichaltrige X oder Y. Ich verberge den flehenden Unterton gar nicht mehr vor ihm, wenn er mir um meines Seelenheils willen bestätigen soll, dass ich um Längen jünger aussehe. Selbst Ausrufe wie »gar kein Vergleich mit dir!« habe ich beschlossen, ihm gänzlich unironisch abzukaufen.
Noch mit Anfang dreißig wurde ich von älteren Leuten häufig für eine frischgebackene Abiturientin gehalten. Nannte ich ihnen daraufhin mein Alter, folgte unweigerlich der Satz: Später würde ich froh sein, so viel jünger geschätzt zu werden.
Ich hatte diesen Satz so oft gehört, dass ich anfing, ihn zu glauben, gefährlicher noch, ihn als normalen Umstand meiner noch sehr fernen Stunden zu betrachten. Was für eine naive Schnepfe war ich bloß, anzunehmen, daran würde sich nie etwas ändern?
Es muss mit meinem nicht in gleichem Maße gealterten Selbstbild zu tun haben, dass es mich beinahe bestürzt, wenn man seit Jahren auf die Nennung meines Alters höchstens mit freundlicher Kenntnisnahme reagiert. Niemand sagt mehr völlig entgeistert zu mir, was denn, so alt bist du schon?
Und ich sehe es selbst: Ich sehe aus wie eine Frau Anfang fünfzig.
Als ich mal mit meinem Mann ausging und auf die verspiegelte Wand hinter dem Bartresen schaute, passierte es mir, dass ich mich für den Bruchteil einer Sekunde wie eine Fremde musterte. Mir huschte die komische altmodische Redewendung »Eine Frau in mittleren Jahren« durch den Kopf.
Eine gleichaltrige Zürcher Freundin von mir formulierte die Bewandtnis unseres Alters schärfer: Sie schrieb mir aus ihren Ferien in Barcelona, dass sie sich dort endlich einmal nicht wie »ein Regenschirm« fühle, sondern als Frau wahrgenommen, auch wenn sie die viel beschworene Blütezeit hinter sich hat. Mir fiel dazu ein, dass die Autorin Birgit Vanderbeke in irgendeinem ihrer Romane geschrieben hatte, dass sie sich über Bauarbeiter, die ihr als junges Mädchen hinterhergepfiffen hatten, aufgeregt habe, um mit vierzig erschrocken dahinterzukommen, dass ihr diese zweifelhafte Anerkennung auf einmal abging.
Und trotzdem gelingt es mir ab und zu, die scheinbar über Nacht eintretenden Veränderungen in meinem Gesicht mit der Forscherfaszination meines früheren Zoologie-Professors anzuschauen, der über Jahrzehnte den Mikrokosmos Kuhfladen untersuchte. Oder über meine Derrick-Tränensäcke an manchen Morgen zu lachen, auch wenn Horst Tappert mit seinen wenigstens Geld verdiente. Mir das Lachen nicht zu verkneifen, obwohl sich die Haut dabei besonders unter den Lidern kräuselt, als wäre ich als kostbare Craquelé-Keramik wiedergeboren.
Als ich noch in dem Alter war, in dem mir das Alter weit weg erschien – alt immer nur die anderen waren –, da ging ich mit einer gewissen Selbstverständlichkeit davon aus, dass meine Eltern, die seit jeher für ihre Schönheit bewundert wurden, sich als Diven aufführen würden, sobald die Jahre ihre Reize dahinschwinden ließen. Anzeichen dafür gab es genug.
Mein Vater muss schon an die siebzig gewesen sein, als er sich am Steuer seines Autos zu mir im Fond wandte und klagte: »Nach mir sehen sich mittlerweile nur noch Dreißigjährige um!«
Ich erwiderte lapidar: »Eigentlich ja nicht so schlecht für einen fast Siebzigjährigen.« Worauf mein damals ungefähr zwölfjähriger Halbbruder mit der Empörung eines Kindes, das eine kolossale Ungerechtigkeit wittert, ausrief: »Aber Papa ist doch nicht mal fünfzig!«
Er hegte nicht den leisesten Argwohn gegen seinen Papa. Denn er hatte schlicht keine Ahnung, dass der erst mit 58 Jahren sein Vater geworden war.
Mit seiner Ahnungslosigkeit befand sich mein Halbbruder in bester Gesellschaft. Weder die zweite Frau meines Vaters noch die Berliner Freunde kannten sein wahres Alter; sie alle dachten, er sei mindestens zwanzig Jahre jünger. (Wie in dieses zwanzig Jahre kürzere Leben so viel Leben gepasst hatte, fragte keiner.) Das Herrschaftswissen um sein wahres Alter teilten meine Mutter, meine Schwester und ich.
Zugegeben, er hatte auch leichtes Spiel, in dieser Sache zu tricksen: Nachdem er 1955 aus Teheran zum Studium nach Deutschland gekommen war, hatte man in den Behörden sein Geburtsdatum vom islamischen Kalender auf den christlichen übertragen. Mal errechnete man den 11. Mai, mal den 13. Juli, mal den 4. August als seinen Geburtstag – selbst sein Geburtsjahr, 1930, war nicht in all seinen Ausweispapieren das gleiche.
Aber ich glaube, in Wahrheit brauchte mein Vater die Umrechnungsfehler gar nicht als Legitimation für sein Schummeln – er sah ja aus wie ein höchstens Fünfzigjähriger, das genügte ihm als Rechtfertigung. Wahrscheinlich hätte er – wenn er darüber überhaupt je nachgedacht hat – erklärt, dass schließlich nicht er die Unwahrheit sagte, sondern die Zahlen: Sein Aussehen strafte doch die Fakten Lügen.
Meine Mutter hatte in dieser Frage ihre eigenen Maßnahmen zur Selbstberuhigung. Lange vor ihrem vierzigsten Geburtstag versuchte sie, sich gegen jenen Tag, den sie als einschneidende Zäsur gedanklich vorwegnehmen wollte, zu wappnen, indem sie ihn mit uns in einer kleinen Komödie zelebrierte. Unter Gelächter, scheinbar auf Kosten meiner Mutter, inszenierten wir über die Jahre wieder und wieder eine Feier, als könne die bloße Wiederholung dieses Rituals den Schrecken dieses noch weit entfernten Tages bannen.
Damals fand ich es lustig, ohne zu verstehen, was das Theater eigentlich sollte. Wie jedem Kind erschien es mir ausgesprochen erstrebenswert, so schnell wie möglich älter zu werden.
Zu dieser Zeit nannte mein Vater meine Mutter »Lederstrumpf«, um sie zu ärgern, aber auch, um ihre leise Unruhe vor dem Älterwerden zu verspotten. In meiner Erinnerung hatte meine Mutter da noch keine einzige tiefere Falte, was kein Wunder war, denn sie war erst Mitte dreißig.
Aber kann ich das wirklich so genau wissen, nachdem es schon über vierzig Jahre her ist? Und warum ist mir die Erinnerung neuerdings so wichtig? Weil die Strecke, die meine Vergangenheit einnimmt, mittlerweile beträchtlich länger ist als diejenige meiner Zukunft? Und ich, selbst wenn nichts dazwischenkommt, das halbe Jahrhundert, das ich hinter mir habe, gewiss nicht mehr vor mir habe? Oder hat es damit zu tun, dass das Alter einem den Vergleich mit den Eltern mehr und mehr aufdrängt? Es heißt, keinen Satz höre eine Frau mit größerem Erschrecken als den »Du wirst deiner Mutter von Tag zu Tag ähnlicher«.
Ich bilde mir ein, meiner Mutter weder äußerlich noch charakterlich besonders zu gleichen, aber auch, dass es mir keinerlei Not bereiten würde, wenn dem so wäre. Und wenn mein angeheirateter persischer Onkel, der meinen Vater noch aus ihren gemeinsamen Schulzeiten kennt, mich mit Blicken abtastet und am Schluss seiner Inspektion ungläubig kopfschüttelnd zu mir sagt, die Ähnlichkeit mit meinem Vater verblüffe ihn immer wieder – dann denke ich allenfalls, schade, dass das Gesicht meines Vaters in der weiblichen Variante seine Imposanz verwirkt.
Viel interessanter als den kontinuierlichen Abgleich mit meinen Eltern finde ich es, mich mit mir selbst zu vergleichen, mein jetziges Ich mit der Vielzahl meiner früheren Ichs. Das bedeutet nicht, dass ich mich für eine multiple Persönlichkeit halte, oder gar für eine zerrissene – es ist eher so, als würde ich in einen großen Spiegel schauen, in einem Raum, der an zwei Seiten verspiegelt ist. Wie in den großzügigen Eingangshallen mancher Gründerzeithäuser: wo man sich ins Unendliche vervielfacht sieht, als eine Gestalt hinter der Gestalt hinter der Gestalt. Als ein Bild, das sich ewig fortsetzt.
Dabei ist mir sonnenklar, dass mein Ich, mein Bewusstsein von mir, den Ringen gleicht, die sich bilden, sobald man ein Steinchen ins Wasser wirft. Es ist ein Prozess, mehr nicht. Eine Fiktion. Und doch kann ich nicht umhin, mich täglich aufs Neue in meinem selbst entworfenen Spiegelkabinett zu bewegen und es durchaus selbstbewusst »mein Leben« zu nennen. Es bleibt ja nur die Möglichkeit, unsere Erfahrungen in den Erfahrungen der anderen zu spiegeln. Ob man will oder nicht: Man muss nun mal ein Bild entwerfen, von sich und anderen, um im Miteinander etwas zum Hantieren zu haben.
Wahr muss das alles ja deshalb gar nicht sein. Andererseits kann auch eine Illusion ausgesprochen wahr sein. Und sind Erinnerungen nicht gerade deswegen für uns so bestimmend, weil sich vor allem aus unseren Illusionen, aus den Trugbildern, unsere Identität konstruiert?
In meinem Gehirn jedenfalls, mit seiner Unzahl Schubladen, in denen mein höchstpersönliches Sammelsurium verwahrt wird, ist eine Art Beweisfoto für die Schönheit meiner Mutter abgelegt, wie sie mit langem, rostbraunem Haar in ihrem offenen VW-Cabrio sitzt und ihr der Fahrtwind die Locken aus dem Gesicht weht. Zugleich hat sich in mein Gedächtnis mein Stolz eingebrannt, jedes Mal wieder, etwa wenn meine so junge, so schöne Mutter zum Elternabend in die Schule kam, im knöchellangen Jeansrock und einem Häkelwestchen mit Batikfarbverlauf, von dem sie mir gesagt hatte, dass es sündhaft teuer war. Dazu trug sie die passende gehäkelte Kappe, die exakt jenen Punkt traf, an dem sich die zwei modischen Linien »hippielässig« und »mondän« kreuzen.
Zusammen allerdings erschienen meine Eltern damals schon lange nicht mehr zu den Elternabenden. Sie trennten sich, als ich knapp vier war, meine Schwester fünfeinhalb. Daran muss es liegen, dass zu den Schnappschüssen in meinem Gehirn ein einziger gehört, der meinen Vater in meinem Kinderalltag zeigt: Darauf sehe ich ihn, wie er sich, vor Müdigkeit murrend, in die Daunen des Ehebettes wühlt, während meine Schwester und ich neben ihm wie wild gewordene Humpty Dumptys auf der Matratze herumhüpfen. Bestimmt war er spät vom Nachtdienst im Krankenhaus zurückgekehrt und wollte sich von uns nicht um seinen verdienten Schlaf bringen lassen.
Sehr viel später, wohl erst als junge Erwachsene, erfuhr ich, dass die schlafraubenden Nachtdienste meines Vaters nicht allein seinem Beruf als Arzt geschuldet waren. Im Krankenhaus hatte er eine Patientin kennengelernt, Ines, und mit ihr eine Affäre angefangen. Die am Ende die Ehe meiner Eltern sprengen würde.
Ines arbeitete wie meine Mutter als Model – auch wenn das bis in die Siebziger hinein »Mannequin« und »Fotomodell« hieß. Sie stand meiner Mutter in Attraktivität also nicht nach, war aber ein vollkommen anderer Typ Frau als sie: Ines war groß und dünn wie eine Ampel, an die eins achtzig, was in ihrer Generation ausreichte, um für Aufsehen zu sorgen. Sicherlich ist mein Blick auf meine Mutter kein objektiver, trotzdem glaube ich, dass auch andere meine Mutter im direkten Vergleich für die weitaus Schönere gehalten hätten. Meine Mutter wurde oft mit Audrey Hepburn verglichen: Sie hat ähnlich hohe Jochbögen und kühn funkelnde Augen, ihr Gesicht ist herzförmig geschnitten und strahlt eine feine, natürliche Eleganz aus sowie ein sehnsüchtiges, tiefes Wesen.
Ines dagegen war vor allem eines: sexy. Nie sah man sie ungeschminkt; ihr Mund war – das erste Mal, dass ich so etwas sah – immer mit einem zu dunklen Konturenstift umrandet. Außerdem band sie sich extravagant gemusterte Hermès-Seidentücher um den Kopf, was sie, zusammen mit ihrer giraffenhaften Gestalt, zu einer glamourösen Erscheinung machte. Und zu einer verruchten: Sie schien Männern Abwechslung vom ehelich anständigen Blümchensex zu versprechen – meinem Vater, den meine Mutter in diesen Dingen als seinerzeit entzückende Unschuld beschreibt, vermutlich mehr denn je. Ines’ magnetische Kraft auf meinen Vater fasste meine Mutter im Nachhinein in einer Zeile zusammen: Ines habe garantiert den »doppelten Rittberger« beherrscht. Sie selbst machte keinen Hehl daraus, dass sie lieber über ein kultivierteres Brevier, auch in dieser Hinsicht, verfügen wollte.
Viele Jahre darauf brachte die B.Z. die Liebesgeschichte von meinem Vater und Ines in wenigen Zeitungsabsätzen kondensiert, mit Namensnennung und mit dem Boulevard als Hauptaroma. Dort konnte man in etwa folgendes Geschehen nachlesen: »Schöner Arzt vom Kaukasus behandelte das Berliner Hausmannequin von Modemacher Detlev Albers, weil es seinen Ring nicht mehr vom geschwollenen Finger abbekam – behutsam befreite der Arzt den Ring vom Finger der Patientin, ohne dass der Ring geopfert werden musste. Bei der Rettungsaktion verliebten sie sich Hals über Kopf ineinander«. Dass wir dieser Rettungsaktion, sofern die Beschreibung Spurenelemente der Wahrheit beinhaltete, zum Opfer fielen, ließ der Artikel unerwähnt.
Für Ines – und auch darüber kann ich lediglich spekulieren – wird mein Vater eine Trophäe gewesen sein, so wie sie ihn ihrerseits zunächst mit ihrer lasziven Oberfläche gelockt haben wird.
Er galt allen als der schöne Exot; mit diesem Etikett war er bei seiner Ankunft in Deutschland ausstaffiert worden. Warum er sich als junger Iraner dazu entschieden hatte, ausgerechnet in einer nachkriegsdeutschen Kleinstadt Medizin zu studieren, Tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt, das hat er mir erst spät beantwortet. Sein bester Freund Hamid sei auf den Gedanken gekommen, nach Deutschland zu gehen und dort Medizin zu studieren, aber das hörte sich für mich an, als suche er mir zuliebe nach einer schlüssigen Antwort. Vielleicht hatte er es aber auch nur vermieden zu formulieren, dass er einem Impuls gefolgt war – und keiner wohlüberlegten Entscheidung. Aber wäre seine Entwurzelung, die im Rückblick aufscheinende Zwangsläufigkeit, besser zu ertragen gewesen, wenn sie rationalen Überlegungen statt einer jugendlichen Laune entsprungen wäre? Hätte irgendein vernünftiger Grund ausgereicht, damit er es für sich legitimieren konnte, dass er seine Heimat verlassen hatte?
Vor einer Weile nahm ich meinen Mut zusammen und fragte meinen Vater, ob er mit dem Wissen von heute, mit der Erfahrung seiner sechzig Jahre in Deutschland, die Entscheidung, wegzugehen, so noch einmal treffen würde – seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: ein unmissverständliches Nein. Das für sich stand und auf das keine weitere Erklärung folgte.
Sein »Nein« hörte sich nicht verbittert an und stimmte mich dennoch melancholisch. Es klang so folgenschwer vergeblich.
2
Ich erschrecke über meine Kaltschnäuzigkeit. Erleichtert zu sein, wenn ich um mein tägliches Telefonat mit ihm herumkomme, weil er den Hörer nicht abnimmt. Froh, die paar Minuten für etwas anderes verwenden zu können, froh, ihn nicht mit leiser, verwaschener Stimme klagen zu hören. Froh, mich nicht daran erinnern lassen zu müssen, dass er nun ein alter, kranker Mann ist.
Einmal mehr zu spüren, dass Schmerz nicht teilbar ist.
Aber kaum wird mir bewusst, wie meine Gefühle in den letzten sieben Jahren verroht sind, überfällt mich schon das schlechte Gewissen – und genau in diesem Moment wird es noch größer, denn ich will nicht, dass mein schlechtes Gewissen zu dem stärksten Gefühl gegenüber meinem Vater wird.
Um mich vor mir selbst als Tochter zu rehabilitieren, erinnere ich mich daran, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, als ich von seiner Parkinson-Diagnose erfuhr. Wie todunglücklich ich war, angesichts der Vorstellung, mein Vater würde seinen klaren Verstand einbüßen. Das war es, was mir damals als Erstes in den Sinn kam: dass er als Persönlichkeit, von der er in meinen Augen eine fulminante Ladung mehr besitzt als die meisten anderen Menschen, verschwinden würde.
Von da an durchlief ich im Zeitraffer die wahrscheinlich üblichen Reaktionen darauf. Zuerst zweifelte ich die Kompetenz des Neurologieprofessors an, der die Diagnose gestellt hatte. Dann wurde ich wütend, weil es Anlass zur Vermutung gab, dass seine Parkinsonerkrankung die Folge einer Jodvergiftung war – mein Vater war mit einer akuten Flugthrombose in letzter Minute in jenes Krankenhaus gefahren, an dem er Jahrzehnte zuvor als Oberarzt gearbeitet hatte. Dort hatte ein junger Arzt neben die Vene und ihm dadurch einen geschwollenen Arm gespritzt, und als die Untersuchung auf den nächsten Tag verschoben wurde, ging vergessen, dass ihm das Kontrastmittel bereits einmal gespritzt worden war. Die Überdosis Jod, die er damit verabreicht bekommen hatte, ließ seine Schilddrüse verrücktspielen. Plötzlich plagten meinen bis dahin fast übernatürlich gesunden Vater etliche Gebrechen.
Anfangs nahm er den Arzt vor uns in Schutz – behandle man einen Kollegen, sei man nun mal nervös und mache eher einen Fehler, und der Chefarzt des Spitals habe ihm zur Entschuldigung bereits einen Riesenblumenstrauß ans Krankenbett geschickt. Dann witzelte er, dass er in den USA mit einem derartig gravierenden Kunstfehler leicht Millionen hätte machen können und so auf seine alten Tage noch steinreich geworden wäre. Aber als der junge Arzt selbst nie ein Wort des Bedauerns über seine Lippen oder zu Papier brachte, begann er, auf seine Zunft zu schimpfen.
Ärzte seien das Letzte, wütete er, und nach jedem Besuch bei einem neuen Nervenspezialisten, nachdem er zum x-ten Mal in eine Röhre geschoben worden war – unnötigerweise, wie er fand, nur damit die Krankenhäuser Kohle machten –, fluchte er mehr und lauter auf seine Berufskollegen.
Damals auch muss sein Rollenwechsel stattgefunden haben: vom Mediziner zum Patienten. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie schwer ich es aushielt, als mir meine Schwester, die ihn in Berlin zu allen Untersuchungen begleitete, erzählte, mein sonst so durchsetzungsfähiger, willensstarker Vater habe wie ein verschüchterter kleiner Junge in der Praxis seines Neurologen gesessen und kaum etwas gesagt, obwohl er doch dessen medizinische Ausführungen in jedem Detail verstand.
Berichtete meine Schwester mir in den Monaten, die folgten, wie alle Krankenschwestern und Ärzte bei Spitalaufenthalten um meinen Vater herumtanzten – um ihn, den Liebling der Götter –, war ich etwas beruhigt; und die Bruchstücke meines langsam bröckelnden Bildes von ihm, der andere nach wie vor anzog wie Motten das Licht, wieder notdürftig zusammengefügt.
Hätte sich mein Blick auf ihn allmählich der Realität angepasst, müsste ich ihn längst einen Greis nennen. Doch da sind immer andere, die mir dabei helfen, mir weiter in die Tasche zu lügen: zum Beispiel wenn sie von meinem Vater als »betagt« sprechen und damit sein Alter mit dem Make-up der Normalität überschminken.
Jeder hat ein Bild von seinen Nächsten, eines, das die Veränderungen von Jahrzehnten scheinbar ohne Rückstände überdauert. Dabei können die Ansichten nirgends so überholt sein wie in der Familie, ohne dass einer das unangemessen finden würde: Die eine Tochter ist vielleicht längst überpünktlich, wird in der Familie aber dennoch auf immer und ewig als die gelten, die alles auf den letzten Drücker erledigt – so wie sie als Jugendliche war. Die andere Tochter dagegen frönt im Erwachsenenalltag dem Schlendrian, wird aber das Attribut der Gewissenhaften, mit dem die Eltern sie als kleines Mädchen versahen, beibehalten. Aber vor allem die Eltern werden in den Augen ihrer Kinder immer eines bleiben: ihre jungen Eltern.
Erst wenn der Augenblick naht, in dem Verlust droht, ist man gezwungen, die früh unmerklich als Fundamente errichteten Bilder zu überprüfen. Vielleicht wird mein Vater doch noch hundert, wie meine Mutter schon an Tagen prophezeit hat, an denen wir Galgenhumor bitter nötig haben. Wenn wir uns gegenseitig daran erinnern müssen, dass einige Ärzte schon gesagt haben, wie gesund mein Vater in seiner Grundkonstitution sei – sieht man von seiner Krankheit ab. Aber falls er nicht hundert wird: Was genau weiß ich von meinem Vater? Was alles weiß ich nicht? Was davon stimmt, was ist Legende, schon jetzt, zu seinen Lebzeiten? Und warum bin ich plötzlich so erpicht darauf, meinem Mann begreiflich zu machen, dass der Altersgeiz, den mein Vater entwickelt hat, eine Eigenschaft ist, die wir alle nie und nimmer mit ihm zusammengebracht hätten? Dass hinter seiner neuen Knickrigkeit die Angst stecken muss, ihm könne das Geld ausgehen, jemanden dafür zu bezahlen, dass der ihm jeden Handgriff abnimmt, noch den intimsten, wenn er das selbst nicht mehr vermag?
Seit einiger Zeit hat er eine Pflegerin, die täglich für Stunden zu ihm nach Hause kommt, am frühen Abend, weil er bis dahin ohnehin schläft, nur von kurzen Wachphasen unterbrochen, in denen er sein Medikamenten-Bataillon schluckt. Sie ist jung und hübsch und sorgt sich derartig rührend um ihn, dass es weit über ihr Soll als Altenpflegerin hinausgeht – öfter hat sie zu uns gesagt, sie wolle auf keinen Fall, dass mein Vater denke, sie stehe ihm nur zur Seite, weil sie dafür entlohnt wird.
Carina liebt mich, wir werden noch heiraten, scherzt mein Vater ab und zu, auch vor ihr, und es gehört zu ihm und seinen Königssohn-Allüren, dass wir kurz ernsthaft in Erwägung ziehen, diese attraktive Berlinerin Anfang dreißig könnte an ihm als Mann tatsächlich Gefallen gefunden haben.
Sie ist die Einzige von uns, die auch nach Jahren von seiner Spitzzüngigkeit verschont geblieben ist – während er an seinen Freunden und besonders an meiner Mutter, seiner Exfrau, seine Launen auslässt, daran gewöhnt, dass man ihm alles verzeiht. Und jetzt, wo er krank ist, mehr denn je.
Zweifelsohne, er ist krank – aber wenn man sich nichts schönredet, auch schlicht und einfach: alt. Ganze 87 Jahre alt, ein Alter, das ich ihm nie zugetraut hätte, hätte ich mir je darüber Gedanken gemacht: Auf eine seltsam halb bewusste Weise ging ich immer davon aus, dass man so maßlos, wie er sein Leben über große Strecken geführt hat, nicht richtig alt werden kann.
Längst sind die Belege für seine Unersättlichkeit in meinem Gedächtnis zur Anekdote geworden: dass er etwa eines Nachmittags mit mir zum prächtigsten Eiscafé am Kurfürstendamm fuhr, wie stets viel zu schnell in seinem Ro 80 im Siebzigerjahre-Orange, und dort, in der Sonne sitzend, für mich ein Spaghetti-Eis bestellte und für sich Vanilleeis, 49 Kugeln – worauf der italienische Kellner meinte, sich verhört zu haben, und dreimal nachfragte. In meiner Erinnerung hat mein Vater die Anzahl der Kugeln bestätigt, als sei seine Absicht, so einen Haufen Eis zu vertilgen, nichts Außergewöhnliches. Ich bilde mir sogar ein, dass er in den zwei Wochen vorher, wie oft, lediglich Kaugummi gekaut hatte, nichts anderes, weil er keinen Bauchansatz kriegen wollte, und die 49 Kugeln Vanilleeis seine erste feste Nahrung gewesen sind. Aber waren es wirklich 49 Kugeln, oder hat sich mir diese Zahl willkürlich ins Hirn graviert? So wie ich, nach rund vier Jahrzehnten, ja nicht mehr sicher sein kann, ob er mir vor der Fahrt zum Café wie sonst verbot, mich anzuschnallen – das Leben ist Risiko, pflegte mein Vater zu sagen, und dass ich mir solche Sätze aus seinem Mund nicht im Nachhinein zusammenfantasiere, das kann meine Kindheitsfreundin bestätigen, die sich noch immer in einer Mischung aus Schaudern und Lust daran zurückerinnert, wie wir vielleicht zehnjährige Mädchen auf der Rückbank schlotterten, weil wir fürchteten, gleich mit hundert Sachen auf den nächsten Baum zuzurasen.
Folgerichtig wurde mein Vater über Jahre aus sämtlichen Autoversicherungen geschmissen, und waren wir als Kinder mit ihm auf dem französischen Volksfest in Berlin oder einem anderen Rummel, dann half kein Sträuben und Jammern: Wir mussten mit ihm auf die Achterbahn und das doppelte Looping irgendwie durchstehen. Während andere leuchtende Augen angesichts von »Wilder Maus« und Schiffsschaukel bekommen, fing ich meine gesamte Kindheit hindurch sofort zu flennen an, sobald ich eine Kirmes betrat.
Außerdem fuhr er jahrelang ungestraft ohne Führerschein, nachdem er ihn wegen zu schnellen Fahrens oder Überfahren roter Ampeln hatte abgeben müssen. Geriet er in eine Straßenkontrolle, behauptete er unverfroren, er sei als Notarzt unterwegs – diesen Ausweis konnte er vorweisen –, und die Polizei bohrte zu seinem Glück nie nach.
Meinen Vater habe ich immer wieder an den äußersten Grenzen des Daseins erlebt. Als Gegenbild dessen, was man gemäßigt nennt. Dutzende Geschichten, die man uns früher erzählte, runden das Bild ab: Wie sein Chef nachmittags bei uns anrief; gleich werde mein Vater nach Hause kommen, er sei mal wieder zornentbrannt aus dem Operationssaal gestürmt und habe ihn, seinen Chef, ein »Arschloch« und eine »Riesenflasche« genannt. Meine Mutter solle ihn bitte beknien, seine Kündigung zurückzunehmen, und ihn wieder in den OP schicken, man brauche ihn dort.
Oder die Story von seinen Monaten im Knast, als er nach Schüler- und Studentendemonstrationen gegen den Schah eingebuchtet wurde. Mit Hunderten anderen in einem Keller hockte, jede Nacht zu Verhören abgeholt, stundenlang im Scheinwerferlicht bedroht – bis er, wohl auf Betreiben seines Vaters, der im Wirtschaftsministerium arbeitete, unerwartet gehen durfte. Womit die Sache familienintern aber noch lange nicht ausgestanden war, denn seine Eltern sprachen angeblich ein halbes Jahr kein Wort mehr mit ihm, was ihn damals, behauptet er, nicht das kleinste bisschen gejuckt habe. Heute sagt er, ob aus seiner alten Lust an der Provokation oder weil er es verklärt hat, dass die Monate im Gefängnis unter lauter Intellektuellen eine seiner spannendsten Zeiten gewesen seien. Zumindest hat ihn diese Erfahrung nicht davon abhalten können, 1968 in Berlin vor der Deutschen Oper zu stehen, mit Anti-Schah-Transparent, umzingelt von iranischen Geheimdienstleuten, von sogenannten Jubelpersern.
Seine Mutter, meine Großmutter, bemerkte vor einer Ewigkeit mal gegenüber ihrer Schwiegertochter, meiner Mutter, dass wir zu Unrecht annähmen, seine Radikalität sei Ausdruck seiner Mentalität – von wegen! In Wahrheit habe die rein gar nichts mit der persischen Herkunft meines Vaters zu tun, sondern vielmehr damit, dass er in eines der schlimmsten Erdbeben seiner Heimat geboren wurde. Als er – den historischen Aufzeichnungen nach wahrscheinlich doch Mitte Mai 1930 – zur Welt kam, hatte ein Beben der Stärke 7,1 auf der Richterskala seine Heimatstadt Shahpoor dem Erdboden gleichgemacht; an die dreitausend Menschen kamen zu Tode. Und noch fast vier weitere Monate nach dem Hauptbeben ließen zahlreiche schwere Nachbeben die Leute in der Region im nordwestlichen Aserbaidschan um ihr Leben bangen.
Seine Mutter war fünfzehn, als sie ihn, ihren Ersten, unter freiem Himmel gebar, selbst noch ein halbes Kind. Und erkannte doch intuitiv, dass diese Ausnahmesituation während der Schwangerschaft zu den wackligen Randpfosten seiner Existenz werden würde.
Und obwohl ich kaum glaube, dass meine Großmutter sich auch nur mit Küchenpsychologie, geschweige denn mit frühkindlichen Traumata auskannte, hat sie sein Gemüt, das nur Hoch oder Tief zu kennen scheint, immer auf diese gewaltigen Erschütterungen seines neugeborenen Lebens geschoben und auf seine ersten Wochen in einem Zelt. In der Tat verging bis heute kein Jahr, in dem der Boden unter seinen Füßen nicht gefährlich schwankte, mal mehr, mal weniger, stabil blieb bloß das Instabile seiner Person.
Mein Vater ist ein furchtloser Mensch – erst seitdem er mit Parkinson im Gepäck seine letzten Meter gehen muss, beschleicht ihn die Angst, die wir alle wahrscheinlich fürchten, sobald wir sie nicht weiter halbwegs erfolgreich verdrängen können: Todesangst. Dann keucht er, dass neben seinen viehischen Rückenschmerzen sein Brustkorb fürchterlich eng werde, und kläglich wie ein Kind japst er, ich sterbe.
Mein Vater hat eine ausgeprägte melodramatische Ader; auch seine Gefühle erlebt und drückt er nur in absoluten Größen aus. Bei aller scheinbaren Ungebrochenheit ist er aber trotzdem meistens in der Lage, seinen Aufwallungen einen Schuss Selbstironie hinzuzufügen – nicht selten überzeichnet er die Emotion dann eigenhändig zur Karikatur. Wie ein Troubadour bläst er lauter als nötig ins Horn, zugleich verweist er von sich aus darauf, wie unnötig es im Grunde ist, derart aufzudrehen. Zum Beispiel sagte er zu mir: Heute bin ich nur noch Konsument, nicht mehr Produzent des Lebens. Beziehungsweise wenn ich überhaupt noch etwas produziere, dann bin ich ein verdammt primitiver Durchlauferhitzer: Ich tue nichts mehr, bloß noch fressen und scheißen.
Ich verstehe sein Hadern. Gleichzeitig denke ich, jeder andere mit seinem Leben wäre in der Lage, die Brosamen zusammenzuklauben und dankbar zu sein. Sich zu sagen, es lohnt nicht mehr – dafür hat es sich bis vor einiger Zeit mehr als nur gelohnt.
Er hat doch das Glück, nicht als laue Seele auf die Welt gekommen zu sein, und niemand wird ihn deswegen je des Lebensplagiats überführen können. Das ist doch was, keine Nichtigkeit, aber ihm ist das alles keinen Pfifferling wert – lieber verlegt er sich darauf, es als eine schreiende Ungerechtigkeit zu betrachten, dass er am Ende wie alle anderen vor ihm geworden ist: hinfällig.
Warum kann mein Vater dem Abrieb der Zeit nicht zubilligen, dass der einen in Teilen verkrüppelt? Mir hat der Hirnforscher Gerhard Roth mal erklärt, dass Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die Kinder kein Trauma durch elterliche Gewalt erlitten hätten – es sei für diese Kinder normaler Alltag gewesen, von den Eltern geschlagen zu werden, und daher hätten sie keine traumatische Erfahrung davongetragen. Und ja, auch mein Vater hat vor einer ganzen Weile angefangen zu welken, wie jedermann, nur konnte er es lange gut kaschieren, vor uns und sich.
Ob Glaube an etwas Größeres oder nicht, könnte er jetzt nicht einfach ein wenig – meinetwegen, demütig – werden, gegenüber den vielen prallen Erfahrungen, die er hat machen dürfen? Gegenüber dem, was die Natur ihm mitgegeben hat?
Die Friseuse, die ihm bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt im Krankenbett die Haare schnitt, murmelte, seinen Schädel umfassend: Was für ein schöner Kopf!
Auch darin ist mein Vater ein Phänomen: An den seltenen guten Tagen verzaubert er noch heute die Leute. Sieht er wieder aus wie Mitte sechzig. An den sich mehrenden schlechten dagegen sieht er aus wie vor einer ganzen Weile verstorben. Sein Körper aber ist nach wie vor straff, sein Hintern noch ein solcher Apfelpo, dass allein sein parkinsonschlurfender Gang seine 87 Jahre eines Besseren belehrt.