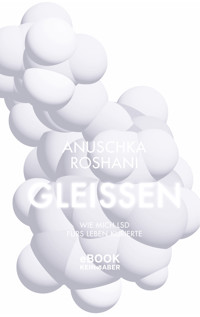
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Durch die Forschungsrenaissance von LSD neugierig geworden, fängt Anuschka Roshani an, zu recherchieren: Sie erfährt, wie vielversprechend es heute als Medikament etwa bei Depressionen und Angststörungen erscheint – aber auch, warum es über ein halbes Jahrhundert als Teufelszeug verbannt wurde. Und dann ist plötzlich die Gelegenheit da für einen radikalen Selbstversuch: Als Probandin kann sie unter ärztlicher Aufsicht mehrere Trips machen. So naiv wie kühn stürzt sie sich ins große Ich-Abenteuer. Seitdem ist nichts mehr, wie es war: eine Menge euphorische Gelassenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Anuschka Roshani, in Westberlin geboren, studierte Verhaltensbiologie und besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule, bevor sie viele Jahre Redakteurin und Reporterin beim Spiegel war. Seit 2002 lebt sie mit ihrer Familie in Zürich. Bei Kein & Aber hat sie Truman Capotes Gesamtwerk herausgegeben. 2018 erschien ihr Debüt Komplizen.
ÜBER DAS BUCH
Durch die Forschungsrenaissance von LSD neugierig geworden, fängt Anuschka Roshani an, sich mit dessen Geschichte zu beschäftigen und wagt schließlich eine eigene Reise ins Unbekannte. Die Substanz wirft sie aus der gewohnten Bahn, zum Glück! Seitdem ist nichts wie vorher: Sie sieht die Welt in einem neuen, helleren Licht.
Here comes the Sun …
NÜCHTERNBESEHEN, bin ich dieselbe geblieben, so stinknormal wie eh und je. Doch gucke ich bei vollem Bewusstsein durch das Brennglas LSD, versuche ich meine Reiseerfahrungen in einem einzigen Satz zu bündeln, dann läuft es auf diese eine Zeile heraus: Ich ist eine andere.
Im Rückspiegel betrachtet, habe ich den Eindruck, bis dahin mehr als fünfzig Jahre lang durchs Tal der Ahnungslosen gewandelt zu sein, über ein Feld, von dessen feiner Beschaffenheit ich nicht den leisesten Schimmer hatte. Über ein höchst privates Feld, nicht weniger als mein Leben.
Mittlerweile erscheint mir die Erfahrung, sechsmal under the influence gewesen zu sein, zu einem einzigen Paradoxon zusammengeschnürt, das bis in meine Gegenwart ausgestrahlt hat, noch immer weiter ausstrahlt – in einer Widersprüchlichkeit auf immens vielen verschiedenen Ebenen.
Seitdem mutet das tägliche Leben schlichtweg eigenartig an, so, als würde alles und jedes miteinander zusammenhängen, obgleich ich nach wie vor nicht unbedingt zu sagen wüsste, wie: Überall entdecke ich jetzt lauter Querverbindungen zu dem Dreh- und Angelpunkt meines »Überwältigungserlebnisses«.
Heute Morgen etwa sah ich einen kleinen Jungen mit großer Begeisterung wieder und wieder in eine Pfütze springen, und mir schoss durch den Kopf, dass meinem Alltag im Grunde genau dieses magische Aufleuchten banaler Momente verloren gegangen ist – ein solch simpler Freudensprung!
Mit jedem Jahr, das ich älter wurde, war aus dem ursprünglichen, kindlichen Erleben mehr und mehr ein bloßes Wegleben meiner Tage geworden, und ein nervtötendes Planer-Temperament übernahm an dieser Stelle. Anstatt mich dem Geschehen hinzugeben, wertvollere Augenblicke auszukosten und Unangenehmes schlicht und einfach, ohne allzu viel Grübeln und Hadern, durchzustehen, kommentierte eine penetrante Stimme in meinem Schädel permanent die nichtigsten Ereignisse, noch während sie stattfanden.
Nun, mit einem Schlag, wars damit aus und vorbei. Auf dem Zenit meines Trips hatte ich gemeint, die Schönheit der Existenz in all ihrem Gleißen wahrzunehmen; alles flammte auf.
Und diese einmalige Anschauung – so sah es auf eine fast gespenstische Weise aus – trudelte mit einem geradezu phänomenalen Langzeiteffekt bei mir ein! Denn allem Anschein nach taugte LSD auch fürs prosaische Dasein als Blicköffner: Plötzlich begann ich, die ordinäre Welt ebenfalls mit radikal anderen Augen zu sehen – und das, nachdem ich sie nur für wenige Stunden derart verändert und unmittelbar angetroffen hatte.
Die Substanz hatte mein Ich in eine gefühlte Ewigkeit gebombt – ich glaubte zu sterben –, und meinem Alltagsbefinden währenddessen, so unmerklich wie unverkennbar, eine funkelnagelneue Dimension hinzugefügt. Das Zeug machte mich offensichtlich über den Trip hinaus quicklebendig, in einem Maße lebendig, wie ich es zuvor niemals für möglich gehalten hätte.
Unter LSD hatte ich mir eingebildet, dass die Zeit gar nicht existiert, sie lediglich ein Konstrukt des Gehirns war, das die Tage strukturieren wollte, und dank dieser unschuldig daherkommenden Eingebung ergriff mich ein sagenhafter Gleichmut. Mehr noch: euphorische Gelassenheit.
Fortan, folgerte ich, musste ich zu keinem Zug mehr hetzen; wenn ich ihn verpasste, konnte ich genauso gut den nächsten nehmen. Ich musste keine E-Mail unverzüglich beantworten; das konnte ich auch eine Woche später machen, sollte es sich dann nicht eh schon von allein erledigt haben.
Das meiste – so meine Gemütsverfassung – geschah ja sowieso ohne mein Zutun.
Sechsmal hatte ich im Basler Universitätsspital die ekelerregende LSD-Alkohollösung hinuntergewürgt. Ich war sehr nervös (und sehr blauäugig) in dieses tolldreiste Experiment gegangen; und ohne jede Heilserwartung.
Anders als jene wissenschaftlichen Studien, welche die Forschungsrenaissance von LSD in den letzten Jahren eingeleitet haben: Sie richten ihr Interesse auf psychische Erkrankungen – besonders auf Depressionen, Angststörungen und Süchte.
Die Aufbruchstimmung in der Psychiatrie kommt nicht von ungefähr, rund 200 bis 300 Millionen Menschen weltweit sind seelisch krank. Ein Markt von schätzungsweise einer Milliarde Konsumenten wartet auf neue Arzneimittel, die eine Alternative zu den herkömmlichen Antidepressiva und Angstlösern sein könnten. (Und wenn die finsteren Prognosen sich bewahrheiten, wird die Zahl durch die Pandemie noch um ein Vielfaches größer werden.)
Die klinische Studie in Basel, an der ich als Probandin teilnahm, befasste sich mit der pharmazeutischen Wirkung von verschiedenen LSD-Dosierungen – wie der 5-HT₂A-Rezeptor durch welche Dosis stimuliert wird –; eine Heilwirkung aber sollte nicht untersucht werden.
Wenn ich nun darüber schreibe – und schreiben heißt ja auch, sich selbst zu lesen – muss ich mich erst einmal an die Unschuld erinnern, die meine Tage davor hatten. Und gleichzeitig in dieses Davor miteinbeziehen, dass ich nie von mir dachte, ich würde mit einem stumpfen Blick durchs Leben gehen.
Erst von heute aus zurückgeschaut, wird es zu einer Behauptung (noch nicht Lüge), dass ich dieses Wagnis damals in erster Linie im Namen der Wissenschaft eingegangen bin. Sicherlich kann ich weiter annehmen, dass ich mir erhoffte, die Ergebnisse der Studie würden dazu beitragen, LSD als Medikament in naher Zukunft in der Praxis erproben zu dürfen: Die Droge werde nach ihrem nahezu weltweiten Verbot 1971 und ihrer damit einhergehenden jahrzehntelangen Dämonisierung wieder für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Untersuchungsgegenstand salonfähig. Diese wären bereit, das vermeintliche Gift mit altem, neuem medizinischen Sachverstand anzugehen.
Jetzt jedoch ist es für mich befremdlich, dass mir die Monate, in denen ich an der Studie teilnahm, irgendwie lebendiger vorkommen als die Monate davor. Natürlich erkenne ich mich in der Person davor wieder – ich kann mich sehr gut an sie erinnern –, bloß kann ich heute nicht um das leise Unbehagen drumrumdenken, ich könnte über manche Strecken in meinen vorübergezogenen Tagen davor unnötig abwesend gewesen sein. Etwas muss schon da gewesen sein (vielleicht nur zaghaft an eine Tür gepocht haben), als ich meine Exkursion begann. Hätte ich mir meine bevorstehende Reise sonst nicht als eine Wartung meines Selbst, anstatt als eine Reparatur erträumt? Anders kann ich es mir nicht mehr vorstellen: Mich wird die vage Aussicht gejuckt haben, meine eigene individuelle Wahrnehmung erweitern zu können – sie in unbekannte Höhen hinauf auszudehnen, beziehungsweise in unbekannte Tiefen.
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, im etymologischen Wörterbuch nachzuschlagen, ob curious und »kurios« auf den gleichen Wortstamm zurückgehen; bevor ich loslief, schwante mir jedenfalls nichts Böses. Damals schätzte ich, Neugier würde die halbe Miete bei dieser Expedition sein und so etwas wie Mut überhaupt nicht vonnöten. Kurioserweise wähnte ich mich tatsächlich auf der sicheren Seite (und da spielt mir meine Erinnerung wohl auch keinen Streich): Ich musste keinen besonderen Unbilden ein Schnippchen schlagen – und meine Vorannahme, umgekehrt würde bestimmt noch genügend Vergnügliches für mich im Netz hängenbleiben, war weniger Unschuld als Erfahrungswert.
Alles in allem war ich mit meiner grundsätzlichen Verfassung und den näheren Umständen zufrieden, das heißt, mit all dem, was mir tagtäglich so geschah – und ich kam mir auch eher durchschnittlich neurotisch vor. Und dennoch muss in einer Ecke meines Wachbewusstseins schon ein Trotzdem gewesen sein, die stete Frage: Muss es nicht trotzdem noch mehr als alles geben?
Auch die Scham, vermute ich, war in der unschuldigen Vorzeit angelegt. Auf einem Nebengleis fürchtete ich mich bereits damals davor, mich unerträglich ich-besoffen aufzuführen. Gleichzeitig war mir eins von Anfang an ungeniert klar – ich würde diese Reise mit mir als einziger Reisebegleitung antreten. Der abgedroschene Werbeslogan fiel mir ein, »Machen Sie mal Urlaub vom Ich!«. Das Wenige, was ich wusste, als ich mich aufmachte zu meiner persönlichen Terra incognita, war: In Basel würde ich mich definitiv in die entgegengesetzte Richtung bewegen – Urlaub mutterseelenallein mit meinem Ich machen. Einsam mein Ich-Territorium durchqueren, und wer weiß, womit im Marschgepäck. Mir fehlte jegliche Vorstellung davon, ob dieser Vorstoß ein sonnenheller Spaziergang oder ein Horrortrip werden würde.
Wenn meiner Imagination auch inzwischen durch LSD beträchtlich auf die Sprünge geholfen wurde, der Ausklang dieser fundamentalen Sinnesreizung ist verquer geblieben: Das Surreale dieser Erfahrung machte mein Leben seltsamerweise auf Dauer, über die mehr als zwanzig Stunden hinaus, die ich im Krankenhausbett mit 200 Mikrogramm LSD im Blut dalag, realer denn je. Irgendwie fühlbarer.
Über Monate darauf war alles leicht und licht, unbeschwert und himmlisch. Keine kleinste Sorge, keine größere Angst dräute am Horizont. Ein früherer Gedanke – dass ich nicht bloß auf der Welt war, um etwas zu Lebzeiten auf die Beine zu stellen – streifte mich erneut und mit einer gewissen Penetranz: Vielleicht lag meine Aufgabe vielmehr darin, mich anständig an meinen Privilegien qua Geburt zu ergötzen – im richtigen Land, zur richtigen Zeit, in der richtigen Familie geboren zu sein.
Mein selbst antrainierter Erledigungszwang löste sich derweil in Luft auf; ich schlenderte nun lässig, überdies mit sanft aufgespannten, zarten Antennen, durch meine Tage – keinesfalls länger wie ein ferngesteuerter Pyjama. Ja, alles schien in Butter.
Vorübergehend auf jeden Fall.
Zu diesem Wahnsinnsprodukt war ich meinem Empfinden nach wie die Jungfrau zum Kinde gelangt. Mich erreichte diese Gabe in einer Art unbefleckter Empfängnis, irgendwie von LSD erzeugt. Aber welchen Weg hatte es in meinem Körper und Geist insgesamt zurückgelegt, welchen Weg hatte ich in der Tat hinter mich gebracht?
Zunächst kriegte ich nurmehr mit, dass ich in eine unablässige Wirklichkeitsjustierung hineingeschlittert war: Die Wucht, mit der mich das Lysergsäurediethylamid durch mein Ego gepeitscht hatte, hallte so ungeheuer wie ungeheuerlich als stetes Echo nach. Ständig glich ich die verschiedenen Realitäten gegeneinander ab, beobachtete ich mich im Kontrast zwischen Davor und Danach. Wie konnte das sein?
Schließlich war ich doch bloß für ein paar Stunden auf den tiefen, dunklen Grund meines Unterbewusstseins hinunter zu einem Nichts gesunken – und was für ein schöner Befreiungsakt folgte daraus! (Und was für ein Mysterium! Ohne Absicht nahm ich vier Kilo ab, wuchs mehrere Zentimeter, schlief nur wenige Stunden und war tagsüber dennoch putzmunter.)
Konnte ich mir selbst kaum erklären, was da eigentlich passiert war, wie sollte ich davon Außenstehenden berichten können? Entzogen sich diese pointillistisch anmutenden Impressionen nicht eh jeder Darstellung, waren sie nicht ganz und gar unbeschreiblich – und bedeutete das nicht im Umkehrschluss, dass es bei dem Versuch, innere Wahrheiten schriftlich festzuhalten, so oder so bei einer reinen Nabelschau bliebe?
Vielleicht hilft es hier und jetzt, das Phänomen mit einem hochintensiven Traum zu vergleichen: Träumt man, stellt sich die Abfolge der Dinge nahezu zwangsläufig dar – in einer Traumlogik miteinander verknüpft –, und erst beim Erwachen, sobald man jemandem von seinem Traum erzählt, ergibt es keinerlei nachvollziehbaren Sinn mehr. Persönlich finde ich nichts langweiliger als fremde Träume – dessen ungeachtet sagt mir ein gegenteiliges Gefühl, dass die Logik der Träume unter LSD Aussagekraft hat. Sodass ich mir wünsche, der Forscherdrang auf diesem Gebiet – meiner und jener der wissenschaftlich Forschenden – wird sich auszahlen, indem sich die einzelnen Träume als exemplarisch erweisen.
Ich war schon in der zweiten Lebenshälfte, als ich mich mit dem Idealismus der Jugend und der Desillusioniertheit des Alters in dieses Unterfangen stürzte. Beaufsichtigt von Ärzten und Pharmakologinnen, die mittels Fragebögen meine LSD-Erfahrung abzuklopfen versuchten, von dem Ziel gelenkt, am Ende ihrer Studien allgemeinere Aussagen treffen zu können.
Bei Reiseantritt beurteilte ich mich als Mensch im Wesentlichen als die Summe meiner Erinnerungen, von denen sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine hübsche Menge angesammelt hatten. Empfand mich als eine Art aufgeklärte Enthusiastin, als optimistische Pragmatikerin, mit einem durch und durch guten Leben, das mir so reichte, dass ich mich nie nach einer Religion sehnte. Und all dies Geschwafel vom Universalen, von einer übergeordneten Ordnung der Dinge war für mich wishful thinking, ja Unfug.
Und doch: ob LSD buchstäblich eine Neuverschaltung meiner Synapsen bewerkstelligt hat, wie die Forschung annimmt, oder was immer für die unheimlichen Veränderungen in meiner (Selbst)Beobachtung verantwortlich ist – seither will mich die Möglichkeit nicht verlassen, dass das Leben mir schöne Augen macht. Dass das Schicksal – was auch immer! – es prinzipiell besser mit mir meint.
Das wiederum bescherte mir die generelle Hoffnung, dass dieser Superwirkstoff ein verflucht vielversprechender Ausblick für all jene werden könnte, die sich vom Schicksal vor allem gebeutelt fühlen.
Gut zwei Jahre danach fühle ich mich beschenkt, so anstrengend die Etappen mitunter auch waren. Indem mir die Trips in einer Eindeutigkeit veranschaulicht haben – mittels reinster Empfindung, unter Ausschluss meiner Ratio –, welch unfassliches Abenteuer dem ganz gewöhnlichen Leben innewohnt, sobald man es wagt, in unbekannter Flughöhe darüber zu kreisen und sich über seine irdische Existenz zu erheben. Und für wenige Stunden einmal ans Unendliche zu rühren (es zumindest anzutippen).
Deshalb ist mein Wunsch, dass nicht nur für mich ein Schuh draus wird, wenn ich mich nun an einer Momentaufnahme probiere: unverhohlen und tunlichst präzise zu beschreiben, was das Psychedelikum mit mir im Einzelnen angestellt hat.
Wie hatte mir Peter Gasser gesagt, Psychiater in Solothurn und absoluter Pionier in der Erforschung von LSD als Therapeutikum? Er wolle seine mit LSD behandelten Patientinnen und Patienten in seiner Praxis nicht ins »Nirvana« schicken; es gehe darum, dass Arzt und Patient »der Erfahrung Sprache geben und dadurch eine Bedeutung«.
Der erste Satz in Annie Ernauxs Buch Le jeune homme spukt mir im Kopf herum: Wenn ich nicht darüber schreibe, bleiben die Dinge unvollendet – dann wurden sie bloß erlebt.
Heißt das, solange ich mit Worten ringe, ringe ich in Wahrheit mit dem Abstand und der Nähe zu mir selbst und zu anderen?
Zeichne ich meine LSD-Erfahrungen nach, liegt genau darin die Wucht, die ich empfinde, wenn ich zurückdenke – in der kruden emotionalen Mischung aus gnädigem Abstand und intimster Nähe zu meiner Vergangenheit. Mal sehen, ob die Antwort darauf im Prozess reift, als work in progress.
Doch so viel vorweg: Nie mehr sollte ich derartig bei mir sein und zugleich so außer mir.
VORBEBEN
Wo fange ich an? Oder besser: Wo fing ich an, an welchem Ausgangspunkt?
Cary Grant kannte ich aus meiner Kindheit. Damals lernte ich den Hollywood-Star als liebenswürdigen Tolpatsch kennen. Sein besonderer Charme entspross für mich einer gutmütigen Verpeiltheit, wie dem Umstand, dass er sich seines schrulligen Gebarens nicht bewusst war. Die Komödie Leoparden küsst man nicht habe ich in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts sicher ein halbes Dutzend Mal im Fernsehen gesehen. Und mit kaum abebbender Begeisterung freute ich mich jedes Mal wieder auf meine Lieblingsstelle, die Schlussszene der Screwball Comedy, in der Cary Grant, ganz zerstreuter Paläontologe, auf dem Brontosaurier-Skelett herumklettert, damit er es um den finalen, endlich aufgefundenen Knochen ergänzen kann. Und sich Katharine Hepburn im wahrsten Sinne als umwerfende Frau entpuppt, als sie das wertvolle Knochengerüst zusammenstürzen lässt. Das tut der Innigkeit des Kusses fürs Happy End, wie man weiß, keinen Abbruch.
Mittlerweile liegt mein Filmvergnügen von einst eine Ära zurück. Zusammen mit US-Nostalgieware wie den Waltons, Eine amerikanische Familie und Verliebt in eine Hexe lagert es irgendwo tief verbuddelt im Fernseh-Pleistozän. (Bedenkt man, was diesem Kinderspaß allein in den deutschen Programmen noch alles nachfolgen sollte, darunter solche Feminismus-Ohrfeigen wie etwa Hugo Egon Balders Tutti Frutti, dann kriegt man den Eindruck, dass sich unser aller Sehgewohnheiten massiv verändert haben).
An Cary Grant jedenfalls habe ich über Dekaden meines erwachsenen Lebens keinen Gedanken mehr verschwendet. Er war als Held ausgemustert oder durch andere Ikonen Hollywoods ausgetauscht worden.
Vier Jahrzehnte darauf erfahre ich das nächste Mal wieder von ihm – genau genommen von jener transformativen neuen Rolle, die sich der Star in Eigenregie und abseits des Filmsets gab – um sie für seine Zukunft als Privatmensch voll und ganz ausspielen zu können.
Davon erzählt mir ein Mann, Michael Pollan, ein amerikanischer Journalist und Autor von Bestsellern über Ernährung, dessen Namen ich bis dahin nie gehört habe. Er erzählt es mir über den Nachrichtenumweg Zeitung: Denn ich liege, wie beinahe jeden Sonntag, mittags noch in den Kissen bei der Wochenendlektüre und lese die Seiten »Life & Arts« in der Financial Times.
Und da steht nun, jener Michael Pollan habe ein Sachbuch veröffentlicht – mit dem Titel How To Change Your Mind –, das nach seinem Ersterscheinen in den USA kürzlich in Großbritannien publiziert worden sei.
Geschildert werde die Historie der Psychedelika-Forschung: Pollan habe alte Studien aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren, aber auch aktuelle aus dem angelsächsischen Raum recherchiert und zu einer ebenso ausführlichen wie aufregenden Wissenschaftsgeschichte zusammengefasst. Darin wird auch erwähnt (wenngleich in eher sparsam gehaltenen Absätzen des fast fünfhundert Seiten dicken Buches), dass er während seiner Recherche Erfahrungen mit verschiedenen sogenannten psychoaktiven Substanzen wie LSD, Psilocybin, Ayahuasca und DMT, dem Gift der Sonorischen Wüstenkröte, machte. Zu diesen Selbstversuchen hatte er sich nach seinem sechzigsten Geburtstag entschieden und notgedrungen in den Bereich des Illegalen vorwagen müssen – Präsident Richard Nixon hatte die Droge LSD 1966 in den USA verboten.
Zunächst reagiere ich auf den Artikel über den amerikanischen Kollegen mit scheinbar journalistischem Reflex: Hey, was für ein brandaktuelles Thema! Denn obwohl ich Michael Pollan gar nicht kannte, meine ich, den Reporterehrgeiz zu kennen, der zu seinem jüngsten Buch geführt hat.
Allerdings unterschlüge ich hierbei den Kitzel, den mein vegetatives Nervensystem als Signal darauf an mein Hirn sendet: Noch im Bett liegend sage ich zu meinem Mann, das mache ich nach! Genau mit diesem Ausrufezeichen in der Stimme.
Was mich bei allem herkömmlichen Wissensdurst in diesem Augenblick elektrifiziert, ist die Verlockung, in meinem ebenfalls fortgeschrittenen Alter selbst noch mal den Überschwang des von Pollan angedeuteten Erkenntnisprozesses zu erleben, ja, wer weiß, womöglich so was wie Ekstase.
Die Potenz des Psychedelikums, sagte Pollan, habe er als »Awe in a pill« – als Ehrfurcht in Tablettenform – gespürt. Von seinen Trips sei er mit einem Satz zurückgekehrt, der zwar, wie er gegenüber dem Financial-Times-Mann zugab, genauso auf einer Schmalzwunschkarte stehen könnte, dessen Wahrheitsgehalt er danach aber mit jeder Faser seines Herzens unterschreiben wollte: dass Liebe die größte Kraft des Universums ist.
Bereits an diesem Punkt scheidet sich die (gedankliche) Spreu vom Weizen; ich glaube, damals hat auf einer realen, sachlichen Ebene meine Bewusstseinsveränderung begonnen. Sowie ein bis heute andauerndes Dilemma: Das LSD hat es geschafft, Zwietracht zwischen meiner Ratio und meiner Emotion zu säen. Mich derart verwirrt, dass ich mich von ihm geheißen fühlte, immer wieder durchzuführen, was sie beim Film den »Weißabgleich« nennen: die Farbtemperatur von Kunst- und Tageslicht gegeneinander abzugleichen.
Stopp, der Reihe nach! Halte ich mich am besten an die Chronologie der Ereignisse – ungeachtet meines jetzigen Wissens, dass die kontinuierliche Abfolge der Zeit das Erste sein würde, was über die Leitplanken meines Bewusstseins flöge.
Doris Dörrie sagt in ihrem Buch Leben Schreiben Atmen, Schreiben sei »wie mit der Vergangenheit telefonieren und sie in die Gegenwart holen«. Demnach muss ich jetzt wohl alles dransetzen, mir die Vergangenheit ein zweites Mal in die Gegenwart zu holen. Das erste Mal hat es das LSD für mich besorgt, das zweite Mal werde ich mich an der Tastatur tippend an mich erinnern müssen. Und dafür billigend in Kauf nehmen, dass mir abermals schwindlig wird, während ich vorm Spiegel Pirouetten um meine eigene Achse drehe.
Doch an diesem Sonntagmorgen ist die Erfahrung des (streckenweise süßen) Schwindels längst keine Erinnerung. Ich bin noch nichtsahnend, wie häufig mir in den kommenden Monaten richtig plümerant werden wird. Wie viele Male ich hin und her taumeln werde, etwa zwischen jenen Bewertungen, an die mein analytischer Verstand anschließen kann, und denen, die sich ihm vordergründig komplett entziehen.
Ja, ich weiß nicht mal darüber Bescheid, dass mein Experiment mitunter mit einem Gefühl von Jetlag einhergehen wird, weil ich mit meinem irgendwie neuartigen Um-die-Ecke-Denken eine Weile brauche, um einigermaßen die intellektuelle Kurve zu kratzen: es sich hinziehen wird, bis ich die Angriffe auf mein Selbstbild für mich einsortieren kann.
Schon aus alter Gewohnheit ist mir jedes Esoterik-Klimbim ein Gräuel. Und wäre mir der Ausdruck »Psychonauten« bis dahin jemals untergekommen, hätte ich sie vermutlich für eine obskure Sekte oder eine Weltraum-Spinner-Vereinigung gehalten.
Ich bin gänzlich unbeleckt von eigener Erfahrung. Im Moment meiner Absichtserklärung – als ich meinem Mann (und vor allem mir) schwöre, das recherchiere ich jetzt auf der Stelle nach, Selbstversuch inklusive! – zeigt er mir einen Vogel.
Was natürlich zu erwarten war: Wir haben beide, wie die meisten Leute in unserem Kulturkreis, LSD als gefährliche Droge abgespeichert. Wir Kinder der Siebzigerjahre, groß geworden mit dem Märchen vom bösen, bösen Stoff, der etliche in der Generation vor uns in die Hölle katapultiert hat.





























