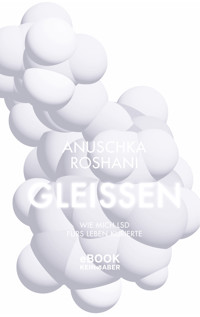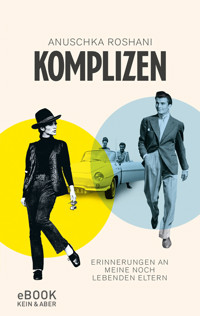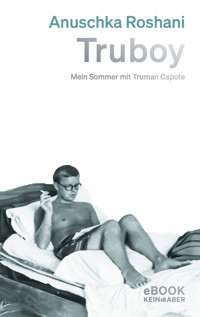
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In Truboy begibt sich Anuschka Roshani auf detektivische Spurensuche. Sie trifft Weggefährten und Kumpane Truman Capotes – darunter die Letzten, die den Schriftsteller lebend sahen. Wie seine Fast-Adoptivtochter; den bekanntesten Lektor aller Zeiten; seinen Anwalt; seinen Intimus; seinen letzten Interviewer; seinen Freund; seinen Tanzpartner im Studio 54.
Von ihnen erfährt sie nie gehörten Klatsch und jede Menge Kuriosa, prallbunte Stories, die allesamt eine Existenz bezeugen, die larger than life erscheint. Dann am Ende ihrer Reise erfüllt sich sogar ihr Stoßgebet: Anuschka Roshani spürt ein Fragment von Capotes verschollenem Roman auf.
Truboy ist ein Roadmovie zum Lesen, eine Neuentdeckung des weltberühmten Schriftstellers und selbst für jene ein Vergnügen, denen der Name Capote bisher wenig sagt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Anuschka Roshani studierte Verhaltensbiologie und besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule, bevor sie viele Jahre Redakteurin und Reporterin beim Spiegel und dem Tages-Anzeiger-Magazin war. Seit 2002 lebt die gebürtige Berlinerin mit ihrer Familie in Zürich. Bei Kein & Aber hat sie Truman Capotes Gesamtwerk herausgegeben. 2018 erschien ihr Debüt Komplizen. 2022 folgte Gleißen. Sie schreibt ihre Dissertation über Truman Capote.
ÜBER DAS BUCH
DIE ERZÄHLUNG EINER GROSSEN LEIDENSCHAFT
Die Begeisterung für das Werk Truman Capotes bewegt Anuschka Roshani, auf die Suche zu gehen: Einen Sommer lang reist sie durch die USA, um nach einem halben Jahrhundert endlich das Rätsel um sein verschollenes Manuskript "Erhörte Gebete" zu knacken. Liegt es, wie die Legende sagt, in irgendeinem Schließfach?
»Ein existenzieller Thriller, in dem es weniger um einen speziellen Fall als vielmehr um alles geht. Ein Meisterwerk.« NILS MINKMAR/DER SPIEGEL ÜBER KOMPLIZEN
Für meine Mutter, ohne die nichts gewesen wäre, wie es war
Bird Winging Southward
Feathers cut a graceful curve
Across the twilight sky,
While I,
A thing as distant as the night,
Mark the winging pattern
Of her pilgrim flight.
TRUMAN CAPOTE (13 Years)
»One time I remember I said to him: ›Why can’t you stop drinking? I love you!‹ And he sighed: ›No, Darling, that’s not enough. I know you don’t understand now but you will when you are older. There are those of us for whom the glare of life is too much.‹«
»ADOPTIVTOCHTER« KATE HARRINGTON ÜBER TRUMAN CAPOTE
Wo seine Welt anfängt
Ein Kind brüllt sich die Seele aus dem Leib. Es ist zu klein, um die Klinke zu erreichen, doch auch wenn es ihm gelänge, die Tür ist verriegelt. Mit der Nacht dehnt sich seine Panik aus. Und wie Blitze die Schwärze in Stücke reißen, durchzuckt ein Schauer frühen Erkennens die Luft: Es ist mutterseelenallein.
Irgendwo draußen vor der Tür vergnügt sich seine Mutter, als gäbe es kein Morgen. Während der neue Tag anbricht, fällt das Kind, von seinem unerhörten Geschrei entkräftet, in einen erlösenden Schlaf. Am Ende jedoch bleibt es untröstlich.
Zum Glück. Weil die Einsamkeit das Kind bald darauf anstiftet, sich selbst Trost zuzusprechen. Und es dadurch vermag, uns alle mit zu trösten.
Zu guter Letzt nämlich wird es sich nicht damit aufhalten, seine Misslichkeit zu beweinen. Ihm dämmert allmählich, dass es – hat man erst einmal für sich ausgeklügelt, wie das Ganze einen Sinn ergibt – zur Genüge wärmen kann, daraus das Schöne zu schälen. Sein Gang der Handlung setzt bei der Unerlässlichkeit ein, sich das Dasein erträglich zu machen. Denn das Schicksal droht zuzuschlagen, noch bevor es anfängt: Seine Mutter hat es abtreiben wollen.
Auf welche Weise sie das anzustellen versuchte, lässt sich höchstens vermuten. Ob sie sich um eine Engelmacherin bemühte oder vom Schrank sprang oder sich einen Sud braute; schlimm genug die Vorstellung, wie das Kind eines Tages davon erfuhr, bereits als Leibesfrucht unerwünscht gewesen zu sein. Hat die Mutter ihm im Streit etwas Vernichtendes wie »Ich wollte dich nie!« entgegengeschmettert? Ihm in einem einzigen Satz von vornherein das Existenzrecht abgesprochen?
Ich weiß es nicht – bloß von dem Segen, dass es dem Satz nicht gelang, das Kind zu zerstören. Im Gegenteil, so allein auf weiter Flur beschließt es mit acht Jahren, sich seine Daseinsberechtigung eigenhändig zu erschaffen. Aus dem Verlassensein seinen außerordentlichen Zugang zur Welt, Wort für Wort, zu schmieden.
Das Kind wird am Dienstag, den 30. September 1924, geboren. Als es von New Orleans achtbarstem Gynäkologen Dr. King nachmittags um drei, auf einen gleißenden Planeten voll unverdorbener und verdorbener Ungeheuer verfrachtet wird, heißt es Truman Streckfus Persons. Berühmt werden aber wird es unter dem Namen, den ihm sein kubanischer Stiefvater Joseph Garcia Capote per Adoption gibt: Truman Capote.
Unterdessen hat sich seine Drangsal, für immer und ewig der Sonderling zu sein, seinem Empfinden aufgeprägt wie ein Wasserzeichen; fortan wird es unverkennbar durch jede einzelne Seite scheinen. Und Capote sich noch in dem verwaisten Kind mit der wund geschrienen Kehle wiedererkennen, lange nachdem er sich selber das Licht in der Dunkelheit angezündet hat.
»Was wir auch tun, es geschieht aus Angst.«
Das schrieb Truman Capote als 22-jähriger in seiner Erzählung Die Tür fällt zu. Und da mein Geist einer Hupfdohle gleicht, die mal hierhin, mal dorthin hüpft, sprang in meinem Hirn der Gedanke an, ja, natürlich!, das ist es, was wir gemein haben, Truman und ich und wir alle, egal, wie recht oder schlecht wir uns durchs Leben mogeln mögen: Angst.
Dann dachte ich – kurios, dass man mit jeder Faser altert, aber eins nicht reift, sondern kindlich bleibt, die Furcht, nirgends dazuzugehören. Zwar kann man lernen, ihr bei klarem Bewusstsein mit Überzeugung und Haltung entgegenzutreten, nachts aber wird man mit einem Bein in ihrem Schlick stecken bleiben.
Capote war ein hundsmiserabler Schläfer. Seine Schlaflosigkeit versagte es ihm, sich selbst für eine Weile loszuwerden.
Nach wie vor wissen wir nicht genau, weshalb wir schlafen müssen; wir fügen uns einfach. Dafür entdröselte die Wissenschaft den »Traum«. Und die sagt, der Gemütszustand, in dem man einschlafe, erzeuge ein Bild. Geht man etwa beunruhigt zu Bett, weckt die Sorge ein Monster aus der Tiefe. Das heißt, nicht der Albtraum jagt uns den Schrecken ein. Es verhält sich umgekehrt: Der Albdruck entsteigt einer Beklemmung, die schon dagewesen ist, noch ehe die Helligkeit schwand.
An sich hat Capote nix anderes gemacht – er nahm seine existenzielle Angst und modellierte aus ihr einen Wachtraum. Spitzte einen seiner Blackwing-Bleistifte, griff sich einen gelben, linierten Block oder ein schwarz-weiß gesprenkeltes Notizbuch, eines von denen, wie sie bis heute in amerikanischen Schreibwarengeschäften zu kriegen sind, und setzte sich ins weiche Bett seiner Fantasie. Begann mit offenen Augen zu träumen.
Vorsatz und Programm: weder der äußeren noch inneren Düsternis nachgeben. Lieber zu seiner eigenen Widerstandsbewegung werden. Indem man so furchtlos und einmalig wie möglich gegen sie anschreibt. Nacht für Nacht. Seltener am Tag.
Nach Jahrzehnten, in denen ich Capotes Bücher gelesen habe – da, scheinbar plötzlich geht mir auf: Was mich in Wahrheit mit Capote verbindet, ist nicht meine Schwäche für Sprache, nicht Hingabe an die »große, großartige Erzählung«, ach was, profaner, es ist die Schönheit, die auf seinen Sätzen wie eine Schaumkrone thront. Die mich derartig unmittelbar rührt, dass sie mir als Reflex des Staunens direkt ins Rückenmark fährt.
Na und wenn schon. Dann ist meine Liebe zu Capote eben schlichter gestrickt, so was wie eine Reaktion des vegetativen Nervensystems. Die exakt in jenem Augenblick erwachte, als ich seine Kurzgeschichte Kindergeburtstag in die Finger bekam. Es reichte mir, deren erste Zeile zu lesen:
»Gestern Nachmittag überfuhr der Sechs-Uhr-Bus Miss Bobbit.«
Schon war es um mich geschehen.
Mir wurde federleicht zumute, zugleich angenehm schwer ums Herz. Von der Art Schwere, die man auskosten möchte; als würde man wieder und wieder mit der Zunge gegen eine sanft brennende Stelle im Mund stupsen.
In der Geschichte um Miss Bobbit, dieses wunderliche kleine Mädchen mit seiner alterslosen Seele – in dieser einen Geschichte ist alles enthalten. Alle Zerbrechlichkeit und alle Vergeblichkeit und Traurigkeit, alles, was Truman Capote damals bereits übers Leben wusste.
Sodass mir beim Lesen beinahe die Tränen kommen. Aber nicht, weil ich von Anfang an weiß, Miss Bobbit wird am Schluss unter die Räder geraten. Sondern weil es mich eigentümlich beglückt, ungefähr wie der Moment, in dem ich vor meinem Fenster die Blutbuche im Sommerleuchten aufglühen sehe. Bloß durch das Kristallklare der Empfindung, die aus seiner haarfeinen Beobachtung spricht und die prompt auch bei mir ein Gefühl zum Fließen bringt. Allein durch seine durchscheinenden Sätze, keusch dahinrauschend wie ein Gebirgsbach.
Zu dieser Zeit ist meine horrende Angst schon so gut wie vergessen. Über die Jahre war sie unmerklich geworden, ein Steinchen im Schuh, das lediglich so lange drückt, bis man sich daran gewöhnt hat. Erst als meine Ängste buchstäblich über Nacht zerbröseln, ähnlich morschen Schmetterlingsflügeln in einem verstaubten Schaukasten, fällt mir auf, wie sehr sich ihre spitzen Kanten vorher in mein Fleisch gebohrt haben. Aber das ist eine andere Geschichte, aus einem anderen Buch. Wahrscheinlich, ziemlich sicher hat auch sie mit dem Universalen in Capotes Werken zu tun, und unser beider früheste Verängstigung gleicht sich womöglich. Aber das ist nicht wichtig, einschneidender empfinde ich die Bewunderung für ihn: dass er in ihren kalten Stollen kroch und er aus seinem Aufruhr, mit immenser Tapferkeit und ebensolchem Talent und vielleicht einem irgendwie grimmigen Vergnügen, seine einzigartigen Wörter herausschürfte. Und dabei zu seinem ganz eigenen Maßstab wurde.
Das gelang ihm, davon bin ich überzeugt, weil er schon sehr früh wusste, wer er war. Für sich und für andere. Ausgestattet mit einem Äußeren, das den Leuten als »weibisch« aufstieß, löste Truman regelrecht Abscheu aus. Man empfand ihn als Freak – er selbst sich daraufhin als »Kalb mit zwei Köpfen«1. Der Mutter war seine Mädchenhaftigkeit wahrlich zuwider: sein blondes Engelsgesichtchen mit jener »Haferflockengesundheit«, die er später Holly Golightly andichtete. Vor allem aber seine quäkend-schrille Art zu sprechen2 empfanden die Leute als anstößig: eine stimmhafte sexuelle Nötigung. Sie schien ihnen der lauthalse Offenbarungseid seiner Homosexualität zu sein.
Anstatt beelendet zu sein und sich in Kummer zu verkriechen, entschied er sich für die Flucht nach vorn: sie auf dem Papier zu einer Stimme umzuformen, die seinem größten Wundmal – das er nie loswerden würde, weil es ein Muttermal war – eine eigenwillige Eleganz abtrotzte.
Immerhin gehörte zu seinem Erstgepäck auch eine überreiche Sensibilität – die Umgebung mit sperrangelweit geöffneten Augen und empfindlichsten Antennen wahrzunehmen. Also ließ sich wohl oder übel aus seiner naturgegebenen Otherness der Auftrag ableiten, dass er zum Verwandlungskünstler werden sollte. Seine fundamentale Not in eine Tugend verkehren musste.
So stelle ich es mir auf alle Fälle vor: Wer sich einmal im Kern erkannt hat, für den ist das Kennenlernen seiner selbst keine Verpflichtung mehr. Und ja, vielleicht zählt Schreiben zum rasantesten Katalysator und besten Handwerk der Selbstwerdung.
Ich glaube, mich hat Truman Capote als lebenslange Freundin gewonnen, als es ihm glückte, seiner Angst eine künstlerische Gestalt zu verleihen. Und da Lesen heißt, sich einzufühlen, so wie Schreiben das Bemühen ist, sich einzufühlen, Literatur eigentlich nichts anderes ist als praktiziertes Einfühlungsvermögen, deshalb bedeutet Truman Capote zu lesen für mich, seinen, meinen, vielleicht unser aller stärksten Ängsten auf den Grund zu gehen. (Möglichst, bevor sie uns einholen.) Seine Angst kennenzulernen. Denn was man kennt, das kann einen nicht mehr derart schrecken wie das Unbekannte mit seinem verborgenen Gesicht.
Und Capotes elementare Angst, die hatte das Gesicht einer Schlange.
Mit neun war er in den Südstaatensümpfen von einer Mokassinschlange gebissen worden. Er strich mit seinen Cousins durch den Wald, stapfte durch einen Bach nahe einer abgeschiedenen Mühle, als er eine beindicke Schlange über die Wasseroberfläche auf sich zugleiten sah. Er wollte davonlaufen, rutschte auf den glitschigen Kieseln aus, die Schlange preschte blitzschnell vor und biss ihn ins Knie. Seine Cousins trugen ihn huckepack bis zu einer Farm, und während der Farmer die Pferde anspannte, um ihn in die nächste Stadt, nach Alabama, ins Krankenhaus, zu bringen, fing die Bauersfrau mehrere Hühner, riss ihnen bei lebendigem Leib den Balg auf und drückte die verblutenden Vögel auf Trumans Knie – das noch warme, pulsierende Blut sollte das Gift herausziehen.
Zwei Monate lang musste Truman danach das Bett hüten. In diesen Wochen scheint mit ihrem Gift auch ihre Anziehungskraft in ihn eingesickert zu sein. Die Schlange packte ihn als Symbol seiner Angst am Nacken, wurde ihm sprachlicher Fetisch – und machte aus ihm den Schriftsteller, der er längst war.3
Wie dieser Schlangenbiss zu seinem Erweckungserlebnis führte, das schildert Capote 1967 in dem Essay Die Stimme aus der Wolke:
Knapp zwanzig streift er an einem frostigen Dezembernachmittag abermals durch das Walddickicht seiner Kindheit, als ihn, bei ebenjener Mühlenruine angelangt, der alte Schock von Neuem erstarren lässt. Die Erinnerung daran, wie ihn die Todesangst so lähmte, dass er vor der Schlange erst fliehen konnte, als es zu spät war, überfällt ihn jetzt mit gleicher Heftigkeit. In seiner zurückkehrenden Erregung – »einer Spielart schöpferischen Komas« – verirrt er sich im Wald. Durch seinen Kopf wirbelt schwindelerregend die Vision des Buches, das er, kaum zu Hause, unverzüglich zu schreiben beginnt: Andere Stimmen, andere Räume, den Roman, der ihn auf einen Schlag berühmt machen wird. Und von dem er am Ende seines Lebens sagen wird, es sei sein höchstpersönlicher Exorzismusversuch gewesen. Das Verlangen, seine »Dämonen auszutreiben« – seine rohe Angst in eine Form zu sperren und dadurch zu bändigen.
Darum lässt er seinem 13-jährigen Protagonisten Joel Knox widerfahren, was ihm widerfuhr, bis zur Schlangenbegegnung. Bei Erscheinen seines Debüts 1948 leugnet er es in Interviews noch, an einer Endhaltestelle seiner Laufbahn, im Vorwort der Jubiläumsausgabe von Andere Stimmen, andere Räume, wird er es zugeben: Joel Knox ist niemand anderes als Truman Capote.
Wenn Joel im Roman betet »Gott gib, dass ich geliebt werde!«, dann hallt daraus die Sehnsucht, die auch den jungen Truman beherrscht – wie dessen Verzweiflung, vielleicht niemals von diesem Sehnen erlöst zu werden.
Joel oder Truman, sie sind ein und dieselbe Person: der zartbesaitete Junge, der um seine Sexualität noch vor jeder sexuellen Erfahrung weiß; wie auch darum, dass er sein Anderssein und die Ängste, die es im Schlepptau hat, umschlingen muss, will er ihnen nicht wehrlos ausgeliefert sein. Von da an bringt Capote das Kunststück fertig, seine Angst in einen schöpferischen Zauber umzugestalten, den er wie einen Talisman in die Tasche stecken kann.
Lange habe ich mir eingebildet, Truman Capotes größter Fan zu sein, obwohl ich gar nicht besonders zum Fan tauge. Zumindest nicht zu der Sorte, deren Puls rast, sobald der Verehrte ein paar Armlängen von einem entfernt steht. Was im Fall von Truman Capote schon deswegen schwierig wäre, weil er 1984 starb, vor vierzig Jahren.
Hauptsächlich aber, weil ich aus der Generation bin, der man den Zweifel gerne als Tugend verkaufte. Und das Aufgehen in der grölenden Masse als gefährliche Untugend.
Doch Fans sind nicht unweigerlich blind für Realitäten. Auch wenn Capote seine gewaltige innere Unruhe schriftlich zu bannen vermochte, ist mir nicht verborgen geblieben, dass sie ihm das Genick brach: Zuletzt ergab er sich ihrem Gewicht. Antwortete ihrer Schwerkraft mit einem schmerzlich langen freien Fall ins Bodenlose.
Ich habe seinen Totenschein in den Händen gehalten. Auf dem steht, dass sein Tod am 25. August 1984 um 12.21 Uhr eintrat, am 11001 Sunset Boulevard, Los Angeles. Todesursache: Leberschaden mit Komplikationen durch Venenentzündung und Einnahme mehrerer Drogen.
Capote-Sympathisantin hin oder her, ich muss einsehen, dass sein Merksatz – nichts ist erfolgreicher als der Erfolg – sein kindliches Unglück nur so lange kaschieren konnte, wie er es fruchtbar machen konnte. Mitte der Siebzigerjahre, als er in seine Fünfziger startete, brach sein Kindheitselend mit fataler Wucht auf. Eine Menge in seinem Leben ging kolossal schief. Seinen Verfall dokumentieren Fotos – und von denen gibts zuhauf. (Angeblich ist er der meistfotografierte Schriftsteller des 20. Jahrhunderts; weswegen wohl noch der Abglanz seines Lebens larger than life4 strahlt und Capote bis heute eine »Celebrity« ist.)
Über viele Jahrzehnte hinweg knipsten ihn die Großmeister des Fachs, darunter Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Irving Penn, Slim Aarons. Ein guter Teil ihrer Aufnahmen hielt eine optische Täuschung fest: einen Mann, der außen wie innen ein Kind zu bleiben schien. Der ein scheinbares Paradox verkörperte, bei dem Alter und Talent wie Zahlendreher anmuteten – bis Mitte dreißig sieht Capote aus wie ein Vierzehnjähriger; mit vierzehn kann er schreiben wie ein Vierzigjähriger.
Alsbald entfaltete sich vor aller Augen ein vergnügtes Leporello: Für seinen Fotografenfreund Cecil Beaton etwa springt Truman, der »Liebling der Götter«, in Marokko vor einer gekalkten Wand in die Höhe, so schwungvoll, dass man beinahe anfängt, sich über seine schwarze Silhouette auf der Mauer zu wundern – ein zu quecksilbriger Luftgeist, um einen behäbigen Schatten zu werfen. Den Mund vor Lachen weit aufgerissen, die Arme nach oben gestreckt, als warte die Welt lediglich darauf, von ihm umarmt zu werden. In seiner hübschen Lausbubenmiene die Absicht, aufs Schicksal zu pfeifen und fröhlich weiter seine eigene, mannigfaltige Melodie zu summen.
Auf dem Foto, das als Torpedo für seinen pfeilschnellen Karrierestart gilt, lümmelt er auf einer Chaiselongue und schaut wie ein unschuldiges Bübchen in die Kamera.
Von wegen unschuldig! Das genaue Gegenstück meinten die Leute zu erkennen. Das Porträt zierte den Umschlag seines Romanerstlings, und ehe der in den Buchhandlungen zu haben war, zerriss man sich schon das Maul über diesen Debütanten, der augenscheinlich mit allen Wassern gewaschen war. Der sich wie Naschwerk feilbot. Oder wie ein erregt wallender Rezensent schrieb: der sich dem Betrachter förmlich anbot, so, als solle man ihn kurzerhand »besteigen«.
Ein mutmaßliches Enfant terrible. Ihm gefiel das ganz und gar nicht, und er bestritt jedes Kalkül hinter dem provokanten Jünglings-Eros. Behauptete, das sei bloß ein Schnappschuss des jungen Fotografen Harold Halma gewesen. Dennoch machte er nie einen Hehl daraus, schwul zu sein, nicht mal zu einer Zeit, als männliche Homosexualität fast überall als sexuelle Perversion galt und unter Strafe stand.
Einstweilen konnte er den Skandal um sein Toyboy-Image verschmerzen, verhalf er ihm doch aus dem Stand zu Bekanntheit und hohen Verkaufszahlen. Seit diesem einen Foto aber vernebelt Capotes Homosexualität der Kulturkritik die Sicht: auf die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Als schwebe eine anhaltende Luftspiegelung über seinen Buchseiten. Damals ist das »Narrativ« vom größenwahnsinnigen, in seiner Exaltiertheit »typisch schwulen« Schriftsteller entstanden, der an seiner Übertriebenheit – an seiner Großmanns- wie anderen Sucht – zugrunde ging. Fertig die Legende vom jähen Aufstieg und Fall des Truman Capote: von dem schamlosen Parvenü, der sich bis in die Café Society hochquatschte, dort jahrezehntelang ihr »Tru Heart« oder »Tru-boy« war und sie dann nach Strich und Faden verriet, indem er das erste Kapitel seines Sittengemäldes Erhörte Gebete im Oktober 1975 vorab im Esquire-Magazin veröffentlichte, La Côte Basque, 1965. Das habe er von langer Hand als heimtückischen Akt ersonnen, als Abrechnung mit der sogenannten piekfeinen Gesellschaft – darauf angelegt, sie bloßzustellen: außen hui, innen pfui.
Schauplatz des Kapitels ist das gleichnamige Edelrestaurant an der East 55th Street, in dem Manhattans eleganteste Ladys Mittag für Mittag zu einem Jahrmarkt der Eitelkeiten aufmarschieren. Kaum verhüllt plaudert Capote darin die Intimstgeheimnisse seiner langjährigen Freundinnen, seiner »Schwäne«, aus. Worauf ihn die vergötterte Babe Paley, sein liebster »Schwan«, aus ihrem Freundeskreis ausmustert wie ein Paar Pumps von der vergangenen Saison.
Von da an gings bergab, besagt der Mythos. An diesem Punkt habe sich sein Leben geradezu zwangsläufig zur Tragödie gewendet. Er sei zu seiner eigenen dekadenten Parodie verkommen: Aus dem gefährlich begabten Tausendsassa wurde die »versoffene, bekokste Tunte«, die ihren Manierismen freien Lauf ließ, wo sie sich ihrer besser von Anfang an hätte schämen sollen. Die sich unrechtmäßig Einlass zur vornehmsten Gesellschaft verschafft hatte und sodann verdientermaßen an der eigenen Hinterfotzigkeit erstickte. Capote sei in seinen letzten Lebensjahren ein tragischer Fall gewesen, aber, anders als in anderen tragischen Fällen, gebühre ihm kein Mitleid; er hätte seinen Scheiterhaufen ja eigenhändig angerichtet.
Bis heute – bei aller Social-Media-Selbstbeweihräucherung – kreidet man ihm eine pompöse Egozentrik an: Wer sich so maßlos mit überkandidelten Ungezogenheiten ausstaffiere, solle büßen. (Mal ganz abgesehen davon, dass einer gar kein Genie sein könne, wenn er als Maulheld mit Posaune in eigener Sache unterwegs ist.) Seitdem ertönt ein sexistischer Dreiklang, schallend genug, die Größe seines Werk hinter seiner öffentlichen Persona zum Verschwinden zu bringen: Schwuchtel, Superegozentriker, Süchtiger.
Anders lässt sich mir nicht erklären, warum ihm seine Sucht oft schadenfroh wie eine Niedertracht ausgelegt wird, komplett selbst verschuldet. Als wäre ein Kranker verantwortlich für seine Krankheit. Als wäre er von vornherein niemals legitimiert gewesen, sich zum Scheinwerferlicht vorzudrängeln. Als hätte er ein Schild – »Zutritt verboten für Unberechtigte« – aus fahrlässiger Eitelkeit ignoriert.
Anstatt solch ein Getöse um sich zu entfachen, wäre er dagegen gut beraten gewesen, sich im Schatten seiner Homosexualität leise zu ducken: so armselig klein – ein Meter sechzig – und unverschämt tuckig!
Nach La Côte Basque, 1965 setzt die Häme heftiger denn je ein, befeuert von dem Umstand, dass er den Roman nie fertigstellt. Nun wird der Luftikus endgültig aus dem fidelen Bilderreigen radiert, für jedermann unübersehbar. In Andy Warhols Aufnahme etwa hat Capotes Blick allen Schalk eingebüßt und etwas Waidwundes an sich. Seine Züge sind von einer künstlich mageren Schnittigkeit – nicht ohne Grund, denn er hatte sich kurz zuvor liften lassen. Gegen Schluss weidet sich die große Masse zur besten Sendezeit an Capotes erbärmlichen Vorstellungen in den TV-Talkshows: Erscheint er der Nation auf dem Bildschirm fett, fast kahl, verlottert, eine höchstens bedauernswerte »Drama Queen«. Seine früher eindringlich dreinschauenden, wissenden Augen blinzeln schmal unter teigig versunkenen Lidern. Und erschreckend vulgär schlängelt sich seine Zunge wie ein unkontrollierbar gewordenes Biest bis zum Rand seiner straff gespannten Lippen vor.
Das allerletzte Foto zeigt ihn tadellos gekleidet, proper mit Jackett und Schlips, doch sichtbar ermattet in einem Rattansessel: Er liegt mehr, als dass er sitzt, und seine linke Hand ruht schlaff auf dem Rücken eines Dobermanns, dem Hund seiner guten Freundin Joanne Carson, in deren Haus er einen Tag später sterben wird. Cinnamon, der Dobermann, starrt in die andere Richtung, aus dem Bild heraus – als würde er die lautlose Katastrophe nahen sehen.
Natürlich, man sieht nur, was man weiß. Und ich weiß nun mal, dass Capote einen Monat vor seinem sechzigsten Geburtstag kapitulieren musste. Trotzdem oder gerade deshalb möchte ich New Yorks Bürgermeister zurufen, Capote jetzt zu seinem hundertsten Geburtstag ein Denkmal zu setzen. Es am besten in Bryant Park zu platzieren, direkt vor der New York Public Library, wo sich sein gesamter Nachlass in 39 Pappkartons befindet. Als Vorbild in Sachen Widerstandskraft für uns alle. (Wie als Mahnmal für die Wirbellosen innerhalb der Gattung Mensch.)
Aus der Glaubensgemeinschaft der Capote-Gläubigen möchte ich stellvertretend aufmucken: Denn mögen auch tonnenweise Mut letztlich nicht ausreichen – der hartnäckige Kampf, sich nicht unterkriegen zu lassen, ist die Plackerei allemal wert.
Stopp, auf Pause gedrückt und noch mal zurück: In mir rumort der Gedanke, dass jedes Leben multiple Lesarten hat und Symmetrie eine Illusion ist. Könnte schließlich sein wie beim separaten Spiegeln der Hälften eines Gesichts, wo der Spiegel jeweils grundverschiedene Ansichten reflektiert – die, erneut zusammengefügt, eine verblüffend ambivalente Gesamtheit ergeben. Ein bisschen ist es vielleicht wie in Rumis altpersischem Gleichnis, in dem die Wahrheit ein großer Spiegel in der Hand Gottes war. Doch als Gott ihn fallen ließ, zerbarst er in Abertausende kleinste Splitter. Denen jagt seitdem jeder Mensch auf Erden nach. Und erwischt er ein Bruchstück, meint er beim Hineinblicken in der Scherbe die volle Wahrheit zu sehen.
Lassen sich möglicherweise all die Anekdoten über Capotes Kapriolen – wie er sie irgendwann einmal erzählte oder andere über ihn – im Zeitraffer auf zwei ganz und gar unterschiedliche Lebensläufe eindampfen? Auf eine Chronologie des Gelingens und auf eine Chronologie des Scheiterns? Je nachdem, welche Episoden man ins Licht rückt, ergibt sich im Idealfall aus der scheinbaren Absolutheit zweier Splitterwahrheiten ein und derselben Existenz wiederum so etwas wie: ein ganzes wahres Leben.
1 »Calves with two heads«, diese Formulierung, in Bleistift geschrieben, werde ich in einem von Capotes letzten Notizbüchern finden, nie in seinem Werk.
2 Einer nannte sie mal »Robbenbabystimme«. Capote sagte, er habe abgesehen, wie der Journalist ihm gesinnt war, sobald der auf »diese schrecklich markante, seltsame Stimme, die ich habe« anspielte. In den Artikeln fielen dann solche Sätze: »Er klingt wie ein lispelndes Kind, das nie die Pubertät durchgemacht hat.«
3 Die Schlange sollte ihn in Text und Leben nie wieder loslassen. Die Leidenschaft seiner letzten Jahre wird es werden, im Geheimen kleine Kunstwerke aus Plexiglasboxen zu basteln, deren Innenseiten er mit dem Papier von Snake Emergency Kits, Notfallsets bei Schlangenbissen, beklebt. In seinem Apartment verwahrt er ausgestopfte Schlangen, darunter eine zum Sprung steil aufgerichtete Kobra. Und in Handgeschnitzte Särge werden durch Amphetamine aufgeputschte Klapperschlangen zu Mördern.
4 Die Auktion »The Private World of Truman Capote« bewies 2006, dass es Leute gab, denen der Autor selbst tot, 22 Jahre nach seinem Ableben, satte 43500 Dollar wert war: Für diese Summe wurde eine Portion seiner Asche an einen anonymen Bieter versteigert. Das machte international Schlagzeilen und zeigte, wie zwei Kinofilme und eine Serie über ihn, dass sein Leben Hollywood-Format besitzt.
Chronologie des Gelingens
Er kommt als altes Kind auf die Welt: ein Frühreifer mit zwei Gewissheiten – schwul zu sein und ein Schriftsteller.
Die 17-jährige Lillie Mae Faulk, das hübscheste Mädchen Alabamas, und der neun Jahre ältere Arch Persons, ein charmanter Hallodri, sind bei ihrer Hochzeit, die von der Nachbarin Mrs. Lee am Klavier festlich begleitet wird, im siebten Himmel.
Bald darauf wird Lillie Mae schwanger; sie will zu einer Engelmacherin – das ist 1924 die einzig halbwegs garantieversprechende Methode –, doch Jennie Faulk, Lillie Maes rechtlicher Vormund, kann sie von dem Schwangerschaftsabbruch abhalten. Diese unglückselige Tatsache wird die Prämisse für Capotes Existenz setzen. Doch zum Guten gewendet: Das Leben wird für ihn nie Selbstverständlichkeit bedeuten, ein unübliches Talent für das Augenblicksglück entwickeln.
Bei seiner Geburt ist Lillie Mae knapp achtzehn: zu jung, um sich der Verantwortung für ein Kind aussetzen zu wollen. Dafür alt genug, um zu begreifen, dass ihr Sohn sie für immer an ihren Gatten binden würde. Sie entflieht der Enge der Ehe und nimmt die Beine in die Hand. Sie hat Großes mit sich vor: will ihre Ambitionen mehr als tausend Kilometer entfernt von allem Südstaatenmief, in New York City, verwirklichen.
Der dreijährige Truman kommt zu ihrer Familie väterlicherseits, die in der South Alabama Road Nr. 199 in dem Südstaatenstädtchen Monroeville lebt. Das hat in den Dreißigerjahren rund 7500 Einwohner. Für Kleinstadtverhältnisse sind die Faulks wohlhabend. Sie betreiben ein gut gehendes Hut- und Kleidergeschäft am Hauptplatz.
Trumans erste tiefe Freundschaft zu einer Frau entsteht: Sook, die älteste Schwester im Haus, ist mehr als ein halbes Jahrhundert älter; eine entfernte Blutsverwandte, dafür seine früheste Seelenverwandte. Sie überschüttet Truman mit Liebe, in ihr findet das elternlose Kind die beste Ersatzmutter. Sie wird helfen, seinen außergewöhnlichen Charakter zu formen. Kein Wunder daher, dass sich unter Capotes Hinterlassenschaft, unter seinen über viele Umzüge hinweg gehorteten Schätzen, auch ein von Sook handgenähtes Lebkuchenmännchen aus Filz befindet und eine gehäkelte Patchwork-Babydecke. Beides fertigt sie für ihren kleinen Freund; er wird es sein Leben lang aufbewahren und keine Reise ohne seine Decke unternehmen.
Sook setzt alles daran, ihren »Buddy«, wie sie ihn nennt, glücklich zu machen. Zeigt ihm, wie man einen Drachen steigen läßt. Wie man einen Früchtekuchen backt, Kräutertränke gegen Wehwehchen aller Art herstellt, etwa gegen Wassersucht. Im Wesentlichen aber macht sie ihm vor, wie man liebt und geliebt wird. Wie es sein kann, wenn man als der akzeptiert wird, der man ist.
»Sie war all die kuriosen Dinge in ihm, wie der Pekannussbaum und dass er gerne liest und für andere genug empfindet, um von ihnen verletzt zu werden. Sie war all das, was er sich scheute, irgendjemanden sehen zu lassen.«
Dieser Absatz aus Kindergeburtstag erzählt von den Gefühlen, die im 13-jährigen Billy Bob anklingen, nachdem Miss Bobbit in die Stadt gekommen ist. Es wäre ebenso zutreffend gewesen für das Band zwischen Truman & Sook.
Mit vier Jahren bringt er sich selbst das Lesen bei. An Abenden auf der Veranda, wo munter erzählt wird, entsteht sein Faible fürs Fabulieren.
Sook läßt sich von Truman vorlesen oder die Abenteuer, die er am Wochenende im Kino sehen darf, Szene für Szene nacherzählen. Sook und er leben innigst verbunden in ihren eigenen wunderbaren Welten. Die Gestalten aus Hollywood, aus all den Bücher- und Radio-Geschichten kommen Truman viel realer vor als die Menschen aus Fleisch und Blut um ihn herum. Er beneidet Kinderstars wie Shirley Temple und träumt davon, ein berühmter Stepptänzer zu werden. Mit seinem unermüdlichen Geklackere treibt er den Haushalt halb in den Wahnsinn.
Sook steckt ihn in Sonntagskleider, auch an stinknormalen Werktagen – in Mädchenkleider, sogar in adrette Reifröcke, wie sie Miss Bobbit trägt. Und flicht ihm Schleifchen ins Flachshaar. Sein Aufzug trägt ihm gleichermaßen Frotzeleien wie die Achtung der anderen Kinder ein. Uneingeschränkt beliebt dagegen macht er sich bei ihnen, weil er sich stets neue Flausen ausdenkt.
Seine Kindheitsverbündete wird die jungshafte Nachbarstochter Nelle. Auch sie wird später Schriftstellerin: Nelle erlangt unter dem Namen Harper Lee mit einem einzigen autobiografischen Roman weltweite Berühmtheit (im Buch heißt sie Scout, ihr Bruder Jem).
In Wer die Nachtigall stört verewigt sie Truman in der Figur des Dill (der Spitzname für Charles Baker Harris). Eine Art Merlin in Taschenformat, dessen Fantasie ständig lustige Volten schlägt:
»Im Sitzen war er kaum größer als die Grünkohlstauden. Wir starrten ihn an, bis er zu sprechen anfing.
›Hallo!‹
›Selber hallo‹, antwortete Jem freundlich.
›Ich bin Charles Baker Harris‹, sagte er, ›ich kann lesen.‹
›Na, und?‹, sagte ich.
›Ich dachte nur, ihr würdet vielleicht gern wissen, dass ich lesen kann. Wenn ihr was habt, was gelesen werden muß, kann ich’s machen.‹
›Wie alt bist du denn?‹, fragte Jem. ›Viereinhalb?‹
›Bald sieben!‹
›Dann brauchst du dir nichts drauf einzubilden‹, meinte Jem und zeigte mit dem Daumen auf mich. ›Scout hier liest schon, seit sie geboren ist, und dabei geht sie noch nicht mal zur Schule. Dafür, dass du bald sieben wirst, siehst du aber ziemlich knirpsig aus.‹
›Ich bin klein, aber alt‹, sagte er.«
Ab seinem fünften Lebensjahr hat Truman immer ein winziges Wörterbuch, einen Bleistift und Zettel für Notizen in der Hosentasche. Ans Schreiben gerät er durchs Lesen, was er am liebsten mit Nelle in ihrem Baumhaus tut. Ihre Bücherliebe und ihr wachsender sprachlicher Stolz schweißt sie zusammen. Mit acht überredet er Nelle, sich eine gemeinsame Nachmittagsroutine zuzulegen: nach der Schule jeweils zwei bis drei Stunden an der Schreibmaschine zu sitzen und Geschichten zu verfassen. In ihm reift der Entschluss, Schriftsteller zu werden. Und eines Tages schlendert er die Straße entlang, einen Kiesel vor sich herkickend, als ihn das Gefühl überfällt, ein Dämon ergreife von ihm Besitz: ein Schreibteufel – und der wird ihm von da an für immer über die Schulter linsen.
In den ersten Grundschuljahren glänzt Truman durch gute Noten. Ein Wissenschaftlerteam, das durch die Lande fährt, unterzieht Trumans Klasse einem Intelligenztest. Als Trumans IQ weit überdurchschnittlich ausfällt, misst man ein zweites Mal: und wieder phänomenal hoch. Daraufhin lädt man ihn nach New York ein, an die Columbia University, wo man eine Woche lang weitere Untersuchungen durchführt. Am Schluss ergibt sich ein IQ von 215: »Ich kam als Genie nach Hause – wissenschaftlich belegt, besaß ich die höchste je gemessene Intelligenz eines Kindes in den USA.« Das gibt ihm Selbstvertrauen: »Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eitel war. Es war, als würde ich ihnen allen eine lange Nase zeigen und sagen: ›Ha, ha, siehst du!‹« Fortan begleitet ihn das Gefühl, dass seine Einmaligkeit seinem Genius geschuldet ist.
Frühreif in jeder Hinsicht, auch in Sachen Sex, fängt der achtjährige Truman an, mit älteren Jungen seiner Schule »ins Bett zu gehen«. Er habe »nie ein Problem« damit gehabt, homosexuell zu sein. In einem späten Interview blickt er zurück auf diese Zeit: »Ich war immer ganz vorne mit dabei. Die anderen Kinder mochten mich dafür. Ich war wirklich ziemlich beliebt. Ich war lustig, und ich war hübsch. Ich sah nicht aus wie alle anderen, und ich war nicht wie alle anderen. Am Anfang schrecken die Leute vor etwas zurück, das ihnen anders vorkommt, aber das entwaffnet sie sehr leicht. Verführung – das ist es, was ich beherrsche! So wars: Du denkst, ich bin anders, nun, dann werde ich dir zeigen, wie anders ich tatsächlich bin. Es waren also mehrere Schichten, die ich aufgebaut habe, bei dieser Persona, aber ich habe nicht einmal gemerkt, was ich da tat. Ich habe mich komplett selbst erschaffen.«
Es wird kein Zufall sein, dass sein sexuelles Erwachen zeitlich mit seiner Entscheidung für eine Schriftstellerexistenz zusammenfällt.
Seine Kurzgeschichte Mrs Busybody, die er bei einem Wettbewerb der Lokalzeitung einreicht, wird mit dem ersten Preis prämiert.
Nach ihrer zweiten (Liebes-)Heirat 1932 mit Joseph Garcia Capote, einem erfolgreichen kubanischen Geschäftsmann, verwandelt sich seine Mutter von der Landschönheit Lillie Mae Faulk in die Salonlöwin Nina Capote. Kurz nach seinem neunten Geburtstag holt sie Truman zu sich nach New York.
Vor seinem Umzug in den Norden schmeißt er an einem Freitagabend ein sensationelles Abschiedsfest für seine Freunde in Monroeville: eine Halloween-Kostümparty. Die Uhrzeit bleibt nicht der einzige Verstoß gegen die guten Sitten. Einen schwarzen Plantagenarbeiter seines Großvaters bittet er, die von ihm und Nelle wochenlang geplanten Spiele zu beaufsichtigen und für diese Aufgabe ein weißes Hemd, einen weißen Anzug und weiße Schuhe zu tragen. Der Mann ist so stolz auf Trumans Auftrag, dass er es in den Wochen vorm Fest in der Stadt rumerzählt: was erst die bewaffnete Polizei alarmiert – man habe gehört, dass er Farbige eingeladen habe, um den rassistischen Süden damit zu provozieren – und schließlich den Ku-Klux-Klan auf den Plan ruft. Der rückt nach Sonnenuntergang als Fackelzug an, doch kann er von Nelles Vater Richter Lee, der Autorität im Ort, in die Schranken gewiesen werden. Nachdem sich die Kapuzenmänner kleinlaut trollen mussten, juchzt Truman, für seine Party als Fu Manchu verkleidet: »Vor unseren Augen hat sich etwas Historisches ereignet. Wir waren dabei, als der Ku-Klux-Klan Selbstmord begangen hat. Der wird in diesem Land keinen Rückhalt mehr bekommen. Er ist letzte Nacht gestorben.«
Noch während seiner Sommerferien in Alabama beziehen seine Mutter und sein Stiefvater eine Wohnung am Riverside Drive. Lucy Brown, eine schwarze Angestellte der Faulks in Monroeville, begleitet Truman 1932 nach New York, um bei der Familie Capote als Köchin anzufangen. Dort beginnt er die vierte Klasse an der Trinity School in Manhattan. In den Schulaufführungen brilliert er in Mädchenrollen, etwa als Little Eva in Onkel Toms Hütte oder als Prinzessin.
Am 14. Februar 1935 adoptiert ihn sein Stiefvater – aus dem Nachnamen Persons wird Garcia Capote.
Am Trinity entzückt er Schüler wie Lehrer mit seinem beißenden Witz. Wegen seines enormen Unterhaltungstalents schätzen ihn seine Kameraden als niedliches Klassenmaskottchen. Alle hängen an seinen Lippen, Lehrer inklusive.
Ab dreizehn, vierzehn wird er sich seiner immer gewisser. Er erkennt, dass er ausschließlich sich selbst verpflichtet ist: dass er er sein muss. Und diese Treue zu sich umfasst seinen eigentlichen Hauptschwur: Er muss Schriftsteller werden.
In einem fast physikalisch klingenden Gesetz bündelt er, was das für ihn bedeutet:
»Künstler zu sein, trennt einen von den üblichen Dingen. Die Sinne arbeiten mit einem rascheren, lichtempfindlicheren Wimpernschlag als bei den meisten Menschen. Die meisten Menschen haben, sagen wir, zehn Wahrnehmungen pro Minute, während ein Künstler vielleicht sechzig oder siebzig Wahrnehmungen pro Minute hat.«
Die kleine Familie zieht 1939 in eine schöne Villa im Tudor-Stil, nach Greenwich, einem vermögenden Vorort New Yorks, und der Vierzehnjährige beginnt an der Greenwich High School die achte Klasse. Seine Englischlehrerin Catherine Wood erkennt seine große Sprachbegabung und fördert ihn, wo sie kann. Sie prophezeit seiner Mutter, er würde ein berühmter Schriftsteller werden. Mit Wood bleibt er bis zu ihrem Tod in enger Verbindung.
In der Schülerzeitung The Green Witch veröffentlicht er Kurzgeschichten, die kraft der Sonne seines Talents bereits hell leuchten. Vielleicht bewahrheitet sich schon an dieser Stelle der Satz des Philosophen Hans Blumenberg: »Wozu erzählt man Geschichten? Im besten Fall, um sich die Zeit zu vertreiben; im weniger guten, die Angst.«
Mit fünfzehn verliebt er sich und übt sich von ersten Liebeslorbeeren gekrönt in der Verführungskunst: Der attraktivste Junge der Schule erhört ihn.
Mit seinen neuen Freundinnen, alle höhere Töchter aus bestem Hause – Oona O’ Neill (die einzige Tochter des bekannten Dramatikers, die mit Anfang zwanzig die vierte und letzte Frau von Charlie Chaplin werden wird), Carol Marcus (der späteren Frau von Walter Matthau) und Millionenerbin Gloria Vanderbilt – stiehlt er sich als Teenager an den Wochenenden in die angesagtesten Bars von Manhattan, zum Beispiel in den Stork Club und das El Morocco. Es werden unzählige gemeinsame glamouröse Cocktails folgen, über viele Jahrzehnte hinweg.
Ab 1942 übersiedeln die Capotes von Connecticut wieder zurück nach New York City, an eine schicke Adresse in der Park Avenue 1060. Truman wechselt von der Greenwich High School auf die elitäre private Franklin School an der Westside, wo er ein Jahr später seinen Abschluss macht. Daneben arbeitet der Achtzehnjährige eine Weile als Copyboy beim New Yorker, über dessen Flure er mit theatralischem Cape und königlicher Selbstsicherheit schreitet.
Mitte der Vierzigerjahre verschickt er seine Erzählungen an diverse Redaktionen. Die Wände sind kalt, seine erste Kurzgeschichte, wird 1943 in der populären Anthologie Decade of Short Stories abgedruckt. Ein Jahr darauf schafft er es mit zwei weiteren Erzählungen in diesen Band.
Darüber hinaus erscheinen seine Short Storys nun in Magazinen wie Mademoiselle oder Harper’s Bazaar. Obwohl er die literarische Bühne erst betreten hat, wird er schon als Wunderkind gehandelt.
Für seine Kurzgeschichte Miriam, die in der Juni-Ausgabe von Mademoiselle 1945 erscheint, wird er mit dem O. Henry Award ausgezeichnet: Preisgeld 300 Dollar – die er umgehend in einen maßgeschneiderten Anzug investiert.
Mit Miriam erregt er die Aufmerksamkeit von Random House. Der Verlag gibt ihm daraufhin seinen ersten Buchvertrag – für Andere Stimmen, andere Räume.
1946 tritt er ein elfwöchiges Stipendium in der angesehenen Künstlerkolonie Yaddo in Upstate New York an, wo er sich mit Carson McCullers anfreundet. Die sieben Jahre ältere Carson unterstützt Trumans schriftstellerische Ambitionen großzügig und vermittelt ihm wertvolle Branchenkontakte. Seit ihrem Debüt Das Herz ist ein einsamer Jäger gilt sie als (weibliches) Wunderkind aus den Südstaaten.
In Yaddo verknallt sich der 21-jährige Hals über Kopf in den mehr als doppelt so alten Newton Arvin, einen Literaturkritiker und Anglistik-Professor vom Smith College in Massachussets. (Arvin, der mit einer ehemaligen Studentin verheiratet ist, entscheidet sich bei Trumans Auftauchen dafür, die Hexenjagd in Kauf zu nehmen, die die Liebe unter Männern damals mit sich bringt. Und tatsächlich kommt es zu seiner akademischen Vernichtung.)
Arvin nennt Truman zärtlich »dearest child« oder »dearest little boy« oder »Spooky«. Der schenkt 1946 seiner ersten großen Liebe (die zwei Jahre dauern wird) ein Geschenk von Sook weiter: Manschettenknöpfe, versehen mit den Initialen TC. Dazu schreibt er: »Liebster, die Manschettenknöpfe hat mir jemand geschenkt, der mich auch liebte, die liebe, gute Sooky, an meinem zwölften Geburtstag – trage sie, Liebling, wenn du kannst. Ich liebe dich. T.«
Für Truman wird Arvin sein »Harvard«, seine persönliche Bildungsinstanz. Sein Geliebter führt ihn an die Klassiker der Literatur heran, obwohl Truman seine Säulenheiligen selbst in jugendlichen Lesestunden entdeckt hat. Proust lernt er sogar schon als Kind schätzen; seine kindlich-emotionale Nähe zu ihm als Mensch beschreibt er: »Ich hatte das Gefühl, er sei eine Art geheimer Freund.« Flaubert wiederum ist sein Vorbild in handwerklichem Perfektionismus, während Proust ihm durch seine feine Beobachtung der französischen Aristokratie zum mentalen Mentor wird. Weiter in der Theorie zur Praxis schult er sich, indem er Arvins Vorlesungen besucht.
Für seine Erzählung Die Tür fällt zu erhält er 1947 zum zweiten Mal den O. Henry Award (und ein drittes Mal 1951 für Ein Haus aus Blumen).
Im Sommer 1947 mieten sich die beiden für zwei Monate ein Haus auf Nantucket, um wie in der Anfangsphase als Frischverliebte in Yaddo über längere Zeit zusammen zu sein. Truman möchte dort Andere Stimmen, andere Räume abschließen, was ihm am 11. August 1947 auch gelingt.
Sein Wunderkind-Ruf ist ihm vorausgeeilt, vor allem durch das laszive Kleine-Jungen-Umschlagfoto des Buchs, dem er einen frivolen Klappentext hinzugefügt hat: Bis dahin habe er Reden für einen drittklassigen Politiker geschrieben, als Tänzer auf einem Vergnügungsdampfer gearbeitet, die Wahrsagerei erlernt und sei mit Blumen-Glasmalerei reich geworden – das sind nur einige Schnörkel in seiner aus Witz erstunkenen und erlogenen Vita.
Schon vier Monate vor Erscheinen, im Oktober, wird sein Roman von den Buchhändlern in ungewöhnlichen Zahlen vorbestellt; Random House lässt zehntausend als Erstauflage drucken und verkauft vorab etliche Auslandslizenzen von Andere Stimmen, andere Räume.
Am 19. Januar 1948 erscheint der Roman, den er Newton Arvin widmet.
Viele Rezensionen füllen kurz danach die Zeitungen. Man vergleicht ihn mit Faulkner, und in der Chicago Times steht: »Dieser kurze Roman ist das atemberaubendste Phänomen, das die literarische Szene in den vergangenen zehn Jahren erlebt hat.«
Das Buch klettert augenblicklich auf die New York Times-Bestsellerliste, auf der es sich neun Wochen hält. Mehr als 26000 Exemplare gehen über den Ladentisch, ein veritabler Verkaufsschlager, besonders für ein Debüt. Auf alle Fälle ist es das meistdiskutierte Werk der Saison. Selbst der Durchschnittsbürger weiß nach all der Presse jetzt etwas mit Capotes Namen – vor allem mit seinem blonden Bürschchengesicht – anzufangen.
Im Oktober desselben Jahres lernt er seinen Lebensgefährten Jack Dunphy kennen.
Zusammen mit Jack, meistens aber ohne ihn – der meidet jeden gesellschaftlichen Rummel – frönt Truman genüsslich seinem Reisefieber. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, bevor der Massentourismus einsetzt, ist er häufig mehrere Monate am Stück in Europa: in Italien oder Griechenland, am liebsten auf Inseln, wo er sich eine günstige Unterkunft am Meer mietet. Abwechselnd dem süßen Leben huldigt und schreibt.
Auch die Pariser sind nach all den Magazinartikeln und dem Gerede über ihn und sein berückendes Bübchen-Foto auf diesen Ausnahmedebütanten mit dem Ausnahmecharme neugierig; selbst Jean Coctau will Truman unbedingt kennenlernen. Der wird ihm bald Colette vorstellen, aber in Bars und Cafés wie dem Flore stößt Truman auch von allein auf weitere wichtige Künstlerinnen und Künstler der Zeit. Die amerikanische Expat-Künstlerelite mischt sich mit den französischen Intellektuellen – tout New York trifft auf tout Paris. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gertrude Stein und ihre Partnerin Alice B. Toklas sind nur einige, die ihn zu ihren feuchtfröhlichen Stelldicheins dazuladen, aber auch alte Bekannte wie Janet Flanner, die Korrespondentin des New Yorker, oder James Baldwin sind Teil dieser Gemeinde. Ebenso Richard Wright, der erste afroamerikanische Bestsellerautor, der in seinem Roman Sohn seines Landes 1940 den Rassismus in den USA angeprangert hat.
Albert Camus, der spätere Literatur-Nobelpreisträger, wird Trumans Lektor bei Gallimard, dem Pariser Verlag, der Andere Stimmen, andere Räume auf Französisch herausgegeben hat. (Mit ihm hat er nach eigenem Bekunden einen One-Night-Stand.)
Auf Taormina, Sizilien, mieten sich Truman und Jack ein kleines Häuschen; er arbeitet an seinem zweiten Roman Die Grasharfe.
Der erscheint im Oktober 1951. Vorbild für die Heldin Dolly Talbo ist Sook. An einer Stelle des Romans gesteht Richter Charlie Cool seinen neuen Freunden – drei Misfits, genauer gesagt ein Waisenknabe und zwei schrullige alte Frauen, die sich in sanfter Revolte in ein Baumhaus verzogen haben, dass er den einen Menschen, vor dem man nichts zu verbergen habe, selbst nie gefunden hätte:
»›Ich meine‹, erklärte der Richter, ›einen Menschen, dem man alles sagen kann. Ob ich wohl ein Narr bin, dass ich mir so etwas wünsche? Aber, ach, die Mühe, die wir darauf verwenden, uns voreinander zu verbergen, die Angst, dass wir erkannt werden könnten! Aber hier sind wir erkannt als das, was wir sind: fünf Narren in einem Baum. Das ist ein großes Glück, vorausgesetzt, dass wir den richtigen Gebrauch davon machen, wenn wir unbesorgt darum sind, wie wir den anderen erscheinen, und frei herausfinden dürfen, wer wir in Wahrheit sind …‹«
William S. Paley, Chef des TV-Senders CBS, und seine feengleiche Gattin Babe vergucken sich in den Golden Boy; erstmals begegnen sie sich im Januar 1955 im Feriendomizil der Paleys auf Jamaika, wohin ihn ein gemeinsamer Freund mitgenommen hat. Von da an ist er regelmäßig und über Jahrzehnte bei den Paleys zu Gast. Truman steigt zum Liebling der High Society auf. Die oberen Zehntausend der Ostküste reißen sich ebenso wie der internationale Jetset um Truman als glänzenden Unterhalter: keine Party mehr ohne ihn und seine hochvergnüglichen Geschichten!
1953 adaptiert er seine Kurzgeschichte Ein Haus aus Blumen fürs Theater; 165 Mal wird es bis Mai 1955 unter tosendem Applaus am Broadway aufgeführt.
Über viele Wochen ist er als Pionierreporter mit der afroamerikanischen Theatertruppe von Porgy and Bess unterwegs durch die Sowjetunion. Sein anschließender Bericht wird im New Yorker publiziert und im Dezember 1956 in Buchform.
Er bezieht mit Jack Dunphy ein Apartment in Brooklyn Heights, in dem sie für fast eine Dekade wohnen bleiben.
Sook setzt er 1956 in seinen Weihnachtserinnerungen ein liebevolles Denkmal. Als äußerst kluge Menschenkennerin und beachtliche Erzählerin lehrt Sook ihn demnach durch all ihre großen kleinen Geschichten auf poetische Weise Hochachtung vor der Kreatur.
1957 veröffentlicht er, erneut im New Yorker, ein Porträt von Marlon Brando, das für Aufsehen sorgt, weil es den berühmten Schauspieler von einer gänzlich unbekannten, intimen Seite präsentiert. Bis heute hat Der Fürst in seinem Reich die journalistische Latte für echte Nahaufnahmen von Prominenten gesetzt: Damit wurde es ein früher Vorläufer, ein Brandbeschleuniger für den New Journalism.
1958 bringt der Esquire seinen Kurzroman Frühstück bei Tiffany vorab heraus; im selben Jahr erscheint es als Buch, zusammen mit weiteren Erzählungen. 1961 kommt die Verfilmung unter der Regie von Blake Edwards ins Kino: Und die grazile Audrey Hepburn macht im Nu Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Trumans Holly Golightly verliebt. Wie nebenbei entwirft sie ein neues Schönheitsideal; mittlerweile sind in den Köpfen Audrey und Holly längst zu einer anmutigen Silhouette verschmolzen.
In der New York Times stößt er am 16. November 1959 auf die Meldung, in Kansas sei eine vierköpfige Farmersfamilie brutal ermordet worden. Er reist umgehend an den Tatort, nach Holcomb, im Auftrag des New Yorker. Dort ist er sich schnell sicher, dass das Verbrechen an der Familie Clutter den geeigneten Stoff abgibt für sein länger bestehendes Vorhaben, ein tatsächliches Ereignis mit literarischen Mitteln nachzuerzählen.
Am 30. Dezember werden die mutmaßlichen Mörder Perry Smith und Richard Hickock von der Polizei geschnappt. Er beginnt intensive Gespräche mit ihnen im Knast – wie unzählige mit Ermittlern und Betroffenen des Mordes.
Der Roman seiner frühen Kameradin an der Schreibmaschine Harper Lee, To kill a Mockingbird, erscheint in den USA, nachdem Truman seine zwei Jahre jüngere Freundin einem Literaturagenten empfohlen hat. Sie revanchiert sich, indem sie ihm maßgeblich bei der Recherche für Kaltblütig hilft.
Zusammen mit Jack kauft er sich 1960 als enthusiastischer Skiläufer ein kleines Chalet nahe Verbier in der Schweiz. Ohne Jack erwirbt er 1965 ein Apartment im United-Nations-Plaza-Gebäude in Manhattan, dem damals angesagtesten Skyscraper der Metropole. Sein Landhäuschen in Sagaponack auf Long Island behält er ebenfalls, dort wohnt Jack in Rufweite in einem beinahe baugleichen Beach House. Zudem gehört ihm ab 1970 ein komfortabler Bungalow in Palm Springs.
Kaltblütig, sein schriftstellerischer Triumph, entsteht in weiten Teilen während seiner Winter in den Schweizer Alpen. Fünf Jahre Recherche bilden dessen Resonanzboden; fünf lange Jahre recherchiert Capote die Hintergründe des Verbrechens. Als er seine Ergebnisse zu einer Erzählung verdichtet hat, verschlägt es allen den Atem.
Zunächst erscheint sie in vier Folgen im New Yorker: erzählt als reales Geschehen, verkauft als »Tatsachenroman«, bis ins letzte grausame Detail wahrhaftig. Die zwei Mörder verstören die Leserschaft mit Innenansichten, welche der sonst so behaglichen Aufteilung in Täter und Opfer, in Gut und Böse, in die Parade fahren.
Mit Pauken und Trompeten empfängt man im Januar 1966 Kaltblütig; gewidmet ist das Buch Jack Dunphy und Harper Lee, »in Liebe und Dankbarkeit«. In der Erscheinungswoche ist es auf diversen Titelblättern zu sehen, und in ausnahmslos jedem Kulturaufmacher des Landes wird es besprochen.
Mit Kaltblütig verdient er Millionen: Es steht 37 Wochen durchgehend auf der New York Times-Bestsellerliste – allein im ersten Jahr wird es in den USA 300000 Mal verkauft. (Bis 1987 wächst die Zahl auf fünf Millionen Bücher, und es ist in 37 Sprachen übersetzt. In seinem Interview mit Lawrence Grobel wird Capote Mitte der Achtziger sagen, es seien in den USA an die 15 Millionen Exemplare verkauft worden.)
Das große Los geht zusätzlich mit etlichen nichtmonetären Anerkennungen einher: Die Literaturkritiker wie seine Kollegen – ältere Hasen im Geschäft, wie Gore Vidal oder Norman Mailer – zollen ihm Tribut. Rühmen ihn den »vollkommensten Stilisten ihrer Generation«, mit einem »absoluten Gehör« für die Dialoge der Wirklichkeit. Man preist ihn als Erfinder eines neuen Literaturgenres, der Non Fiction Novel, mit dem er Journalismus in Literatur verwandelt habe.
Marella Agnelli, die Frau des Fiat-Chefs, wird in den Sechzigerjahren sein europäischer »Schwan Numero Uno«. Oft schippern sie gemeinsam auf der Jacht der Agnellis über die Weltmeere, zum Beispiel durch die Ägais oder die Türkei. Sie betrachtet ihn als einen ihrer engsten Freunde und vertraut ihm ihr Innerstes an.
Sein Jubelzug gipfelt im November 1966 in seinem Black and White Ball im New Yorker Hotel Plaza, den er offiziell zu Ehren der Washington Post-