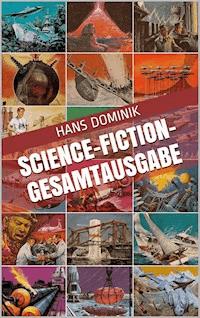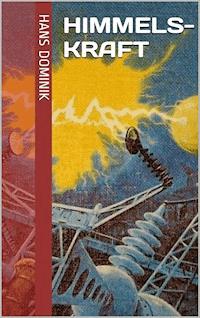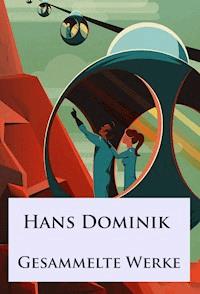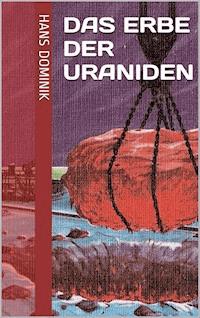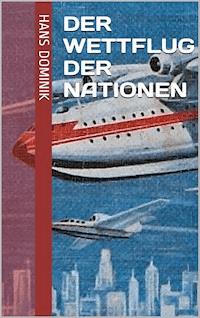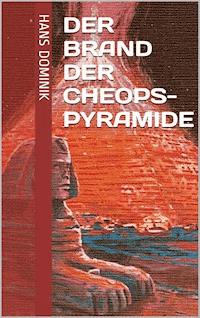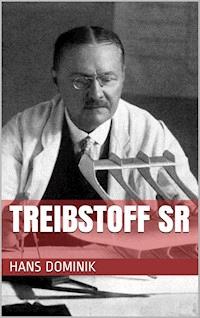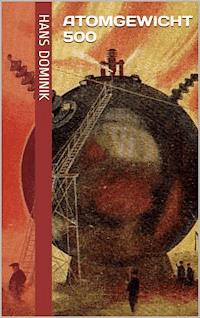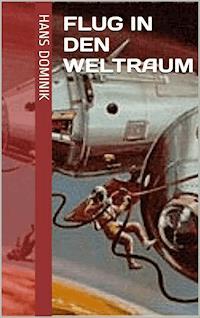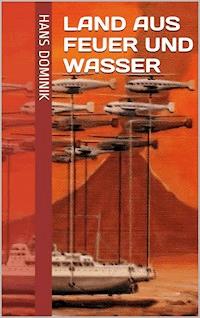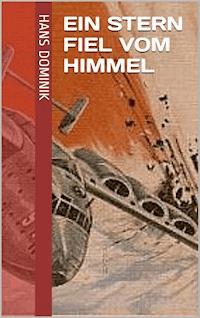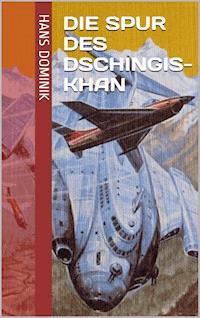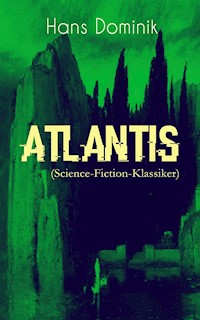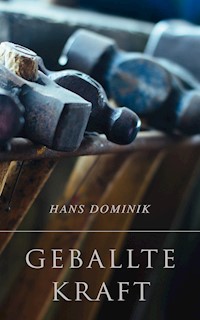Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"König Laurins Mantel" ist ein 1943 veröffentlichter Science-Fiction-Roman (damals: Zukunftsroman, oder auch utopisch-technischer Roman) des Autors Hans Dominik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
König Laurins Mantel
Impressum
König Laurins Mantel
Ein häßlicher, feuchtkalter Herbsttag. Auf den Sommersitzen der englischen Gesellschaft rüstete man zur Abreise.
Die altersgrauen Mauern von Roßmore-Castle verschwammen im grauen Dunst des Hochmoornebels.
Lord Roßmore schritt in seinem Arbeitszimmer unruhig auf und ab, blieb zuweilen am Kamin stehen und wärmte die Hände am Feuer. Ein alter Diener trat ein, um die Glut zu schüren.
»Ist mein Sohn William noch nicht zurück?«
»Jawohl, Euer Lordschaft! Mr. Hogan kehrte eben von der Jagd zurück!«
»Er soll zu mir kommen!«
Ein wenig später trat der Gerufene ein. Die sorgenvollen Züge Lord Roßmores schienen sich zu glätten, als sein Blick über das frische, wettergebräunte Gesicht seines Sohnes, über die schlanke, sportliche Gestalt im Jagddreß glitt. Doch dann wehrte er unwillig den Jagdhund ab, der ihm gefolgt war und tapsig an ihm hochsprang.
William Hogan griff den Hund am Halsband.
»Kusch dich, Hektor! – Nun, Vater –?«
Wortlos schritt Lord Roßmore an den Tisch und reichte seinem Sohn einen Brief.
»Oh! ...« Das gezwungene Lächeln und die leichte Röte, die über das Gesicht des jungen Mannes huschten, verrieten unangenehme Überraschung.
»Mr. Malone ist wieder mal um seine Pfunde besorgt. Es war doch abgemacht, daß er sich mit der Begleichung der Schuld bis zum Winter gedulden wolle!«
»Und dann?!« rief der Lord in scharfem Tone. »Wie gedachtest du die tausend Pfund zu zahlen? – Du schweigst. Weißt genau, daß dein mütterliches Erbteil längst aufgebraucht ist. Weißt ebenso, daß ich mich geweigert habe, deinem Leichtsinn fernerhin Vorschub zu leisten. Die Einkünfte aus Roßmore genügen gerade, um meine Bedürfnisse und später die deines Bruders Allan zu bestreiten, der als Ältester die Pairie erbt. Du, als zweiter Sohn, bist darauf angewiesen, nach meinem Tode für dich selber zu sorgen. Alle Mahnungen, dir eine gute Ausbildung zu verschaffen, schlugst du in den Wind!«
Der Lord trat vor seinen Sohn, der sich verlegen zur Seite gewandt hatte. »Bill!« Er legte seine Hand auf Williams Schulter. »Ich war heute morgen in Lacey-Hall. Edward Lacey hat durch seine amerikanische Heirat seine Verhältnisse aufs beste geordnet. Ich weiß von Laceys Gattin, daß es dich nur ein Wort kostet, und Maria Potter, die bei ihr zu Besuch weilt, ist die deine!«
Bei Nennung dieses Namens wollte William brüsk auffahren. Dann, als besänne er sich, sah er den Vater bittend an – und erblaßte unter dessen strengem Blick. Mit müden Schritten ging er zu einem Sessel.
»Vater, du gestattest, daß ich mir eine Erfrischung kommen lasse. Die Jagd hat mich durstig gemacht.« Er drückte auf einen Knopf. Der Diener erschien. »Whisky und Soda, Thomas!«
Der Alte brachte gleich darauf das Gewünschte, ließ die Tür einen Augenblick offen, schlurfte wieder hinaus.
»Zurück, Hektor! Bist du verrückt geworden?«
Unwillkürlich waren Vater und Sohn aufgeschreckt. Der Hund, der in einer Ecke gelegen hatte, stürzte plötzlich erregt zur Tür.
»Kusch, Hektor!« rief William Hogan zornig.
Was hatte der Hund? Mit gesträubtem Fell, funkelnden Auges knurrte er am Zimmereingang, als stünde ein Fremder vor ihm. William erhob sich, um das wütende Tier zu bändigen. Da, als hätte ein Fußtritt ihn getroffen, wich der Hund aufheulend zur Seite, duckte sich furchtsam, kroch kläglich winselnd unter einen Sessel.
»Was hat das zu bedeuten?« fragte Lord Roßmore erstaunt. »Ist Hektor krank?«
William Hogan schüttelte den Kopf, blickte halb verwundert, halb besorgt auf den Hund. »Ich kann es mir nicht erklären. Er verhält sich so, als wenn ein Fremder ins Zimmer tritt. Doch wir sind allein. Die Tür ist zu, draußen ist niemand. Thomas hätte einen Besucher längst gemeldet.«
»Er scheint sich jetzt beruhigt zu haben. Er liegt still, doch seine Augen glühen, als wittre er Verdächtiges.«
»Ruhig, Hektor! Ruhig!« William Hogan warf sich sinnend in seinen Sessel.
Sein Vater betrachtete ihn schweigend, voll verstohlenen Mitleids. Er sah, wie allmählich aller Glanz aus dem eben noch so frischen Antlitz wich, wie tiefe Falten sich in die glatte Stirn gruben. Lord Roßmore schritt zum Fenster.
William legte die Hand auf die Augen. »Vivian!« flüsterte er. »Vivian! Dich lassen –!«
Seine Augen schlossen sich. Er sah in Gedanken die zarte Gestalt, das rührend liebliche Antlitz. Wie oft schlossen ihre Arme ihn an ihre Brust? ... Das heimliche Stelldichein im Park von Doherty-Hall – die Stunden im nächtlichen Hain – –
Dann, als hätte eine Faust ihn berührt, erstarrte er in Schreck und Abwehr. Das letzte Zusammentreffen ... was hatte ihm da Vivian schluchzend zugeraunt?
Wie von einem Hieb getroffen, schnellte er hoch. »Unmöglich, Vater! Ich kann Maria Potter nicht heiraten! Nie!«
Lord Roßmore wandte sich um, sah in tiefer Betroffenheit das todblasse Gesicht seines Sohnes. »Ich weiß, William, woran du denkst. Vivian Doherty – du liebst sie! Ich ahnte es längst. Mit Freuden würd' ich sie als Schwiegertochter begrüßen. Es ist aber unmöglich! Ihre karge Mitgift reicht nicht aus. Ihr seid beide von Jugend auf verwöhnt. Diese Heirat wäre Torheit! Du mußt dir das endlich klarmachen!« Seine Stimme wurde schärfer. »Von mir hast du nichts zu erwarten – das weißt du! Es gibt nur den einen Ausweg: die Ehe mit Maria Potter.«
William wollte sprechen, doch sein Vater schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab. »Nur zwei Möglichkeiten gibt es für dich. Du heiratest Maria Potter oder nimmst Dienst irgendwo in den Kolonien. Roßmore-Castle wird dir für alle Zukunft so oder so verschlossen bleiben. Die Eltern Maria Potters verlangen natürlich, daß ihr einziges Kind in Brasilien bleibt. Du müßtest nach dort übersiedeln.«
William ließ den Kopf tiefer und tiefer sinken. Die zuckenden Schultern verrieten, wie stark es in ihm arbeitete.
Ein langes Schweigen folgte. Dann richtete er sich auf. »Wie hoch ist die Summe, um die ich mich verkaufen muß, Vater?«
Lord Roßmore zuckte zusammen. »Verkaufen? Warum dieses harte Wort? Miß Maria ist ein liebenswertes Mädchen, mögen auch die Eltern ihre niedere Herkunft nie verleugnen können.« Und leiser fuhr er fort: »Man schätzt das Vermögen des alten Potter auf mindestens zwei Millionen Süd-Dollar.«
»Gib mir Bedenkzeit, Vater! Ich kann – –«
»Unmöglich!« Der Lord deutete auf den Brief. »Die Schuld muß bis morgen getilgt sein. Ich kann dir nur beispringen, wenn ich weiß, was du unternimmst.«
William schritt erregt auf und ab, machte dann vor seinem Vater halt. »Also gut!« Und wandte sich mit schmerzlichem Seufzer zur Tür.
Eilends folgte ihm der Hund. Doch in der Nähe der Tür wiederholte sich das seltsame Gebaren des Tiers. An das Knie seines Herrn geschmiegt, den Schwanz eingeklemmt, den Kopf verängstigt zur Seite gedreht, folgte es zögernd.
William achtete nicht darauf. Er öffnete die Tür, ließ aber im selben Augenblick erschrocken die Klinke los. Verharrte sekundenlang wie unter dem Eindruck einer jähen Überraschung. Seine Nasenflügel bebten, als erfühle er etwas Fremdes, Ungreifbares. Der Hund neben ihm stieß plötzlich ein klagendes Geheul hervor.
Lord Roßmore kam mit schnellen Schritten. »William, was ist –? Du bist ja wie irre! Auch der Hund – – Was soll das?«
William Hogan holte tief Atem, strich sich über die Stirn. »Eine Sinnestäuschung, Vater. Auch Hektor ... Es war mir, als hätte jemand, der hier gestanden, das Zimmer verlassen.«
Lord Roßmore schlang besorgt den Arm um die Schulter des Sohnes. »Deine Nerven sind überreizt. Ich weiß ja, wie schwer der Entschluß dir fällt! Glaub mir, William, es ist das einzig Richtige! Geh nun in dein Zimmer, schlaf dich aus! Morgen früh werden wir Fräulein Potter unsere Aufwartung machen.«
Eine knappe Wegstunde von Roßmore-Castle entfernt, nahe am Ufer des Weyman-River, liegt auf einem nach drei Seiten steil abfallenden Felsenplateau Doherty-Hall. Auf den Grundmauern eines alten Normannenschlosses hatte der Vater des jetzigen Besitzers, Sir Roger Doherty, einen stattlichen Landsitz errichten lassen. Regelmäßig verbrachte die Familie hier den Sommer. Der frühe Eintritt des Herbstes brachte jetzt die Rückkehr nach London in nächste Nähe.
Den breiten Fahrweg, der zum Hause führte, kam ein junger Mann mit einem Knaben entlang. In der Nähe einer großen Buche, deren Laub schon in allen Farben schimmerte, lief der Knabe von seinem Begleiter fort zu einer Bank, die unter den tief hängenden Zweigen verborgen war.
»Da sind wir wieder, Vivian!« Der Knabe schlang die Arme um die Gestalt eines jungen Mädchens. »Dr. Arvelin und ich haben einen weiten Weg hinter uns. Wir waren auf der anderen Flußseite, in den Wäldern von Roßmore-Castle. Dort trafen wir William Hogan. Er war auf der Jagd, hatte einen starken Hirsch erlegt. Das prächtige Geweih zeigte er mir. So groß!« Er breitete mit drolligem Ernst beide Arme aus.
Das Mädchen hob ihn auf den Schoß, streichelte seine Stirn. »Nun wirst du müde sein und Hunger haben, Phil.«
Der Bruder nickte eifrig. »Ja, ja, Vivian, gewiß bin ich hungrig. Aber –« Ein Lächeln glitt über seine Züge. »Erst mußt du noch hören, was da passiert ist! Erst kriegte ich einen Schreck – dann mußte ich aber so lachen! – Als wir bei William Hogan standen, kam der alte Hektor aus den Büschen geflitzt und auf uns zugelaufen und ... ja, wie er bei uns war – ha, ha, Vivian, wie hab' ich lachen müssen! –, da wollte er Dr. Arvelin beißen! Oh, Hektor war sehr böse! Er hat geknurrt und gebellt. So zornig, als wollte er den Doktor fressen. Aber da hat William Hogan ihn mit der Peitsche geschlagen und ist mit ihm fortgegangen.«
»Und hat er weiter nichts zu dir gesagt, Phil?« flüsterte Vivian leise dem Bruder ins Ohr.
»O ja, Vivian! Ich soll Grüße an dich bestellen!«
Errötend drückte das Mädchen einen zärtlichen Kuß auf die Lippen des Bruders und übergab ihn seinem Erzieher, der jetzt näher trat.
»Verzeihen Sie, Fräulein Doherty, wenn ich Sie darauf aufmerksam mache, daß Sie in leichtem Kleid in der kühlen Luft hier sitzen! Darf ich Ihnen einen Schal oder ein warmes Kleidungsstück holen?«
Vivian Doherty wehrte freundlich ab. »Vielen Dank für Ihre liebenswürdige Fürsorge! Es ist wirklich nicht nötig. Ich komme gleich ins Haus zurück.«
Ihr Blick haftete an den Davonschreitenden, bis sie an einer Wegbiegung verschwanden. – –
Schon über drei Jahre war Dr. Arvelin im Hause Sir Dohertys. Von einer Reise hatte ihn dessen Gattin Mary als Hauslehrer für Phil mitgebracht. Der Knabe, bis dahin ein schwächliches, nervöses Kind, wurde unter Arvelins Leitung von Grund auf verändert. Geistig und körperlich blühte er auf, und das Verhältnis des Doktors zur Familie gestaltete sich im Laufe der Zeit immer inniger. Nichts im Hause geschah, ohne daß man ihn zur Teilnahme aufforderte, obwohl sein schüchternes, linkisches Wesen zu dem rauschenden Gesellschaftstrubel schlecht paßte.
Für Fremde mochte er wohl seines unvorteilhaften Äußeren wegen eine Spottgestalt sein. Der sonderbar geformte Schädel mit der vorspringenden Stirn, der schmale Schnurrbart unter der überlangen Nase, die mittelgroße, hagere Gestalt in schlecht sitzender Kleidung – das alles konnte bei oberflächlichem Eindruck lächerlich wirken. Anders freilich wurde es, sobald er sprach. Die wohllautende Stimme, das lebhafte Spiel der großen, geistvollen Augen ließ die Körpermängel vergessen. Phil jedenfalls hing mit abgöttischer Liebe an seinem Lehrer.
Als sich herausstellte, daß Dr. Arvelin sich aus Liebhaberei mit physikalischen Studien beschäftigte, richtete ihm Sir Doherty im turmartigen Giebel des Hauses ein Laboratorium ein. Hier verbrachte der Doktor fast alle freien Stunden. Es gab Zeiten, wo nächtelang das Licht im Turmzimmer nicht erlöschte.
Das Personal des Schlosses hatte einen heiligen Respekt vor dem Gelehrten. Unter den Dienstboten lief allerlei Gemunkel um über sein geheimnisvolles Treiben; nur scheu betraten sie den Turm.
Der Tochter des Hauses, Vivian, begegnete Dr. Arvelin stets mit rührender Ergebenheit. Soweit es seine Stellung erlaubte, suchte er jeden ihrer Wünsche, kaum daß er geäußert worden, mit emsiger Beflissenheit zu erfüllen.
Langsam schlenderte Vivian dem Hause zu. Traf in der Halle den kleinen Bruder, der mit Appetit seine Mahlzeit verzehrte.
»So allein, Phil?«
»Ja, Vivian! Dr. Arvelin ist noch einmal zurückgewandert. Er hat unterwegs seinen Stock vergessen. Weil er ein wertvolles Andenken ist, will er ihn suchen.«
Fahles Mondlicht lag über dem Herbstlaub des nächtlichen Parks. Aus einem Pförtchen an der Rückseite des Hauses schlüpfte eine weibliche Gestalt. In ein dunkles Tuch gehüllt, eilte sie über den mondbeschienenen Platz und verschwand in den Bosketten. Vorsichtig im Schatten der Sträucher und Baumgruppen bleibend, pirschte sich Vivian über den Rasen nach einem Weg, der zu der Brüstung der großen Plattform führte. Dort senkte sich der Fels weniger steil zur Flußniederung.
Ein sausender Windstoß, vom Meere her, fuhr durch die breiten Äste der hohen Platanen, Regen von Laub rieselte über das Wäldchen herab. Fröstelnd zog sie das Tuch enger um die Schultern, barg sich hinter einem schützenden Baumstamm.
Minute um Minute verrann. Angestrengt horchte sie nach dem Flusse. Endlich ein schriller Pfiff vom Wasser her. Vivian schrak zusammen, eilte unwillkürlich zur Brüstung, starrte in das Halbdunkel über der Tiefe.
Wird William sein Versprechen gehalten und mit seinem Vater gesprochen haben? O Gott, wenn der Lord die Bitte zurückwies –! Was sollte aus ihr werden, wenn Lord Roßmore seine Einwilligung verweigerte? Die Eltern – der strenge Vater, was würde er mit ihr tun?
Ihr Herz pochte mit stürmischen Schlägen. Ein zweiter, leiser Pfiff vom Fuß der Felsen. Hastig richtete sie sich auf, blickte voll banger Erwartung in die Tiefe. Noch war nichts zu sehen. Wieder packten sie die quälenden Gedanken.
War die Entscheidung gefallen? Hatte Lord Roßmore den Bitten seines Lieblingssohnes widerstehen können? Nein! Nein! Es konnte, durfte nicht sein! Williams Gruß durch ihren Bruder Phil mußte als gutes Zeichen gelten. Lord Roßmore würde doch Mittel und Wege finden, William zu helfen.
Poltergeräusch eines fallenden Steins ließ sie aufmerken. Aus dem Schatten eines Strauchs tauchte die Gestalt eines Mannes, der langsam den steilen Hang heraufkletterte. Vivian vermochte die brennende Ungeduld kaum zu zügeln. Sie winkte mit einem kleinen Tuch dem Ankömmling zu, der jetzt schneller zu steigen begann. Noch ein paar Schritte, und er hatte den Fuß der Mauer erreicht.
»William! ... Bringst du gute Kunde?« kam es flüsternd von den Lippen des Mädchens.
Der Kletterer antwortete nicht, legte die Rechte auf die Brüstung, zog sich empor, um sich herüberzuschwingen.
Beim Anblick seiner bleichen, erregten Züge prallte Vivian zurück, preßte die bebende Hand aufs Herz.
»William!« wollte sie rufen, doch ihre Stimme versagte.
Hogan, die Augen auf Vivian gerichtet, wollte eben mit letzter Anstrengung sich über die Mauer werfen, da ... ein heiserer Laut der Überraschung, des Schreckens: Seine weit aufgerissenen Augen starrten auf die Gestalt Arvelins, die plötzlich, wie aus dem Boden gezaubert, hinter Vivian stand und ihm drohend die Faust entgegenreckte.
Gelähmt von dem spukhaften Bild, versagten Williams Kräfte. Seine Finger glitten von den Steinen ab; vergeblich suchten die Füße Halt. In schwerem Sturz fiel der Körper zurück, rollte, sich überschlagend, den Hang hinab.
Ein Schrei des Entsetzens kam aus Vivians Mund. Angstbetäubt taumelte sie zur Mauerbrüstung, streckte jammernd die Arme nach dem Stürzenden aus. Sank dann ohnmächtig zu Boden. –
Wie lange sie gelegen, wußte sie nicht. Als sie die Lider hob, drang die Stimme Arvelins an ihr Ohr. Sie lag im Schatten der Platane, von dem Doktor sorglich gebettet. Seine Hand strich beruhigend über ihre angstvoll starrenden Augen.
»Keine Sorge, Vivian! William Hogan lebt! Eine ungefährliche Fußverletzung – er wird bald wiederhergestellt sein!«
Eine leichte Röte huschte über Vivians blasse Züge. »Sie lügen nicht, Dr. Arvelin? Es ist Wahrheit?«
Arvelin nickte. »Es ist Wahrheit! Ich selbst sah, wie Hogans Diener seinen Herrn ins Boot brachte und ihn über den Fluß setzte.«
Unter dem Bann ihrer zweifelnden Augen sprach er weiter: »Ich war zu später Stunde noch in den Garten gegangen, allerhand Gedanken nachhängend. Kam hierher, hörte Ihren Schrei, sah, wie Sie fielen. Nachher eilte ich den Hang hinab und stellte fest, was ich Ihnen vorhin erzählte!«
Er schob den Arm unter Vivians Achsel, richtete sie auf. »Sie müssen ins Haus zurück, dürfen nicht länger hierbleiben. Es könnte jemand kommen. Raffen Sie Ihre Kraft zusammen!«
Mit dankbarem Lächeln hob sich Vivian an Arvelins Arm vom Boden, mühte sich tapfer, an seiner Seite weiterzuschreiten. Doch ihre Glieder versagten. Halb bewußtlos strauchelte sie aufs neue. Hilfsbereit hatte Arvelin die Sinkende aufgefangen und trug sie nun in eiligem Lauf ins Schloß.
Wochen waren vergangen. Eine Reihe schöner, warmer Herbsttage hatte Sir Doherty veranlaßt, die Abreise nach London zu verschieben. Unter der glasbedeckten Halle saß die Familie beim Lunch. Phil hüpfte dem Diener entgegen, der die Post brachte.
»Oh! Etwas aus Brasilien?« Fröhlich schwenkte er einen Brief durch die Luft.
Alle sahen neugierig Doherty zu, der den Umschlag öffnete. Dr. Arvelin streifte mit einem schnellen Seitenblick Vivian, auf deren Antlitz Blässe und Röte wechselten. Jetzt hatte Doherty das Schreiben entfaltet.
»Oh – eine große Neuigkeit! William Hogan zeigt seine Verlobung mit Fräulein Potter in Rio de Janeiro an.«
Noch ehe die anderen den Sinn der Worte erfaßt hatten, flogen aller Augen zu Dr. Arvelin, der aufgesprungen war und die ohnmächtige Vivian in den Armen hielt.
Die weiteren Ereignisse des Tages überstürzten sich in rascher Folge. Vivian, von ihrer Mutter zu Bett gebracht, hatte in wirren Fieberträumen verraten, wie es um sie stand. Die Eltern, niedergeschmettert von dem Furchtbaren, konnten es nicht begreifen. Die einzige, die eine Erklärung abgeben konnte, Vivian selbst, schien mit dem Tode zu ringen.
Unmöglich, jetzt an die Abreise zu denken. Die schottischen Wälder lagen im ersten Schnee, und noch immer war man in Doherty-Hall.
Finstere, sternenlose Nacht. Wieder öffnet sich die Hintertür des Landsitzes. Eine Gestalt schreitet wie im Schlafwandel der Plattform zu, schwingt sich über die Mauer. Vorsichtig, Fuß vor Fuß setzend, klettert sie den steilen Hang hinab. Beschleunigt unten ihre Schritte, eilt dem Flusse zu.
Jetzt hält sie jäh an, wendet den Kopf zurück. Ihre Augen durchdringen das Dunkel ... Nichts zu sehen. Und doch! Hatte ihr Ohr nicht den Ruf »Vivian« vernommen?
Sie wendet sich, schreitet weiter. Da! Hört sie nicht: plötzlich das Keuchen eines Menschen, der hinter ihr her eilt? Sie beginnt zu laufen. Nichts zu sehen – und doch wieder der heisere Ruf: »Vivian!«
Unaufhaltsam eilt sie in jagender Hast ihrem Ziele, dem Flusse, zu. Springt auf eine Steinplatte, die weit über das Ufer hinausragt. Stürzt sich in jähem Schwung in die dunkle Flut. Noch ein letztes Mal glaubt sie jenen Ruf zu hören, dann schlagen die Wellen über ihr zusammen.
Wieder standen die schottischen Wälder in herbstlichem Farbenspiel. Aber Doherty-Hall blieb unbewohnt. Nach den furchtbaren Ereignissen des vergangenen Jahres hatten die Dohertys es gemieden. In ihrem Londoner Haus standen die Koffer gepackt. Sir Doherty war im Begriff, mit seinen Angehörigen nach Kalkutta zu fahren, wo er eine hohe Stellung bekleiden sollte.
Noch einmal drückte Dr. Arvelin den kleinen Phil an sein Herz, sprach liebevoll auf den weinenden Knaben ein. Die Mutter mußte kommen, die Arme Phils zu lösen, die Arvelins Hals nicht loslassen wollten. Noch ein herzlicher Händedruck an die Eltern. Dr. Arvelin wandte sich, um seine Rührung zu verbergen, und schritt schnell aus der Halle.
An jenem Stein, der zuletzt Vivians Fuß getragen, ehe sie den Tod in den Fluten suchte, stand Dr. Arvelin. Stand lange so. Das Mondlicht, das durch die Uferbäume brach, weckte ihn aus seinen Sinnen. Fröstelnd zog er den Mantel enger um die Schultern, ging langsam flußabwärts.
Eine kleine Viertelstunde mochte er gegangen sein. Wieder wandte er sich dem Ufer zu. Ein Weidenbaum neigte seine Zweige bis auf den Wasserspiegel. Hier war's, wo er mit Aufbietung seiner letzten Kräfte, die Gerettete im Arm, aus dem Wasser kam.
Er kehrte jetzt dem Fluß den Rücken. Vor ihm lief ein schmaler Pfad einer Hütte zu, die, halb versteckt, sich ins Schilf duckte. Dorthin war er damals mit Vivian geeilt. Eine alte Fischerwitwe wohnte in dem Häuschen. In jungen Jahren war sie in Doherty-Hall bedienstet gewesen. Sie kannte Vivian von Kindheit an, hatte die ersten Stunden der Neugeborenen betreut.
Jene Schreckensnacht verging. Im Morgengrauen hörte das alte Fischerweib den letzten Seufzer Vivians, den Schrei jungen Lebens neben ihr ...
Die Erinnerung an diese Nacht wuchs lebendig vor Arvelins Augen herauf. Das heilige Versprechen, das Vivian mit ihrem letzten Atemzug ihm abgenommen, nichts von allem den Eltern zu verraten, ihnen die Schande zu ersparen – – er hatte es gehalten.
Arvelin stieß die Tür zu der Hütte auf. Im Lichtschein des Herdfeuers sah er das alte Fischerweib an einer Wiege sitzen, in der ein kräftiger Knabe lag. Er beugte sich über das Kind, schaute ihm lange ins Gesicht. Suchte fast ängstlich die Züge Vivians wiederzuerkennen, suchte lange – frohlockte innerlich, als die Alte rief: »Genau so sah die Mutter aus, als sie in diesem Alter war!«
Die Frau kramte in dem halbdunklen Hintergrund der Hütte allerhand zusammen, machte ein Bündel daraus und übergab es Arvelin. Der drückte ein paar Banknoten in die runzlige Hand, wandte sich zur Wiege, hüllte ein Tuch um das Kind. Die leichte Last auf dem Arm, verließ er die Hütte.
An der Ostseeküste unweit der Grenze auf einer Anhöhe ragte das Schloß der Freiherrn von Winterloo. Die alten, dicken Backsteinmauern, die noch wohlerhaltenen beiden Türme gaben ihm ein burgartiges Aussehen. Ein Stück landeinwärts der große Wirtschaftshof, an den sich die ausgedehnten Fluren schließen. Im oberen Turmgemach nach der Seeseite zu zwei Männer im Gespräch.
»Ich weiß nicht, lieber Arvelin, weshalb du dir meinen Vorschlag noch lange überlegen willst.« Freiherr von Winterloo deutete auf die offene Tür nach einem Saal hin, der wie ein Laboratorium eingerichtet war. »Hier findest du alles Notwendige für deine Arbeiten! Sollte etwas fehlen, würde ich's gern beschaffen. Du sagst ja selbst, daß du durch die kleine Erbschaft, die dir kürzlich zufiel, ziemlich unabhängig bist. Die Jagd nach einer beamteten Stelle hast du doch nicht mehr nötig.« Er streckte Arvelin die Rechte entgegen. »Schlag ein, lieber Freund! Eine größere Freude könntest du mir nicht machen, als wenn du dauernd hier bei mir bliebest!«
Der andere zögerte noch immer. Der laute Ruf einer Knabenstimme vom Garten her ließ ihn aufhorchen. Der Freiherr runzelte die Stirn.
»Wieder dieses Kindergeschrei! Hab' ich nicht der alten Droste streng befohlen, alle Störungen von diesem Teil des Gartens unter meinen Fenstern fernzuhalten?«
Arvelin hatte Winterloos Hand ergriffen, drückte sie, rief: »Ich bleibe!«
Der Freiherr umarmte seinen Freund. »Oh, wie schön! Wir werden ein glückliches Leben führen. Jeder wird seinen Arbeiten nachgehen, den anderen an seinen Erfolgen teilnehmen lassen. Mir ist's, als wär' ich um zehn Jahre jünger geworden!«
Arvelin wollte sprechen, da scholl wieder von unten die Knabenstimme. Der Freiherr hastete ärgerlich zur Tür, doch hielt der Doktor ihn zurück.
»Was hast du, Winterloo? Ist dir dies unschuldige Kind so verhaßt?«
Der Freiherr blickte erstaunt. »Das Kind? Ich kenn' es ja gar nicht! Oder doch: Es wird der Knabe der Droste sein. Ja, richtig! Die Alte ist zur Stadt gefahren. Und der Bengel benutzt nun die Stunden der Freiheit, um sich im Garten auszutoben – das heißt, uns zu stören!«
»Nein, Winterloo – mich stört er nicht! Ich freue mich darüber. Ein hübscher, frischer Junge! Ich sah ihn gestern, als ich die alte Droste, deine Haushälterin, begrüßte. Es ist ihr Sohn – oder ihr Enkel?«
Der Freiherr schüttelte den Kopf. »Nein. Doch wenn du so viel Interesse daran nimmst, will ich dir sein sonderbares Schicksal erzählen. Von der Alten selbst würdest du nichts erfahren. Sie hängt mit abgöttischer Liebe an dem Kleinen, behandelt ihn wie ihr eigenes Kind, hat ihm ja auch ihren Namen gegeben.«
»Du machst mich neugierig, Winterloo! Erzähle bitte! Laß mich mehr über den Jungen hören!«
Die beiden setzten sich. Der Freiherr begann: »Es mögen jetzt an die sieben bis acht Jahre her sein, daß der Knabe in mein Haus kam. An einem stürmischen Herbstmorgen. Die See ging hoch. Schon seit Tagen wagte sich kein Fischer aufs Meer. Ich war wohl eben aufgestanden, da hörte ich vom Ufer her lautes Geschrei. Ich lief hinaus, schrak zusammen: Ein Frachtschiff, weit draußen in der See, stand in Flammen! Was auf dem vorging, war mit dem Fernglas nicht zu erspähen. Noch stand alles in den Anblick des furchtbaren Schauspiels versunken, da schoß eine Feuergarbe zum Himmel hinan. Kurz darauf traf uns der Schall einer furchtbaren Explosion. Und ein paar Minuten später waren die brennenden Reste des Schiffes im Meer versunken.
Lange standen wir, starrten über die gischtenden Wogen nach der Unglücksstätte. Vielleicht, daß es doch der Mannschaft gelungen war, die Boote klarzumachen. Da plötzlich ein Schrei vom Turm her, wo der alte Droste dem Schauspiel zugesehen: ›Ein Boot kommt an!‹
Die hohen Wellen versperrten uns jede Aussicht. Ich eilte selbst in das Turmzimmer, nahm das große Stativrohr zu Hilfe, schaute in der Richtung, in der Droste das Boot erblickt hatte. Und fand es bald. Es trieb in rasender Schnelle dem Strande zu. Wunderbar, wie das leichte Fahrzeug unversehrt durch die Wogen glitt! Immer wieder erwartete ich, es werde sich querlegen, von einer überbrechenden Welle zum Kentern gebracht werden. Doch immer wieder, wie von einem unsichtbaren Gott gelenkt, immer wieder bot das Schiffchen den anstürmenden Wassern den scharfen Bug. Niemand am Steuer, leer das Boot. Nur wenn es in ein Wellental hinabschoß, glaubte ich am Boden ein Bündel zu sehen.
So kam's heran. Kurz bevor es den Strand erreichte, eilte ich hinab. Kam gerade zurecht, als eine Riesenwoge den Nachen ans Ufer setzte. Noch bevor die nächste Welle drohte, hatten die zuspringenden Fischer ihn landeinwärts gezogen.
›Bark Anne Mary!‹ rief ein Fischer mir zu. ›Anscheinend ein englisches Schiff, das da unterging!‹
Ich wollte mich zum Hause wenden. Da plötzlich ein vielstimmiger Schrei aus der Menge. Droste hatte das Bündel aus dem Schiff genommen und zu aller Überraschung entdeckt, daß es ein kleines Kind barg. Es lebte und streckte mit vergnügtem Lachen seine Händchen den fremden Menschen entgegen.
›Ein Wunder!‹ rief alles durcheinander.
Auch mich überlief's wie ein frommer Schauer. Wirklich, ein Wunder war da geschehen! Das Kind der einzige Überlebende von dem Unglücksschiff!
Im Lauf der Zeit wurde durch die Seeämter festgestellt, daß tatsächlich die Bark ›Anne Mary‹ auf der Fahrt von Leith nach Memel verschollen sei. Von der übrigen Besatzung hat niemals jemand wieder etwas gehört. Eine Passagierliste fand man nicht. Des Kindes Eltern sind sicherlich bei dem Schiffbruch zugrunde gegangen. Droste nahm es in seine Wohnung. Seine fromme Alte hielt es für ein Geschenk des Himmels an sie. Und seit nun vor Jahresfrist ihr Mann gestorben ist, hängt sie mit all ihrer Liebe an dem Knaben und hält ihn ganz wie ihr eigen.«
»Und du?« fragte Arvelin.
Der Freiherr lächelte in harmloser Abwehr. »Kindergeschrei ist nicht nach meinem Geschmack! Vielleicht, wenn der Junge größer wird ... Doch nein! – warum soll ich mich um ihn kümmern? Eine bessere Pflegemutter als die alte Droste könnte er nirgends finden!«
Jahre ... viele Jahre waren seit dieser Unterredung vergangen. Alt und grau waren die beiden Freunde geworden. Und in ihren Gemeinschaftsbund wuchs ein dritter hinein: Medardus Droste.
Nicht lange, nachdem Arvelin Wohnung in Schloß Winterloo genommen, hatte er den Knaben aus seiner Verborgenheit gezogen, war ihm Spielgefährte und Lehrer geworden. Auch der Freiherr hatte, je weiter das Kind zum Jüngling erwuchs, immer größeres Interesse für ihn bewiesen. Fast schien es, als ob sich die beiden Alten eifersüchtig um die Zuneigung des jungen Medardus stritten.
Da kam der große Streit zwischen der neuen Großmacht Brasilien und Venezuela. Auf die Kunde von den neuen Ölfunden hatte in Venezuela eine heftige Bewegung eingesetzt für ein Gesetz, das die Ausbeutung von Ölvorkommen durch ausländische Gesellschaften verbieten sollte. Die bis dahin bekannten Ölquellen neigten ihrer Erschöpfung zu. Die sich mehr und mehr ausdehnende Industrie Venezuelas war Hauptrufer in diesem Streit. Hatte man doch schon mit Bangen dem Augenblick entgegengesehen, da die Quellen versiegten und man genötigt sein würde, synthetischen Betriebsstoff zu beziehen.
Das Gesetz wurde im venezuelischen Parlament mit großer Stimmenmehrheit angenommen. Es traf in erster Linie brasilianische Interessen, in geringerem Maße auch englische. Die Ölinteressenten der brasilianischen Union unter Führung des Leiters der Centralen Oil Gesellschaft, William Hogan, hatten vergeblich gegen das Zustandekommen dieses Beschlusses gearbeitet. Durch geschickte Agitation verstanden sie es dann, die Stimmung in Brasilien derart zu beeinflussen, daß die Regierung eine diplomatische Aktion einleitete. Als sie fruchtlos zu verlaufen drohte, gaben ein paar Zwischenfälle, bei denen brasilianische Bürger ums Leben kamen, Anlaß zum Appell an die Waffen.
Doch in einem hatten sich die Brasilianer verrechnet. Aus dem geträumten Spaziergang nach Caracas wurde nichts. Der Krieg, auf beiden Seiten mit großer Erbitterung geführt, zog sich immer länger hin und verschlang Riesensummen. –
Es war ein schwarzer Tag in Winterloo, als von Medardus die Nachricht kam, er wolle die günstige Gelegenheit nutzen, seine Flugkenntnisse zu vervollkommnen und habe die Führung eines Luftriesen übernommen, den die Firma Truxton & Co. gechartert hatte, um Konterbande für Venezuela über den Ozean zu schaffen. Vergeblich alle Versuche der beiden Alten, Droste von diesem gefahrvollen Vorhaben abzubringen.
Die Wellen der Weltereignisse, die bis dahin das Gestade Winterloos kaum beunruhigt hatten, begannen nun stärker und stärker zu branden. Mit unverhohlener Sorge verfolgten die Freunde die Kriegsgeschehnisse, gespannt auf alle Nachrichten, die von den Fahrten ihres Medardus zu ihnen drangen.
Arvelin saß in seinem Schlafgemach. Vor ihm lag eine englische Zeitung, die das Bild des kühnen Flugkapitäns Medardus Droste brachte. Lange vertiefte sich der Alte in die frischen, energischen Züge.
»Das Bild ist gut getroffen!« murmelte er vor sich hin. »Medardus, wie er leibt und lebt!«
Er beschattete sinnend die Augen. Schritt dann zu einer kleinen Kassette, nahm ein Päckchen heraus und ging wieder zum Tisch.
Die Hülle des Päckchens fiel. Eine verblichene Photographie kam zum Vorschein. Das Bild einer jungen Dame. Arvelin legte es neben das Zeitungsblatt. Seine Augen gingen von dem einen zum anderen. Ein wehmütiges Lächeln glitt über sein faltiges Gesicht.
»Dieselben Züge, dieselben Augen! Nur daß das Kinn bei dem Jungen sich stärker ausprägt, energievoller. Keine Spur aber, gottlob, von William Hogan, diesem Verfluchten!«
Über dem Gasadorado ein alter, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammender Steinbau. Er stand noch im Weichbild der Befestigungsanlagen von São Salvador. Schon längst zum Abbruch bestimmt, hatte ihm der Krieg zwischen Brasilien und Venezuela neue Frist geschenkt.
Zwölf Schläge der alten Turmuhr. Edna Wildrake, die Insassin der Zelle 17, schob das Buch, in dem sie gelesen, zurück, ging ein paarmal wie in Erwartung auf und ab. Vom Ende des langen Ganges klang das Rasseln von Schlüsseln – die tägliche Revision des Fortkommandanten. Noch zehn Minuten – Edna hatte die Zeit wohl berechnet –, dann würde auch ihr Zimmer geöffnet werden. Hauptmann Winterloo würde, wie an jedem Tage, die üblichen vorgeschriebenen Fragen stellen und dann ... blieb sie wieder für vierundzwanzig Stunden allein.
Wenige Worte nur pflegte er an sie zu richten – und doch, welches Gewicht erhielten sie in seinem Munde! Ihr durch die lange Haft geschärftes Empfinden spürte unverkennbare Teilnahme an ihrem Schicksal heraus. Wie vorteilhaft unterschied sich überhaupt sein Benehmen von dem seines Vorgängers, des Majors Tejo. Der hatte nie anders als in brüskem, verächtlichem Tone mit ihr gesprochen.
Aus dem kurzen Gespräch mit der alten Mulattenwärterin, die täglich zu ihr kam, hatte sie einiges aus dem Leben der beiden Offiziere erfahren. Die furchtbare Katastrophe, die halb Bahia in Asche legte und Tausende von Menschenleben vernichtete, hatte auch in das Leben dieser Männer eingegriffen. Unter den Opfern befanden sich die Eltern Tejos und dessen Schwester Viktoria, die Verlobte des Hauptmanns Winterloo. Diese Katastrophe aber war das Werk des Kapitäns Wildrake, ihres Bruders! Sein stärkstes Heldenstück in den Augen des venezuelischen Vaterlandes und der neutralen Welt – ein fluchwürdiges Verbrechen in den Augen der Brasilianer. Verbrechen?! Immer wieder fragte sie sich, wie die brasilianische Union sie und ihre Familie für das Geschehene mitverantwortlich machen konnte.
Sie trat ans Fenster. Von der Höhe, auf der das Gefängnis lag, bot sich ein weiter Rundblick über den nördlichen Teil der Stadt. Wohin ihr Auge schaute – nichts als Trümmer und verkohlte Ruinen. Ragende Wrackteile auch im flachen Wasser der Bai.
»Damit Sie die Schandtat Ihres Bruders nicht vergessen, Fräulein Wildrake, hab' ich Ihnen das Zimmer mit dieser schönen Aussicht anweisen lassen. Eigentlich kein angemessener Kerkerraum für Leute Ihrer Art!« hatte Major Tejo gesagt, als sie hier hereingebracht wurde.
Der neue Kommandant Winterloo aber hatte schon beim ersten Besuch wie beiläufig sich erkundigt, ob sie nicht einen anderen Raum haben wolle. Sie hatte abgelehnt. Nur ihre Augen hatten gedankt für das verborgene Entgegenkommen, das in seiner Frage lag. Doch war es ihr seitdem, als webe unsichtbar ein Verbundensein zwischen ihr und diesem Manne – dem Manne, dem die Tat ihres Bruders die Braut geraubt.
Schon längst hatte sie das Grausige des Anblicks da unten überwunden. Nur immer wieder die Erinnerung aufgefrischt an das Heldentum ihres Bruders, an den Schlag, der den Koloß für Augenblicke zum Erzittern brachte. –
Dunkle Herbstnacht. Ein rasender Nordoststurm peitscht die Wasser der Bai zu haushohen Wellen. Mit Mühe halten sich die Tausende von großen und kleinen Fahrzeugen vor Anker. Die Kriegsschiffe draußen auf der Reede machen Dampf auf, um sich nötigenfalls auf die hohe See zu flüchten. Auch auf den beiden Riesenschlachtschiffen, die vor São Salvador festgemacht haben, ein wirres Hin und Her. Der ›Columbus‹ und ›Pizarro‹, der Stolz der brasilianischen Marine, Wunder der Schiffsbautechnik, kurz vor Beginn des Krieges fertig geworden. Keine Marine der Welt hatte ähnliche Schiffseinheiten aufzuweisen: Vier Torpedotreffer sollten sie ertragen können, ohne zu sinken ...
Da – der Ausguck auf dem ›Columbus‹ wollte schreien: »Periskop Backbord voraus in Sicht!« – Doch der Ruf erstarb in einer Detonation an Backbord des ›Columbus‹, der fast gleichzeitig eine zweite an Steuerbord des ›Pizarro‹ folgte.
Ein furchtbares Dröhnen in den beiden Riesenleibern, dann legen sich, wie Nußschalen auf einem Bach, die gigantischen Panzer auf die Seite ... Ein paar Minuten später, da, wo sie gelegen, nur noch ein Gewirr von Trümmern und von Menschen, die um ihr Leben ringen. Ihre Hilferufe verhallen im Brausen des Orkans.
– – Am Kai ankern die zwölf Öltankschiffe des Konvois, den die beiden Panzerschiffe hierher in den Hafen geleitet. Ihre kostbare Fracht ist zum Teil schon in die Ufertanks übergeleitet. Jetzt – ein kurzes Aufblitzen am Rumpf des ersten Schiffes ... des fünften, des achten –! Laute Schreie der Besatzungen. Am Ufer wird man aufmerksam, Lichter blitzen auf. Riesige brennende Ölmassen ergießen sich aus den getroffenen Schiffsleibern. Die lange Front des Seawall ist im Nu ein Flammenmeer, das sich, vom Sturm zu hemmungsloser Glut entfacht, mit Blitzesschnelle über die ganze Südfront der Bai ausbreitet.
Schon brennen die Docks! Dazwischen krachen die Explosionen der Landtanks. Die verängstigten Einwohner, durch des Brandes Tageshelle aus dem Schlaf gescheucht, stürzen auf die Straße. Da plötzlich ein donnerähnliches Getöse, das sich weiter und weiter fortpflanzt, ohne aufzuhören. Die riesigen Munitionsmengen, die, zur Verladung bestimmt, an den Kais lagern, explodieren.
Wildes Geschrei und Wehklagen der unzähligen von den Sprengstücken Getroffenen. Feuerwehr und Militär jagt zur Unglücksstätte. Noch weiß man nicht, was geschehen, übersieht kaum die Größe der Gefahr, da flackern schon die langen Uferstraßen mit den langen Lagerhäusern und hinter ihnen die stolzen Geschäftspaläste in lodernden Flammen.
Vergeblich alle Versuche, sie mit menschlichen Mitteln zu bekämpfen. Der tobende Sturm spottet aller Menschenmacht, stäubt die Flammen über Straßen und Plätze, verjagt die Helfer, frißt hohnlachend die verlassenen Löschapparate. Die Glut greift auf die innere Stadt über, überspringt ganze Viertel. Tausende, die sich noch retten wollten, sind plötzlich abgeschnitten, auf allen Seiten von brennenden Häuserblocks umgeben.
Erst in der Morgendämmerung legt sich die Gewalt des Orkans. Die Strahlen der jungen Sonne bescheinen ein Bild, weit grausiger und schrecklicher noch als das der großen Erdbebenkatastrophe vor fünfzig Jahren. Viel stärker und einschneidender auch als damals wirkte dies Unglück sich in den Ländern aus. Der Verlust so ungeheurer Werte jetzt mitten im Kriege war doppelt schwer zu ertragen. Bildete doch Bahia das Hauptsammellager für die technische Kriegführung. Auf den Kriegsschauplätzen machte sich der Ausfall empfindlich bemerkbar.
Wie war das Unglück entstanden? Man wollte, konnte nicht glauben, daß etwa ein Feind durch die hundertfach gesicherte Minensperre gebrochen sei. Die Berichte aus Bahia selbst waren so unklar, daß man sich kein sicheres Urteil bilden konnte. Da brachte am Abend des folgenden Tages der amtliche Heeresbericht aus Caracas folgende Nachricht: »Gestern nacht gelang es unserem U-Boot 48, in den Hafen von São Salvador einzudringen und die beiden Schlachtschiffe ›Columbus‹ und ›Pizarro‹ sowie zwölf Tankschiffe zu versenken.«
Die Welt verhielt den Atem.
Wer war es?
Ein paar Stunden später: der Name Robert Wildrake im Munde jedes Brasilianers. Er der Täter! Der Verbrecher! Millionen Flüche und Verwünschungen wurden auf sein Haupt geschleudert. Schon mehr als einmal hatten venezuelische Heeresberichte kühne Taten des Kapitäns Wildrake erwähnt. Man wußte Bescheid über ihn. Wußte, daß sein Großvater James Wildrake aus Schottland nach Venezuela eingewandert war und dort umfangreiche Ländereien erworben hatte. Dessen Sohn hatte eine Tochter des Generals Alvarado geheiratet und die venezuelische Staatsangehörigkeit angenommen. In Wildrake-Hall, am Nordufer des Rio del Caroni, war Robert Wildrake geboren.
Wildrake-Hall! Ednas Gedanken flogen dorthin. Wie mochte es da aussehen? Die Brasilianer würden mit dem Besitztum ihres Feindes wohl ebensowenig glimpflich umgehen, wie sie ... Ihre Gedanken stockten. Ein harter, bitterer Zug grub sich um ihren Mund. Wie konnte man so unmenschlich, so grausam handeln? Wer hätte je annehmen können, daß der Feind ungeschützte Frauen, den kranken Vater aus dem Hause reißen, in Gefangenschaft fortschleppen würde? Gewiß, sie waren gewarnt. Lag doch Wildrake-Hall in der Gefahrenzone. Aber niemand hätte für möglich gehalten, daß das geschah, was in jener Schreckensnacht vor sich ging, als ein Geschwader landete und Wildrake-Hall umstellte.
Die Eltern – Maria, Roberts Braut – sie, Edna, selbst – gefangen fortgeführt unter dem Vorgeben, sie hätten gegen die Sicherheit der Besatzungstruppen konspiriert. Der kranke Vater dahingesiecht – vor zwei Wochen hatten sie ihn begraben. Maria, die Ärmste – wieviel mußte sie gelitten haben, bis die Tränen ihr Augenlicht verdunkelten und man sie endlich mit der sterbenden Mutter heimsandte ...
Ein Schaudern überlief Edna bei dem Gedenken an ihre eigene harte Behandlung in der ersten Zeit der Haft. Das erste freundliche Wort, das sie in der Gefangenschaft gehört, kam aus dem Munde Winterloos. Doch wie lange würde er noch bleiben? Täglich konnte er abgelöst werden. Mit Freude hatte sie beobachtet, wie seine anscheinend schwere Fußverwundung so schnell und gut verheilte. Doch mit Bangen dachte sie an die Stunde, wo Winterloo, völlig wiederhergestellt, seinen Interimsposten als Fortkommandant aufgeben würde, um zur Front zurückzukehren.
Wie in Gedanken öffnete sie den Fensterflügel bis zur Wand, trat vor die blanke Scheibe, schaute hinein. Denn ein Spiegel war ihr versagt. Mit ein paar kurzen Bewegungen ordnete sie die Fülle ihres blonden Haares. Lächelte dann über sich selbst. Ein Restchen Eitelkeit also selbst jetzt noch – trotz bitterer Gefangenschaft!
Kanonendonner von der Seeseite her ließ sie zusammenfahren. Nicht lange, und es krachte ein zweiter dumpfer Knall, dem wie ein Echo vom Meere her andere Schüsse folgten. Edna starrte durch das Gitter auf die Straße, die plötzlich von einem Gewimmel freudig erregter Menschen erfüllt war.
Ein großer Sieg der Union? Oder gar Friede? Und Freiheit für sie, der man doch nichts anderes vorwerfen konnte, als daß sie Robert Wildrakes Schwester war? Sie wußte ja über den Gang der Kriegsereignisse nur wenig. Zeitungen waren verbotene Lektüre für sie.
In ihrem Sinnen und Raten überhörte sie, daß sich die Tür ihrer Zelle öffnete. Erst der Klang der wohlbekannten Männerstimme ließ sie aufmerken. Ihr Auge begegnete in stummer Frage dem Blick des Offiziers. Der nickte ihr freundlich zu.
»Waffenstillstand, gnädiges Fräulein! Gebe Gott, daß der Krieg endgültig vorüber ist! Vielleicht wird Ihre Haft nun bald ein Ende haben!«
Ein kurzer Händedruck. Noch ehe sie sich von der Überraschung erholte, war sie wieder allein.
Friede, Freiheit! Sie preßte die Hände ineinander. Oh, daß es Wahrheit werde!
Waffenstillstandsverhandlungen im Lager des brasilianischen Höchstkommandierenden. Zehn Stunden lang schon saß man zusammen, in den Grundzügen ungefähr einig. Immer wieder nur der eine Punkt, an dem alles zu scheitern drohte: das Schicksal von vier venezuelischen Offizieren, deren Auslieferung zur Aburteilung durch ein brasilianisches Kriegsgericht gefordert wurde.
»Unmöglich, Señores!« Der greise Oberst Guerrero nahm auf Seiten Venezuelas das Wort. »Unmöglich! Keine venezuelische Regierung dürfte das wagen, will sie nicht von der Volkswut hinweggefegt werden. Die Namen Wildrake, Alvarez, Barradas und Calleja sind meinen Landsleuten Symbole höchsten Heldentums. Niemals werden wir ...«
Sein Blick streifte die anderen Delegierten Venezuelas. Er hielt inne. Was war mit denen? Dachten sie jetzt doch anders? Ein bitteres Gefühl stieg in ihm auf. Die Kameraden umgefallen – doch umgefallen? Ihre verlegenen Mienen ... Er atmete heftig. Den weißhaarigen Kopf zurückgeworfen, stieß er schroff hervor: »Niemals werde ich in die Auslieferung dieser Tapferen, die Sie Verbrecher nennen, einwilligen.«
»Gestatten Sie, daß wir uns einige Augenblicke zu einer Beratung zurückziehen!« Der Führer der venezuelischen Delegation hatte sich erhoben, winkte den anderen, ihm zu folgen. Nach einer kurzen Weile betraten die Unterhändler wieder den Raum.
»Herr Oberst Guerrero läßt sich entschuldigen. Eine plötzliche Unpäßlichkeit hindert ihn heute, weiter an den Verhandlungen teilzunehmen.«
Eine halbe Stunde später waren die Waffenstillstandsbedingungen schriftlich festgelegt. Die Vertreter der beiden Staaten unterschrieben das offizielle Protokoll. Und unterschrieben ein zweites Schriftstück ...
Im Golf von Maracaibo die idyllische Insel Aruba. Noch vor wenigen Jahren eine nur den Fischern bekannte Insel. Dann hatten spekulative Börsenjobber dies köstliche Fleckchen Erde entdeckt und einen fashionablen Badeort daraus gemacht. Palastartige Hotelbauten wuchsen wie Pilze aus der Erde. In kurzem war Aruba ein Treffpunkt für die millionenschweren Sportsleute ganz Südamerikas geworden, und ein reges Badeleben der oberen Zehntausend aus den benachbarten Staaten spielte sich am Strande ab.
Der Krieg hatte all dieser Herrlichkeit ein Ende bereitet. Verlassen jetzt die Hotelbauten, verödet der paradiesische Strand.
Ein kleines Motorboot, die Flagge Venezuelas am Heck, näherte sich von Westen her der Anlegestelle, machte dort fest. Ein Marineoffizier sprang heraus, verabschiedete sich von dem Führer des Bootes und ging quer über den Strand. Die hohe, kräftige Gestalt, der schmale Kopf, die klaren, stahlblauen Augen, das Blondhaar, das unter der Mütze hervorquoll ... lauter Charakteristika eher eines Nordländers als eines Angehörigen romanischer Rasse. Die Örtlichkeit schien ihm von früher her vertraut. Nur flüchtig glitt sein Blick über die verlassenen Strandhotels. Jetzt näherte er sich einer zwischen Palmen versteckten Villa. ›Dependance de l'Hotel Imperial‹ stand in goldenen Lettern an ihrem Giebel.
Als er den Garten erreichte, sprangen drei Offiziere in weißen Tropenuniformen aus ihren Hängematten, die dort an den Bäumen befestigt waren.
»Hallo, Kapitän Wildrake! Ist's möglich?«
Eine kleine bewegliche, fast jungenhafte Gestalt eilte ihm entgegen. »Sie sind's wirklich, Wildrake? Ich begrüße Sie herzlich in unserer Mitte! Kommt her, Barradas und Calleja! Ein illustrer Gast ... der vierte König im Kartenspiel. Calleja – das Licht, das du gestern aufstecktest, beginnt mir hell zu leuchten! – Pardon, Kapitän, Sie kennen die Herren noch nicht? Herr Leutnant Antonio Barradas und Juan Calleja.«
Der Angeredete drückte jedem die Hand, ließ dann seine Blicke musternd um sich gehen. Ein leichtes Lächeln trat auf seine Züge.
»Man hat uns ja eine ganz nette Erholungsstätte angewiesen, meine Herren. Nun, das Vaterland weiß, was es uns schuldig ist, Señores. Freier Aufenthalt in Aruba, dem Milliardärbad – nicht übel! Wäre nur nicht –« er drehte sich dem Meere zu – »dort drüben die unliebsame Nachbarschaft!« Er deutete auf ein paar Rauchwolken, die über die Kimme des Horizontes stiegen. »Das brasilianische Kreuzergeschwader, das da hinten vor Anker liegt, dürfte besser fehlen. Unsere Ruhe könnte von denen da drüben leicht gestört werden. Und wär's auch nur, daß sie uns ein paar Granaten aufs Hausdach setzten.«
»Ah, gut! Seht ihr? Sagte ich nicht dasselbe?« Leutnant Calleja war aufgesprungen. »Wußte gleich, daß der Brief, der mich hierherbeorderte, ein Uriasbrief war.«
»Ich will und kann es nicht glauben!« unterbrach ihn Barradas, eine hohe, düstere Männergestalt. »Solch schnöder Undank des eigenen Vaterlandes, für das wir hundertmal unser Leben aufs Spiel gesetzt – dem wir vom ersten bis zum letzten Tag mit jedem Atemzug gedient – –« Der Offizier, die Lippen zusammengepreßt, eine finstere Falte zwischen den Brauen, starrte drohend nach dem Festland hin. »Dann –!« Er hatte die Faust geballt, die Worte zischten aus seinem Munde. »Dann wäre mir jeder Schuß leid, mit dem ich die hundert brasilianischen Flieger herunterholte. Die Stunde wird kommen!« erwiderte Calleja. »Verlaß dich darauf, Barradas! Bald wirst du erkennen, wie Venezuela seinen besten Luftkämpen dankt. Der Brand von Pernambuco – vergiß ihn nicht! Er steht im brasilianischen Schuldbuch auf deinem Konto, Barradas! Wie konntest du auch so unvorsichtig sein und eine Bombe auf die Munitionsdepots werfen, die die lieben Brasilios unmittelbar neben der Stadt errichtet hatten! Pernambuco ist eine offene Stadt, mein Lieber! Da muß man vorsichtig sein! – Wenn ich übrigens einen leisen Zweifel hatte, so hat die Ankunft unseres verehrten Kapitäns Wildrake ihn behoben. Man versäumte es, dem alten, braven Guerrero rechtzeitig den Mund zu stopfen. Durch einen Verwandten im Ministerium kam mir einiges von den Verhandlungen im brasilianischen Hauptquartier zu Ohren. Das eine weiß ich: Hier spielt man ein böses Spiel!«
»Eine Falle! Nichts anderes!« fiel Alvarez ein. »Wie denken Sie darüber, Kapitän? Daß Sie nicht der Meinung unseres ehrlichen Barradas sind, seh' ich schon längst.«
Wildrake nickte stumm.
»Aber was sollen wir tun?« rief Barradas. »Wir haben Befehl, uns bis auf weiteres hier aufzuhalten. Wäre es wahr, was ihr und Sie, Herr Kapitän Wildrake, denken, keine Minute länger würde ich bleiben. Einer Regierung, die solch schändlichem Plan zugestimmt, den Gehorsam zu verweigern, würde mir ein Vergnügen sein. Ich begreife nicht, Kapitän, wie Sie hierherkommen konnten, wenn Sie die Überzeugung haben, daß ...«
»Befehl ist Befehl, Leutnant Barradas! So lange ich nicht den greifbaren Beweis habe, daß meine Vermutungen richtig sind, gehorche ich dem Befehl, bleibe hier.«
»Beweis, Kapitän Wildrake?« hohnlachte Alvarez. »Der Beweis dürfte erst erbracht sein, wenn uns die Brasilianer hier ausgehoben und nach den Südstaaten verschleppt haben. Es gibt genug Möglichkeiten, die Insel zu umstellen und uns wie die Mäuse aus der Falle wegzunehmen. Bleiben wir also hier, dann sind wir einem überraschenden Überfall der Brasilianer wehrlos preisgegeben. Denn ist's eine Falle, in der wir stecken, so ist ein Entkommen unmöglich. Narren wären wir, uns mit offenen Augen hineinzubegeben.«
»Falle, mein lieber Alvarez? Gewiß, in eine Falle geht, wer keinen Ausweg sieht.«
»Ah, Kapitän Wildrake!« rief Calleja. »Sie wüßten, wie gegebenenfalls –?«
Wildrake nickte.
»Und wie wäre das?« Gleichzeitig kam die Frage aus dem Munde der drei.
»Ich habe«, fuhr Wildrake fort, »für den Fall, daß gewisse Ereignisse hier eintreten, mir die Flucht unter Wasser gesichert.«
»Ah! Das wäre!« Sie umringten ihn freudig. »Was haben Sie – ein U-Boot? Es liegt schon da? Es wird kommen?«
Wildrake sprach weiter. »Es wird da sein, wenn das Ereignis eintritt. Doch ich will Sie nicht länger im unklaren lassen. Ich kenne die Insel von einem früheren Aufenthalt her genau. An der Nordspitze befindet sich eine Höhle, die die Flut in den Felsen gewaschen hat. Vielleicht sah sie schon einer von Ihnen? Jedenfalls kennen Sie die Anhöhe dort. Sie ist gänzlich frei, reiner Fels. Ein rauchendes Feuer, da oben angezündet, wäre weithin sichtbar. Eine Stunde, nachdem das Signal gegeben, wird Kapitän Pedrazza – er war im Anfang des Krieges mein Leutnant auf U 48 – mit seinem Boot unter der Höhle liegen. Eine kleine Schwimmtour von hundert Metern, und wir sind an Bord.«
»Ah! Bravo!« Die anderen schüttelten ihm die Hand. »Das wäre Rettung, Wildrake!«
Er hob abwehrend die Hand. »Es gilt nun, scharf Ausguck zu halten, daß wir nicht in den Betten von den brasilianischen Fliegern überrascht werden. Machen wir uns jedenfalls sofort an die Arbeit, das Signal für alle Fälle vorzubereiten! Hoffentlich finden sich noch ein paar alte Teertonnen, um der Glut die nötige Kraft zu geben.«
*
Als Oswald Winterloo in sein Zimmer kam, trat ihm Major Tejo entgegen.
»Ah, guten Tag, Alfonso! Beglückwünschen wir uns! Waffenstillstand! Friede! Endlich der Krieg vorüber! Der militärische Spaziergang war doch etwas lang geraten, und mit dem Einzug in Caracas ist's auch nichts geworden.«
Tejo machte ein finsteres Gesicht. »Leider! Die Federfuchser haben wieder einmal die Arbeit der Soldaten verdorben!«
»Alfonso! Wünschst du wirklich, daß der Krieg noch weiterginge? Noch weiter Tausende ihr Blut vergießen müßten?«
»Wer möchte das? Aber sonst ist es halbe Arbeit, nichts anderes! Man will jetzt Venezuela zwingen, alles Gebiet bis zum fünften Breitengrad abzutreten. Wie lange wird's dauern? Ein, zwei Jahrzehnte – ein neuer Krieg dann, um auch den Rest der Union einzuverleiben. Die Opfer werden da noch größer werden.«
»Alfonso! Ich verstehe dich nicht, verstehe dich schon längst nicht mehr.«
Tejo wandte sich um, trat zum Fenster, deutete auf die Stadt. »São Salvador, Pernambuco, Manaos in Schutt und Asche! Die unschuldigen Frauen und Kinder – zu Tausenden füllen sie, Opfer dieser Banditen, die Riesenfriedhöfe ... Wär' mir wenigstens das geblieben, daß ich an den Gräbern meiner Eltern, meiner Geschwister stehen könnte! Doch nein! Sie sind verbrannt – wer weiß, unter welchen Qualen? Keine Spur mehr von ihnen zu finden. Ihre Asche verstreut, verweht ... Und du? Auch ich verstehe dich nicht mehr! Hättest du Victoria wirklich geliebt, müßtest du denken wie ich.«
»Alfonso, wohin treibt dich der Haß? Du weißt, wie teuer mir Victoria war. Aber wird ihr Andenken mir dadurch kostbarer, daß noch weitere Hekatomben von Opfern verbluten?«
»Du bist ein Deutscher? Obgleich ihr schon seit Generationen hier im Lande wohnt. Ein Deutscher – schwach im Hassen, schwach im Lieben.«
»Sieh hinaus auf die Straßen! Der Jubel der Bevölkerung beweist zur Genüge, daß andere ebenso denken wie ich.«
Tejo machte eine wegwerfende Handbewegung. »Vergleichst du dich mit diesen?«
Winterloo unterdrückte die heftige Antwort, die ihm auf der Zunge schwebte. »Ich für meine Person werde jedenfalls mit Freuden das Ende dieses Kampfes begrüßen, dessen materielle Ursachen für die Wissenden doch nur allzu durchsichtig sind. Nicht mit Unrecht nennt die Welt ihn den Petroleumkrieg. Vor allem bin ich froh, dieses Postens hier so oder so bald ledig zu sein.«
»Meinst du, daß die politischen Gefangenen hier so bald entlassen werden?«
»Gewiß! Zweifellos sind doch darunter sehr viele, die auf einen bloßen Verdacht hin verhaftet wurden. Man wird sie ohne Prozeß freigeben müssen.«
»Ha!« Tejo lachte ein häßliches Lachen. »Du denkst wohl besonders an diese Edna Wildrake?«
Winterloo biß sich auf die Lippen. Eine leichte Röte war in sein Gesicht gestiegen. »An sie nicht mehr als an die anderen ...«
»... Unschuldigen, möchtest du wohl sagen?«