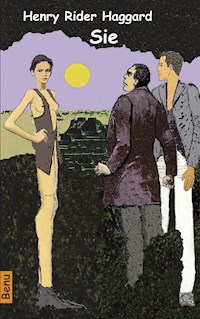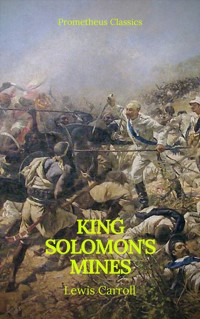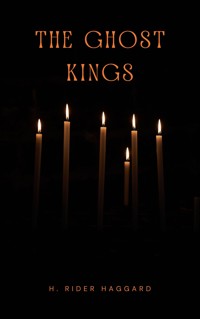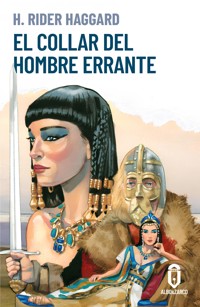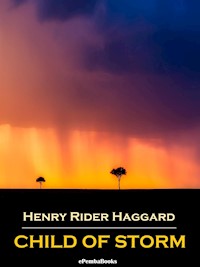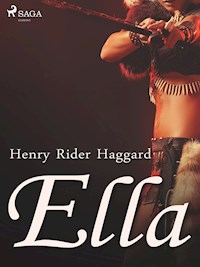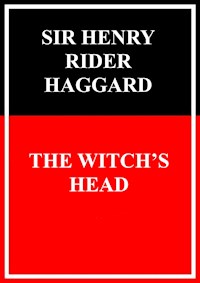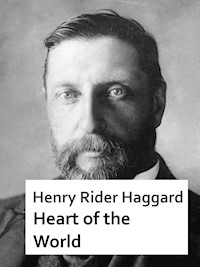Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Allan Quatermain, einer der bekanntesten Großwildjäger Afrikas, macht sich gemeinsam mit Sir Henry Curtis und Captain Good auf die Suche nach den sagenumwobenen Diamantenminen König Salomons. Diese sollen in einer unerforschten Gebirgsregion liegen, die noch keinen Weißen Fuß betreten hat und die von den Kukuanas beherrscht wird, einem gefährlichen Eingeborenenstamm, dessen straff disziplinierte, spartanisch organisierte Kriegsheere als unbesiegbar gelten... Die hinreißende Beschreibung dieser Expedition - erst-mals 1950 mit Stewart Granger und Deborah Kerr verfilmt (Regie: Compton Bennett/Andrew Marton) – wirkte so überzeugend, dass zahlreiche Abenteurer sich daraufhin auf Schatzsuche begaben und tatsächlich in Metapos und nahe am Tokwe-Strom (wo Haggard diesen Roman ansiedelte) Gold- und Diamanten-Bergwerke, Heerstraßen und Ruinen phönizischer Kolonien fanden! Der Apex-Verlag veröffentlicht KÖNIG SALOMONS DIAMANTEN als durchgesehene Neuausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HENRY RIDER HAGGARD
König Salomons Diamanten
Roman
Apex-Verlag
Impressum
Der Roman King Salomon's Mines von H. R. Haggard ist gemeinfrei.
Copyright © dieser Ausgabe by Apex-Verlag.
Übersetzung: Volker H. Schmied (bearbeitet von Christian Dörge).
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg.
Cover: Christian Dörge/Apex-Graphixx.
Satz: Apex-Verlag.
Verlag: Apex-Verlag, Winthirstraße 11, 80639 München.
Verlags-Homepage: www.apex-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
KÖNIG SALOMONS DIAMANTEN
Der Autor stellt sich vor
Erstes Kapitel: Ich begegne Sir Henry Curtis
Zweites Kapitel: Die Sage von Salomons Minen
Drittes Kapitel: Umbopa tritt in unsere Dienste
Viertes Kapitel: Auf Elefantenjagd
Fünftes Kapitel: Unser Marsch durch die Wüste
Sechstes Kapitel: Wasser! Wasser!
Siebtes Kapitel: Salomons Straße
Achtes Kapitel: Wir betreten Kukuana-Land
Neuntes Kapitel: Twala der König
Zehntes Kapitel: Die Hexenjagd
Elftes Kapitel: Wir wirken Wunder
Zwölftes Kapitel: Vor der Schlacht
Dreizehntes Kapitel: Der Angriff
Vierzehntes Kapitel: Der Grauen letzter Widerstand
Fünfzehntes Kapitel: Good wird krank
Sechzehntes Kapitel: Der Platz des Todes
Siebzehntes Kapitel: Salomons Schatzkammer
Achtzehntes Kapitel: Wir geben die Hoffnung auf
Neunzehntes Kapitel: Wir nehmen Abschied von Ignosi
Zwanzigstes Kapitel: Gefunden
Allan Quatermain: Die echten Minen König Salomons
Das Buch
Allan Quatermain, einer der bekanntesten Großwildjäger Afrikas, macht sich gemeinsam mit Sir Henry Curtis und Captain Good auf die Suche nach den sagenumwobenen Diamantenminen König Salomons. Diese sollen in einer unerforschten Gebirgsregion liegen, die noch keinen Weißen Fuß betreten hat und die von den Kukuanas beherrscht wird, einem gefährlichen Eingeborenenstamm, dessen straff disziplinierte, spartanisch organisierte Kriegsheere als unbesiegbar gelten...
Die hinreißende Beschreibung dieser Expedition - erstmals 1950 mit Stewart Granger und Deborah Kerr verfilmt (Regie: Compton Bennett/Andrew Marton) – wirkte so überzeugend, dass zahlreiche Abenteurer sich daraufhin auf Schatzsuche begaben und tatsächlich in Metapos und nahe am Tokwe-Strom (wo Haggard diesen Roman ansiedelte) Gold- und Diamanten-Bergwerke, Heerstraßen und Ruinen phönizischer Kolonien fanden!
Der Apex-Verlag veröffentlicht König Salomons Diamanten als durchgesehene Neuausgabe.
KÖNIG SALOMONS DIAMANTEN
Dieser ehrliche, wenngleich anspruchslose Bericht
von einem bemerkenswerten Abenteuer
wird hiermit voller Ehrfurcht gewidmet
vom Erzähler
ALLAN QUATERMAIN
allen großen und kleinen Jungs, die ihn lesen
Der Autor stellt sich vor
Jetzt, da das Buch gedruckt ist und der Öffentlichkeit übergeben werden soll, empfinde ich seine Unzulänglichkeit in Stil und Inhalt besonders schwer. Was den Inhalt betrifft, kann ich nur sagen, dass es keinen Anspruch erhebt, ein vollständiger Bericht all dessen zu sein, was wir unternommen und erlebt haben. Es gibt vieles, was mit unserer Reise ins Kukuana-Land zusammenhängt und das ich kaum gestreift habe. Dazu gehören die seltsamen Legenden, die ich über die Kettenpanzer gesammelt habe, welche uns in der großen Schlacht von Loo das Leben retteten, ebenso wie die Sagen von den Schweigenden oder Kolossen am Eingang zur Stalaktitenhöhle. Außerdem, wäre es nach mir gegangen, so wäre ich auch gerne auf die unterschiedlichen Dialekte der Zulus und der Kukuanas eingegangen; einige von ihnen sind meiner Meinung nach äußerst aufschlussreich. Vorteilhaft wäre es auch gewesen, einige Seiten der heimischen Flora und Fauna des Kukuana-Landes zu widmen. Und schließlich und endlich noch das Interessanteste, worauf nur gelegentlich angespielt worden ist: die hervorragende Organisation der Streitkräfte des Landes, die meines Erachtens das militärische System der Chakas im Zululand übertrifft, das diese neu eingeführt hatten; gestattet es doch eine sehr schnelle Mobilmachung und zwingt nicht zu einer in jeder Hinsicht verderblichen Ehelosigkeit.
Ich habe letztlich auch kaum von den Stammes- und Familienbräuchen der Kukuanas gesprochen - viele von ihnen sind höchst merkwürdig - oder von ihrer Kunstfertigkeit, Metalle zu schmelzen und zu schweißen. Diese Wissenschaft hatten sie zu einer beachtlichen Vollkommenheit entwickelt; ein gutes Beispiel dafür sind ihre tollas, die schweren Wurfmesser; die Rücken dieser Waffen sind aus gehämmertem Eisen, und die Schneiden aus erstklassigem Stahl sind mit großer Fertigkeit an die Eisenrücken angeschweißt.
Tatsache ist, ich war mit Sir Henry Curtis und Captain Good einer Meinung, das Beste sei es, die Geschichte ehrlich und schlicht zu erzählen und all die oben erwähnten Dinge vorläufig zu übergehen, um später einmal von ihnen zu berichten, wenn immer es sich ergibt. Selbstverständlich bin ich inzwischen gerne bereit, jedem, der sich für derartige Sachen interessiert, genaueste Auskunft darüber zu geben, soweit es in meiner Kraft steht. Und nun habe ich mich nur noch wegen meines schwerfälligen Stils zu entschuldigen. Ich bin es eben mehr gewohnt, mit einem Gewehr als mit einer Feder umzugehen, und ich möchte keine großen literarischen Geistesflüge und blumenreichen Ausdrücke vorspiegeln, wie ich sie in Romanen finde - ich lese zuweilen gerne einen Roman. Ich nehme an, solche Flüge und Floskeln sind sehr beliebt, und bedaure, dass ich damit meinen Lesern nicht dienen kann. Gleichzeitig glaube ich, dass die einfachsten Dinge die eindrucksvollsten und Bücher leichter verständlich sind - wie die Bibel -, die in einer schlichten Sprache geschrieben sind.
Freilich, vielleicht habe ich gar kein Recht, über solche Dinge eine Meinung zu äußern. Ein scharfer Speer, so sagt ein kukuanasches Sprichwort, bedarf keines Schliffs; und nach dem gleichen Grundsatz wage ich zu hoffen, dass eine wahre Geschichte, so merkwürdig sie sein mag, nicht mit Wortspielereien ausgeschmückt zu werden braucht.
- Allan Quatermain
Erstes Kapitel: Ich begegne Sir Henry Curtis
Es ist schon merkwürdig, dass ich in meinem Alter - ich bin jetzt über Sechzig - noch zur Feder greife, um zu versuchen, eine Geschichte zu schreiben. Ich bin nur gespannt, was für eine Geschichte dabei herauskommt, sofern ich überhaupt bis zum Ende der Reise durchhalte! Ich habe in meinem - wie mir scheint - langen Leben viele nützliche Dinge getan, vielleicht, weil ich schon in jungen Jahren arbeiten musste. In einem Alter, in dem andere Jungen die Schule besuchten, verdiente ich mir bereits meinen Lebensunterhalt in der alten Kolonie und in Natal. Seit dieser Zeit habe ich gehandelt, gejagt, gekämpft oder geschürft. Und es sind jetzt erst acht Monate, dass ich mir mein Haus gebaut habe. Es ist ein großes Gebäude, das ich jetzt besitze - ich weiß noch gar nicht, wie groß -, aber ich glaube nicht, dass ich selbst dafür die vergangenen fünfzehn oder sechzehn Monate noch einmal durchmachen würde, nein, selbst nicht, wenn ich wüsste, dass ich heil davonkäme, mein Ziel, ein eigenes Haus und was weiß ich noch alles erreichen würde. Nun ja, ich bin ein furchtsamer Mensch und hasse Gewalttätigkeit; mehr noch, ich bin der Abenteuer beinahe überdrüssig. Ich möchte bloß wissen, warum ich eigentlich dieses Buch schreiben will, es schlägt nicht in mein Fach. Ich bin kein Schriftsteller, auch wenn ich mich sehr stark dem Alten Testament und den Ingoldsby-Legenden widme. Ich will versuchen, meine Gründe darzulegen, nur um zu sehen, ob ich welche habe.
Erster Grund: Weil Sir Henry Curtis und Captain Good mich baten.
Zweiter Grund: Weil ich hier in Durban durch den Schmerz in meinem linken Bein ans Bett gefesselt bin. Seit damals, da mich der verdammte Löwe erwischt hat, leide ich darunter, und jetzt ist es besonders schlimm und schwächt mich mehr denn je. An einem Löwenzahn muss irgendein Gift sein; wie käme es sonst, dass einem bereits geheilte Wunden immer wieder aufbrechen, im Allgemeinen - beachten Sie - in der gleichen Jahreszeit, in der man verwundet worden ist? Es ist schon bitter, wenn einem Mann wie mir, der im Laufe seines Lebens fünfundsechzig Löwen zur Strecke brachte, der sechsundsechzigste das Bein wie ein Tabak-Priemchen zerkaut. Diese Episode unterbricht jedoch den geordneten Ablauf der Schilderung, da andere wichtige Vorfälle und Tatsachen übergangen werden; ich bin ein ordnungsliebender Mensch und mag so etwas nicht. Dies nur nebenbei.
Dritter Grund: Weil ich möchte, dass mein Junge Harry, der an einem Londoner Hospital studiert, um Doktor zu werden, etwas bekommt, das ihn unterhält und ihn wenigstens für eine Woche von Dummheiten fernhält. Die Arbeit an einem Krankenhaus muss mit der Zeit an Reiz verlieren und recht langweilig werden; Leichen sezieren muss man ja einmal satt bekommen. Und da diese Geschichte, mag sie sein wie sie will, nicht langweilig sein wird, kann sie ein oder zwei Tage ein wenig Leben in den Alltag bringen, wenn Harry von unseren Abenteuern liest.
Vierter und letzter Grund: Weil ich die seltsamste Geschichte erzählen werde, an die ich mich erinnern kann. Es mag sonderbar klingen, so etwas zu behaupten, zumal keine Frau darinnen vorkommt - ausgenommen Foulata. Halt, doch! Da ist Gagool, wenn das ein Weib war und nicht ein Teufel. Indessen, sie war mindestens hundert Jahre alt und daher nicht mehr im Heiratsalter, so dass ich sie hier nicht zähle. Auf jeden Fall kann ich mit Sicherheit behaupten, dass in der gesamten Story kein Unterrock vorkommt.
Nun, ich komme besser zur Sache. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, und mir ist, als ob ich bis zu den Achseln im Schlamm versinken würde. Aber sutjes, sutjes, wie die Buren sagen; ich weiß wirklich nicht, wie sie es schreiben. Ein starkes Gespann wird schließlich durchkommen, wenn es nicht zu dürr ist. Mit ausgehungerten Ochsen wird man nie etwas erreichen. Also, los geht's.
Ich, Allan Quatermain, aus Durban, Natal, ein Gentleman, schwöre und sage aus - so begann ich meine eidliche Zeugenaussage vor dem Polizeirichter über den traurigen Tod des armen Khiva und Ventvögels; doch das scheint mir nicht die richtige Art und Weise zu sein, ein Buch zu beginnen. Und außerdem: bin ich ein Gentleman? Was ist ein Gentleman? Ich weiß es nicht genau, und bisher hatte ich es nur mit Niggern zu tun gehabt - nein, ich werde dieses Wort Nigger streichen, denn ich mag es nicht: ich habe Eingeborene gekannt, die Gentleman sind, und das gleiche wirst du sagen, Harry, mein Junge, sobald du mit der Geschichte zu Ende bist, und ich habe niederträchtige Weiße mit einem Haufen Geld, frisch aus der Heimat noch dazu, gekannt, die es nicht sind.
Auf jeden Fall, ich wurde als Gentleman geboren, obwohl ich Zeit meines Lebens nichts als ein armer reisender Händler und Jäger gewesen bin. Ob ich ein Gentleman geblieben bin, weiß ich nicht, darüber musst du urteilen. Der Himmel weiß, ich habe mir die größte Mühe gegeben. Ich habe in meinem Leben viele Menschen getötet, aber stets in Notwehr. Niemals habe ich jemanden grundlos getötet oder gar meine Hand mit unschuldigem Blut befleckt. Der Allmächtige gab uns unser Leben und, glaube ich, auch den Auftrag, es zu verteidigen. Ich habe wenigstens immer darnach gehandelt, und ich hoffe, es wird nicht Klage wider mich erhoben, wenn meine Stunde schlägt. Tja, ja, es ist eben eine grausame und gottlose Welt, und für einen Angsthasen bin ich in recht viele Kämpfe verwickelt gewesen. Ich kann dies nicht rechtfertigen, aber auf jeden Fall habe ich nicht gestohlen - obgleich ich einmal einen Kaffer um eine Herde Vieh gebracht habe. Doch dieser Bursche hatte mir einen bösen Streich gespielt, und es hat mich seither bei meinem Geschäft gequält.
Nun, es sind jetzt etwa achtzehn Monate her, dass ich Sir Henry Curtis und Captain Good zum ersten Mal begegnet bin. Das ging so zu. Ich war auf Elefantenjagd jenseits Bamangwato gewesen und hatte Pech gehabt. Alles ging bei dieser Expedition schief, und zu guter Letzt packte mich ein böses Fieber. Sobald es mir einigermaßen gutging, treckte ich zu den Diamantenfeldern hinunter, verkaufte das Elfenbein, das ich hatte, zusammen mit meinem Wagen und den Ochsen, entlohnte meine Jäger und nahm die Postkutsche zum Kap. Eine Woche verbrachte ich in Kapstadt. Ich hatte alle Sehenswürdigkeiten gesehen, einschließlich der Botanischen Gärten, die, wie mir scheint, einen großen Nutzen für das Land bedeuten, und das neue Haus des Parlaments, das meiner Meinung nach nicht seinesgleichen hat. Inzwischen fand ich, dass man mir im Hotel das Fell über die Ohren zog, und so entschloss ich mich, mit der Dunkeld, die im Hafen auf die von England fällige Edinburgh Castle wartete, nach Natal zurückzufahren. Ich nahm mir eine Schlafkoje und ging an Bord. Am gleichen Nachmittag wurden noch die Natal-Passagiere von der Edinburgh Castle an Bord übernommen, und wir lichteten die Anker und stachen in See.
Unter den Passagieren, die an Bord kamen, befanden sich zwei, die meine Neugierde weckten. Der eine, ein Gentleman von etwa dreißig, war vielleicht der Mann mit dem mächtigsten Brustkasten und den längsten Armen, den ich je sah. Er hatte blonde Haare und einen dichten blonden Bart, offene Gesichtszüge, und große graue Augen saßen tief in seinem Kopf.
Ich sah nie einen besser aussehenden Menschen, und irgendwie erinnerte er mich an einen alten Dänen. Nicht, dass ich viel über die alten Dänen wüsste, ich erinnere mich nur eines dänischen Zeitgenossen, der mich um zehn Pfund geprellt hat; aber ich entsinne mich, einmal ein Bild von einigen dieser Leute gesehen zu haben, die, wie ich annehme, eine Art weiße Zulus waren. Sie tranken aus großen Hörnern, und ihre langen Haare hingen über die Rücken hinunter. Als ich meinen Freund, der an der Kajütentreppe stand, erblickte, dachte ich, er hätte zu diesem Bild Modell gesessen haben können, wenn man sein Haar nur ein Stück wachsen ließe, eines der Kettenhemden über seine breiten Schultern streifte und ihm eine große Streitaxt sowie ein Trinkhorn gäbe - ganz ein alter Däne. Am Rande vermerkt, so merkwürdig es erscheinen mag, hier bewies sich, wie das Blut durchschlägt.
Später erfuhr ich nämlich, dass Sir Henry Curtis, so hieß dieser baumlange Kerl, dänischer Abstammung war. Er erinnerte mich noch stark an jemanden, aber damals fiel mir nicht ein, an wen.
Der andere, der neben Sir Henry stand und sich mit ihm unterhielt, war klein, stämmig, dunkel und besaß eine ganz andere Physiognomie. Meine erste Vermutung war: ein Seeoffizier; ich weiß nicht warum, aber es ist schwer, sich bei einem Seemann zu irren. Ich habe im Laufe meines Lebens mit einigen von ihnen Jagdausflüge unternommen, und sie haben sich immer als die besten, kühnsten und nettesten Kameraden erwiesen, die ich je traf, obgleich einige von ihnen arg lästerlich fluchen.
Ich stellte einige Seiten vorher die Frage, was ein Gentleman sei. Ich will die Frage jetzt beantworten: ein Offizier der Königlichen Flotte ist in der Regel einer, mag es natürlich auch unter ihnen mal ein schwarzes Schaf geben. Ich stelle mir vor, dass es gerade das weite Meer und der Hauch von Gottes Winden sind, die ihre Herzen reinigen und die Bitterkeit aus ihrem Herzen blasen und sie so machen, wie man sich Männer vorstellt.
Na, um darauf zurückzukommen, ich hatte wieder einmal recht. Ich ermittelte: der dunkle Mann war Seeoffizier, Leutnant von 31 Jahren, der nach siebzehnjähriger Dienstzeit im Rang eines Kapitäns aus Ihrer Majestät Dienste wegen mangelnder Beförderungsmöglichkeiten verabschiedet worden war - eine Ehre, die absolut nichts einbrachte. Das also haben die Männer, die der Königin in Treue dienen, zu erwarten: hinausgestoßen zu werden in die teilnahmslose Welt, ihren Lebensunterhalt gerade dann zu suchen, wenn sie ihr Geschäft wirklich zu verstehen beginnen und in der Blüte ihrer Mannesjahre stehen. Ich schätze, sie machen sich nichts daraus, für meinen Teil aber habe ich mir lieber mein Brot als Jäger verdient. Das Kleingeld ist zwar manchmal arg knapp, dafür bekommt man nicht so viele Tritte. Er hieß, wie ich an Hand der Passagierliste herausfand, Good - Captain John Good. Er war breitschultrig, von mittlerer Größe, dunkel, kräftig und im Übrigen ein ziemlich seltsamer Vogel. Er war unwahrscheinlich ordentlich, immer ganz glatt rasiert und trug stets im rechten Auge ein Monokel. Es schien hier angewachsen zu sein, denn er trug es weder an einer Schnur, noch nahm er es je heraus, ausgenommen, um es einmal zu putzen. Anfangs glaubte ich, er schlafe auch damit, entdeckte aber später, dass dies denn doch ein Irrtum gewesen war. Wenn er zu Bett ging, steckte er es nämlich mit seinen falschen Zähnen in die Hosentasche. Ja, seine falschen Zähne, oben wie unten, sie waren wunderschön. Meine eigenen sind nicht die besten, und so verstieß ich öfters gegen das 10. Gebot. Doch eben habe ich wieder vorgegriffen.
Kaum waren wir auf hoher See, brach der Abend herein und mit ihm sehr schlechtes Wetter. Eine scharfe Brise kam von Land auf und eine Art schottischer Nebel, nur noch schlimmer, die jeden bald von Deck vertrieben. Was die Dunkeld betraf, war sie ein flachbodiges Schiff mit geringem Tiefgang und schlingerte daher heftig. Fast schien sie kentern zu wollen, ließ es aber dann doch sein. Es war völlig unmöglich, herumzulaufen; so stand ich nahe bei der Maschine, wo es warm war, und vergnügte mich damit, ein mir gegenüber aufgehängtes Pendel zu beobachten, das langsam vor- und rückwärts schwang, im Rhythmus, wie das Schiff schlingerte. Es zeigte so den Neigungswinkel an, den das Schiff bei jedem Überholen annahm.
»Das Pendel zeigt falsch an, es ist nicht richtig beschwert«, sagte eine ziemlich verdrießliche Stimme hinter mir. Ich sah mich um, hinter mir stand der Seeoffizier, den ich bemerkt hatte, als die Passagiere an Bord kamen.
»So? Und warum glauben Sie das?«, fragte ich.
»Glauben? Ich glaube nicht. Wenn nämlich«, fuhr er fort, als sich das Schiff nach einem starken Überholen wieder aufrichtete, »der Kahn wirklich so geschlingert hätte, wie das Ding da anzeigt, dann würde es bestimmt nie wieder schlingern, das ist's. Aber das sieht diesen Handelsmarineschiffen ähnlich, die sind ja immer so verflucht nachlässig.«
Da läutete gerade die Dinnerglocke, und ich war heilfroh, denn es ist schrecklich, einem Offizier der Königlichen Marine zuhören zu müssen, wenn er auf dieses Thema zu sprechen kommt. Ich weiß nur ein Ding, das noch schlimmer ist: einen Kapitän der Handelsmarine seine offene Meinung über die Offiziere der Königlichen Marine äußern zu hören.
Captain Good und ich gingen miteinander zum Dinner hinunter. Sir Henry Curtis saß schon bei Tisch. Er und Captain Good saßen nebeneinander, und ich saß ihnen gegenüber. Der Captain und ich kamen bald in ein Gespräch über die Jagd und so weiter; er stellte mir eine Menge Fragen, denn er ist sehr interessiert an allen Dingen, und ich beantwortete sie, so gut ich konnte. Bald kam er auf Elefanten zu sprechen.
»Oh, Sir«, rief jemand, der neben mir saß, »da sind Sie gerade an den richtigen Mann gekommen. Wenn überhaupt jemand, dann dürfte Jäger Quatermain in der Lage sein, Ihnen über Elefanten zu erzählen.«
Sir Henry, der bisher unserem Gespräch ganz still gefolgt war, fuhr sichtlich zusammen.
»Entschuldigen Sie, Sir«, sagte er und bog sich weit über den Tisch. Er hatte eine leise, tiefe Stimme, eine sehr angenehme Stimme, die, so schien mir, aus mächtigen Lungenflügeln kam.
»Verzeihen Sie, Sir, aber ist Ihr Name Allan Quatermain?«
Ich bejahte.
Der Riese schwieg wieder, ich hörte jedoch, wie er »Schicksal« in seinen Bart murmelte.
Bald darauf ging das Dinner zu Ende, und als wir gerade den Speiseraum verlassen wollten, kam Sir Henry auf mich zu und fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm in seiner Kajüte eine Pfeife zu rauchen. Ich nahm die Einladung an und folgte ihm zur Deckkabine der Dunkeld. Es war eine sehr gute Kabine. Eigentlich waren es zwei Kabinen gewesen, aber als Sir Garnet oder einer von diesen vornehmen Stutzern auf der Dunkeld die Küste entlang fuhr, hatte man die Zwischenwand einfach herausgeschlagen und sie nie wieder eingebaut. In der Kabine stand ein Sofa, davor war ein kleiner Tisch. Sir Henry schickte den Steward nach einer Flasche Whisky. Wir drei setzten uns und zündeten unsere Pfeifen an.
»Mister Quatermain«, sagte Sir Henry Curtis, als der Steward den Whisky gebracht und die Lampe angezündet hatte, »im vorvorigen Jahr um diese Zeit waren Sie, glaube ich, an einem Ort namens Bamangwato im Norden von Transvaal.«
»Stimmt«, antwortete ich, ziemlich überrascht, dass dieser Gentleman meine Unternehmungen so genau kennen sollte, die meines Wissens für die Allgemeinheit doch nicht von besonderem Interesse sein konnten.
»Handelsgeschäfte haben Sie dorthin geführt, nicht wahr?« schaltete sich Captain Good in seiner lebhaften Art ein.
»Ja. Ich nahm eine Wagenladung Waren mit, schlug mein Lager außerhalb der Siedlung auf und blieb dort, bis ich alles verkauft hatte.«
Sir Henry saß mir gegenüber in einem Madeira-Stuhl und stützte die Arme auf den Tisch. Nun schaute er hoch und heftete seine großen grauen Augen voll auf mein Gesicht. Da flackert eine merkwürdige Angst in ihnen, dachte ich.
»Haben Sie zufällig da oben einen Mann namens Neville getroffen?«
»Oh, ja; er spannte für vierzehn Tage direkt neben mir aus, um seinen Ochsen etwas Ruhe zu gönnen, bevor er ins Innere weiterzog. Vor ein paar Monaten bekam ich von meinem Rechtsanwalt einen Brief mit der Frage, ob ich wüsste, was aus ihm geworden ist. Ich habe damals nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet.«
»Ja«, sagte Sir Henry, »Ihr Brief wurde mir zugeschickt. Sie schrieben, der Gentleman namens Neville habe anfangs Mai Bamangwato verlassen, und zwar mit einem Wagen, einem Fuhrmann, einem Voorlooper und einem Kaffernjäger namens Jim. Angeblich hätte er beabsichtigt, wenn möglich bis Inyati, dem vorgeschobensten Handelsposten in der Makabelegegend, zu trecken. Dort wollte er seine Wagen verkaufen und zu Fuß weitergehen.
Sie schrieben auch, dass er seinen Wagen tatsächlich verkauft habe, denn sechs Monate später sahen Sie den Wagen im Besitz eines portugiesischen Händlers, der Ihnen erzählte, dass er ihn in Inyati von einem Weißen, dessen Namen er vergessen hatte, gekauft hätte. Der Weiße sei mit einem eingeborenen Diener zu einer Jagdexpedition ins Innere aufgebrochen, wie er glaube.«
»Ja.«
Es folgte eine Pause.
»Mr. Quatermain«, sagte Sir Henry plötzlich, »ich nehme an, Sie wissen nichts Näheres oder haben keine weiteren Anhaltspunkte, die auf die Beweggründe für die Reise meines.... von Mr. Nevilles Reise hindeuten; er ging nach Norden, aber wohin genauer - was war das Ziel?«
»Ich habe etwas läuten gehört«, antwortete ich und schwieg sofort wieder. Das war ein Thema, über das ich nicht zu sprechen wagte.
Sir Henry und Captain Good blickten einander an, und Captain Good nickte.
»Mr. Quatermain«, sagte ersterer, »ich werde Ihnen gleich eine Geschichte erzählen und erbitte Ihren Rat, vielleicht auch Ihre Hilfe. Der Agent, der mir Ihren Brief übersandte, schrieb mir, ich möchte mich unbedingt darauf verlassen, da Sie - wie er versicherte - gut bekannt und in Natal allgemein geachtet wären. Besonders bekannt aber für Ihre Verschwiegenheit.«
Ich verbeugte mich leicht und trank einen Schluck Whisky mit Soda, um meine Verlegenheit zu verbergen, denn ich bin ein bescheidener Mensch - und Sir Henry fuhr fort.
»Mr. Neville war mein Bruder.«
»Ach!«, sagte ich und sprang auf, denn nun wusste ich, an wen mich Sir Henry erinnert hatte, als ich ihn zum ersten Mal sah. Sein Bruder war zwar um ein gutes Stück kleiner und trug einen dunklen Bart, aber - und jetzt fiel es mir ein - er besaß Augen von der gleichen grauen Schattierung und den gleichen scharfen, durchdringenden Blick. Auch die Gesichtszüge waren nicht unähnlich.
»Er war mein einziger und jüngerer Bruder«, setzte Sir Henry seine Erzählung fort. »Bis vor fünf Jahren waren wir wohl kaum jemals länger als fünf Monate nicht beisammen. Nun eben vor ungefähr fünf Jahren geschah das Unglück, wie es halt manchmal in Familien passiert. Wir waren heftig ins Streiten geraten, und in meinem Zorn benahm ich mich meinem Bruder gegenüber recht unschön und war äußerst ungerecht.«
Hier nickte Good sehr nachdrücklich mit dem Kopf. Das Schiff schlingerte in diesem Moment gerade stark, so dass der Spiegel, der uns gegenüber steuerbord hing, kurz dicht über unseren Köpfen war. Ich saß mit den Händen in den Taschen und schaute nach oben. So konnte ich ihn gleich allem nicken sehen.
»Ich darf wohl annehmen, dass Ihnen folgendes bekannt ist«, fuhr Sir Henry fort. »Wenn ein Mann ohne Testament stirbt, und er besitzt kein Vermögen außer Grund und Boden - Grundeigentum nennt man es in England fällt alles seinem ältesten Sohn als Erbe zu. Gerade zu dieser Zeit, da wir in Streit lebten, starb unser Vater ohne Testament. Er hatte es immer wieder aufgeschoben, bis es zu spät war. Das Resultat: mein Bruder, der keinen Beruf erlernt hatte, blieb ohne einen Penny. Selbstverständlich wäre es meine Pflicht gewesen, für ihn zu sorgen. Aber damals tobte der Streit so heftig zwischen uns, dass ich - zu meiner Schande muss ich es gestehen (er seufzte tief) - mich nicht erbot, etwas für ihn zu tun. Es lag nicht daran, dass ich ihm etwas missgönnt hätte, aber ich erwartete von ihm als dem Jüngeren, dass er versuchen würde, einzulenken. Er dachte aber nicht daran. Es tut mir leid, Mister Quatermain, dass ich Sie mit all dem beschweren muss, aber ich muss diese Angelegenheit klären, nicht wahr, Good?«
»Ganz recht, stimmt«, sagte der Captain. »Ich bin sicher,
Mr. Quatermain wird diese Geschichte für sich behalten.«
»Ganz selbstverständlich«, erwiderte ich, denn ich brüstete mich gerne meiner Verschwiegenheit, der ich, wie Sir Henry gehört hatte, einigen Ruf verdanke.
»Nun«, fuhr Sir Henry fort, »mein Bruder hatte damals ein paar hundert Pfund auf seinem Konto, und ohne mir einen Ton zu sagen, hob er diese lächerliche Summe ab, nahm den Namen Neville an und reiste in der abenteuerlichen Hoffnung nach Südafrika, dort sein Glück zu machen. Das erfuhr ich jedoch erst später. Etwa drei Jahre vergingen, und ich hörte nichts von meinem Bruder, obzwar ich ihm einige Male schrieb. Zweifellos erreichten ihn meine Briefe nicht. Aber als die Zeit verging, wuchsen meine Unruhe und meine Sorge um ihn immer mehr. Ich entdeckte, Mr. Quatermain, dass Blut dicker als Wasser ist.«
»Das stimmt«, sagte ich und dachte an meinen Jungen Harry.
»Ich stellte fest, dass ich mein halbes Vermögen opfern würde, Mr. Quatermain, wenn ich erfahren könnte, dass mein Bruder George, der einzige Verwandte, den ich habe, heil und gesund ist und ich ihn wiedersehen könnte.«
»Aber gemacht hast du's nie, Curtis!«, fiel Captain Good ihm ins Wort und streifte mit einem Blick das Gesicht des Riesen.
»Nun, Mr. Quatermain, mit der Zeit wurde ich immer besorgter und versuchte mit allen Mitteln herauszubekommen, ob mein Bruder lebte oder ob er tot war. Wenn er am Leben war, wollte ich ihn wieder nach Hause holen. Ich stellte Nachforschungen an, und Ihr Brief war einer der Erfolge. Soweit sich die Spuren verfolgen ließen, konnte man zufrieden sein, denn es zeigte sich, dass George bis vor kurzem noch am Leben war. Dennoch habe ich nicht genug unternommen. Aber um die lange Geschichte abzukürzen--------------------------
Ich entschloss mich, mich aufzumachen und selbst nach ihm zu suchen. Captain Good besaß die Freundlichkeit, mich zu begleiten.«
»Na ja«, sagte der Captain; »nichts anderes zu tun, wissen Sie. Von den Lords der Admiralität weggejagt, darf ich bei halbem Sold verhungern. Und nun, Sir, erzählen Sie uns vielleicht, was Sie von dem Gentleman namens Neville wissen.«
Zweites Kapitel: Die Sage von Salomons Minen
»Was haben Sie eigentlich über die Reise meines Bruders nach Bamangwato erfahren?«, fragte Sir Henry, als ich eine kurze Pause machte, um meine Pfeife zu stopfen, bevor ich Captain Good antwortete.
»Folgendes«, antwortete ich, »und ich habe bis heute zu keiner Menschenseele darüber gesprochen. Ich hörte, dass er nach Salomons Minen aufgebrochen ist.«
»Salomons Minen?«, riefen meine beiden Zuhörer zugleich. »Wo liegen die denn?«
»Ich weiß es nicht«, sagte ich; »ich weiß nur, wo sie der Sage nach liegen sollen. Einmal sah ich die Gipfel des Gebirges, hinter dem sie sich angeblich befinden, aber damals lagen hundertdreißig Meilen Wüste zwischen mir und ihm, eine Wüste, die meines Wissens bisher kein Weißer durchquert hat, außer einer. Aber vielleicht ist es das gescheiteste, wenn ich Ihnen die Sage von Salomons Minen erzähle, so wie ich sie kenne. Sie müssen mir aber Ihr Wort geben, ohne mein Einverständnis nichts von dem verlauten zu lassen, was ich jetzt erzähle. Einverstanden? Ich habe meine Gründe dafür.«
Sir Henry nickte, und Captain Good erwiderte »gewiss, gewiss.«
»Nun«, begann ich, »es wird Ihnen wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sein, dass Elefantenjäger im allgemeinen eine raue Sorte von Männern sind, die sich nicht viel um andere Dinge kümmern als um das nackte Leben und die Sitten und Gebräuche der Kaffern. Ab und zu trifft man freilich einen, der sich die Mühe macht, bei den Eingeborenen alte, seit Generationen überlieferte Bräuche zu sammeln, und versucht, ein kleines Zipfelchen der Geschichte des schwarzen Erdteils zu lüften. Solch einer war es, der mir die Sage von Salomons Minen als erster erzählte; nahezu dreißig Jahre ist es jetzt her. Es war auf meiner ersten Elefantenjagd in der Gegend von Matable. Er hieß Evans und wurde ein Jahr darauf von einem angeschossenen Büffel angenommen und getötet; armer Bursche, er ist unweit der Sambesifälle begraben. Eines Abends, erinnere ich mich, erzählte ich Evans von einigen seltsamen Bergwerken, die ich bei einer Jagd auf Kudus (Schraubenantilopen) und Elenantilopen entdeckt hatte, dort, wo jetzt der Lydenburg-Distrikt von Transvaal liegt. Soweit mir bekannt ist, stieß man später beim Goldschürfen wieder auf diese Bergwerke, aber ich wusste schon Jahre vorher von ihrer Existenz. Eine prächtige, breite Straße ist dort durch den festen Felsen gehauen, die zum Eingang des Bergwerks bzw. dem Durchgang führt. Innerhalb des Schachtmundes lagen Stapel von Goldquarz, fertig zur Aufbereitung aufgeschichtet, ein Zeichen, dass die Arbeiter, wer immer sie auch waren, sie fluchtartig zurücklassen mussten. Etwa zwanzig Schritt dieses Durchgangs waren überdacht, und es war ein gutes Stück Mauerwerk.
Ja, sagte Evans, aber ich werde dir ein seltsameres Garn spinnen, und er begann mir davon zu erzählen, wie er im Inneren des Landes eine zerstörte Stadt entdeckt hatte, die er für das Ophir der Bibel hielt - nebenbei, andere, sogar Gelehrte, haben dasselbe schon lange vor Evans behauptet. Ich erinnere mich genau, wie ich offenen Ohres all diesen Wundern lauschte; denn ich war damals ja jung, und diese Geschichte einer sagenhaften Kultur und eines Schatzes, den jene alten jüdischen und phönizischen Abenteurer aus einem Land holten, das schon längst wieder in finstere Barbarei zurückgeglitten war, regte meine Phantasie gewaltig an. Plötzlich fragte er mich:
Junge, hast du schon einmal etwas vom Sulimangebirge im Nordwesten des Mashukulumbwelandes oben gehört?
Ich verneinte.
Na schön, sagte er, dort oben hatte Salomon tatsächlich seine Minen, seine Diamantenminen, meine ich.
Woher willst du das wissen?, fragte ich.
Es wissen! Ei, was ist denn Suliman anderes als eine Verballhornung von Salomon? Und außerdem erzählte mir eine alte Isanusi, eine Zauberdoktorin in der Manicagegend oben, alles davon. Sie sagte, dass das Volk, welches über dem Gebirge drüben lebt, ein Zweig der Zulu wäre, der einen Zulu-Dialekt spreche; es seien aber größere und hübschere Menschen, und unter ihnen gebe es mächtige Zauberer, die ihre Kunst von weißen Männern gelernt hätten, als die ganze Welt finster war, und die das Geheimnis einer wunderbaren Mine glänzender Steine besäßen.
Nun, damals lachte ich über diese Geschichte, obwohl sie mich interessierte, denn zu der Zeit waren Afrikas Diamantenfelder noch nicht entdeckt. Der arme Evans zog weiter und wurde getötet. Während der nächsten zwanzig Jahre dachte ich nicht mehr an die Sache. Aber genau zwanzig Jahre später - und das ist eine lange Zeit, Gentlemen, ein Elefantenjäger lebt bei seinem Beruf selten zwanzig Jahre -, da hörte ich etwas Genaueres über das Sulimangebirge und das Land, das jenseits von ihm liegt. Ich war über die Manicagegend hinauf an einen Ort, Sitandas Kraal genannt, gezogen. Es war eine Gotts erbärmliche Gegend, man konnte dort nichts zu essen bekommen, und rundum gab es nur Kleinwild zum Jagen. Ich hatte einen Fieberanfall und war überhaupt in einer bösen Verfassung, als ein Portugiese mit einem einzigen Gefährten - einem Halbblut - ankam. Na, ich kenne diese Delagoa-Portugiesen zur Genüge. Es gibt im Allgemeinen ungehängt keine größeren Teufel als sie. Sie mästen sich an der menschlichen Qual und am Fleisch ihrer Sklaven. Aber der war gegenüber diesen niederträchtigen Burschen ein ganz anders gearteter Typ, als ich ansonsten gewohnt war zu begegnen. Er erinnerte mich an die chevaleresken Doms, von denen ich gelesen hatte. Er war lang und hager, hatte große schwarze Augen und einen gezwirbelten Schnurrbart. Wir unterhielten uns ein wenig, denn er sprach gebrochen Englisch, und ich verstand etwas Portugiesisch. Er erzählte mir, dass er José Silvestre heiße und an der Delagoa-Bay seinen Wohnsitz habe. Als er am nächsten Tag mit seinem Halbblut-Gefährten aufbrach, verabschiedete er sich mit einem freundlichen Adieu und zog seinen Hut ganz nach alter Manier. Auf Wiedersehen, Señor, sagte er, wenn wir uns wiedersehen sollten, werde ich der reichste Mann der Welt sein, und ich werde mich dann Ihrer erinnern. Ich lachte kurz, ich war selbst zu schwach, kräftig zu lachen. Dann beobachtete ich, wie er auf die große Wüste im Westen zuhielt. Zu gerne hätte ich gewusst, ob er verrückt war oder was er dort zu finden glaubte.
Eine Woche verging, und ich erholte mich von meinem Fieber. Eines Tages saß ich auf der Erde vor meinem Zelt, nagte an dem letzten Knochen eines erbärmlichen Huhns, das ich für ein Stück Stoff - zwanzig Hühner wert - von einem Eingeborenen bekommen hatte, und starrte in die heiße untergehende Sonne. Plötzlich sah ich eine Gestalt, offensichtlich die eines Europäers, denn sie trug einen Männerrock, etwa dreihundert Yards entfernt mir gegenüber auf dem Hang des ansteigenden Geländes. Der Mensch kroch auf Händen und Füßen vorwärts, brach zusammen und kroch wieder weiter. Der Mann war in Not, das war mir klar, und ich schickte deshalb einen meiner Jäger hinaus, ihm zu helfen. Bald darauf kehrte er zurück. Was glauben Sie, wen er mitgeschleppt brachte?«
»José Silvestre natürlich«, sagte Captain Good.
»Jawohl, José Silvestre, oder genauer gesagt, sein Skelett mit ein wenig Haut. Sein Gesicht war quittengelb von Gallenfieber, und seine großen, schwarzen Augen standen fast aus dem fleischlosen Schädel. Nichts wie pergamentartige Haut, weiße Haare und spitz hervortretende Knochen, kein Quäntchen Fleisch.
Wasser! Um Christi willen Wasser!, stöhnte er. Seine Lippen waren aufgesprungen, seine Zunge war geschwollen und schwärzlich.
Ich gab ihm Wasser mit etwas Milch gemischt, und er trank in großen Schlucken ohne abzusetzen zwei Viertel oder mehr. Ich hätte ihm aber unter keinen Umständen auch nur einen Tropfen mehr gegeben. Dann packte ihn das Fieber wieder. Er brach zusammen und begann vom Sulimangebirge, von Diamanten und der Wüste zu phantasieren. Ich brachte ihn ins Zelt und tat für ihn, was ich tun konnte; es war wenig genug. Doch ich sah, wie es enden musste. Gegen elf Uhr wurde er ruhiger, und ich legte mich nieder, um ein wenig auszuruhen, und schlief ein. Bei Morgengrauen wurde ich munter und sah Silvestre aufrecht im Zwielicht sitzen, eine seltsame, hagere Gestalt, die hinaus in die Wüste starrte. Kurz darauf schoss der erste Strahl der Sonne unmittelbar über die weite Ebene vor uns bis zu dem weit entfernten Gipfel eines der höchsten Berge des Sulimangebirges, mehr als hundert Meilen weg.
Das ist er!, schrie der Sterbende auf Portugiesisch und zeigte mit seinem langen, dürren Arm hin. Aber ich werde ihn nie erreichen, nie! Keiner wird ihn je erreichen! Plötzlich hielt er inne und schien einen Entschluss zu fassen. Freund, sagte er, indem er sich mir zuwendete, sind Sie da? Meine Augen werden trübe.
Ja, sagte ich, legen Sie sich jetzt hin und ruhen Sie sich aus.
Ei, erwiderte er, ich werde bald ruhen, ich habe Zeit zu ruhen, eine ganze Ewigkeit. Hören Sie, ich liege im Sterben! Sie sind gut zu mir gewesen. Ich werde Ihnen die Urkunde geben. Vielleicht gelingt es Ihnen, lebend durch die Wüste zu kommen, die mich und meinen armen Diener auf dem Gewissen hat. Dann langte er in sein Hemd und zog etwas heraus, was ich für einen burischen Tabaksbeutel aus der Haut eines Swart-vet-pens, einer Schwarzantilope, hielt. Es war mit einem kurzen, schmalen Fellstreifen, wir nennen ihn Rimpi, zugebunden, und er versuchte ihn aufzuknüpfen, vergebens. Er reichte den Beutel mir.
Aufknüpfen, sagte er.
Ich tat's und zog ein Stück zerrissener, gelber Leinwand heraus, auf der etwas in verblassten Buchstaben geschrieben war. Eingewickelt in diesen Fetzen war ein Papier.
Er wurde zusehends schwach, und die Mattigkeit wuchs.
Die Urkunde beschreibt alles, was auf dem Leinen ist. Jahre hat es mich gekostet, es zu entziffern. Hören Sie: mein Ahne, ein politischer Flüchtling aus Lissabon und einer der ersten Portugiesen, die an diesen Küsten landeten, schrieb das nieder, als er in jenem Gebirge dort, das keines Weißen Fuß vorher und seitdem berührt hat, im Sterben lag. Sein Name war José da Silvestra. Er lebte vor dreihundert Jahren. Sein Sklave, der am Fuß des Gebirges auf ihn gewartet hatte, fand ihn, als er ihn nach langem Warten suchte, tot auf und brachte das Schriftstück nach Delagoa. Seit damals wurde es in unserer Familie aufbewahrt, aber niemand hat sich die Mühe gemacht, die Schrift zu entziffern, bis ich es schließlich tat. Und jetzt kostet mich das mein Leben, ein anderer kann Erfolg haben und der reichste Mann der Welt werden - der reichste Mann der Welt. Nur geben Sie es niemandem anderen, Señor; gehen Sie selbst!
Dann begann er wieder wirr zu reden, und in einer Stunde war alles vorbei.
Gott schenke ihm die ewige Ruhe! Er starb sehr ruhig, und ich begrub ihn tief unter großen Geröllbrocken. Ich glaube also nicht, dass ihn Schakale ausgraben konnten. Dann zog ich weiter.«
»Ja, aber das Dokument?«, sagte Sir Henry stark interessiert.
»Ja, das Dokument; was stand darin?«, fügte der Captain hinzu.
»Nun, Gentlemen, wenn Sie es wünschen, werde ich es Ihnen erzählen. Ich habe es bisher noch niemandem gezeigt, außer einem betrunkenen alten portugiesischen Händler, der es mir übersetzte und bis zum nächsten Morgen alles wieder vergessen hatte. Das Original des Fetzens liegt bei mir zu Hause in Durban, zusammen mit der Übertragung des armen Don José. Die englische Übersetzung aber habe ich bei mir in meinem Notizbuch sowie ein Faksimile der Landkarte, wenn man es eine Karte nennen kann. Hier ist's.«
Ich, José da Silvestra, der jetzt vor Hunger im Sterben liegt, in der kleinen Höhle, wo kein Schnee ist, auf der Nordseite der Brust des südlichsten der zwei Berge, die ich Shebas Brüste nannte, schreibe dies im Jahre 1590 mit einem gespaltenen Knochen auf dem Rest meiner Kleidung, mein Blut dient als Tinte. Falls es mein Sklave, wenn er kommt, findet und nach Delagoa bringen sollte, möge mein Freund (unleserlicher Name) die Angelegenheit dem König melden, damit dieser eine Armee aussenden kann; diese wird ihn, wenn sie die Wüste und das Gebirge überquert, die tapferen Kukuanas und ihre teuflischen Künste bezwingt - wozu einige Priester mitgehen sollten -, zum reichsten König seit Salomon machen. Mit eigenen Augen habe ich die unzähligen Diamanten in Salomons Schatzkammer hinter dem Weißen Tod aufgehäuft gesehen; aber infolge der Verräterei Gagools, der Hexenspürerin, konnte ich nichts in Sicherheit bringen, kaum mein Leben. Lasst den, der kommt, meiner Karte folgen und den Schnee von Shebas linker Brust besteigen, bis er zur Brustwarze kommt, auf der Nordseite davon beginnt die von Salomon gebaute große Straße, von hier sind es noch drei Tagesreisen zum Königspalast. Tötet Gagool. Betet für meine Seele. Lebt wohl.
José da Silvestra
Als ich dieses Dokument zu Ende vorgelesen und die Kopie der Karte gezeigt hatte, von der Hand des sterbenden alten Dom mit seinem Blut als Tinte gezeichnet, folgte eine Stille des Staunens.
»Na«, brach Captain Good schließlich das Schweigen, »zweimal bin ich um die Welt gesegelt, und in den meisten Häfen der Welt bin ich vor Anker gegangen, aber gehängt will ich als Meuterer werden, wenn ich je ein Garn wie dieses je gehört habe!«
»Eine seltsame Geschichte«, sagte Sir Henry. »Ich nehme an, Sie halten uns nicht zum besten? Ich weiß, man hält es für durchaus erlaubt, ein Greenhorn auf den Arm zu nehmen!«
»Wenn Sie das glauben, Sir Henry, nun - dann ist die Ge
schichte zu Ende«, sagte ich sehr verstimmt und steckte meine Papiere wieder in die Tasche. Denn ich schätze es absolut nicht, für einen jener albernen Burschen gehalten zu werden, die es witzig finden, Lügen zu erzählen, und sich Neuankömmlingen gegenüber immer mit ungewöhnlichen Jagdabenteuern brüsten, die sich nie ereigneten. Ich stand auf, um zu gehen.
Sir Henry legte seine große Hand auf meine Schulter. »Setzen Sie sich, Mr. Quatermain«, sagte er, »ich bitte um Verzeihung; ich weiß sehr wohl, dass Sie uns nicht betrügen wollen, aber die Story klingt so ungewöhnlich, dass ich sie nur schwer glauben kann.«
»Sie sollen das Original des Schreibens und der Karte sehen, sobald wir in Durban sind«, antwortete ich, einigermaßen besänftigt. Denn wenn ich die Sache ruhig betrachtete, so war es kaum verwunderlich, dass er an meiner Ehrlichkeit zweifelte. Und so fuhr ich denn fort:
»Ich habe Ihnen noch nichts über Ihren Bruder erzählt. Ich kannte Jim, den Mann, der ihn begleitete. Von Geburt ein Bechuana, war er ein tüchtiger Jäger und für einen Eingeborenen ein sehr cleverer Bursche. An dem Morgen, an dem Mr. Neville aufbrach, sah ich Jim bei meinem Wagen stehen und auf der Deichsel Tabak schneiden.
Jim, sagte ich, wohin geht jetzt die Reise? Auf Elefanten?
Nein, Baas, antwortete er, wir sind hinter etwas her, was mehr wert ist als Elfenbein.
Und was soll das ein?, fragte ich, denn ich war neugierig. Gold?
Nein, Baas, noch wertvoller als Gold, und er grinste.
Ich riskierte keine weiteren Fragen mehr, denn ich wollte nicht mein Ansehen aufs Spiel setzen, wenn ich neugierig schien. Aber ich zerbrach mir den Kopf. Kurz darauf hörte Jim mit dem Tabakschneiden auf.
Baas, sagte er.
Ich nahm keine Notiz.
Baas, wiederholte er.
He, Junge, was gibt's?, fragte ich.
Baas, wir sind hinter Diamanten her.
Diamanten? Na, da geht ihr aber in die falsche Richtung; ihr solltet Kurs nach den Feldern nehmen.
Baas, haben Sie schon mal was von Sulimans Berg gehört?
Mhm.
Habt ihr etwas von den Diamanten dort gehört?
Ein albernes Märchen, weiter nichts, Jim.
Nein, Baas, kein Märchen. Ich habe einmal ein Weib getroffen, das von dort her kam und mit ihrem Kind nach Natal wollte, das erzählte mir's - es ist jetzt tot.
Dein Herr wird den Aasvögeln, den Geiern, zur Nahrung dienen, Jim, wenn er versucht, Sulimans Land zu erreichen, und du genauso, wenn sie an euren wertlosen alten Kadavern überhaupt noch etwas Abfall finden, sagte ich.
Er grinste.
Vielleicht, Baas. Jeder muss sterben; ich möchte vorher noch zu gerne ein fremdes Land kennenlernen. Die Elefanten sind drauf und dran, hier herum zu verschwinden.
Na, mein Junge, sagte ich, warte mal, bis der bleiche alte Mann nach deiner gelben Gurgel packt, und dann wollen wir mal hören, was für ein Liedchen du dann singst.
Eine halbe Stunde später fuhr Nevilles Wagen ab. Knapp darauf kam Jim noch einmal zurück.
Adieu, Baas, sagte er, »ich möchte nicht von hier fortgehen, ohne Lebewohl zu sagen, denn ich glaube, Sie haben recht und wir werden nie mehr südwärts ziehen.»
Will dein Herr tatsächlich zum Sulimansberg, Jim, oder lügst du?
Nein, erwiderte er. Er geht. Er erzählte mir, er wäre gezwungen, irgendwie sein Glück zu machen, beziehungsweise es zu versuchen; so könnte er sich ebenso gut auf Diamanten stürzen.
Oh!, sagte ich, warte einen Augenblick, Jim; wirst du deinem Herrn eine Notiz überbringen, Jim, und versprechen, sie ihm nicht früher zu geben, als bis ihr in Inyati seid?
Das war hundert Meilen entfernt.
Ja, Baas.
Also nahm ich einen Zettel und schrieb darauf: Lasst den, der kommt... den Schnee von Shebas linker Brust besteigen, bis er zur Brustwarze kommt, auf der Nordseite davon ist Salomons große Straße.
Nun, Jim, sagte ich, wenn du das deinem Herrn gibst, berichte ihm, er soll diesem Rat unbedingt folgen. Du darfst ihm den Zettel aber jetzt noch nicht geben, weil ich nicht mag, dass er zurückkommt und mir Fragen stellt, die ich nicht beantworten möchte. So, jetzt hau ab, du fauler Kerl, der Wagen ist beinahe außer Sicht.
Jim nahm die Notiz und ging. So, das ist alles, was ich von Eurem Bruder weiß, Sir Henry; aber ich fürchte sehr...«
»Mr. Quatermain«, unterbrach mich Sir Henry, »ich unternahm diese Reise, um meinen Bruder zu suchen. Ich werde seine Spur bis zu Sulimans Berg verfolgen und, falls notwendig, darüber hinaus, beziehungsweise bis ich mit Sicherheit weiß, dass er nicht mehr lebt. Wollen Sie mich begleiten?«
Ich glaube, ich habe es bereits erwähnt, ich bin ein vorsichtiger Mensch, ja sogar furchtsam, und ich schreckte vor dem Gedanken an solch ein Abenteuer zurück. Es schien mir, dass ein solches Unternehmen nicht weniger als den sicheren Tod bedeuten würde; und abgesehen von allem anderen, ich hatte für einen Sohn zu sorgen. Ich konnte es mir nicht leisten, gerade jetzt zu sterben.
»Nein danke, Sir Henry, ich glaube, ich mache es lieber nicht«, antwortete ich deshalb. »Ich bin zu alt für derartige abenteuerliche Jagden und würde nur so enden wie mein armer Freund Silvestre. Ich habe einen Sohn, der von mir abhängig ist, und kann es daher nicht verantworten, mein Leben so leichtsinnig aufs Spiel zu setzen.«
Beide, Sir Henry und Captain Good, schauten sehr enttäuscht drein.
»Mr. Quatermain«, brach ersterer das Schweigen, »ich bin wohlhabend und auf dieses Unternehmen versessen. Sie können den Lohn für Ihre Dienste, in welcher Währung Sie auch immer wollen, nach Recht und Billigkeit selbst festsetzen. Er wird Ihnen ausbezahlt, bevor wir aufbrechen. Mehr noch, ich werde im Fall, uns oder Ihnen stößt etwas Unerwartetes zu, dafür sorgen, dass Ihr Sohn angemessen versorgt ist. Ich glaube, Sie sehen an diesem Angebot, wie wichtig mir Ihre Teilnahme ist. Außerdem, gesetzt den günstigen Fall, wir erreichen diesen Platz und finden Diamanten, sollen diese Ihnen und Good zu gleichen Teilen gehören. Ich will nichts davon. Aber freilich, solche Verheißungen sind so gut wie nichts wert, obwohl das gleiche gilt für das Elfenbein, das wir eventuell erbeuten. Sie können mir aber auch Ihre eigenen Bedingungen stellen, Mr. Quatermain; selbstverständlich komme ich für alle Unkosten auf.«
»Sir Henry«, erwiderte ich, »das ist das großzügigste Angebot, das ich jemals bekommen habe, eines, das ein armer Jäger und Händler nicht einfach ausschlagen kann. Aber es ist auch der größte Job, der mir je unterkam, und ich muss in Ruhe darüber nachdenken. Sie erhalten meine Antwort, bevor wir in Durban anlegen.«
»Sehr gut«, antwortete Sir Henry.
Alsdann wünschte ich eine gute Nacht, ging zu Bett und träumte von dem armen, längst verstorbenen Silvestre und den Diamanten.
Drittes Kapitel: Umbopa tritt in unsere Dienste
Je nach Schiff und Wetterlage dauert die Fahrt vom Kap nach Durban etwa vier bis fünf Tage. Zuweilen, wenn das Anlegen in East London schwierig ist - der wunderbare Hafen, von dem so viel gesprochen und in den so viel Geld gesteckt wird, ist noch nicht fertig -, liegt ein Schiff für vierundzwanzig Stunden fest, bis die Lastboote endlich auslaufen und die Güter übernehmen können. Diesmal jedoch mussten wir nicht warten, denn an der Sandbank herrschte keine nennenswerte Brandung. Die Schlepper kamen sofort heraus, hinter ihnen ein Schwanz hässlicher flacher Boote, in die die Fracht mit viel Lärm verladen wurde. Es spielte gar keine Rolle, um was für eine Ware es sich dabei handelte. Alles flog über Bord, gleich ob Porzellan oder Wolle. Alles erfuhr die gleiche Behandlung. Ich sah, wie eine Kiste mit vier Dutzend Champagnerflaschen in tausend Stücke zerschellte und der Champagner über den schmutzigen Schiffsboden sprudelte und schäumte. Es war eine verdammte Verschwendung, und das dachten allem Anschein nach die Kaffern in dem Boot auch, als sie ein paar heile Flaschen fanden. Sie schlugen ihnen die Hälse ab und tranken. Nur hatten sie nicht mit der Kohlensäure gerechnet, die sich ausdehnt, und nun fühlten sie sich aufschwellen, wälzten sich auf dem Schiffsboden herum und schrien laut, der gute Likör wäre tagati - verhext. Ich rief ihnen vom Schiff aus zu und erzählte ihnen, dass es die stärkste Medizin des weißen Mannes sei und sie so gut wie tote Männer wären. In panischer Angst kehrten sie an Land zurück, und ich glaube nicht, dass sie je wieder Champagner anrühren werden.
Nun, die ganze Zeit über, da wir auf Natal zu dampften, dachte ich über Sir Henrys Angebot nach. Wir sprachen zwei oder drei Tage kein Wort mehr über dieses Thema, obwohl ich zahlreiche Jagdgeschichten zum besten gab, jede einzelne wahr. Denn es ist völlig unnötig, Jägerlatein aufzutischen, da einem Mann, dessen Beruf die Jagd ist, soviel kuriose Dinge tatsächlich Unterkommen. Doch dies nur nebenbei.
Schließlich, eines schönen Abends im Januar, dem heißesten Monat hier, dampften wir die Küste von Natal entlang. Wir hofften, Durban Point bei Sonnenuntergang zu erreichen. Ab East London übrigens eine reizende Küste, die ganze Strecke. Rote Sandhügel wechseln mit belebenden weiten Grünflächen, da und dort übersät mit Kaffernkraals, eingesäumt vom weißen Band der Brandung, die in Schaumpfeilen aufspritzt, wo sie gegen die Felsen prallt.
Kurz vor Durban ist ringsum eine besonders fruchtbare Landschaft. Tiefe Kluften, während Jahrhunderten durch die tropischen Regengüsse ausgewaschen, zerschneiden die Hügel, durch die in der Regenzeit Flüsse herunterschäumen. Das satte Grün des Busches, der wächst, wie Gott ihn pflanzte, daneben das zarte Grün der Maisgärten und Zuckerplantagen, während da und dort ein weißes Haus, auf die ruhige See hinauslächelnd, das Bild vollendet und der Landschaft den Charakter der Schlichtheit verleiht. Für meinen Geschmack kann eine Landschaft so schön sein wie sie will, um sie zu vollenden, bedarf es der Anwesenheit von Menschen. Doch vielleicht kommt das daher, weil ich so lange in der Wildnis lebte und daher den Wert der Zivilisation besonders hoch schätze, obgleich sie andererseits das Wild vergrämt. Der Garten Eden war schön, ehe es den Menschen gab - ohne Zweifel -, aber so bei mir denke ich immer, er muss noch schöner gewesen sein, als Eva darin lustwandelte.