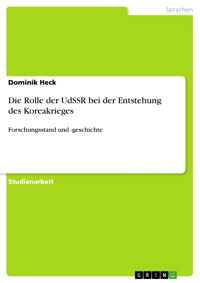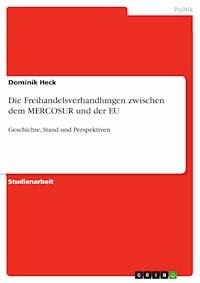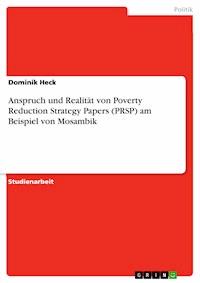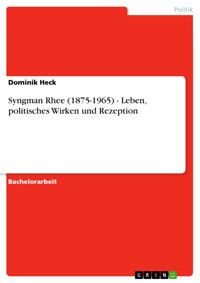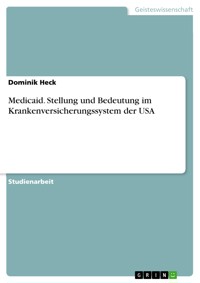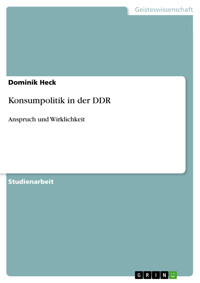
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Soziologie - Soziales System und Sozialstruktur, Note: 1,3, Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Sozialwissenschaft), Veranstaltung: Soziale Ungleichheit und Sozialstruktur (Theorien sozialer Ungleichheit), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Vehemenz, mit der die Abwicklung der DDR vor allem durch die ostdeutsche Bevölkerung vorangetrieben wurde, ließ auf eine tiefe Unzufriedenheit der Menschen mit den Lebensverhältnissen im real existierenden Sozialismus hindeuten. Es stellt sich daher die Frage, weshalb ein Staat, der vorgab, eine im Vergleich zum marktwirtschaft-kapitalistischen Westen gerechtere und menschlichere Gesellschaftsordnung aufzuweisen, am Ende seiner Geschichte nahezu keinen politischen und gesellschaftlichen Rückhalt in der Bevölkerung besaß. Vor diesem Hintergrund soll sich im Rahmen dieser Arbeit mit der Konsumpolitik der DDR auseinandergesetzt werden. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit soziale Ungleichheiten5 im Konsumgefüge der DDR bestanden, wodurch diese hervorgerufen wurden und welche Konsequenzen – sowohl in sozialer, als auch in ökonomischer Hinsicht - sich daraus ergaben. Auf Grund der planwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung stand die Ebene des Konsums - wie auch alle anderen Bereiche der DDR-Volkswirtschaft - unter unmittelbarem staatlichem Einfluss. Daher wird einführend zunächst auf ideologische Implikationen im Hinblick auf den Konsum in der DDR eingegangen. Zum adäquaten Verständnis der in der DDR betriebenen Konsumpolitik ist eine Einbettung in den historischen Kontext unter politischen und ökonomischen Gesichtspunkten vonnöten, die daran anknüpfend vorgenommen wird. Auf diesen Ausführungen aufbauend sollen im inhaltlich zweiten Bereich konkrete Dimensionen sozialer Ungleichheit in der Konsumlandschaft der DDR thematisiert werden. Hierzu bieten sich die Unternehmen Intershop, Delikat und Genex an, deren Bestehen vordergründig zwar für eine allgemeine Verbesserung des Versorgungsniveaus sorgte, allerdings neben umfangreichen gesellschaftlichen Verwerfungen auch ideologische und wirtschaftliche Probleme aufwarfen. Im inhaltlich dritten Bereich soll dabei anhand der so genannten Kaffeekrise der Jahre 1977 gezeigt werden, wie komplex sich das Verhältnis zwischen ökonomischen Rahmenbedingungen und Erfordernissen, politischen Maßnahmen und Druck aus der Bevölkerung konkret gestaltete und dies symptomatisch für die in der DDR betriebene Konsumpolitik war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Sozialwissenschaft Sektion Soziologie
Soziale Ungleichheit und Sozialstruktur (Theorien sozialer Ungleichheit) Wintersemester 2008/09
Konsumpolitik in der DDR
Bochum, den 31. März 2009
Page 3
1. Einführung
Nicht einmal elf Monate nach der Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989 war der selbst ernannte Arbeiter- und Bauernstaat Deutsche Demokratische Republik (DDR) Geschichte. Angefangen von der Massenflucht von DDR-Bürgern über Ungarn im Ergebnis der geöffneten Grenze zu Österreich über die landesweiten Demonstrationen und Proteste im Herbst 1989 bis hin zur massenhaften Übersiedlung von Ostdeutschen in die Bundesrepublik im Zuge des Falls der innerdeutschen Grenze1manifestierte sich der gesellschaftliche Exodus der DDR im Wesentlichen anhand einer Abstimmung mit Füßen.
Der mit atemberaubender Geschwindigkeit stattfindende Zerfall des Staatswesens der DDR war selbst für kritische westliche Beobachter in dieser Form zur damaligen Zeit überraschend. Trotz aller bekannten Defizite - insbesondere im politischen Bereich - galt die DDR als ein verhältnismäßig stabiler Staat.2Schon kurz nach den Ereignissen des 9. November 1989 zeigte sich allerdings, dass die Bevölkerung der DDR in der Mehrheit nicht gewillt war, den sozialistischen Weg beizubehalten, sondern stattdessen einen raschen Übergang zum marktwirtschaftlich-kapitalistischen System präferierte, was schließlich zwangsläufig zur schnellen Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990 führte. Die Vehemenz, mit der die Abwicklung der DDR vor allem durch die ostdeutsche Bevölkerung vorangetrieben wurde3, ließ auf eine tiefe Unzufriedenheit der Menschen mit den Lebensverhältnissen im real existierenden Sozialismus hindeuten. Es stellt sich daher die Frage, weshalb ein Staat, der vorgab, eine im Vergleich zum marktwirtschaft-kapitalistischen Westen gerechtere und menschlichere Gesellschaftsordnung aufzuweisen, am Ende seiner Geschichte nahezu keinen politischen und gesellschaftlichen Rückhalt in der Bevölkerung besaß.
Vor diesem Hintergrund soll sich im Rahmen dieser Arbeit mit der Konsumpolitik4der DDR auseinandergesetzt werden. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit soziale
1Ingesamt verlor die DDR im Jahr 1989 343.854 Einwohner durch Flucht oder Übersiedlung. Im Vergleich zu 1988 war dies ein Anstieg um rund 900 Prozent (39.845 Personen). Vgl. Schroeder 2000, S.274. In Relation zur Gesamtbevölkerung von etwa 17 Millionen verließen im Jahr 1989 somit etwa 2 Prozent die DDR.
2Dies zeigte sich vor allem daran, dass das desolate Ausmaß des wirtschaftlichen Zustandes der DDR, die sich in ihrer Außendarstellung als zu den zehn größten Industrienationen zugehörig präsentierte, erst nach der Wende in vollem Umfang ersichtlich wurde.
3Beispielhaft sei hier nur das Ergebnis der ersten freien Volkskammerwahl vom 18. März 1990 genannt, in der die Allianz für Deutschland, ein inoffizielles Bündnis von für die Vereinigung Deutschlands eintretender Parteien bestehend aus Christlich Demokratischer Union (CDU), Deutsch Sozialer Union (DSU) und dem Demokratischen Aufbruch (DA), mit 48,15% der gültigen Stimmen stärkste Kraft wurde.
4Da der inhaltliche Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Konsumlevel und der Zufriedenheit der Bevölkerung mit den Lebensverhältnissen in einem Staat offensichtlich ist, soll auf einen näheren theoretischen Diskurs im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden. Für theoretische Überlegungen hinsichtlich der Entwicklung des modernen Konsumbegriffs vgl. Merkel 1999, S.19ff.