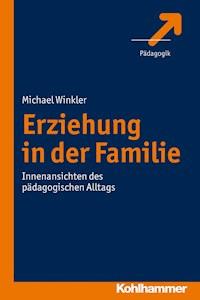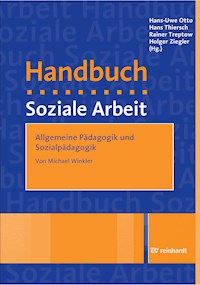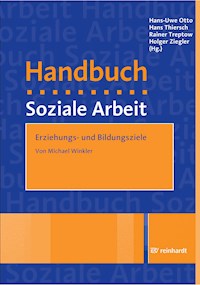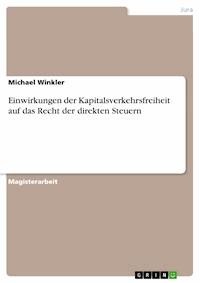Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Inklusion hat sich als Leitformel und Programm politischer, sozialer und pädagogischer Veränderung durchgesetzt. Verlangt wird die Inklusion aller, die Hoffnung gilt einer inklusiven Gesellschaft. Die Debatte - hier setzt die "Kritik" des Buches an - wird allerdings generalistisch geführt, tritt als Totalstrategie auf, die es sozialtechnisch umzusetzen gilt. Nicht in den Blick kommen die konkreten Individuen, nicht ihre Lebenslagen, Lebensformen und Lebenspraktiken, schon gar nicht ihre Subjektivität mit ihren Eigenheiten und Eigenwilligkeiten. Das Buch verweist mit allem Nachdruck auf die fatalen Widersprüche, in die sich Inklusion bei näherer Betrachtung verstrickt sieht. Winklers Kritik der Inklusion ist weit entfernt vom Plädoyer für Exklusion. Aber er zeigt, wie Inklusion einer Politik falscher Versprechungen Vorschub leistet, vielleicht sogar jenen noch die nötige Macht nimmt, die sie eigentlich doch unterstützen will. Plädiert wird dagegen für eine gute Pädagogik, die den Menschen in seiner Individualität und Subjektivität gerecht wird, für eine ethische Haltung, die sich aus Anerkennung und Achtung für alle und für jede und jeden begründet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Prof. Dr. Michael Winkler ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Pädagogik und Theorie der Sozialpädagogik am Institut für Bildung und Kultur der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne. Seine Arbeitsgebiete sind: Theorie und Geschichte der Pädagogik, Bildungstheorie, Friedrich Schleiermacher, Friedrich Fröbel, Kindheit, Familienerziehung, Theorie der Sozialpädagogik, Hilfen zur Erziehung, Übergang von Schule ins Berufsleben, Inklusion. Zahlreiche Auslandsaufenthalte, Gastprofessuren u. a. an der Universität Graz und Wien.
Michael Winkler
Kritik der Inklusion
Am Ende eine(r) Illusion
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-035248-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-035249-0
epub: ISBN 978-3-17-035250-6
mobi: ISBN 978-3-17-035251-3
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort
Inklusion – Einhegung, Einschluss. Ein starkes Wort setzt sich durch, als Leitformel und Programm politischer, sozialer und pädagogischer Veränderung. Verlangt wird die Inklusion aller, die Hoffnung gilt einer inklusiven Gesellschaft. Das hört sich gut an, in Verbindung mit den neuen Leitvokabeln, die da lauten: Entwicklung und Teilhabe. Indes: Der Verdacht lautet, dass es weniger darum geht, Menschen einen Platz in einer Gesellschaft zu verschaffen und ihnen eine Möglichkeit zu eröffnen, ihre Lebensform zu finden und sie gestalten zu können, als individuelle Lebensform in einer Gesellschaft. Nein: Alle sollen gefangen, eingeschlossen und hinter die Grenzen einer Gesellschaft verbracht werden, die wohl als die beste alle Welten gelten soll. In der sie dann gut funktionieren sollen.
So recht möchte man das nicht glauben, schon gar nicht will man sich einer solchen Strategie anschließen. Einschließungspraktiken scheinen doch überwunden, spätestens seit der Kritik an den Inkarzerationsprozessen, denen psychisch Kranke ausgesetzt waren und sind. Antipsychiatrie und demokratische Psychiatrie sind zwar in mancher Hinsicht gescheitert, als Kritik des Wegsperrens bleiben sie präsent – sie sollten das wenigstens, wenngleich Skepsis gegenüber der Fähigkeit zur Erinnerung angesagt ist.
Inklusion für alle? Eine Utopie oder eine Dystopie? Könnte es sich um ein totalitäres Denken handeln, wie gut gemeint die Forderung nach Inklusion für jene klingt, die als behindert oder chronisch krank ausgeschlossen wurden oder sich – das markiert eine Differenz – als ausgeschlossen erleben. Gelingt Inklusion überhaupt ohne Exklusion? Wird nicht wieder eine Gruppe festgestellt, festgelegt und kategorisiert, nämlich die der zu Inkludierenden. Wer handelt eigentlich? Die, die doch schon drin sind und jetzt großzügig Inklusion durchsetzen, irgendwie paternalistisch und beruhigend gegenüber jenen, die sich bewusst und laut als Krüppelinitiativen artikuliert haben. Und so ganz nebenbei: Entstehen nicht schon wieder Unterschiede, nämlich zwischen jenen, die inkludiert werden sollen, und den anderen, die sich integrieren sollen? Wie die Geflüchteten, übrigens mit einer nicht unerheblichen Zahl von Menschen, die behindert, erkrankt, vielleicht traumatisiert sind, von Kriegserfahrungen, Vertreibung, Flucht, Hoffnungen und deren Enttäuschung.
Die Debatte wird generalistisch geführt, tritt als Totalstrategie auf, eindimensional und sozialtechnisch, wenig dialektisch. Sie nimmt nicht die konkreten Subjekte in den Blick, nicht die von diesen erfahrenen Lebenslagen, Lebensformen und Lebenspraktiken, schon gar nicht ihre Subjektivität. Mit ihrem Bezug auf die Menschenrechte hat sie einen universalistischen Anspruch, aber ihr fehlt sogar noch die entscheidende Idee, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, in einer Gesellschaft als Menschen individuell eigenartig und eigenwillig zu wirken. Sie stellt sich kaum der Frage, wie diese Gesellschaft mit ihren Mitgliedern umgeht, die Frage nach einem guten Leben für alle klingt nicht einmal an. Inklusion bleibt abstrakt formalistisch und vereinnahmend, wird vorsichtig zurückhaltend, wenn es um die geht, die sich integrieren sollen. Vor allem: Sie zielt zwar – so zumindest die Lesart mancher – auf eine revolutionär andere politische Form der Gesellschaft, verzichtet jedoch auf eine kritische Untersuchung der gegebenen Gesellschaft. Selbst, wenn man jenen folgt, die die Debatte in den angelsächsischen Ländern gestartet haben und sich – wie Mel Ainscow wohl einmal gesagt hat – angesichts ihrer Dynamik ein wenig ›jetlagged‹ fühlen, selbst wenn man vorrangig pragmatisch und nicht theoretisch denkt, bleibt doch der Vorbehalt: Wie Möglichkeiten und Grenzen einer inklusiven Reform bestimmt sein sollen, wie nicht zuletzt in aller Inklusion die individuell subjektiven Rechte als solche geschützt bleiben. Übrigens auch das Recht, für sich zu bleiben. Und das gilt vor allem dann, wenn Inklusion auf Pädagogik bezogen wird. Mehrdeutigkeit bestimmt alle Pädagogik, macht möglicherweise sogar ihr Spezifikum und ihren herausfordernden Reiz aus. Sie kann nicht in eine Richtung aufgelöst werden – und das markiert wohl ziemlich präzise den Punkt, an welchem sich Pädagogik und Politik, vermutlich auch die Pädagogik und die neueren Spielarten einer Psychologie voneinander scheiden, die auf statistische Evidenz bei der Bestimmung von Problemlagen wie bei der Behauptung von Lösungen für diese abheben.
Inklusion verlangt, kluge Entscheidungen konkret zu treffen, im Bewusstsein darum, dass sie politisches und moralisches Urteilen verlangen, bezogen jedoch auf Individuen und die von ihnen zu wählenden Möglichkeiten der Lebensführung. Das Feld sollte sichtbar werden, in seinen Begrenzungen, auf der einen Seite die Inklusion als Einschluss in das Ganze, auf der anderen Seite die Freiheit und Autonomie der individuellen Subjekte. Hier zeigt sich der sachliche Grund dafür, von einer sozialpädagogischen Auseinandersetzung mit Inklusion zu sprechen. Die sozialpädagogische Perspektive unterscheidet sich jedenfalls von anderen darin, dass sie einerseits die Spannung zwischen gesellschaftlichen Bedingungen menschlicher Entwicklung und individueller Subjektivität und Selbstwahrnehmung zu wahren, wenn nicht sogar in dem Sinne aufzuheben sucht, den Hegel dem Begriff der Aufhebung gegeben hat; das Soziale, sei es in Gestalt der Gesellschaft oder eher der von Gemeinschaft, bleibt ebenso wichtig wie die subjektiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in dem noch sich zeigen, was als eigene Lebensform beschrieben wird. Die eigene Lebensform fügt sich aus Sozialem und Individuellem, aus Natur und Geist – um es in einer Weise zu formulieren, die traditionell wirkt und doch im thematischen Zusammenhang nicht vergessen werden darf; sie entsteht bedingt durch Natur und Gesellschaft, immer im Zusammenhang mit Kultur, niemals aber determiniert, sondern immer aus einem Verhältnis heraus, das Subjekte praktisch gestalten. Sie verhalten sich gegenüber der Welt und gegenüber sich selbst.
Die sozialpädagogische Denk- und Handlungsweise bleibt vorsichtig gegenüber einem Vorrang der Sozialpolitik. Das hat nicht zuletzt einen Grund in dem fundamentalen Wandel, der der Sozialpolitik allzumal aufgrund der irritierenden Denkwechsel seitens der Sozialdemokratie widerfahren ist. Diese ist heute der Garant des falschen Neoliberalismus geworden, fatalerweise in all ihren sozialpolitischen Maßnahmen. Die sozialpädagogische Denk- und Handlungsweise unterscheidet sich zudem darin, dass sie immer Veränderungen, Entwicklungen, mithin Prozesse im Blick hat, nicht bloß auf Strukturen setzt, sondern sich vergegenwärtigt, wie Menschen in diesen und an diesen lernend sich bilden. Sie bleibt der Pädagogik verpflichtet, nicht nur, weil pädagogisches Denken und Handeln das Tun der anderen ermöglichen und ihnen Lebensformen eröffnen möchte, die zu finden sie auf Unterstützung angewiesen sind. Vor allem jedoch: Sozialpädagogik lässt sich von einem durchaus emphatisch gemeinten Begriff des Subjekts und seiner Subjektivität leiten. So manche haben diesen dekonstruiert, einige haben das Subjekt für tot erklärt. Nur: Was bleibt dann eigentlich, um Menschen in ihrer Lebendigkeit, in ihrem Eigenwillen und der Absicht zu begreifen, sich selbst zu erfassen, zu entwerfen, zu bestimmen und zu verwirklichen? Das tote Subjekt, das dekonstruierte Subjekt, sie sind dann wohl Funktionen, vielleicht auch Algorithmen. Daran mag etwas sein. Soll es dabei bleiben?
Das Buch ist in mehrfacher Hinsicht ein Versuch. Ein Versuch, weil die Überlegungen gleichsam neben der Debatte entstanden sind, diese immer wieder kommentierend. Statt die Thematik einzuengen, sich zu fokussieren, das Problem auf den Punkt zu bringen, will das Buch Rahmungen anbieten. Dafür arbeitet es pointillistisch und nennt viele Punkte, an die eben zu denken wäre. Es versucht, vergleichsweise breit angelegt und zuweilen assoziativ Überlegungen anzustellen, die das Thema rahmen und diskutieren; man kann sagen, dass es Teil eines hermeneutischen Prozesses wurde, der das Geschehen zu verstehen suchte und sucht. Deshalb mäandriert es manchmal, in Bereiche hinein, die man nicht erwarten würde. Das ist Absicht.
Das Buch will also Denkmöglichkeiten für eine Hermeneutik eröffnen, die man verwerfen kann. Immerhin geht die Debatte täglich weiter. Deshalb hat das Schreiben viel länger gedauert als erwartet, am Ende war es gar nicht so recht abzuschließen. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich ihm und seinen Gedanken morgen noch zustimmen werde. Es kann sein, dass mich jemand überzeugt, die Akzente demnächst anders zu setzen, andere Perspektiven zu sehen. Erstaunlicherweise finde ich das erfreulich, weil es zeigt, wie wir alle in einem Prozess der Veränderung des Denkens und Handelns stehen. Nicht leugnen kann es einen normativen Anspruch: Es geht mir allerdings darum, darüber nachzudenken, wie allen Menschen die Möglichkeit eröffnet werden kann, sich gut zu entwickeln, vor allem das Maß an Subjektivität und Autonomie zu finden, das jede und jeder für sich selbst wünscht – jenseits der Bedingungen, die man in der eigenen Verfasstheit findet und bewältigen muss.
Die Überlegungen stützen sich auf eine Reihe von Vorträgen und Beiträgen in Zeitschriften; vieles ist völlig neu entstanden, insbesondere in der Auseinandersetzung um die Reform der Kinder- und Jugendhilfe. So weit wie möglich habe ich Überschneidungen und Wiederholungen entfernt, ganz lassen sie sich nicht vermeiden. Überrascht bin ich über den Zuspruch, den meine Überlegungen häufig gefunden haben. Dankbar bin ich für alle kritischen Hinweise und Anregungen, besonders erwähnen will ich Reinhard Rudeck und Markus Hundeck. Die Geduld von Klaus-Peter Burkarth, der als Lektor das Projekt betreute, kann ich nur noch bewundern.
Michael Winkler
Inhalt
Vorwort
1 Inklusion – Eine Annäherung
Beobachtungen
Notizen
2 Realitäten
Bittere Einsichten
Schwierigkeiten mit der Literatur
3 Inklusion – Back to the Basics
Menschliche Praxis oder Humantechnologie
Die UN-Konvention
4 Inklusion – Politik mit der Pädagogik
Auftakt: Eine kleine Theorie moderner Politik
Inklusion als ein Kampffeld
5 Inklusion als die Individualisierung des Politischen. Oder: Die harte Politik der »Krüppelinitiative«
6 Einschluss und Ausschluss in Gesellschaften. Eine Aufführung ohne Bühnenbild
Die soziale Wirklichkeit der Inklusion – ein kleiner Umweg
Exklusion und Inklusion – Perspektiven der Soziologie.
7 Inklusion und die Gesellschaft der Gegenwart
Über Alltag und Normalität als Bedingungen der Subjektivität
Das Risiko der modernen Gesellschaften
Inklusion ohne Gesellschaft – die unmögliche Erwartung
8 Inklusion – Nachfragen der Pädagogik. Oder: Die Verwunderung der Pädagogin
Die Sorge um die Kinder und Jugendlichen – Aufklärung eines Missverständnisses
Pädagogische Handlungslogik und pädagogische Haltung
Die Praxis der Erziehung und ihre merkwürdigen Elemente
Bescheidenheit – oder auch: die Grenzen des Geschehens
9 Inklusion – eine ethische Frage
Die fatale Ethik der Verbesserung
Die Chance der Inklusionsdebatte
Reden wir doch mal über Menschen
Literaturhinweise
1 Inklusion – Eine Annäherung
Beobachtungen
Fotobücher ersetzen heute das Fotoalbum, sie beendeten den Ärger mit den Klebeecken, die nur selten die Fotos festhalten. Spätestens bei der dritten Besichtigung fielen die Aufnahmen heraus, abgesehen von jenen, die man selbst herausgenommen hat. Sie kamen niemals an ihren einmal vorgesehenen Platz zurück, den jetzt eine sinnlos gewordene, handschriftliche Bemerkung ziert.
Fotobücher gewinnen einen besonderen Reiz dann, wenn sie thematisch geordnet und arrangiert sind: Eines zeigt die ersten fünf Jahre in den Leben zweier Kinder, eines Mädchens und eines Buben. Sie verbringen viel Zeit miteinander, seit ihre Mütter sich zufällig kennen lernten, wie das manchmal in kleineren Ortschaften so passiert. Familien brauchen bekanntlich andere Familien, um ihren Alltag zu bewältigen. Die Kinder treffen sich regelmäßig und wachsen mehr oder weniger gemeinsam auf, sind sogar bei den Familienfeiern des anderen mit dabei. Sie gehören dazu, anderes erwartet keiner, Oma und Opa des einen sind für das andere Kind ebenfalls als solche da, weil seine eigenen Großeltern weit entfernt wohnen. Selbst wenn sich die beiden Kinder streiten, gehen sie doch ungewöhnlich fürsorglich miteinander um.
Eines der beiden Kinder ist chronisch krank. Das Mädchen hat Krampfanfälle und muss mit einer Sonde ernährt werden. Sein Schluckreflex ist gestört. Es hat Schmerzen und muss immer wieder aus dem gemeinsamen Zusammenhang mit anderen herausgenommen werden, um ernährt zu werden. Eigentlich möchte es mit den anderen essen, doch gelingt ihm das nicht. Wenigstens einmal wurde das Gehirn nicht genug mit Sauerstoff versorgt, weil eine Fehldiagnose gestellt wurde, übrigens gegen das bessere Wissen der Eltern. Ohnedies ist der Kampf der Eltern mit Ärzten, Kassen und eigenmächtigen Lieferanten von Hilfsmitteln kaum darzustellen. Eine aussichtsreiche Therapie zur Entwöhnung von der Sonde wurde abgelehnt. Sie war vorgeblich zu teuer, obwohl sie billiger gewesen wäre als der Klinikaufenthalt zur Umgewöhnung. Jetzt steht wieder eine stationäre Aufnahme vor der Türe, den Termin hat die Klinik festgesetzt. Sie ignoriert schlicht, dass beide Eltern berufstätig sein müssen, weil andernfalls nicht zu finanzieren wäre, was das Kind über den genehmigten Bedarf hinaus benötigt.
Gleichwohl: seine Lebensform bleibt eingebettet in das Gesamt der Aktivitäten aller. Wenn die das so mittragen. Andere »schauen schon mal seltsam«, berichtet die Mutter und kann es kaum fassen, wenn die eigenen Verwandten ihr den Gedanken an ein zweites Kind nahelegen: Wenn die mal nicht mehr ist, habt ihr dann wenigstens eines; da fallen Worte, als wäre das Mädchen ein Ding, das man sich besser nicht angeschafft hätte. Aber für Ersatz sollte man sorgen.
Das kleine Mädchen hat sich zuletzt gut entwickelt. Sie zeigt sich zunehmend als eigenständige Person, wie alle Kinder in diesem Alter, sogar gegenüber ihrem jungen Freund, der das gelassen hinnimmt. Sie kann renitent sein. Gerade überspringt sie Verzögerungen in ihrer Entwicklung. Wenn schon trotzig, dann aber richtig. Dennoch sucht sie intensiv Aufmerksamkeit bei Erwachsenen. Wem sie vertraut, den beansprucht sie, verdrängt manchmal sogar das andere Kind: Ich, mir, mein! Beide regulieren das jedoch in einer bemerkenswerten Weise. Das eine Kind billigt dem anderen zu, dass und wie es sich die Zuwendung selbst von Oma und Opa holt, über die zu verfügen es selbst schon genießt. Die Kinder sind altruistisch, kooperieren übernehmen die Perspektiven anderer – seit Anbeginn ihrer Freundschaft haben sie widerlegt, was Piaget unterstellte, nämlich den kindlichen Egozentrismus, und bestätigen die Befunde von Wygotski, der eine elementare soziale Zuwendung erkannt hat. Michael Tomasello, der Evolutionsbiologe und Erforscher des Verhaltens von Primaten und Kindern, folgt ihm und hat experimentell belegt, wie schon sehr kleine Kinder miteinander und mit Erwachsenen kooperieren, dabei etwas zeigen, was er Shared Intention nennt.
Das nun könnte entscheidend sein: Kinder, Menschen überhaupt wirken zusammen, in einer gemeinsamen Praxis, in der sie als konkret Verschiedene miteinander agieren. Sie erkennen die Absichten des anderen, bemerken seine Bedürftigkeit; getragen von einem offensichtlich fundamentalen Altruismus bemerken sie, wie andere einer Hilfe bedürfen, damit alle in einer gemeinsamen Praxis agieren und leben können. Dabei spielt nur bedingt eine Rolle, wenn die eine oder der andere mit einem Handicap zu tun haben – übrigens durchaus leidend und belastet. Kooperation könnte sogar die Grundlage der erfolgreichen und zugleich doch einer unerwarteten menschlichen Evolutionsgeschichte sein. In der Kooperation gleicht sich alle Differenz nämlich aus, hin zu einer Erweiterung dessen, was im 19. Jahrhundert noch als menschliche Lebenskraft bezeichnet wurde. Vor allem Kindern gelingt es auf eine hervorragende Weise, dafür den Blick ihrer Mitakteure aufzunehmen und zu übernehmen, diesen sich zu eigen zu machen. Allerdings, so schränkt Tomasello ein, nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie in öffentlich getragene Erziehung kommen (vgl. Tomasello 2010). Diese operiert meist mit Formen des Vergleichs und des Wettbewerbs, lässt aus Gemeinsamkeit Gegensatz und Konkurrenz entstehen. Dann wird Behinderung plötzlich wichtig als Diskriminierungsmoment. Oder anders: Wir alle, unsere Gesellschaft lassen Behinderung zum Problem werden, weil wir vielleicht Angst vor Gemeinschaft, vor gemeinsamer Lebenspraxis haben.
Notizen
Warum schicke ich das voraus, sozusagen als Gebrauchsanleitung für die folgenden Überlegungen? Aus rhetorischen Gründen, um Erfahrung zu dokumentieren oder um ein »berührendes Beispiel« zu geben, wie unlängst ein Buch über Praktiken der Inklusion beworben wurde? Wahrscheinlich nicht. Zumal ein Buch doch selbstverständlich und so geschrieben sein sollte, dass seine Sätze und die mit diesen ausgesprochenen Gedanken sich als klare nachvollziehen lassen. Man muss ihnen ja nicht zustimmen.
Der Grund ist ein anderer. Eine Gebrauchsanleitung ist nötig, weil die angestellten Überlegungen keine – wie das im Newspeak der Gegenwart gerne formuliert wird – eindeutige Message haben. Deshalb bewegen sich die Gedanken zuweilen im Widerspruch – vielleicht, weil die Wirklichkeit nicht frei von Dialektik bedacht werden kann. Praktiker in einschlägigen Handlungsfeldern, in der Arbeit in Fördereinrichtungen oder in inklusiv gestalteten Lebens- und Lernzusammenhängen sprechen davon, dass sie sich in den letzten Jahren wie in einer Achterbahn bewegt haben. Von der Schließung der Förderschulen und der Inklusion im Regelsystem bis zu einer nicht mehr zu befriedigenden Nachfrage nach Plätzen in vorgeblich oder sogar wirklich besonderen Einrichtungen konnten sie innerhalb kurzer Zeit nahezu alles erleben. Ganz abgesehen davon, dass die oft mühsame und anstrengende Arbeit mit Kindern einfach weitergehen musste, die mehr Zeit für ihre Entwicklung brauchen, Geduld, Herausforderung und Zuwendung, die sich eben deutlich von Kindern unterscheiden, die weniger Unterstützung und Begleitung brauchen. Und das Dilemma bleibt, dass man einerseits jene sieht, die sich vehement gegen die Bezeichnung als behindert wehren, diese als die eigentliche Einschränkung ihres Lebens sehen, die nach einem erfolgreichen Studium klagen, wegen ihrer schweren Sehbehinderung auf eine beschützende Einrichtung verwiesen zu werden – übrigens nicht als erfahrene Fachkraft, sondern als Fall –, dass man andererseits begreifen muss, wie Kinder mit ungeheurer Anstrengung und über Wochen lang eine Bewegungspräsentation einüben, die andere in einem Nachmittag erfassen und beherrschen. Die hier vorgetragenen Überlegungen haben also Sympathie für die Praxis, wissen aber, dass diese oft kontingent bleibt und vom Engagement der Beteiligten abhängt. Diesen wird manchmal zu viel abverlangt. Deshalb sollten Begriff und Programm der Inklusion nicht noch weiter überanstrengt werden, sondern kritisch befragt werden; vielleicht muss die menschliche Lebenspraxis, die Formen, in welchen Menschen handeln und sich entwickeln, doch eher bruchstückhaft, konkret betrachtet werden, nicht unter den Prämissen eines großen Programms und Projekts, das sich dann doch weit von der Wirklichkeit entfernt hat, die hier und heute bewältigt sein will.
Gewiss haben das Programm der Inklusion und die Auseinandersetzung um sie eine Entwicklung vorangebracht, die längst überfällig war. Schulbehörden haben Kinder und Jugendliche in Sondereinrichtungen verwiesen, die mit wenigen flankierenden Hilfen ihren Weg in einem Schulsystem hätten finden können, das für alle Kinder geöffnet ist. Das Gesundheitssystem agiert in einer Weise, bei der sich sogar Satire schämt: Sie brauchen einen Rollstuhl? Wozu denn das. In Ihrem Alter hat man es doch nicht eilig.
Die Lage ist dennoch komplizierter. Inklusion gilt als das neue pädagogische Prinzip, aber das – wie es hier genannt wird – pädagogische bzw. als solches gemeinte System ist in fatale Widersprüche geraten. Beginnend vielleicht damit, dass es als Bildungssystem bezeichnet wird, wenngleich in Rückübersetzung des englischen Ausdrucks education, der auf vorrangig öffentlich verantwortete, institutionelle und curricular geordnete, bzw. auf den systematischen Kompetenzerwerb ausgerichtete Instruktionen abhebt. Schon die Erziehung in der Familie (upbringing) fällt aus dieser Denkweise heraus und muss gesondert bezeichnet werden. Mit fatalen Effekten für die Inklusionsdebatte in Deutschland. Die kann dann nämlich so tun, als ginge es nicht um Familien. Noch schwerer wiegt, dass der Begriff der Bildung gleichsam undertheorised verwendet wird. Er wird nur noch auf Schule bezogen, seine entscheidenden Bedeutungsinhalte werden ausgeblendet. So verschwindet zum einen die für ihn fundamentale Idee der Freiheit. Autonomie und Mündigkeit spielen keine Rolle mehr. Dann wird der Bezug des Begriffs der Bildung auf das Verhältnis zwischen der Besonderheit und Eigenart von Menschen aufgegeben (die nicht notwendig auf Individualität beschränkt sein muss, sondern sogar kollektive Veränderungsprozesse meint). Endlich geht die Hintergrundannahme verloren, dass in Bildungsprozessen das menschliche Subjekt seine natürlichen Möglichkeiten entdeckt und durch seine eigene Auseinandersetzung mit den Artefakten der sozialen und kulturellen Welt so entfaltet, dass es sich selbst zu beherrschen vermag.
Man mag das alles als philosophisch zurückweisen; vermessen lässt sich Bildung in diesem Sinne sicher nicht, doch gibt das traditionelle Verständnis des Begriffs eine Richtschnur dafür, wie Menschen miteinander umgehen können. Es zeigt an, mit welcher Komplexität zu rechnen ist, wenn Entwicklung, Lernen und Selbstbestimmung sich verbinden. Die Dimensionen des Geschehens können nicht auseinandergerissen werden. Dennoch geschieht gerade dieses: Einerseits sollen alle Kinder und Jugendlichen inkludiert werden, sollen Schulen mit Vielfalt umgehen, ohne dass so recht gesagt wird, was das bedeutet, wie es geschehen soll. Natürlich: idealerweise so, dass die Lehrerin jedem Kind maßgeschneiderte Aufgaben stellt und es dann individuell bewertet: 31 Aufgabenstellungen, 31 Bewertungen, nur der Test wird dann standardisiert für alle durchgeführt, der nach einem Jahr dann die Rückmeldung gibt. Jedenfalls spricht man sogar davon, dass Inklusion das Markenzeichen der modernen Unterrichtsgestaltung darstellt. Alle Kinder sollen in eine Schule, die mit Binnendifferenzierung arbeitet. Verbunden damit werden Förderschulen als Teufelswerk bezeichnet; sie sollen verbannt werden, manchmal in einer Art Kirchenkampf, dann nämlich, wenn sie in freier Trägerschaft geführt werden. Schon erweitert sich dieser Bann auf die Hauptschule. Manchmal wird indes nur die Nomenklatur verändert, manche sprechen von Regelschule oder von Mittelschule, auch die Realschule plus wurde eingeführt (was dann nach der Minusvariante fragen lässt). Im Ergebnis geht es um die Schule für diejenigen, die nicht in das Gymnasium gehen – die in mancher Großstadt schon zur Schule für alle geworden ist. Alle anderen finden sich dann auf der Resterampe.
Nein, natürlich nicht, solche Worte verwendet nur die Politik. Institutionelle Trennungen sollen vermieden werden. Dafür spricht allerdings, dass solche Unterscheidungen Chancen – was immer dieser Ausdruck meint – verringern und Lebenswege zementieren. Man könnte von einem Übermut, wenn nicht sogar von einer Hypertrophie des Bildungsdenkens sprechen; in einer Gesellschaft, die von Ungleichheit bestimmt wird, schafft das Bildungssystem kaum Gleichheit, schon gar nicht Gerechtigkeit. Darauf hat nicht nur Bourdieu immer wieder hingewiesen. Vielleicht wird vom Bildungssystem einfach zu viel verlangt. Als Beleg könnte man ja anführen, dass Bildungspolitiker, über Bildung schreibende Journalisten, vor allem die sogenannten Experten einfach nicht lernen, sondern weiter ihren Hoffnungen nachhängen. Zudem: Bei all dem wird geradezu notorisch die Frage nach der Individualität vermieden. Die Frage etwa, ob und wie weit es nicht doch sinnvoll wäre, nach Graden der Behinderung zu unterscheiden; oder die Kinder, die Jugendlichen, ihre Eltern zu befragen, was sie wollen. Mit offenem Ergebnis übrigens. Andererseits: Zunehmend werden Familien und ihre Erziehung in Misskredit gebracht, sie sollen mehr leisten und zugleich gelten sie als Risiko für das Aufwachsen. Institutionelle und – was immer das heißt – professionelle Erziehung werden als die bessere Alternative gesehen. Verschwiegen wird, dass Anstalten keine sicheren Lebensorte sind, dass sie vor allem total werden können. Über Hospitalismus und totale Institutionen wird nicht mehr gesprochen. Das Erinnerungsvermögen selbst der Wissenschaft reicht nicht weit, allzumal, wenn politisch Anderes gefordert wird. Vor allem jedoch: Gegen alle Forderung nach Inklusion steht, dass und wie Schulen sortieren sollen, immer schon, heute aber nur nach Leistung, die an objektiven Kriterien, an Standards gemessen wird (vgl. Biewer 2012). Wie soll das eigentlich gehen, wenn die Voraussetzungen subjektiv und höchst unterschiedlich sind. Wie wird der Handstand objektiv bewertet, wenn die Arme fehlen?
Platt formuliert: Es geht um den Erfolg bei PISA oder um Inklusion. Es geht um den Sieg im globalen Kampf um die besten Köpfe und das größte Wirtschaftswachstum oder um eine gute Gesellschaft, die alle Menschen achtet und in ihrer Lebensform unterstützt. Ob sich beides verbinden lässt, sei dahingestellt; das Bildungssystem verdichtet allerdings die gesellschaftlichen Widersprüche (Höhne 2013), schafft es vor allem, sie zu verkehren, in einer Art von Fetischisierung: Soziale Ungleichheit wird in individuelle umgeformt, um dann eben doch wieder reproduziert zu werden. Man kann dazu erneut eine Menge bei Bourdieu lernen. Meistens so, dass sich die Beteiligten das dann selbst zuschreiben; die Lehrerinnen und Lehrer gelten dann als untauglich, weil es ihnen nicht gelingt, diese Widersprüche aufzuheben. So tendieren Schulen angesichts der an sie gerichteten Leistungsanforderungen dazu, schneller denn je, Kinder und Jugendliche auszusortieren, die sich negativ auf die Testleistungen auswirken. Selbst Eltern bemühen sich inzwischen um medizinische Diagnosen für ihre Kinder, damit diese mehr Rücksichtnahme seitens der Schulen erleben. Der Preis wird gerne gezahlt, dass sie dafür selbst in die Nähe des Sonderfalls rücken. Notorisch sind die Diagnosen zur Lese-Rechtschreibschwäche, dann die zu AD(H)S, obwohl hier der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben hat. Die zunehmende Medikalisierung von Kindheit und Jugend belegt: Behinderung wird sozial erzeugt, von ganz unterschiedlichen Akteuren, zuweilen um Vorteile in einem Wettbewerb zu erhalten, der in Frage gestellt werden muss.
Es ist sehr viel mehr an gemeinsamen Leben möglich, als sich viele vorstellen wollen. Allzumal die Radikalität, mit der Inklusion gefordert worden ist, vielleicht sogar die Schärfe eines Begriffs, der paradoxerweise unklar ist und doch schneidend wirkt, haben mehr Denkprozesse und Handlungen ausgelöst, als dies vorher der Fall war. Der Umgang mit Menschen, die als behindert bezeichnet wurden und werden, meist gegen ihren erklärten Willen, Etikettierung und Stigmatisierung hatten skandalöse Züge. Sie erschrecken heute noch, im Nachhinein, weil bewusst geworden ist, wie die Nationalsozialisten Menschen mit Behinderung grausam gequält und ermordet haben, allzumal in Einrichtungen, die Hilfe versprachen und menschenverachtende Experimente durchführten. Sie erschrecken in der Gegenwart und machen wütend; gleichgültig kann keiner mehr sein, wenn auf dem Schulhof einer den Anderen als behindert bezeichnet: Du Spasti gilt als Jugendjargon. Worte der Verachtung verbieten sich. Aufs Ganze einer gesellschaftlichen Entwicklung gesehen, weist Inklusion in die richtige Richtung, zumal wenn man bedenkt, wie Spaltungen in dieser Gesellschaft voranschreiten. Das Programm erzeugt wohl ein solches Echo, weil es alle berührt und nicht bloß Menschen, die als behindert gelten – manchmal macht sich die Hoffnung breit, dass es jetzt schon Wirkungen auf die Mentalitäten erzeugt hat. Diese Hasssprache wird nicht mehr einfach hingenommen.
Dennoch ist das Konzept kontaminiert, vielleicht durch seinen politischen Erfolg (und weil eine begründende und zugleich kritische Theorie fehlt): Der frühere Thüringer Kultusminister Christoph Matschie hatte laut Bericht der Ostthüringer Zeitung (vom 17.4.2013) Inklusion mit folgenden Worten auf die Agenda gesetzt: Es komme »weniger auf die Rampen« an, die in eine Schule führen, sondern auf die Anstrengung, ein gemeinsames Lernen verwirklichen zu wollen. Das hört sich prima an und bestätigt sogleich, was Kritiker vermuten: es geht um Symbolpolitik, vielleicht um Gesetze, in deren Kleingedrucktem unter der Überschrift »Kosten« zu lesen ist: keine. Man muss gar kein eingefleischter Marxist sein, um daran festzuhalten, dass die materiellen Verhältnisse und Bedingungen vorrangig zu verändern sind, das Bewusstsein wird dem Sein folgen. Wir brauchen also die Rampen, den Platz für den Rollstuhl, die Zeit für die Kinder und Jugendlichen, die es sich mit der eigenen Entwicklung ein wenig schwerer machen. Und wir brauchen das ausgebildete Fachpersonal, das weiß, wie mit Behinderung umzugehen ist, wie Umwege zu entdecken und zu gehen sind, wenn die Sinne sich nicht so ausgebildet haben, wie unsere Welt vorrangig eingerichtet ist. Inzwischen aber drängt sich der Eindruck auf, dass nicht einmal mehr von Rampen oder Fachpersonal die Rede ist. Böse formuliert, durchaus absichtsvoll zweideutig: Inklusion ist erledigt!
Keiner entkommt dem Problem der Sprache. Begriffe, Worte können verletzen, so gesehen bedarf es allerdings einer Haltung, die als Political Correctness bezeichnet wird und mit Dekonstruktion einhergeht. Man sollte die Macht der Worte nicht unterschätzen, die Arbeit an der Sprache ist unerlässlich, soll Zivilisation nicht preisgegeben werden – eben, weil sie immer wieder durch Sprache infrage gestellt wird. Sprache schließt Menschen aus, es gibt Formen der kategorialen Vernichtung, wie es George Steiner genannt hat, was den Juden im Nationalsozialismus zuerst angetan wurde. Sie wurden nicht mehr zur Kategorie der Menschen gezählt, aus dem Geltungsbereich des Begriffs der Humanität ausgeschlossen. Solche Vorgänge haben eine lange Tradition, deshalb ist Wachsamkeit angesagt: Noch bis in das 20. Jahrhundert hat man der Landbevölkerung eine eher tierische Existenz zugeschrieben – manchmal war das sogar als Kritik an den Lebensverhältnissen gemeint, mit welchen Kleinbauern, Knechte oder Landarbeiter zu kämpfen hatten. Die Arbeit an der Sprache, die Arbeit mit den Begriffen und an ihr, ist endlich so wichtig, weil Menschen die Bezeichnungen übernehmen, die ihnen von anderen angetan werden: Unterschicht etwa, die Zuordnung zu einer Klasse oder Schicht, das höhnische Gelächter sogar noch über einen Namen, der einem gegeben wurde und der nach Auffassung mancher Zugehörigkeit und Status signalisiert. Die Mechanismen der Abwertung funktionieren fast überall, sie sortieren Menschen nach Klassen oder als nicht zugehörig. Stigmatisierung wirkt am Ende dann in einem Prozess der Selbstzuordnung; der Labelling Approach hat gezeigt, dass und wie Menschen die Fremdzuschreibung übernehmen und sich zu eigen machen. Ich bin dann eben doch ein solcher – das legt einen fest, eröffnet zuweilen auch Handlungsspielräume.
Aber kann es überhaupt anders gehen? Werden nicht einfach Ordnungen geschaffen, im Zusammenspiel einer für alle unvermeidlichen Kooperation und als Antwort auf Ungleichheit? Selbst, wenn man Trittbrettfahrer in Rechnung stellt (wie alle Anthropologen und Evolutionsforscher tun), Menschen sind verschieden – und nicht wenige Bezeichnungen für sie ergeben sich aus der Differenz ihrer Talente und Tätigkeiten. So gesehen dienen Bezeichnungen als ein Hilfsmittel, um die Ungleichheit in einen Zusammenhang zu bringen, der das Ganze wahrt. Festlegungen werden also vorgenommen, weil eine Gesellschaft andernfalls ungeordnet auseinanderbricht. Dann: Helfen Bezeichnungen nicht auch, eigene Herkunft und den eigenen Ort zu bestimmen? Stellen wir uns mit Zuordnungen und Bezeichnungen nicht auch vor und dar? Ist die Person, die wir zu sein vorgeben, nicht immer eine von uns gewählte Maske, Teil eines Dramas oder eine Komödie, die wir spielen – in welchen wir uns selbst spielen, weil wir gar nicht wissen, wer wir sind oder sein wollen? Entlastet nicht die Rolle, die uns zugerechnet und von uns aufgenommen wird? Meine Aufgabe ist, mehr können Sie mir nicht zumuten, ich verwahre mich entschieden gegen die Erwartung, dass ich … Wenn dem aber so ist, wenn also der Verweis auf Behinderung nur als Ausdruck spezifischer und eigenartiger Leistung zu werten ist, dann tritt ein seltsames Paradox auf, das auf den ersten Blick zynisch erscheint: Dann muss Behinderung sogar benannt werden. Es geht um eine Besonderheit, die sozial und kulturell Aufmerksamkeit verdient, nicht in der Indifferenz der Differenz verschwinden darf. Das scheint abwegig, eine ziemlich wilde These. Historisch aber gibt es Belege für solche Denkweisen. Manche Gesellschaften haben diejenigen heiliggesprochen oder als weise Seher gefeiert, die heute als psychisch krank diagnostiziert werden.
Dann: eine kritische Theorie reagiert allerdings auf die Versuche, Inklusion als ein sozialpolitisches Glaubensbekenntnis zu verstehen, um gesellschaftliche Veränderung voranzutreiben oder gar die Revolution des Bildungswesens betreiben zu wollen. Glauben kann Menschen dazu bringen, die Realitäten zu übersehen und still zu halten, selbst wenn sie Grausamkeit ausgesetzt sind. Gegenüber der frohen Botschaft der Inklusion sollte ein wenig der Zweifel gesät werden. Diese wird nämlich zu einem Zeitpunkt und in Kontexten verkündet, die für das Erhoffte aversiv sind oder es sogar in sein Gegenteil verkehren. Die eine These lautet: Inklusion könnte gut und hilfreich sein, wenn und sofern sie mit einer ebenso radikal wie konsequent verfolgten Vorstellung von demokratischer Zivilgesellschaft verbunden ist. Einiges spricht hingegen dafür, dass Inklusion sich als Teil der politischen, ökonomischen und sozialen Strategien erweist, die als Neoliberalismus bezeichnet werden. Das geschieht einmal mehr widersprüchlich: Menschen wird ihre konkrete Existenz genommen, indem sie von sozialen Zwängen befreit werden, die ihnen mit der Bezeichnung Behinderung auferlegt sind – und damit verlieren sie zugleich soziale und kulturelle Ressourcen. Du bist nicht behindert, sondern ausgeschlossen; jetzt wirst du als Individuum eingeschlossen, frei und gleich wie alle anderen. Eingeschlossen in was? Du darfst mit unternehmerischer Verantwortung für Dich am Arbeitsmarkt teilhaben. Falls das nicht gelingt, musst Du halt Konkurs anmelden. Sehr schlecht für Dich.
Zurecht kritisiert Bernd Ahrbeck, dass mit der Universalisierung von Inklusion und der damit verbundenen Ablehnung von Kategorisierungen eine gefährliche Illusion entsteht (Ahrbeck 2014). Kategorisierungen werden vermutlich nie verschwinden – was als ein Argument dafür gelesen werden kann, sie immer wieder zu attackieren, zumal sie etwa in Gestalt von statistisch begründeten Diagnose- und Therapiemanualen eher zunehmend Verbreitung finden. Zugleich besteht aber die Gefahr, dass die Ablehnung von Kategorisierungen dazu führt, nötige Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen nicht mehr durchzuführen. Die stigmakritische oder sozialisationstheoretische Auflösung von Kategorisierung gefährdet dann unter dem Spardiktat öffentlicher Haushalte (vgl. Becker 2015) das mit Blick auf Behinderung und Krankheit gewonnene Fachwissen sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wenn Differenzierung moderne Gesellschaften auszeichnet, irritiert die Preisgabe eines besonderen, durch Fachlichkeit und Professionalität ausgezeichneten Wissens. Was als Gewinn erscheint, etwa in Gestalt einer eher ganzheitlichen und sozialen Perspektive auf menschliches Leben, erweist sich als Durchsetzung von Willkür. Colin Crouch hat für England gezeigt, wie im Neoliberalismus und unter dem Diktat eines bloßen Zahlenwissens Expertise zu Lasten jener abgeschafft wird, die auf Wissen angewiesen sind, um ihr Leben zu führen oder es zu verteidigen (Crouch 2015). So kommt der moderne, marktradikale und neoliberale Kapitalismus ohne Festlegungen aus; soziologisch gesehen handelt es sich um eine formale, durch Abstraktion vollzogene Inklusion. Dem steht aber ein ganz anderer Vorgang gegenüber, nämlich der der Normierung und der Standardisierung, der mathematisch-statistisch begründeten Verteilung, kurz des Normalismus, die in die Manuale des Human Treatment eingehen (vgl. Link 2006, 2013). Bekannt sind vor allem ICD und DSM V, die WHO führt noch andere, die im Kontext der Inklusionsdebatte eine Rolle spielen. Sie liegen dem Management zu Grunde, das nach Kriterien der Objektivität und evidenzbasierten Wahrheit das Humankapital bewerten und bearbeiten will; Diagnose und Therapie durch Experten. Allzumal die staatlichen Organe drücken neue Ordnungsmuster durch. Stets erscheint alles objektiviert und transparent. Das Teilhabegesetz folgt einem Katalog, der Unterstützung davon abhängig macht, ob fünf von neun Punkten in der Einschränkung der selbständigen Lebensführung gegeben sind. Wir machen es uns nicht einfach und denken vom autonomen Subjekt her. Sein Bedarf lässt sich dann doch objektiv bestimmen. Für jeden Tag? In jeder Situation. Man braucht wenig Fantasie, um sich die abkürzenden Formulierungen zu denken, mit welchen die Menschen kategorisiert werden, sie werden vermessen, berechnet und in digitale Zähleinheiten gebracht (Mau 2017): Das ist ein echter Fünfpunktler, der aber schon ein Sechspunktler für die Person mit Mehrfachbehinderung. Einklagen kann das ohnehin keiner: Die Erhebung wird delegiert an neutrale, private Institute und Institutionen. Schon heute macht sich kein Kultusministerium die Hände mit Standards schmutzig, die doch irgendwie demokratisch legitimiert sein müssten; dafür sind die Experten zuständig. Übrigens so, wie das bei Hartz IV der Fall war. Demokratie? Partizipation? Teilhabe? Das wird beschworen, bleibt aber ohne institutionelle Regelung.
Inklusion verbessert die Lebenssituation von Menschen, sofern diese in sozialen Prozessen ausgeschlossen wurden; sie geht aber damit einher, dass allzumal die pädagogischen Leistungen suspendiert werden, die jene Fähigkeiten und Fertigkeiten initiieren und sichern, welche einem Subjekt die Teilhabe an einer politischen, sozialen und kulturellen Welt erst ermöglichen. Die Deklaration der Inklusion allein, die Proklamation des Menschenrechts auf Teilhabe, bedeutet nämlich noch lange nicht, dass dieses verwirklicht wird; es bedarf dazu objektiver ebenso wie subjektiver Voraussetzungen, die erst erworben und entwickelt werden müssen. Oder anders: Inklusion ohne Bildung ist nicht möglich; Bildungsprozesse setzen zwar systematisch betrachtet Subjektivität voraus, gelingen aber nicht ohne Organisation von hinreichenden Settings, um diese Voraussetzungen, um Fähigkeiten und Fertigkeiten umfassend anzueignen.
Inklusion kommt manchmal naiv und zynisch daher. Sie reduziert Behinderung und Krankheit, lässt den Ernst von Lebensformen und die Komplexität außer Acht, die mit diesem verbunden sind. Man kann sie nicht auf soziale Phänomene reduzieren; die MS-Erkrankte, die alle zwei Tage Betaferon spritzen muss, führt ein anderes Leben – zumal ihr die Aussichten auf den Beruf verstellt sind, für den sie studiert hat. Behinderung oder eine chronische Krankheit sind Tatbestände; den Betroffenen fehlt etwas oder sie müssen Umwege in ihrer Bildungsarbeit gehen. Eine allein soziale Definition von Behinderung bleibt, so Andreas Kuhlmann, unterhalb der erlebten und gelebten Realität und verkennt, wie er geschrieben hat, die Grenzen unserer Lebensform. Oder anders formuliert: Wer sich nur auf Gesellschaft, auf den Zugang zu dieser und ihre Strukturen bezieht, ignoriert die Wirklichkeit menschlicher Besonderheit und konkreter Bedürftigkeit. Wer blind ist, braucht Hilfe, braucht einen anderen Unterricht; Experimente in der Physik müssen erfühlt werden. Das geht nicht so nebenbei in einer Schule, die in ihrer Didaktik und Methodik auf ein Zeigen mit dem ausgestreckten Finger aufbaut, das geht nicht mit Lehrern, die das nicht gelernt haben.
Die Debatte ignoriert zugleich die soziale und kulturelle Bedingtheit von Behinderung und Krankheit. Das scheint im Widerspruch zur eben angeführten Kritik am sozialen Reduktionismus. Aber die Inklusionsdebatte übersieht, wie Gesellschaften und Kulturen Behinderungen und Krankheiten erzeugen, und zwar nicht bloß im Sinne von Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozessen, sondern als reale Beschädigung des menschlichen Lebens, als Krankheit, als Verletzung. Als Störung körperlicher und geistiger Fähigkeiten, die aus der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft entsteht – manchmal hat man den Eindruck, dass die Inklusionsdebatte fast ein wenig weltfremd bleibt, übrigens noch gegenüber jenen, die mehrfach und schwerstbehindert sind, die buchstäblich in jedem Moment ihres Lebens darum kämpfen, überhaupt zu leben. Manche Forderung in der Inklusionsdebatte erscheint seltsam luxuriös gemessen an der realen Dramatik, die der eine oder die andere Behinderte täglich zu meistern hat und meistert.
Menschliches Leben darf nicht weggeschlossen oder ausgegrenzt werden. Aber Subjekte haben das Recht, die Balance zwischen Privatheit und Öffentlichkeit selbst herzustellen. Krankheit und Behinderung greifen das Selbstgefühl an, schränken Freiheit ein; Andreas Kuhlmann hat solche Grenzen der Lebensform verdeutlicht und an die Objektivität von Einschränkungen erinnert, die Freiheit zu einem mühsamen Geschäft machen (Kuhlmann 2011). Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des Inklusionsdiskurses zu übersehen, dass Menschen die Möglichkeiten einer Gesellschaft und Kultur wahrnehmen, die ihnen in ihrer Verfasstheit vorenthalten wurden. Man muss an seinem Leben nicht leiden, kann es dennoch als beschädigt empfinden. Nicht jeder will sein Leben in Anstrengung und Mühe öffentlich bewältigen, um eine Art politisch motivierten Voyeurismus zu befriedigen; mancher verzieht sich schon bei einer einfachen Krankheit in die eigenen vier Wände. Inklusion erzwingt Präsentation sowie Performanz – und sei es zur Darstellung auf dem Arbeitsmarkt. Das soll und muss jeder selbst entscheiden, selbst wenn sich regelmäßig herausstellt, wie das Miteinander alle Beteiligten wachsen und sich entwickeln lässt. Menschen sind sozial. Dennoch sollte man vorsichtig sein gegenüber den Erfolgsmeldungen, allzumal etwa aus anderen Ländern: Sichtbar werden dort Menschen mit deutlich weniger belastenden Handicaps, als dies etwa in Behindertenwerkstätten hierzulande der Fall ist. Ob sie wirklich besser leben? Sie sollen das entscheiden.
2 Realitäten
Bittere Einsichten
Das große Wort von der Inklusion, seine schon fast hypermoralische – und dennoch, wie sich später zeigen wird, eher ethikvergessene – Ladung, verbunden mit dem Wissen darüber, dass Ausgrenzungsprozesse stattfinden, erzeugen eine kommunikativ schwierige Situation. Die »heilige Inklusion«, wie Jantzen sie ironisch nennt (Jantzen 2012), macht es kaum möglich, nüchtern von Erfahrungen zu berichten, die allzumal im Schulsystem gemacht werden. Zumal Erfolgsmeldungen verbreitet werden, die einen kaum unberührt lassen. Vielleicht gibt es keinen Anlass zur Skepsis, vielleicht klagen doch nur wieder einmal die Lehrerinnen und die Lehrer. Allerdings: Wie steht es nun um die Ausbildung der Lehrerinnen für einen inklusiven Unterricht? Man zweifelt schon, ob das nun vorgesehene einzige Modul im Rahmen einer ohnedies vergleichsweise immer noch schmalen pädagogischen Ausbildung zu ersetzen vermag, was ein umfassendes sonderpädagogisches Studium vermittelt. Zumal man nicht vergessen darf, wie die Kinder und Jugendlichen sich nach Art und Weise ihrer Beeinträchtigung unterscheiden, beginnend schon bei den Formen einer Sinnesbeeinträchtigung. Physikunterricht für eine blinde Schülerin muss nun einmal anders gestaltet werden als der für eine hörgeschädigte. Vor allem jedoch: Die Erfahrungen verraten Bitterkeit. Bitterkeit darüber, dass erfolgreiche Projekte nicht weitergeführt werden, weil sie sich als personalintensiv und daher zu teuer erwiesen haben. Man hat den Eindruck, dass zuweilen das Etikett Inklusion noch an der Klassentür klebt, während im Innenraum davon nur mehr wenig zu spüren ist: Die zweite Lehrkraft fehlt, eine sonderpädagogisch ausgebildete Betreuerin kommt nur stundenweise, mehr als beraten kann sie ohnedies nicht mehr, weil sie an mehreren Schulen eingesetzt wird. Eltern machen zudem Druck. Sie meinen, dass ihre eigenen Kinder durch die Verhaltensoriginalität der zwei als förderungsbedürftig eingestuften abgelenkt werden; manche fühlen sich selbst zurückgesetzt.
Spätestens im Frühsommer 2017 spricht sich der Unmut seitens der Lehrerinnen und Lehrer fast explosionsartig aus; zumindest berichtet die Tagespresse wohl bundesweit ausführlich über eine im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) durchgeführte, sehr offen angelegte Untersuchung durch Forsa (vgl. z. B. Schmoll 2017a, b). Diese hatte ergeben, dass knapp mehr als die Hälfte der befragten Lehrerinnen und Lehrer Inklusion zwar grundsätzlich begrüßt, die Zustimmung aber über die Jahre gleichgeblieben ist. Forsa spricht von anhaltender Skepsis. So könnte man vielleicht sagen: Nur die Hälfte stimmt für Inklusion, zugleich empfehlen nahezu alle Lehrerinnen und Lehrer, Förderschulen prinzipiell beizubehalten. Vorbehalte richten sich vor allem gegen die Rahmenbedingungen, unter welchen Inklusion verwirklicht werden soll. Kritik wurde beispielsweise an der fehlenden oder unzureichenden Vorbereitung und Ausbildung geübt, zudem zeigte sich, dass sogar noch die baulichen Gegebenheiten eine Aufnahme von Schülerinnen mit körperlicher Behinderung verhinderten. Deutlich wird zudem, dass die Lehrerinnen und Lehrer Inklusion als gesamtgesellschaftliches und eher volkspädagogisches Programm ansehen, das etwa der Förderung von Toleranz und sozialem Lernen dient, während jedoch wenig positive Effekte im fachlichen Unterricht gesehen werden. Inklusion wird wohl eher strategisch gesehen, nämlich als eine – im Fall des gemeinsamen Unterrichts unbedingt erforderliche, ansonsten aber generell gewünschte – Möglichkeit, dass Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen gemeinsam die pädagogische Arbeit leisten. Solche Tandemlösungen werden offensichtlich favorisiert, um der öffentlich und politisch mit den Stichworten Bildung und Betreuung geäußerten Erwartung gerecht zu werden, nach der Schule Unterricht und Erziehung zu leisten habe – wobei die Mehrzahl der Bundesländer in ihren Regelstrukturen keine Doppelbesetzung vorsieht. Zwei Drittel der Inklusionsklassen werden daher nur von einer Lehrerin oder einem Lehrer unterrichtet, denen keine sozialpädagogische Fachkraft zur Seite steht – ohnedies muss man allerdings Bedenken anmelden, weil Sozialpädagoginnen keineswegs eine behinderten- oder integrationspädagogisch einschlägige Ausbildung haben, erst recht nicht, wenn sie Sozialarbeit studiert haben. Zwar mögen in solchen Studiengängen sozialpolitische Debatten um Menschenrechte oder Integration eine Rolle spielen, spezifisch sonderpädagogisches Können wird jedoch eher selten zugänglich. Letztendlich wird Inklusion auf ganz fatale Weise zu dem Thema, das nun den wachsenden Ärger des pädagogischen Personals an den Schulen und vor allem an einer hochproblematischen Bildungspolitik fokussiert, die zwar mit vielfachen Reformen glänzen will, letztlich aber nur eine neue Expertenkultur etabliert hat, die sich um Beobachtung, Standardisierung und Messung bemüht, das tägliche Elend aber schlicht ignoriert. Die Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich allein gelassen und überlastet, beginnend bei den Alltagsproblemen und kaum endend dort, wo sie die großen gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen sollen. So ist denn Inklusion durchaus in den Hintergrund getreten, weil nun doch wieder Integration geleistet werden soll – nämlich für junge Menschen und mit diesen, die als Geflüchtete und Asylbewerber ins Land gekommen sind, zunehmend zerrissen zwischen den Hoffnungen des »Wir schaffen das« und einer Enttäuschung, die dann mit dem schweizerischen »Wir schaffen sie raus« ausgedrückt wird.
Zunehmend lauter und nachdrücklicher wird inzwischen vorgetragen, dass Inklusion sich als Sparprogramm erweist; Medienkommentare stellten sogar eine Verbindung zwischen dem Ausgang der Wahlen 2017 in Nordrhein-Westfalen und der Bildungspolitik der von SPD und Grünen geführten, abgewählten Landesregierung unter der Ministerpräsidentin Kraft her. Hier wurde und wird besonders auf die Inklusionspolitik im Bildungssystem verwiesen. Nicht ganz unproblematisch übrigens. Denn Inklusion wird nun geradezu schuldig gesprochen für ein Desaster, das den ganzen pädagogischen Bereich auszeichnet. Werden so Menschen mit Behinderung unversehens dann doch wieder, wenn nicht erst recht verantwortlich gemacht? Nach dem Motto: Wenn sich nicht alles nun auf Euch richten würde, dann stellte sich das Ganze vielleicht doch noch ein wenig besser dar. Eine marode Infrastruktur, massiver Mangel an pädagogischen Fachkräften, unzureichende Ausbildung reichen schon für sich hin, um einen politischen Wechsel zu wünschen; mit der vergleichsweise rücksichtslosen und wenig erklärten Durchsetzung des Inklusionsprogramms wurde wohl das Maß des bislang geduldig Hingenommenen überschritten. Massive Verärgerung löste aus, dass die bislang als Projekte geförderten und von allen Beteiligten als erfolgreich und gut erlebten integrativen Schulen nun auf das Normalmaß der staatlichen Ausstattung reduziert werden. Weil alle Schulen gefälligst Inklusion zu leisten haben, kann und darf es besondere Unterstützung nicht mehr geben.
Das macht auf eine fatale Logik aufmerksam, die alle Bereiche des pädagogischen Sektors auszeichnet und den Beschwörungen der Bildungsrepublik schlicht Hohn spricht: Wann immer ein Element in diesem Sektor besondere Aufmerksamkeit gewinnt, rutschen andere aus dem Blick. Der Elementarbereich wird zu Lasten der Hilfen für Jugendliche aufgewertet, die doch vorgeblich in Ganztagsschulen betreut werden. Nur: Wirklich durchgesetzt wurden diese dann doch wieder nicht – und wenn, dann oft genug zu Lasten von Aktivitäten und Angeboten, die nicht minder pädagogisch relevant sind. Ganztagsschulen schränken das Interesse an Vereinen ein, und der Freiwilligen Feuerwehr geht der Nachwuchs aus. Dabei ist gar nicht sicher, ob die in befristeten Programmen bereitgestellten Mittel etwa des Bundes dann auch wirklich abgerufen werden. Vom viel und als beispielhaft gelobten Bundesprogramm für die Einrichtungen von Kindergärten und Kitas haben die Kommunen 2017 nach Presseberichten nur ein Viertel der Gelder abgerufen; verständlicherweise vielleicht, weil sie dafür sorgen müssen, dass Fachkräfte in den andernfalls leerstehenden Gebäuden tätig werden. Nur: Wo gibt es die?
Und noch einmal drängt sich der Eindruck auf: Zwar sind in den letzten Monaten zahlreiche Publikationen erschienen, die Inklusion pragmatisch verhandeln, eher im Blick auf die Organisation wenigstens des Schulunterrichts sowie in dem auf Didaktik und Methodik. Insofern scheint eine Art Normalisierung eingetreten, das Geschäft wird selbstverständlich, so dass man über gute oder gar bessere Wege streiten kann. Das hätte etwas Beruhigendes an sich, selbst wenn man als Pessimist vielleicht zum Verdacht tendiert, dass einfach die Luft aus dem Thema heraus ist. Aber: Könnte es sein, dass die Inklusionsthematik mit ihrer Aufmerksamkeit für Menschen mit Behinderung und Krankheit eben doch in Hintergrund gerückt ist, vielleicht für die Frage nach der Integration von Geflüchteten und Flüchtlingen?