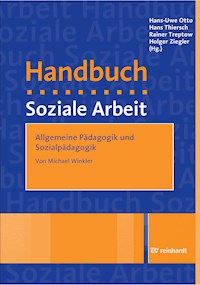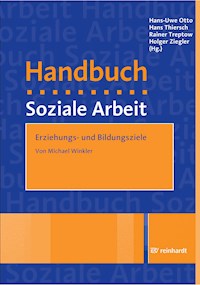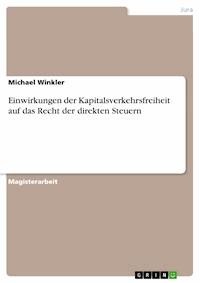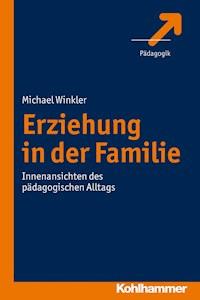
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Erziehung in der Familie ist in der Öffentlichkeit, in Medien und Politik ein heiß diskutiertes Dauerthema. Familienerziehung ist für die einen eine hoch riskante Angelegenheit, der man nicht trauen kann und darf. Die anderen setzen auf Familie als den Ort der Bildung und Erziehung schlechthin. Die Erziehungswissenschaft - so scheint es - hat das Thema den Elternratgebern überlassen. Das Buch stellt die Möglichkeiten, die Leistungen und Funktionen der Familien im Zusammenhang mit Erziehung in den Mittelpunkt. Gefragt wird nach den Stärken familiärer Sozialisation, aber auch nach den Problembereichen im Zusammenspiel der familiären Binnenwelt mit der Außenwelt. Der Behauptung des Werteverfalls, der Rede vom Zerfall der Familien und vom Verlust der elterlichen Erziehungsbereitschaft wird entschieden widersprochen: Familien sind stabil und erbringen pädagogische Leistungen auch jenseits gezielter erzieherischer Beeinflussung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erziehung in der Familie ist in der Öffentlichkeit, in Medien und Politik ein heiß diskutiertes Dauerthema. Familienerziehung ist für die einen eine hoch riskante Angelegenheit, der man nicht trauen kann und darf. Die anderen setzen auf Familie als den Ort der Bildung und Erziehung schlechthin. Die Erziehungswissenschaft - so scheint es - hat das Thema den Elternratgebern überlassen. Das Buch stellt die Möglichkeiten, die Leistungen und Funktionen der Familien im Zusammenhang mit Erziehung in den Mittelpunkt. Gefragt wird nach den Stärken familiärer Sozialisation, aber auch nach den Problembereichen im Zusammenspiel der familiären Binnenwelt mit der Außenwelt. Der Behauptung des Werteverfalls, der Rede vom Zerfall der Familien und vom Verlust der elterlichen Erziehungsbereitschaft wird entschieden widersprochen: Familien sind stabil und erbringen pädagogische Leistungen auch jenseits gezielter erzieherischer Beeinflussung.
Professor Dr. Michael Winkler hat den Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und Theorie der Sozialpädagogik an der Friedrich Schiller-Universität Jena.
Michael Winkler
Erziehung in der Familie
Innenansichten des pädagogischen Alltags
Alle Rechte vorbehalten © 2012 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-021979-3
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022871-9
epub:
978-3-17-027870-7
mobi:
978-3-17-027871-4
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
1 Familie und Familien – Schwierigkeiten mit einer selbstverständlichen Lebensform
Autonomie der familialen Lebenspraxis und Bedeutung der Familiengeschichten
Die sozialisatorische Triade als Modell von Familie
Familie als umgrenzter Ort der Praxis
Sozialisatorische Triade und Familienerziehung
2 Streit über Familie
Familie – die sozialwissenschaftliche Forschungslage
Geschichte der Familie
Befunde
Familie und demographischer Wandel
Familien vs. Kinderlose
3 Was leisten Familien und wie tun sie das?
Familie und Pädagogik – eine kurze Geschichte der fehlenden Familienpädagogik
Familie und Bildung – eine dringend nötige Klärung
Struktur im Prozess – Kontinuität und Wandel im historischen Prozess
Erziehungspraxis als Moderation zwischen sozialer Außenwelt und familiärer Innenwelt
Passagen – Familien regeln Aus- und Übergänge
Erziehung als Zeigen
Sprache, Sprechen und Familienerziehung
Umgangsformen: Verhandlungshaushalt und autoritativer Erziehungsstil
Innerfamiliäre Krisen
4 Familien unter Druck
Familien und Armut
Flüssige Moderne – Erosion von Institutionen und Beschleunigung
Exkurs: Familien mit Migrationshintergrund
Wenn Familie zum Projekt wird – Tücken der Optimierungsideologie
5 Familie und professionelle Erziehung
Ganztagserziehung – Ergänzung oder Ersatz von Familien, Entlastung oder Konkurrenz
Familien und Netzwerke
Bezahlte Elternschaft
Hilfen zur Erziehung
Pflegefamilien, „Scheinfamilien“ in Erziehungshilfen – Professionelle Eltern
Ein pädagogisches Fazit
Literatur
Vorbemerkung
Über Erziehung in der Familie zu reden oder zu schreiben, fällt nicht leicht. Unvermeidlich arbeitet man sich zuerst an den eigenen Erfahrungen und Erinnerungen ab, die man mit Familie und Familien gemacht hat. Distanz stellt sich kaum ein, bei manchen höchstens Bitterkeit. Wer dagegen in professionellen Zusammenhängen mit ambitionierten oder mit scheiternden Familien zu tun hat, wird wenig Positives an dieser Lebensform finden. Denn der Blick richtet sich kaum auf Normalität, die Schatten des Pathologischen sind zu lang und verdunkeln das Gespräch. Endlich sind Zweifel fast epidemisch geworden: War früher Kritik ausgesetzt, wer keine Familie gründete, muss heute mit Einwänden und Vorbehalten rechnen, wer die Angelegenheit angehen will: Die Bedeutung der Familie für das Aufwachsen von Kindern zu betonen, provoziert den Einwand, dass – wenigstens in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften – Familie nur mit Verlusten zu leben ist, dass zudem Kinder meist durch Familienangehörige gefährdet und missbraucht werden. Familie erscheint deshalb als eine riskante Angelegenheit, welche unter Aufsicht gestellt werden sollte. Wenigstens sollten schützende Institutionen und Angebote des Bildungssystems Familien ergänzen, wenn nicht sogar ersetzen, um Kindern eine Selbständigkeit geben, welche in der Familie vorgeblich nicht zu gewinnen sei, da diese mehr oder weniger verborgen autoritäre Strukturen charakterisieren. Dem folgt der Vorbehalt, nach dem Familie als ein Überbleibsel ständischer Verhältnisse darstelle, das Frauen unter das Joch einer Abhängigkeit von Männern zwingt. Für Familie einzutreten gilt demnach als Ausdruck einer familialistischen Tendenz, die Frauen wie Kinder gleichermaßen in untergeordneter Stellung belassen und Gleichheit verhindern will.
Immerhin: In solcher Schärfe werden die Positionen gegenwärtig nicht mehr vertreten. Eher richtet sich der Blick auf ihre Begleiterscheinungen und Nebenfolgen. Denn die Forderung nach Lösung von Frauen und Kindern aus den Zwängen familiärer Hörigkeit gibt eine Selbständigkeit, die als gesellschaftlich, vor allem als rechtlich erzwungene Individualisierung ironischerweise keine Wahlfreiheit eröffnet. Faktisch müssen sich Frauen heute gegen Familie entscheiden, um den eigenen Lebensunterhalt und die eigene Altersversorgung selbst abzusichern. Die in jüngerer Zeit durchgesetzte Neufassung des Sozialstaats macht also schon schwieriger, eine Familie zu gründen und erst recht sie zu verwirklichen. Für den Rückgang der Geburten bildet das einen Grund, dem selbst mit Prämien und Familienförderung nicht beizukommen ist. Junge Frauen wie Männer sehen die Lage realistisch. Sie möchten Familie leben, doch wird ihnen dies verwehrt, auf den mühsamen Wegen der Erwerbstätigkeit fällt am Ende die Entscheidung gegen die Familiengründung.
Angesichts der Befunde, die eine Hochschätzung von Familie ebenso signalisieren wie die Einsicht, dass Familien für das Aufwachsen von Kindern eine entscheidende Rolle spielen, überrascht die fast unheimlich zu nennende Strenge, mit welcher die erziehungswissenschaftliche Forschung über das Geschehen in der Familie urteilt. Nachvollziehen lässt sich, dass pädagogische Professionelle eher zur Skepsis gegenüber der Familie tendieren, weil sie mit Familien in Schwierigkeiten zu tun haben. Gleichwohl überrascht, dass die Kernfrage weitgehend unbeachtet bleibt, die Frage nämlich, wie Erziehung und Bildung im familiären Kontext zu verstehen sind.
Das Buch versucht eine Antwort auf diese Frage. Es ist jedoch mehrfach ungewöhnlich. Zum einen vermeidet es Vereinfachungen, die in vielen Darstellungen von Familie zu finden sind, oft genug aufgrund von Interessenlagen der jeweiligen Autorinnen und Autoren, seien sie eher skeptisch gegenüber Familien oder euphorische Verfechter dieser Lebensform. Daher schlägt das Buch keine eindeutigen Lösungen für Erziehungsfragen vor, wie sie in psychologisch inspirierten Ratgebern anzutreffen sind. Unbefangen nach Einsicht in der Sache zu suchen, fällt aber schwer – abgesehen davon, dass man sich eiliger Zuordnungen erwehren muss. Dennoch bleiben kaum Alternativen zu einem solchen Weg, will man der Frage nachgehen, worin die besonderen Möglichkeiten von Familie als eines pädagogischen Zusammenhangs erst gründen. Deshalb entzieht sich das Buch – zum anderen – dem sozialwissenschaftlichen Mainstream der Familienforschung, um nicht den in diesem transportierten normativen Vorentscheidungen selbst zu verfallen – wie groß übrigens ansonst die Sympathie für Vorstellungen sein mag, die sich gegen Autoritarismen wenden und einer Idee der Emanzipation folgen. Ihr Problem liegt nämlich darin, dass sie die Balance zwischen Individualität und Freiheit einerseits, den sozialen Bindungen und den Verpflichtungen einer wechselseitigen Sorge als Merkmal von Humanität nicht wahren. Das Buch ist endlich ungewöhnlich, weil es einen schwierigen Spagat unternimmt, den pädagogisches Denken aber nicht vermeiden kann. Es versucht, Familienerziehung zu beschreiben, zu analysieren und zu verstehen, als ein stets einmaliges Geschehen, voller Spannungen und Widersprüche, mit Möglichkeiten, die dialektisches Denken verlangen. Dabei gehorcht es dem Rat, Familienforschung interdisziplinär anzulegen, bleibt aber zugleich traditionell, weil es von der Annahme ausgeht, dass eine ausdrücklich pädagogische Perspektive erst den gemeinsamen Fokus für Anfragen an unterschiedliche Disziplinen ermöglicht.
Das dem Buch zugrunde gelegte Konzept einer Autonomie der familiären Lebenspraxis behauptet, dass Familie von den Akteuren selbst ausgestaltet wird, und zwar zuallererst, vor allem legitimerweise. Andere sollen und dürfen sich nur einmischen, wenn sie das gut begründen können. Dieses Konzept stellt also nicht zuletzt den aktuellen bildungs- und sozialpolitischen Zugriff auf Familien in Frage. Kritiker werden diesen Ausgang von der Idee der familiären Lebenspraxis als Ausdruck einer Familienideologie oder als Beleg für einen Familialismus werten. Gegen diesen Vorbehalt sprechen allerdings nicht nur empirische Befunde, die eine Beständigkeit von Familie als Praxis und Idee oder Ideal nahe legen und insofern eine Theorie erzwingen, welche die offensichtliche Funktionalität und Tauglichkeit dieses Lebensmodells belegen. Diese stellen einen erklärungswürdigen Tatbestand dar, dem die Überlegungen nachgehen. Das Buch will Familie verstehen, aber nicht unbedingt für diese als Lebensform plädieren. Solche Entscheidungen müssen die Subjekte schon selbst treffen.
Um der besseren Lesbarkeit willen und zu Gunsten des Umfangs habe ich auf Literaturbelege im eigentlich gebotenen Umfang verzichtet und mich oft auf Hinweise im Text beschränkt; das lässt das Buch gelegentlich apodiktisch oder journalistisch klingen, ließ sich als – zugegeben: schlechter – Kompromiss aber nicht vermeiden. Ich rette mich vor kritischen Vorbehalten, indem ich es als ein Angebot zum Nachdenken bezeichne.
Wichtige Anregungen verdanke ich den Gesprächen mit meinen Jenaer Kollegen, früher mit Ewald Johannes Brunner, in den letzten Jahren vor allem mit Karl Friedrich Bohler und Bruno Hildenbrand, ohne dessen knurrige Hinweise nicht nur auf die französische Familienforschung das Buch hätte kaum entstehen können. Stützen konnte ich mich auf Untersuchungen in Qualifikationsschriften von Anna Dobler, Ines Frießleben und Karolin Martin. Hilfe und Unterstützung bekam ich zudem von Alexander Assmann, Christine Freytag, Steffen Großkopf sowie von Ulf Sauerbrey, zuletzt von Yvonne Semmler – allen sei gesagt: merci beaucoup!
1
Familie und Familien – Schwierigkeiten mit einer selbstverständlichen Lebensform
„Wenn mich niemand darnach fragt, weiß ich es, wenn ich es aber einem, der mich fragt, erklären sollte, weiß ich es nicht.“ Kirchenvater Augustinus hat diese Bemerkung auf die Bestimmung von Zeit gemünzt. Er hätte sie ebenso mit Blick auf die Familie machen können. Denn: dass es Familie gibt und was sie auszeichnet, scheint den meisten völlig selbstverständlich. Manche denken zwar an die eigene Familie mit kritischen Vorbehalten und haben mehr den an Weihnachten fast vorprogrammierten Streit in Erinnerung, nicht wenige verbinden mit ihren Eltern und ihrer Familie traumatische Erinnerungen: Franz Kafka spricht in seinem berühmten Brief an den Vater von der Furcht vor diesem, die so groß ist, dass selbst der 36-Jährige es noch nicht wagt, den Brief abzusenden. Thomas Bernhard konnte an seine Familie nur mit dem Gefühl denken, völlig alleingelassen worden zu sein (allein der Gang in die Schule schien ihm noch schlimmer, dem Weg zum Schafott gleich). Nicht frei von Traumata beschreibt Elias Canetti in Macht und Masse das für den familiären Zusammenhang so wichtige Essen als Machtsituation, in welcher – ganz ungewöhnlich – die Mutter zur dominanten Person wird. In der Literatur, allzumal in der dann gar nicht so schöngeistigen, herrscht ein eher düsteres Bild der Eltern-Kindbeziehungen vor. Noch dunkler stimmt die Berichterstattung der Tagespresse; an einem beliebig gewählten Tag erscheinen dann auf nur einer Seite drei ausführliche Berichte über die dunkelsten Seiten menschlichen Lebens, die allesamt mit Familie verbunden sind: „‚Signal an Gesellschaft‘. Winnenden: Gericht verurteilt Vater des Amokläufers“, „Acht Kinder mit der Stieftochter gezeugt? Rheinland-Pfälzer soll junge Frau missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben“ und „Eigene Mutter mit Hammer erschlagen. Ex-Jura-Student muss für Mord an seinen Eltern in Haft“.
Doch die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen sieht ihre Familie als wichtigen und harmonischen Lebenszusammenhang. Vor allem junge Erwachsene haben überwiegend guten Kontakt zu ihren Eltern und wünschen sich regelmäßig, eine eigene Familie zu gründen. Die jüngste Shell-Studie sowie Erhebungen zur Situation von Studierenden halten eine stetig wachsende Neigung zur Ehe fest, die als Wunsch nach Sicherheit in einer unsicheren Welt interpretiert wird. Familiengründung liegt dann nahe. „Selbst wenn es heute vielleicht nicht mehr zuvorderst wichtig erscheint, ob es sich dabei um Konstruktionen des Living apart together, um Ein-Eltern- oder Zwei-Eltern- um Stiefeltern- oder Fortsetzungsfamilien handelt, ob Kinder von verheirateten oder unverheirateten Partner, vom leiblichen Vater oder vom aktuellen Lebensabschnittspartner der Mutter großgezogen werden, spielen Kinder innerhalb der Wertedimension jedenfalls eine ausgesprochen wichtige Rolle“ (Fritsche 2000, S. 104 f.). Gegenüber einer in den öffentlichen und wissenschaftlichen Debatten sowie unter Professionellen der Pädagogik verbreiteten Skepsis gegenüber Familie bekennen sich die meisten jungen Menschen zu einem überwiegend positiven Familienbild. Sie erinnern sich gerne an Unterstützung durch ihre Eltern, bei denen sie zuerst Rat holen und die sie ihrerseits kaum im Stich lassen würden. Auch wenn die Belletristik eine Vorstellung von urban family entwirft, in der weniger Verwandte und mehr Freunde die Lebenssituation bestimmen, also gegen Jane Austens Pride and Prejudice Fieldings Bridget Jones stellt, verbindet die Mehrheit mit Familie ziemlich klare und begrenzte Vorstellungen: Dass es um Bindungen, um Sicherheit, um Vertrauen und Verpflichtungen geht, welchen man sich nicht entziehen kann, die man aber selbst kaum preisgeben möchte. Obwohl die meisten wissen, dass Familien sich häufig auflösen, lässt sich ebenso wenig übersehen, wie nach Trennung und Scheidung doch wieder Familien gegründet werden. Als eine andere, eine neue Familie, aber eben doch als Familie.
Was also macht Familie aus? Ein Mythos, dem man nicht vertrauen darf? Die Aura eines schwierigen Zusammenlebens? So recht weiß das niemand, doch geht es wohl um mehr als um eine bloße Wohngemeinschaft oder Lebensgemeinschaft von Eltern und Kindern mit mehr oder weniger kurzem Verfallsdatum. So haben viele in den letzten Jahrzehnten zwar schon das Totenglöckchen für die Familie geläutet; vom Ende der Familie war die Rede, vorsichtiger nahmen andere „Abschied von der Normalfamilie“ (Herlth/Brunner/Tyrell/Kriz 1994). Dennoch setzt sich in jüngerer Zeit eine irritierende Einsicht durch. Tilman Allert hat für sie das Wort von der „Familie als unverwüstliche Lebensform“ geprägt (Allert 1998). Zwar verliert Familie in der gesellschaftlichen Modernisierung „an Bedeutung für die Generationenbeziehungen“ (Leisering 1992, S. 43), doch der Krieg zwischen den Generationen fällt in den Familien aus. Allerts Einsicht in die Unverwüstlichkeit, mit der sich eine Lebensform erhält und bewährt, die von den Beteiligten als Familie bezeichnet, verstanden und einigermaßen ungeniert gelebt wird, findet in wachsendem Maße Zustimmung (jedoch weniger unter Vertretern der Sozialwissenschaften, wohl aber bei Historikern und Kennern der fiktionalen Literatur). Unverwüstlichkeit stellt sich allerdings als paradoxe Normalität dar, nämlich als Normalität, die wieder ganz eigenartig, ganz anders ist. „Familienmenschen“ reagieren entsprechend einsilbig: Wir sind halt eine Familie. Und mit Augustinus würden sie bemerken: Wir können nicht erklären, was wir da tun und wie wir Familie leben; aber uns selbst ist das schon klar.
Vermutlich lässt sich gar nicht mit Sicherheit bestimmen, was jeweils als Familie gelten kann und soll. Selbst der Gesetzgeber hadert mit entsprechenden Festlegungen und muss regelmäßig nachjustieren, um aufzunehmen, was und wie Gesellschaften und Kulturen in Sachen Familien denken. Man tut daher gut daran, erst einmal gelten zu lassen, was die Beteiligten für sich selbst als Familie, vor allem was sie als ihre Familie verstehen. Familie ist mithin ein sozialer Zusammenhang, der von den Beteiligten als solcher begriffen und ergriffen, gegenüber anderen Zusammenhängen als besonderer und eigener verteidigt wird. Familien bestehen dann, wenn die an einer Familie Beteiligten ihre Praxis als Familie gestalten und eine Vorstellung von Familie, von ihrer Familie haben; auf den ersten Blick wird man Familie und Haushalt verbinden, doch zählen oft andere Personen, Großeltern etwa, zur Familie, die einen eigenen Haushalt führen. Fehlt eine solche Selbstdeutung als Familie, mögen zwar verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, die jedoch nicht als Familie gelebt werden. Oder mehr noch: Familie ist offensichtlich das, was die Beteiligten als ihre Familie behaupten und in lebendiger Praxis gestalten – oder in manchen Fällen vermeiden, weil sie im Wissen um ihre Familie mit dieser eben gerade nichts zu tun haben wollen. Zuweilen begegnen wir sogar Menschen, die Kinder haben, sich mit diesen aber nicht in einer Familie gebunden sehen, da sie Familie als Trauma erlebt haben.
Es gab immer schon, in der jüngeren Vergangenheit ebenso wie in früheren Jahrhunderten, eine Vielzahl von Formen, in welchen die Praxis der Familie gelebt wird. Nach dem zweiten Weltkrieg verbreiteten sich sogenannte Onkelehen. Waren Lebenspartner verschollen, entstanden neue Familien. Gewachsen ist heute die Toleranz gegenüber der Formenvielfalt von Familien. Neben dem Modell der klassischen Kernfamilie begegnen verkleinerte Formen des familialen Zusammenlebens, etwa solche mit allein erziehenden Eltern; meist handelt es sich um Kinder, die mit ihrer Mutter, seltener mit ihrem Vater in einem Haushalt zusammen leben. Zunehmend finden sich homosexuelle Paare, die mit ihren Kindern erfolgreich gelingende Familien leben. Neue Formen von Familie entstehen im Zusammenhang der Reproduktionsmedizin, wenn Leihmütter in Anspruch genommen werden oder auf anonyme Samengeber zurückgegriffen wird. Die Reproduktionsmedizin belegt das hohe Interesse an Familiengründung (und zudem, wie heute gegebene Lebensbedingungen aversiv wirken, wenn Umweltbelastungen die Zeugungsfähigkeit einschränken). Dann begegnen erweiterte Familien, entweder weil – eher traditionell – Großeltern oder andere Verwandte im Haushalt leben oder die erwachsenen Kinder Partner wählen, die ihrerseits Kinder aus einer früheren Beziehung mitbringen. Hinzu kommen – moderner – Folgefamilien, die nach Trennungen entstehen, Patchworkfamilien, bei welchen Partner mit Kindern eine neue Familie gründen und so völlig eigenartige Konstellationen schaffen: Das – so eine Pressemeldung zu den Absichten des amtierenden französischen Präsidenten – jüngste eigene Kind kommt dann nach dem ersten eigenen Enkel auf die Welt. Die Liste der Möglichkeiten lässt sich kaum abschließen, moderne Gesellschaften erlauben viele Beziehungen.
Autonomie der familialen Lebenspraxis und Bedeutung der Familiengeschichten
Diese Vielfalt verlangt, Familie als eine von den Akteuren selbst gestaltete soziale Wirklichkeit zu fassen. Insbesondere erweiterte oder Folgefamilien nach Trennung und Wiederverheiratung legen nahe, Blutsverwandtschaft als nur bedingt relevant zu werten, obwohl die biologische Herkunft starke Bedeutung hat: Adoptiv- und Pflegekinder fragen regelmäßig nach ihren wirklichen Eltern, obwohl sie psychologische und soziale Eltern als die eigentlichen Eltern schätzen. Fachlich spricht man deshalb von der Autonomie der familialen Lebensform oder Lebensführung (vgl. Mount 1982). Damit ist nicht gemeint, dass Familie unabhängig von sozialen und kulturellen Bedingungen, völlig selbstbestimmt und frei gestaltet wird. Aber Familien regeln ihr Leben weitgehend selbst und ganz eigentümlich (wie sehr sie dabei Mustern folgen, die sie in einer Gesellschaft und einer Kultur vorfinden). Vor allem warnt der Begriff einer Autonomie der familiären Lebenspraxis vor pathologisierenden Urteilen. Juristen und Sozialarbeiter, Lehrer tendieren dazu, vor dem Hintergrund ihrer Herkunft aus der Mittelschicht sowie aufgrund ihres Arbeitsauftrages, professionell soziale und kulturelle Normen durchzusetzen. Sie blicken kritisch auf Lebensverhältnisse, die sie für risikobehaftet halten. Doch sie müssen im Blick auf die entscheidenden pädagogischen Funktionen des Familienlebens lernen, sogar Praktiken zu akzeptieren, die ihnen als seltsam oder gar als abweichend erscheinen. Fachlichkeit verlangt, sich davor zu hüten, den einen oder den anderen Entwurf familialen Lebens zu diskriminieren oder gar verbieten zu wollen. Sie müssen aufpassen, nicht bestimmte Formen familialen Lebens zu prämieren, während sie andere diskreditieren.
Als Familie zu fassen, was die Beteiligten als Familie, als ihre Familie verstehen, verweist übrigens auf ein erstes und sogar zentrales pädagogisches Element. In diesem praktischen, oft gegenüber anderen betonten Selbstverständnis entsteht nämlich ein Gefühl der Zugehörigkeit, des „Wir“. Aus diesem „Wir“ erwachsen das Gefühl des Angenommenseins und einer Anerkennung, zugleich Verbindlichkeiten für die Kinder und Jugendlichen in einer Familie. Verbindlichkeiten, die protopädagogisch, als Erziehung vor aller Erziehung wirken, weil alle Beteiligten auf sie verweisen: Eltern sagen: Wir machen das nicht, Kinder folgen dem, verpflichten umgekehrt ihre Eltern ebenfalls auf Gemeinsamkeit. So entstehen in einem Medium praktischer Gemeinschaft Regeln, die heute zunehmend ausgesprochen und ins Bewusstsein gehoben werden müssen. Sie gelten nämlich nicht mehr selbstverständlich, weil andere, äußere, durch Medien vermittelte Einflüsse auf Familien stärkere Kraft gewinnen.
Dass Familie ist, was die Beteiligten als Familie verstehen, lässt ein zweites pädagogisches Moment erkennen. Sowohl das Bild von Familie wie das, was Familie für die Einzelne und den Einzelnen bedeutet, berichten diese in ihren Familiengeschichten. Diese stiften Zugehörigkeit und Identität. Erzählte Familiengeschichten stellen nicht nur einen Traditionszusammenhang über die zur Familie gehörenden Generationen her, markieren Verwandte, Zugehörige und Fremde. Sie legen fest, wer als zur Familie gehörend angesehen wird. Denn meist ist mit den Personen eine ganz eigene Erzählung verbunden. Kinder sind dabei unbefangen und rechnen zu ihrer Familie nicht nur Haustiere, sondern Freunde ihrer Eltern und entfernte Verwandte, die gar nicht im gleichen Haushalt leben. Familiengeschichten erzeugen eine zeitliche Rahmung und Ordnung, die Kindern und Erwachsenen Orientierung geben. Obwohl nur erzählt, also fiktional, schaffen sie ein Milieu, eine Welt der Symbole und Zusammenhänge, die den Akteuren einen Platz in der Welt und eine sinnhafte Deutung ihrer Kultur sowie eine Grammatik des Verstehens und Handelns vermitteln. Im Medium der Familiengeschichten gewinnen die Beteiligten ihre – in jeder Hinsicht des Ausdrucks – Weltzuständigkeit, ihre Kompetenz. Dabei haben wir mit einer Mischung aus objektiver oder wenigstens objektivierter Erfahrung und subjektiver Erinnerung zu tun, die sich nicht nach harten Kriterien fassen lässt; für die Kinder scheint wichtig, wenn Großeltern oder Eltern einen Eindruck von Alltagswelten erzählen, den sie dann selbst in ihren Vorstellungen weiter entwickeln. Faktisch reproduzieren sich jedoch über Familienerzählungen kollektiv relevante Mentalitäten. So rufen erzählte Erinnerungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs selbst bei deutlich später geborenen Kindern Einstellungen und Haltungen hervor, welche für die Kriegsgeneration maßgebend waren.
Wenn die Beteiligten ihre Familie als Familie bezeichnen, greifen sie wie selbstverständlich auf Vorstellungen und Konzepte zurück, die ihnen vertraut sind und in die sie einsozialisiert wurden, weil sie sie im Zusammenhang sozialer und kultureller Kommunikation erfahren haben. Keineswegs erneuern sie jedoch blind die erlebten Muster familiärer Praxis, schon die Geschichten werden modifiziert, erst recht die mit ihnen sinnhaft verknüpften Praktiken. Manchmal leben die Familiengeschichten nur noch in ironisierter Form weiter. Jede Familie hat jedenfalls ihre Geschichten – und wenn Kinder gut und geborgen aufwachsen, werden sie diese Erzählungen aufnehmen und weiter erzählen, selbst wenn sie bei den erzählten Ereignissen gar nicht dabei waren. Sie wissen, wie es ihrer Oma und ihrem Opa im Krieg erging, obwohl sie die wirkliche Not nicht einmal ahnen. Das bedeutet allerdings, dass alle Arbeit mit Familien auf solche Erzählungen hören und diese anerkennen muss – umgekehrt wird sie aufmerken, wenn es solche Familiengeschichten und ein Familiengedächtnis nicht gibt. Dies weist auf fehlende Integration hin, indiziert zudem, dass Mechanismen der Tradition und der symbolischen Einbettung von Kindern nicht funktionieren und normativ tragen.
Familie und das Familienverständnis der Beteiligten sind – hochtrabend formuliert – Narrative, sie bestehen in den Erzählungen der Akteure von ihrer Familie, über diese und darüber, welche Bedeutung sie für sie hat. Deshalb hat Familie einen ganz eigenen, nämlich symbolisch vermittelten Stellenwert gegenüber anderen Räumen und Orten der Sozialisation. Das relativiert Überlegungen, nach welchen moderne, plurale Gesellschaften eine „pluralistischen Sozialisation“ verlangen, die in der Familie nicht mehr als „Gesamtsozialisation zu steuern“ sei (Giesecke 1990, S. 224). In der Tat sehen Kinder die einst vorrangigen Lebenszusammenhänge lockerer, verpflichten sich stärker ihren weiteren Handlungsfeldern. Dennoch bleibt Familienzugehörigkeit durch Familiengeschichten gebunden, zumal diese über ihre fiktionale Qualität hinaus häufig einen realen Grund in der Tatsache des Familienbetriebs haben. Die Literatur über Familie ignoriert diese übrigens weitgehend, obwohl die Übernahme des elterlichen Betriebes für das Familienbild eine hohe Bedeutung hat.
Familiengeschichten klingen gelegentlich ein wenig irre: Familien rechnen nicht bloß ihre Haustiere, sondern das Familienauto zu ihrer Geschichte hinzu: Damals, wie wir alle im Käfer über den Brenner gefahren sind, erzählen sie den Enkeln von den ersten Familienurlauben. Vermutlich klingen archaische Muster der Organisation von Alltagskultur nach, wenn die Familienwelt so weit über die beteiligten Personen hinausreicht und Dinge umfasst, die eine symbolische Bedeutung haben. Diese Erzählungen stützen und stabilisieren jedoch den sozialisatorischen und erzieherischen Prozess – wie jene für den Außenstehenden bizarr anmutenden, an Altäre erinnernden Bilder von abwesenden oder gestorbenen Personen, die das Familiengedächtnis weiter tragen und eine normativ verbindliche Funktion für die Kinder haben. Abwesende Personen werden symbolisch vergegenwärtigt und bleiben als Instanz der Anrufung aktiv. Zugleich aber können solche Symbole und die mit ihnen verbundenen Regeln Entwicklungen blockieren und die Beteiligten an psychopathogene Zustände heranführen. Manche Familien können nichts wegwerfen und ersticken fast im Müll der Gegenstände und Vorstellungen – Kinder werden so nachhaltig chaotisiert. Überraschenderweise verlieren diese Familien ihre Orientierung, wenn von außen ein ordnender Eingriff erfolgt. Praktisch bedeutet dies jedenfalls: Familien müssen geradezu ethnographisch verstanden werden, man muss sie aufsuchen und besuchen wie einen fremden Stamm, sich auf ihre Erzählungen und die damit gebundenen Regeln ihrer Weltwahrnehmung einlassen, ehe man Veränderungen in Gang setzen kann.
Allerdings: Auch wenn man Familie als einen Zusammenhang verstehen will und muss, der durch die Akteure selbst geschaffen und durch Geschichten verbunden wird, auch wenn Familien davon abhängen, dass sie über eine Erzählung verfügen, ist es nicht ganz beliebig, was nun als Familie verstanden und begriffen wird – und zwar im Konkreten wie im Allgemeinen. Konkretwerden Familiengeschichten von den Beteiligten als ein Skript verstanden, das über Generationen getragen wird, wie Genogrammanalysen zeigen. Abstrakt und grundsätzlich bestehen Unterschiede zu anderen Lebensformen, die sich nicht einebnen lassen, allzumal in pädagogischer Hinsicht. So scheitert das Experiment der Kibbuzerziehung, das auf kollektive Erziehung setzt und den Kontakt zu den eigenen, leiblichen Eltern nur eingeschränkt erlaubt. Offensichtlich verfügt Familie über eine eigene Qualität, die vor dem historischen Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse und der so bedingten Veränderung familialen Lebens liegt: Schon die allerfrühesten Dokumente menschlicher Existenz weisen nämlich auf einen – vorsichtig formuliert – engen Zusammenhang zwischen großen und kleinen Personen hin. Es gibt die Konstanz einer anthropologischen Struktur. In dieser Struktur wirkt eine natürliche Dimension nach, weil Familie offensichtlich konstituiert wird, um biologische Wandlungsprozesse sozial einzubetten. Man könnte also sagen: Die soziale Struktur der Familie wurde evolutionär erfunden und verstetigt, um die Risiken zu mindern, welche mit den für Menschen typischen natürlichen und biologischen Veränderungen einhergehen. Familie bewältigt also die Problematik einer besonderen Schutz- und Unterstützungsbedürftigkeit bei jungen Lebewesen der Gattung Mensch sowie eine ähnliche Problemlage bei den älteren Mitgliedern der Gattung; sie ermöglicht als soziale Einrichtung das physische Überleben, so dass für sie das Wort von der „kulturellen Zwischenwelt“ zutrifft, wie sie zwischen Naturbedingungen und sozialem Leben eingebaut ist (Eibl 2009); möglicherweise geht sie eng mit der Sesshaftigkeit von Menschen einher (vgl. Reichholf 2010). Neurophysiologische Befunde zeigen zudem, wie die Mechanismen der Sorge in den vergleichsweise alten Regionen des Gehirns verankert sind, ergänzt durch die Spiegelneuronen, die dann einen evolutionären Vorteil bieten.
Wenngleich dies den Einwand provoziert, familialistisch zu argumentieren, also Familie als einen natürlich gegebenen Sachverhalt zu ideologisieren, muss man festhalten: Familie ist kein fundamental gesellschaftlicher Tatbestand, doch können die konkreten, wirklichen Praktiken familiären Lebens nicht jenseits von sozialen Bestimmungen erkannt werden; rechtliche Regelungen umgeben sie beispielsweise. Dennoch hilft die Einsicht in die in der Familie eingeschlossene biologische Dimension, Leistungen und Aufgaben von Familien zu verstehen und zu regeln. Dies führt zu einem paradoxen Befund: Familie vollzieht sich zwar in der Autonomie der familiären Lebenspraxis und zugleich als Realisierung eines Modells, das man geradezu dinghaft darstellen kann, als eine Natur, die doch Gesellschaft geworden ist – und in Wirklichkeit ein genuin pädagogischer Sachverhalt ist. Es gibt sozusagen eine Grundstruktur von Familie, eine – um es noch verrückter zu formulieren – objektive Sachstruktur von Möglichkeiten, die mit einiger Verbindlichkeit auftritt und doch eine Vielzahl von Formen annehmen kann, weil sie von den Akteuren ganz unterschiedlich realisiert und erzählt wird, in Abhängigkeit von historisch entstandenen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen.
Die sozialisatorische Triade als Modell von Familie
Wer sich mit Familie befasst, greift häufig auf die Vorstellung vom Familiensystem zurück. Sie hebt den Zusammenhang aller objektiv beteiligten und subjektiv hinzugerechneten Mitglieder (und insofern Elemente) einer Familie hervor. System meint, wie sie so in einer Struktur verbunden sind, dass Geschehnisse und Handlungen sowohl jeden einzelnen wie das Gesamte berühren. Familie als System agiert dann in einem verfestigten Gefüge und in einem Rhythmus, aus dem keiner ausbrechen kann, der aber durch Einflussnahme von außen und durch Umstellung der Positionen von Beteiligten zueinander neu geordnet werden kann. Systemische Therapie nutzt dies. Um die pädagogischen Interaktionen und vor allem die sozialisatorischen Prozesse in der Familie zu verstehen, greift man jedoch besser auf das Arbeitsmodell der sozialisatorischen Triade zurück, wie sie Paarbeziehung und Filiationsbeziehung miteinander bilden: Die Paarbeziehung entsteht zwischen zwei erwachsenen Menschen. Als Filiationsbeziehung bezeichnet man das Eltern-Kind-Verhältnis, mithin Gemeinsamkeit und Differenz der unmittelbar aufeinander folgenden Generationen. Die Paarbeziehung konstituiert sich weitgehend frei, als ein erotisch geprägter Zusammenhang, der auf Zuneigung beruht. Historisch dominieren zwar Rationalitätsmuster, welche auf ökonomische Zusammenhänge, den Erhalt des (familiären) Betriebes abheben, in welchem der künftige Lebenspartner eine tragende Funktion erfüllt. Erst in der Moderne wirkt sich der Code der Liebe aus, stiften Affekte die Paarbeziehung. Doch bleibt letztlich ziemlich rätselhaft, was Menschen dazu bringt, eine auf Dauer angelegte Beziehung einzugehen, die zudem in ihrem Aufeinanderbezogensein und ihrer Intimität mittelbar wieder gesprengt wird; die in die Familie mündende Beziehung hat nämlich eine tragische Dimension, welche das Geschehen überschattet: Die Filiationsbeziehung entsteht in einem Akt, über den man moralphilosophisch streiten könnte. Wieviel Lust beteiligt war, die Kinder sind jedenfalls nicht gefragt worden, ob sie überhaupt gezeugt werden möchten. Immerhin rächen sie sich. Nachwuchs beschert ein bitteres Aus für die traute Zweisamkeit; Familie sprengt erst die Paarbeziehung, verlassen die Kinder ihre Familie, verstören sie ihren Herkunftszusammenhang. Zurück bleiben Eltern, im empty nest finden sie kaum mehr zur Innigkeit der Paarbeziehung.
Das Modell der sozialisatorischen Triade geht auf den Anthropologen Lévy-Strauss und den Soziologen Talcott Parsons zurück, der als Vertreter einer funktionalistischen Theorie der Familie gilt. Zudem spielen neben der Grundannahme des Inzesttabus Einsichten der Psychoanalyse eine wichtige Rolle, insbesondere das Verständnis des ödipalen Konflikts. Die Erklärungsstärke der sozialisatorischen Triade für Zusammenhang und Funktion der Familie, dann vor allem für das Aufwachsen von Kindern und deren Erziehung ergibt sich aus der damit gegebenen Nichtlinearität und Nichtkausalität der Beziehungen. Familie wird so als ein Spannungsfeld verständlich, das von Gemeinsamkeit ebenso bestimmt wird wie von regelmäßigen Ausschließungen: Schon die Eltern bilden eine länger bestehende Paarbeziehung, deren Integrität sie gegen das gleichsam eindringende Kind verteidigen müssen. Nach der Geburt eines Kindes etwa fühlen sich Väter aus dem Bündnis zwischen Mutter und Baby ausgeschlossen, später entstehen die komplizierten Geflechte, wie sie Freud als Ödipuskonflikt beschrieben hat. Umgekehrt nimmt das Kind sein Elternpaar als eine Allianz wahr, gegen die es sich behaupten muss. Spätestens in der Pubertät tendiert es im Konfliktfall dazu, seine Eltern gemeinsam in Haftung zu ziehen. Ihr wollt beide nicht, dass ich das mache. Tatsächlich aber sind die Verhältnisse noch etwas komplizierter. Denn in der Tat halten Eltern zusammen, ein zu großer Unterschied zwischen den von ihnen gewählten Formen des Umgangs mit den Kindern führt diese in massive Verwirrung, erlaubt ihnen später vor allem, Eltern gegeneinander auszuspielen. Im schlimmsten Fall etwa der Trennung entstehen enge Verbindungen zwischen den einzelnen Erwachsenen und einzelnen Kindern, die ihrerseits im Krieg der Eltern instrumentalisiert werden. Andererseits erlaubt gerade die Differenz zwischen den Eltern, dass diese gewissermaßen gemeinsam in ihrer Unterschiedlichkeit den für das gute Aufwachsen von Kindern mittleren Weg des Umgangs gehen. In der Mikrodynamik und Alltäglichkeit des Familienlebens balancieren sich dann Strenge und Milde, hinweisende Führung und nachgehendes Wachsenlassen aus, zugleich machen die Kinder die Erfahrung von einem Dissens, der doch nicht zum Bruch führt. Sie merken jedoch, wenn Konflikte zwischen den Eltern zu stark und insofern zur Bedrohung für die familiäre Lebenspraxis werden. Größer geworden, intervenieren sie: hört auf zu streiten!
Die beiden Grundbeziehungen, das Paarverhältnis und das Eltern-Kind-Verhältnis, also eine Generationenbeziehung, könnte man spöttisch das Kreuz der Familie nennen, an dem der familiäre Interaktionszusammenhang hängt. Beide Beziehungen sind spannungsreich gekoppelt. Denn: die Paarbeziehung ist erotisch bestimmt, Eltern halten zusammen – nicht selten bewahren sie deshalb das Geheimnis ihrer Sexualität und somit der Zeugung. Sie vermeiden die Auskunft, wie ihre Kinder lustvoll entstanden sind – umgekehrt wollen Jugendliche das gar nicht so recht wissen. Eigentlich ist also das Kind von der Paarbeziehung ausgeschlossen, es teilt nicht die Erinnerungen und Erfahrungen seiner Eltern. Kinder, erst recht Jugendliche bewältigen diese Ausschließung, indem sie Eltern für ein wenig seltsam und fast wunderlich halten, für überholt zumindest. Mehr noch: die Filiationsbeziehung steht für eine innere Schranke, nämlich für die Grenze zwischen den Generationen, die in einem universellen Mechanismus mit dem Inzesttabu bewehrt wird. Dass das Tabu sozial und kulturell etabliert wird, weist jedoch darauf hin, dass die Generationenschranke nicht biologisch interpretiert werden darf – in der klinischen und therapeutischen Praxis beobachtet man, wie bei Zerbrechen der Paarbeziehung zwischen dem verbleibenden Elternteil und dem Kind ein enges Verhältnis entstehen kann. Eine Dyade, die den jungen Menschen an den Erwachsenen fesselt, so dass ihm schwerfällt, sich zu distanzieren und selbst erwachsen zu werden (vgl. Stierlin 1978, 1980). Zugleich sind Eltern und Kinder unbedingt aufeinander angewiesen und insofern miteinander verknüpft. Die Filiationsbeziehung zeigt sich als Abhängigkeit. Dennoch eröffnet die Beziehung des Kindes auf die sowohl in der Paarbeziehung gebundenen (insofern gegenüber dem Kind gleichsam feindlichen) sowie durch die Geschlechterdifferenz unterschiedenen und insofern getrennten Eltern ein ungewöhnliches Ausmaß an Verselbständigungsmöglichkeiten. Das Kind erlebt Schutz und Fürsorge der Eltern, erfährt sich in Abhängigkeit, fast unterworfen. Den Zwang zur Identifikation mit den Eltern bricht aber, dass es sich durch den Bezug auf seine Eltern mit differenten Geschlechtern auseinander setzt. Darin liegt zwar ein Konfliktpotential, zugleich eröffnet sich die Chance zur Verselbständigung und Autonomie in einem Prozess, bei dem die Übernahme der Geschlechteridentität selbst zur Auseinandersetzung mit dem jeweils anderen Geschlecht und der Elternfigur führt.
Die enge Beziehung von Eltern und Kindern ist konstitutiv für das gute Aufwachsen von jungen Menschen. Mit Ausnahme der Homosexuellen-Beziehung und der Pflegeelternschaft, also der bloß psychologischen Elternschaft entsteht nämlich aus dem Zusammenhang von biologischen und sozialen Funktionen der Erfahrungsbefund einer Nicht-Austauschbarkeit der beteiligten Personen. Die Beteiligten wissen, dass sie lebenslang miteinander