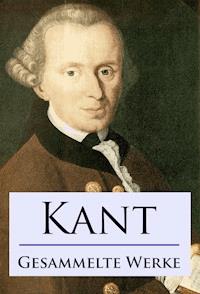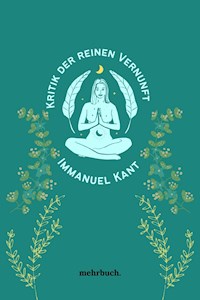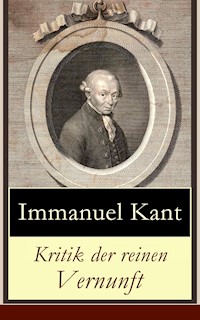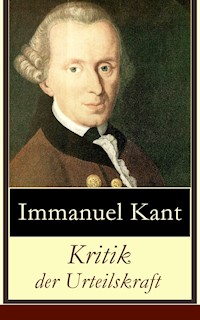
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Kritik der Urteilskraft" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfŠltig korrekturgelesen. Die Kritik der Urteilskraft (KdU) ist Immanuel Kants drittes Hauptwerk nach der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft, erschienen 1790. Sie enthält in einem ersten Teil Kants Ästhetik (Lehre vom ästhetischen Urteil) und im zweiten Teil die Teleologie (Lehre von der Auslegung der Natur mittels Zweckkategorien). Die dritte Kritik ist mit den zwei vorhergehenden Werken der Vernunftkritik eng verbunden. Für Kant zerfiel die Philosophie danach zunächst in zwei Bereiche: einen theoretischen (der reinen Vernunft) und einen praktischen (Ethik, Rechts- und Religionsphilosophie). Mit der dritten Kritik soll nicht nur zwischen Natur und Freiheit vermittelt werden, sondern sie versucht auch Phänomene wie das Schöne in Natur und Kunst, das Genie, das Organische und die systematische Einheit der Natur mit Hilfe eines Konzepts der Urteilskraft zu klären. Immanuel Kant (1724 - 1804) war ein deutscher Philosoph der Aufklärung. Kant zählt zu den bedeutendsten Vertretern der abendländischen Philosophie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kritik der Urteilskraft
Inhaltsverzeichnis
Vorrede zur ersten Auflage, 1790
Man kann das Vermögen der Erkenntnis aus Prinzipien a priori die reine Vernunft, und die Untersuchung der Möglichkeit und Grenzen derselben überhaupt die Kritik der reinen Vernunft nennen: ob man gleich unter diesem Vermögen nur die Vernunft in ihrem theoretischen Gebrauche versteht, wie es auch in dem ersten Werke unter jener Benennung geschehen ist, ohne noch ihr Vermögen, als praktische Vernunft, nach ihren besonderen Prinzipien in Untersuchung ziehen zu wollen. Jene geht alsdann bloß auf unser Vermögen, Dinge a priori zu erkennen; und beschäftigt sich also nur mit dem Erkenntnisvermögen, mit Ausschließung des Gefühls der Lust und Unlust und des Begehrungsvermögens; und unter den Erkenntnisvermögen mit dem Verstande nach seinen Prinzipien a priori, mit Ausschließung der Urteilskraft und der Vernunft (als zum theoretischen Erkenntnis gleichfalls gehöriger Vermögen), weil es sich in dem Fortgange findet, daß kein anderes Erkenntnisvermögen, als der Verstand, konstitutive Erkenntnisprinzipien a priori an die Hand geben kann. Die Kritik also, welche sie insgesamt, nach dem Anteile den jedes der anderen an dem baren Besitz der Erkenntnis aus eigener Wurzel zu haben vorgeben möchte, sichtet, läßt nichts übrig, als was der Verstand a priori als Gesetz für die Natur, als den Inbegriff von Erscheinungen (deren Form eben sowohl a priori gegeben ist), vorschreibt; verweiset aber alle andere reine Begriffe unter die Ideen, die für unser theoretisches Erkenntnisvermögen überschwenglich, dabei aber doch nicht etwa unnütz oder entbehrlich sind, sondern als regulative Prinzipien dienen: teils die besorglichen Anmaßungen des Verstandes, als ob er (indem er a priori die Bedingungen der Möglichkeit aller Dinge, die er erkennen kann, anzugeben vermag) dadurch auch die Möglichkeit aller Dinge überhaupt in diesen Grenzen beschlossen habe, zurückzuhalten, teils um ihn selbst in der Betrachtung der Natur nach einem Prinzip der Vollständigkeit, wiewohl er sie nie erreichen kann, zu leiten, und dadurch die Endabsicht alles Erkenntnisses zu befördern.
Es war also eigentlich der Verstand, der sein eigenes Gebiet und zwar im Erkenntnisvermögen hat, sofern er konstitutive Erkenntnisprinzipien a priori enthält, welcher durch die im allgemeinen so benannte Kritik der reinen Vernunft gegen alle übrige Kompetenten in sicheren alleinigen Besitz gesetzt werden sollte. Eben so ist der Vernunft, welche nirgend als lediglich in Ansehung des Begehrungsvermögens konstitutive Prinzipien a priori enthält, in der Kritik der praktischen Vernunft ihr Besitz angewiesen worden.
Ob nun die Urteilskraft, die in der Ordnung unserer Erkenntnisvermögen zwischen dem Verstande und der Vernunft ein Mittelglied ausmacht, auch für sich Prinzipien a priori habe; ob diese konstitutiv oder bloß regulativ sind (und also kein eigenes Gebiet beweisen), und ob sie dem Gefühle der Lust und Unlust, als dem Mittelgliede zwischen dem Erkenntnisvermögen und Begehrungsvermögen (eben so wie der Verstand dem ersteren, die Vernunft aber dem letzteren a priori Gesetze vorschreibend), a priori die Regel gebe: das ist es, womit sich gegenwärtige Kritik der Urteilskraft beschäftigt.
Eine Kritik der reinen Vernunft, d. i. unseres Vermögens nach Prinzipien a priori zu urteilen, würde unvollständig sein, wenn die der Urteilskraft, welche für sich als Erkenntnisvermögen darauf auch Anspruch macht, nicht als ein besonderer Teil derselben abgehandelt würde; obgleich ihre Prinzipien in einem System der reinen Philosophie keinen besonderen Teil zwischen der theoretischen und praktischen ausmachen dürfen, sondern im Notfalle jedem von beiden gelegentlich angeschlossen werden können. Denn, wenn ein solches System unter dem allgemeinen Namen der Metaphysik einmal zustande kommen soll (welches ganz vollständig zu bewerkstelligen, möglich, und für den Gebrauch der Vernunft in aller Beziehung höchst wichtig ist): so muß die Kritik den Boden zu diesem Gebäude vorher so tief, als die erste Grundlage des Vermögens von der Erfahrung unabhängiger Prinzipien liegt, erforscht haben, damit es nicht an irgendeinem Teile sinke, welches den Einsturz des Ganzen unvermeidlich nach sich ziehen würde.
Man kann aber aus der Natur der Urteilskraft (deren richtiger Gebrauch so notwendig und allgemein erforderlich ist, daß daher unter dem Namen des gesunden Verstandes kein anderes, als eben dieses Vermögen gemeinet wird) leicht abnehmen, daß es mit großen Schwierigkeiten begleitet sein müsse, ein eigentümliches Prinzip derselben auszufinden (denn irgendeine muß sie a priori in sich enthalten, weil sie sonst nicht, als ein besonderes Erkenntnisvermögen, selbst der gemeinsten Kritik ausgesetzt sein würde), welches gleichwohl nicht aus Begriffen a priori abgeleitet sein muß; denn die gehören dem Verstande an, und die Urteilskraft geht nur auf die Anwendung derselben. Sie soll also selbst einen Begriff angeben, durch den eigentlich kein Ding erkannt wird, sondern der nur ihr selbst zur Regel dient, aber nicht zu einer objektiven, der sie ihr Urteil anpassen kann, weil dazu wiederum eine andere Urteilskraft erforderlich sein würde, um unterscheiden zu können, ob es der Fall der Regel sei oder nicht.
Diese Verlegenheit wegen eines Prinzips (es sei nun ein subjektives oder objektives) findet sich hauptsächlich in denjenigen Beurteilungen, die man ästhetisch nennt, die das Schöne und Erhabne, der Natur oder der Kunst, betreffen. Und gleichwohl ist die kritische Untersuchung eines Prinzips der Urteilskraft in denselben das wichtigste Stück einer Kritik dieses Vermögens. Denn, ob sie gleich für sich allein zum Erkenntnis der Dinge gar nichts beitragen, so gehören sie doch dem Erkenntnisvermögen allein an, und beweisen eine unmittelbare Beziehung dieses Vermögens auf das Gefühl der Lust oder Unlust nach irgendeinem Prinzip a priori, ohne es mit dem, was Bestimmungsgrund des Begehrungsvermögens sein kann, zu vermengen, weil dieses seine Prinzipien a priori in Begriffen der Vernunft hat. – Was aber die logische Beurteilung der Natur anbelangt, da, wo die Erfahrung eine Gesetzmäßigkeit an Dingen aufstellt, welche zu verstehen oder zu erklären der allgemeine Verstandesbegriff vom Sinnlichen nicht mehr zulangt, und die Urteilskraft aus sich selbst ein Prinzip der Beziehung des Naturdinges auf das unerkennbare übersinnliche nehmen kann, es auch nur in Absicht auf sich selbst zum Erkenntnis der Natur brauchen muß, da kann und muß ein solches Prinzip a priori zwar zum Erkenntnis der Weltwesen angewandt werden, und eröffnet zugleich Aussichten, die für die praktische Vernunft vorteilhaft sind: aber es hat keine unmittelbare Beziehung auf das Gefühl der Lust und Unlust, die gerade das Rätselhafte in dem Prinzip der Urteilskraft ist, welches eine besondere Abteilung in der Kritik für dieses Vermögen notwendig macht, da die logische Beurteilung nach Begriffen (aus welchen niemals eine unmittelbare Folgerung auf das Gefühl der Lust und Unlust gezogen werden kann) allenfalls dem theoretischen Teile der Philosophie, samt einer kritischen Einschränkung derselben, hätte angehängt werden können.
Da die Untersuchung des Geschmacksvermögens, als ästhetischer Urteilskraft, hier nicht zur Bildung und Kultur des Geschmacks (denn diese wird auch ohne alle solche Nachforschungen, wie bisher, so fernerhin, ihren Gang nehmen), sondern bloß in transzendentaler Absicht angestellt wird; so wird sie, wie ich mir schmeichle, in Ansehung der Mangelhaftigkeit jenes Zwecks auch mit Nachsicht beurteilt werden. Was aber die letztere Absicht betrifft, so muß sie sich auf die strengste Prüfung gefaßt machen. Aber auch da kann die große Schwierigkeit, ein Problem, welches die Natur so verwickelt hat, aufzulösen, einiger nicht ganz zu vermeidenden Dunkelheit in der Auflösung desselben, wie ich hoffe, zur Entschuldigung dienen, wenn nur, daß das Prinzip richtig angegeben worden, klar genug dargetan ist; gesetzt, die Art das Phänomen der Urteilskraft davon abzuleiten, habe nicht alle Deutlichkeit, die man anderwärts, nämlich von einem Erkenntnis nach Begriffen, mit Recht fordern kann, die ich auch im zweiten Teile dieses Werks erreicht zu haben glaube.
Hiemit endige ich also mein ganzes kritisches Geschäft. Ich werde ungesäumt zum Doktrinalen schreiten, um, wo möglich, meinem zunehmenden Alter die dazu noch einigermaßen günstige Zeit noch abzugewinnen. Es versteht sich von selbst, daß für die Urteilskraft darin kein besonderer Teil sei, weil in Ansehung derselben die Kritik statt der Theorie dient; sondern daß nach der Einteilung der Philosophie in die theoretische und praktische, und der reinen, in eben solche Teile, die Metaphysik der Natur und die der Sitten jenes Geschäft ausmachen werden.
Einleitung
I Von der Einteilung der Philosophie
Wenn man die Philosophie, sofern sie Prinzipien der Vernunfterkenntnis der Dinge (nicht bloß, wie die Logik, Prinzipien der Form des Denkens überhaupt, ohne Unterschied der Objekte) durch Begriffe enthält, wie gewöhnlich in die theoretische und praktische einteilt: so verfährt man ganz recht. Aber alsdann müssen auch die Begriffe, welche den Prinzipien dieser Vernunfterkenntnis ihr Objekt anweisen, spezifisch verschieden sein, weil sie sonst zu keiner Einteilung berechtigen würden, welche jederzeit eine Entgegensetzung der Prinzipien, der zu den verschiedenen Teilen einer Wissenschaft gehörigen Vernunfterkenntnis, voraussetzt.
Es sind aber nur zweierlei Begriffe, welche eben so viel verschiedene Prinzipien der Möglichkeit ihrer Gegenstände zulassen: nämlich die Naturbegriffe und der Freiheitsbegriff. Da nun die ersteren ein theoretisches Erkenntnis nach Prinzipien a priori möglich machen, der zweite aber in Ansehung derselben nur ein negatives Prinzip (der bloßen Entgegensetzung) schon in seinem Begriffe bei sich führt, dagegen für die Willensbestimmung erweiternde Grundsätze, welche darum praktisch heißen, errichtet: so wird die Philosophie in zwei, den Prinzipien nach ganz verschiedene, Teile, in die theoretische als Naturphilosophie, und die praktische als Moralphilosophie (denn so wird die praktische Gesetzgebung der Vernunft nach dem Freiheitsbegriffe genannt) mit Recht eingeteilt. Es hat aber bisher ein großer Mißbrauch mit diesen Ausdrücken zur Einteilung der verschiedenen Prinzipien, und mit ihnen auch der Philosophie, geherrscht: indem man das Praktische nach Naturbegriffen mit dem Praktischen nach dem Freiheitsbegriffe für einerlei nahm, und so, unter denselben Benennungen einer theoretischen und praktischen Philosophie, eine Einteilung machte, durch welche (da beide Teile einerlei Prinzipien haben konnten) in der Tat nichts eingeteilt war.
Der Wille, als Begehrungsvermögen, ist nämlich eine von den mancherlei Naturursachen in der Welt, nämlich diejenige, welche nach Begriffen wirkt; und alles, was als durch einen Willen möglich (oder notwendig) vorgestellt wird, heißt praktisch-möglich (oder notwendig): zum Unterschiede von der physischen Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Wirkung, wozu die Ursache nicht durch Begriffe (sondern, wie bei der leblosen Materie, durch Mechanism, und bei Tieren, durch Instinkt) zur Kausalität bestimmt wird. – Hier wird nun in Ansehung des Praktischen unbestimmt gelassen: ob der Begriff, der der Kausalität des Willens die Regel gibt, ein Naturbegriff, oder ein Freiheitsbegriff sei.
Der letztere Unterschied aber ist wesentlich. Denn, ist der die Kausalität bestimmende Begriff ein Naturbegriff, so sind die Prinzipien technisch-praktisch; ist er aber ein Freiheitsbegriff, so sind diese moralisch-praktisch: und weil es in der Einteilung einer Vernunftwissenschaft gänzlich auf diejenige Verschiedenheit der Gegenstände ankommt, deren Erkenntnis verschiedener Prinzipien bedarf, so werden die ersteren zur theoretischen Philosophie (als Naturlehre) gehören, die andern aber ganz allein den zweiten Teil, nämlich (als Sittenlehre) die praktische Philosophie, ausmachen.
Alle technisch-praktische Regeln (d. i. die der Kunst und Geschicklichkeit überhaupt, oder auch der Klugheit, als einer Geschicklichkeit auf Menschen und ihren Willen Einfluß zu haben), so fern ihre Prinzipien auf Begriffen beruhen, müssen nur als Korollarien zur theoretischen Philosophie gezählt werden. Denn sie betreffen nur die Möglichkeit der Dinge nach Naturbegriffen, wozu nicht allein die Mittel, die in der Natur dazu anzutreffen sind, sondern selbst der Wille (als Begehrungs-, mithin als Naturvermögen) gehört, sofern er durch Triebfedern der Natur jenen Regeln gemäß bestimmt werden kann. Doch heißen dergleichen praktische Regeln nicht Gesetze (etwa so wie physische), sondern nur Vorschriften: und zwar darum, weil der Wille nicht bloß unter dem Naturbegriffe, sondern auch unter dem Freiheitsbegriffe steht, in Beziehung auf welchen die Prinzipien desselben Gesetze heißen, und, mit ihren Folgerungen, den zweiten Teil der Philosophie, nämlich den praktischen, allein ausmachen.
So wenig also die Auflösung der Probleme der reinen Geometrie zu einem besonderen Teile derselben gehört, oder die Feldmeßkunst den Namen einer praktischen Geometrie, zum Unterschiede von der reinen, als ein zweiter Teil der Geometrie überhaupt verdient: so und noch weniger, darf die mechanische oder chemische Kunst der Experimente oder der Beobachtungen für einen praktischen Teil der Naturlehre, endlich die Haus- Land- Staatswirtschaft, die Kunst des Umganges, die Vorschrift der Diätetik, selbst nicht die allgemeine Glückseligkeitslehre, sogar nicht einmal die Bezähmung der Neigungen und Bändigung der Affekten zum Behuf der letzteren, zur praktischen Philosophie gezählt werden, oder die letzteren wohl gar den zweiten Teil der Philosophie überhaupt ausmachen weil sie insgesamt nur Regeln der Geschicklichkeit, die mithin nur technisch-praktisch sind, enthalten, um eine Wirkung hervorzubringen, die nach Naturbegriffen der Ursachen und Wirkungen möglich ist, welche, da sie zur theoretischen Philosophie gehören, jenen Vorschriften als bloßen Korollarien aus derselben (der Naturwissenschaft) unterworfen sind, und also keine Stelle in einer besonderen Philosophie, die praktische genannt, verlangen können. Dagegen machen die moralisch-praktischen Vorschriften, die sich gänzlich auf dem Freiheitsbegriffe, mit völliger Ausschließung der Bestimmungsgründe des Willens aus der Natur, gründen, eine ganz besondere Art von Vorschriften aus: welche auch, gleich den Regeln, welchen die Natur gehorcht, schlechthin Gesetze heißen, aber nicht, wie diese, auf sinnlichen Bedingungen, sondern auf einem übersinnlichen Prinzip beruhen, und, neben dem theoretischen Teile der Philosophie, für sich ganz allein, einen anderen Teil, unter dem Namen der praktischen Philosophie, fordern.
Man siehet hieraus, daß ein Inbegriff praktischer Vorschriften, welche die Philosophie gibt, nicht einen besonderen, dem theoretischen zur Seite gesetzten, Teil derselben darum ausmache, weil sie praktisch sind; denn das könnten sie sein, wenn ihre Prinzipien gleich gänzlich aus der theoretischen Erkenntnis der Natur hergenommen wären (als technisch-praktische Regeln); sondern, weil und wenn ihr Prinzip gar nicht vom Naturbegriffe, der jederzeit sinnlich bedingt ist, entlehnt ist, mithin auf dem übersinnlichen, welches der Freiheitsbegriff allein durch formale Gesetze kennbar macht, beruht, und sie also moralisch-praktisch, d. i. nicht bloß Vorschriften und Regeln in dieser oder jener Absicht, sondern, ohne vorgehendes Bezugnehmung auf Zwecke und Absichten, Gesetze sind.
II Vom Gebiete der Philosophie überhaupt
So weit Begriffe a priori ihre Anwendung haben, so weit reicht der Gebrauch unseres Erkenntnisvermögens nach Prinzipien, und mit ihm die Philosophie.
Der Inbegriff aller Gegenstände aber, worauf jene Begriffe bezogen werden, und, wo möglich, ein Erkenntnis derselben zustande zu bringen, kann, nach der verschiedenen Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit unserer Vermögen zu dieser Absicht, eingeteilt werden.
Begriffe, sofern sie auf Gegenstände bezogen werden, unangesehen, ob ein Erkenntnis derselben möglich sei oder nicht, haben ihr Feld, welches bloß nach dem Verhältnisse, das ihr Objekt zu unserem Erkenntnisvermögen überhaupt hat, bestimmt wird. – Der Teil dieses Feldes, worin für uns Erkenntnis möglich ist, ist ein Boden (territorium) für diese Begriffe und das dazu erforderliche Erkenntnisvermögen. Der Teil des Bodens, worauf diese gesetzgebend sind, ist das Gebiet (ditio) dieser Begriffe und der ihnen zustehenden Erkenntnisvermögen. Erfahrungsbegriffe haben also zwar ihren Boden in der Natur, als dem Inbegriffe aller Gegenstände der Sinne, aber kein Gebiet (sondern nur ihren Aufenthalt, domicilium); weil sie zwar gesetzlich erzeugt werden, aber nicht gesetzgebend sind, sondern die auf sie gegründeten Regeln empirisch, mithin zufällig, sind.
Unser gesamtes Erkenntnisvermögen hat zwei Gebiete, das der Naturbegriffe, und das des Freiheitsbegriffs; denn durch beide ist es a priori gesetzgebend. Die Philosophie teilt sich nun auch, diesem gemäß, in die theoretische und die praktische. Aber der Boden, auf welchem ihr Gebiet errichtet, und ihre Gesetzgebung ausgeübt wird, ist immer doch nur der Inbegriff der Gegenstände aller möglichen Erfahrung, sofern sie für nichts mehr als bloße Erscheinungen genommen werden; denn ohnedas würde keine Gesetzgebung des Verstandes in Ansehung derselben gedacht werden können.
Die Gesetzgebung durch Naturbegriffe geschieht durch den Verstand, und ist theoretisch. Die Gesetzgebung durch den Freiheitsbegriff geschieht von der Vernunft, und ist bloß praktisch. Nur allein im Praktischen kann die Vernunft gesetzgebend sein; in Ansehung des theoretischen Erkenntnisses (der Natur) kann sie nur (als gesetzkundig, vermittelst des Verstandes) aus gegebenen Gesetzen durch Schlüsse Folgerungen ziehen, die doch immer nur bei der Natur stehen bleiben. Umgekehrt aber, wo Regeln praktisch sind, ist die Vernunft nicht darum sofort gesetzgebend, weil sie auch technisch-praktisch sein können.
Verstand und Vernunft haben also zwei verschiedene Gesetzgebungen auf einem und demselben Boden der Erfahrung, ohne daß eine der anderen Eintrag tun darf. Denn so wenig der Naturbegriff auf die Gesetzgebung durch den Freiheitsbegriff Einfluß hat, ebensowenig stört dieser die Gesetzgebung der Natur. – Die Möglichkeit, das Zusammenbestehen beider Gesetzgebungen und der dazu gehörigen Vermögen in demselben Subjekt sich wenigstens ohne Widerspruch zu denken, bewies die Kritik der reinen Vernunft, indem sie die Einwürfe dawider durch Aufdeckung des dialektischen Scheins in denselben vernichtete.
Aber, daß diese zwei verschiedenen Gebiete, die sich zwar nicht in ihrer Gesetzgebung, aber doch in ihren Wirkungen in der Sinnenwelt unaufhörlich einschränken, nicht eines ausmachen, kommt daher: daß der Naturbegriff zwar seine Gegenstände in der Anschauung, aber nicht als Dinge an sich selbst, sondern als bloße Erscheinungen, der Freiheitsbegriff dagegen in seinem Objekte zwar ein Ding an sich selbst, aber nicht in der Anschauung vorstellig machen, mithin keiner von beiden ein theoretisches Erkenntnis von seinem Objekte (und selbst dem denkenden Subjekte) als Dinge an sich verschaffen kann, welches das Übersinnliche sein würde, wovon man die Idee zwar der Möglichkeit aller jener Gegenstände der Erfahrung unterlegen muß, sie selbst aber niemals zu einem Erkenntnisse erheben und erweitern kann.
Es gibt also ein unbegrenztes, aber auch unzugängliches Feld für unser gesamtes Erkenntnisvermögen, nämlich das Feld des Übersinnlichen, worin wir keinen Boden für uns finden, also auf demselben weder für die Verstandes- noch Vernunftbegriffe ein Gebiet zum theoretischen Erkenntnis haben können; ein Feld, welches wir zwar zum Behuf des theoretischen sowohl als praktischen Gebrauchs der Vernunft mit Ideen besetzen müssen, denen wir aber in Beziehung auf die Gesetze aus dem Freiheitsbegriffe, keine andere als praktische Realität verschaffen können, wodurch demnach unser theoretisches Erkenntnis nicht im mindesten zu dem Übersinnlichen erweitert wird.
Ob nun zwar eine unübersehbare Kluft zwischen dem Gebiete des Naturbegriffs, als dem Sinnlichen, und dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem Übersinnlichen, befestigt ist, so daß von dem ersteren zum anderen (also vermittelst des theoretischen Gebrauchs der Vernunft) kein Übergang möglich ist, gleich als ob es so viel verschiedene Welten wären, deren erste auf die zweite keinen Einfluß haben kann: so soll doch diese auf jene einen Einfluß haben, nämlich der Freiheitsbegriff soll den durch seine Gesetze aufgegebenen Zweck in der Sinnenwelt wirklich machen; und die Natur muß folglich auch so gedacht werden können, daß die Gesetzmäßigkeit ihrer Form wenigstens zur Möglichkeit der in ihr zu bewirkenden Zwecke nach Freiheitsgesetzen zusammenstimme. – Also muß es doch einen Grund der Einheit des Übersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt, mit dem was der Freiheitsbegriff praktisch enthält, geben, wovon der Begriff, wenn er gleich weder theoretisch noch praktisch zu einem Erkenntnisse desselben gelangt, mithin kein eigentümliches Gebiet hat, dennoch den Übergang von der Denkungsart nach den Prinzipien der einen, zu der nach Prinzipien der anderen, möglich macht.
III Von der Kritik der Urteilskraft, als einem Verbindungsmittel der zwei Teile der Philosophie zu einem Ganzen
Die Kritik der Erkenntnisvermögen in Ansehung dessen, was sie a priori leisten können, hat eigentlich kein Gebiet in Ansehung der Objekte; weil sie keine Doktrin ist, sondern nur, ob und wie, nach der Bewandtnis, die es mit unseren Vermögen hat, eine Doktrin durch sie möglich sei, zu untersuchen hat. Ihr Feld erstreckt sich auf alle Anmaßungen derselben, um sie in die Grenzen ihrer Rechtmäßigkeit zu setzen. Was aber nicht in die Einteilung der Philosophie kommen kann, das kann doch, als ein Hauptteil, in die Kritik des reinen Erkenntnisvermögens überhaupt kommen, wenn es nämlich Prinzipien enthält, die für sich weder zum theoretischen noch praktischen Gebrauche tauglich sind.
Die Naturbegriffe, welche den Grund zu allem theoretischen Erkenntnis a priori enthalten, beruheten auf der Gesetzgebung des Verstandes. – Der Freiheitsbegriff, der den Grund zu allen sinnlich-unbedingten praktischen Vorschriften a priori enthielt, beruhete auf der Gesetzgebung der Vernunft. Beide Vermögen also haben, außer dem, daß sie der logischen Form nach auf Prinzipien, welchen Ursprungs sie auch sein mögen, angewandt werden können, überdem noch jedes seine eigene Gesetzgebung dem Inhalte nach, über die es keine andere (a priori) gibt, und die daher die Einteilung der Philosophie in die theoretische und praktische rechtfertigt.
Allein in der Familie der oberen Erkenntnisvermögen gibt es doch noch ein Mittelglied zwischen dem Verstande und der Vernunft. Dieses ist die Urteilskraft, von welcher man Ursache hat, nach der Analogie zu vermuten, daß sie ebensowohl, wenn gleich nicht eine eigene Gesetzgebung, doch ein ihr eigenes Prinzip nach Gesetzen zu suchen, allenfalls ein bloß subjektives a priori, in sich enthalten dürfte; welches, wenn ihm gleich kein Feld der Gegenstände als sein Gebiet zustände, doch irgendeinen Boden haben kann, und eine gewisse Beschaffenheit desselben, wofür gerade nur dieses Prinzip geltend sein möchte.
Hierzu kommt aber noch (nach der Analogie zu urteilen) ein neuer Grund, die Urteilskraft mit einer anderen Ordnung unserer Vorstellungskräfte in Verknüpfung zu bringen, welche von noch größerer Wichtigkeit zu sein scheint, als die der Verwandtschaft mit der Familie der Erkenntnisvermögen. Denn alle Seelenvermögen, oder Fähigkeiten, können auf die drei zurückgeführt werden, welche sich nicht ferner aus einem gemeinschaftlichen Grunde ableiten lassen: das Erkenntnisvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust, und das Begehrungsvermögen.1 Für das Erkenntnisvermögen ist allein der Verstand gesetzgebend, wenn jenes (wie es auch geschehen muß, wenn es für sich, ohne Vermischung mit dem Begehrungsvermögen, betrachtet wird) als Vermögen eines theoretischen Erkenntnisses auf die Natur bezogen wird, in Ansehung deren allein (als Erscheinung) es uns möglich ist, durch Naturbegriffe a priori, welche eigentlich reine Verstandesbegriffe sind, Gesetze zu geben. – Für das Begehrungsvermögen, als ein oberes Vermögen nach dem Freiheitsbegriffe, ist allein die Vernunft (in der allein dieser Begriff statthat) a priori gesetzgebend. – Nun ist zwischen dem Erkenntnis- und dem Begehrungsvermögen das Gefühl der Lust, so wie zwischen dem Verstande und der Vernunft die Urteilskraft, enthalten. Es ist also wenigstens vorläufig zu vermuten, daß die Urteilskraft eben so wohl für sich ein Prinzip a priori enthalte, und, da mit dem Begehrungsvermögen notwendig Lust oder Unlust verbunden ist (es sei daß sie, wie beim unteren, vor dem Prinzip desselben vorhergehe, oder, wie beim oberen, nur aus der Bestimmung desselben durch das moralische Gesetz folge), ebensowohl einen Übergang vom reinen Erkenntnisvermögen, d. i. vom Gebiete der Naturbegriffe zum Gebiete des Freiheitsbegriffs, bewirken werde, als sie im logischen Gebrauche den Übergang vom Verstande zur Vernunft möglich macht.
Wenn also gleich die Philosophie nur in zwei Hauptteile, die theoretische und die praktische, eingeteilt werden kann; wenn gleich alles, was wir von den eignen Prinzipien der Urteilskraft zu sagen haben möchten, in ihr zum theoretischen Teile, d. i. dem Vernunfterkenntnis nach Naturbegriffen, gezählt werden müßte; so besteht doch die Kritik der reinen Vernunft, die alles dieses vor der Unternehmung jenes Systems, zum Behuf der Möglichkeit desselben, ausmachen muß, aus drei Teilen: der Kritik des reinen Verstandes, der reinen Urteilskraft und der reinen Vernunft, welche Vermögen darum rein genannt werden, weil sie a priori gesetzgebend sind.
IV Von der Urteilskraft, als einem a priori gesetzgebenden Vermögen
Urteilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. Ist das Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert (auch, wenn sie, als transzendentale Urteilskraft, a priori die Bedingungen angibt, welchen gemäß allein unter jenem Allgemeinen subsumiert werden kann) bestimmend. Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist die Urteilskraft bloß reflektierend.
Die bestimmende Urteilskraft unter allgemeinen transzendentalen Gesetzen, die der Verstand gibt, ist nur subsumierend; das Gesetz ist ihr a priori vorgezeichnet, und sie hat also nicht nötig, für sich selbst auf ein Gesetz zu denken, um das Besondere in der Natur dem Allgemeinen unterordnen zu können. Allein es sind so mannigfaltige Formen der Natur, gleichsam so viele Modifikationen der allgemeinen transzendentalen Naturbegriffe, die durch jene Gesetze, welche der reine Verstand a priori gibt, weil dieselben nur auf die Möglichkeit einer Natur (als Gegenstandes der Sinne) überhaupt gehen, unbestimmt gelassen werden, daß dafür doch auch Gesetze sein müssen, die zwar, als empirische, nach unserer Verstandeseinsicht zufällig sein mögen, die aber doch, wenn sie Gesetze heißen sollen (wie es auch der Begriff einer Natur erfordert) aus einem, wenngleich uns unbekannten, Prinzip der Einheit des Mannigfaltigen, als notwendig angesehen werden müssen. – Die reflektierende Urteilskraft, die von dem Besondern in der Natur zum Allgemeinen aufzusteigen die Obliegenheit hat, bedarf also eines Prinzips, welches sie nicht von der Erfahrung entlehnen kann, weil es eben die Einheit aller empirischen Prinzipien unter gleichfalls empirischen, aber höheren Prinzipien, und also die Möglichkeit der systematischen Unterordnung derselben unter einander, begründen soll. Ein solches transzendentales Prinzip kann also die reflektierende Urteilskraft sich nur selbst als Gesetz geben, nicht anderwärts hernehmen (weil sie sonst bestimmende Urteilskraft sein würde), noch der Natur vorschreiben; weil die Reflexion über die Gesetze der Natur sich nach der Natur, und diese sich nicht nach den Bedingungen richtet, nach welchen wir einen in Ansehung dieser ganz zufälligen Begriff von ihr zu erwerben trachten.
Nun kann dieses Prinzip kein anderes sein, als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande haben, der sie der Natur (obzwar nur nach dem allgemeinen Begriffe von ihr als Natur) vorschreibt, die besondern, empirischen Gesetze in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene unbestimmt gelassen ist, nach einer solchen Einheit betrachtet werden müssen, als ob gleichfalls ein Verstand (wenngleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte. Nicht, als wenn auf diese Art wirklich ein solcher Verstand angenommen werden müßte (denn es ist nur die reflektierende Urteilskraft, der diese Idee zum Prinzip dient, zum Reflektieren, nicht zum Bestimmen); sondern dieses Vermögen gibt sich dadurch nur selbst, und nicht der Natur, ein Gesetz.
Weil nun der Begriff von einem Objekt, sofern er zugleich den Grund der Wirklichkeit dieses Objekts enthält, der Zweck und die Übereinstimmung eines Dinges mit derjenigen Beschaffenheit der Dinge, die nur nach Zwecken möglich ist, die Zweckmäßigkeit der Form desselben heißt: so ist das Prinzip der Urteilskraft, in Ansehung der Form der Dinge der Natur unter empirischen Gesetzen überhaupt, die Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit. D. i. die Natur wird durch diesen Begriff so vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund der Einheit des Mannigfaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte.
Die Zweckmäßigkeit der Natur ist also ein besonderer Begriff a priori, der lediglich in der reflektierenden Urteilskraft seinen Ursprung hat. Denn den Naturprodukten kann man so etwas, als Beziehung der Natur an ihnen auf Zwecke, nicht beilegen, sondern diesen Begriff nur brauchen, um über sie in Ansehung der Verknüpfung der Erscheinungen in ihr, die nach empirischen Gesetzen gegeben ist, zu reflektieren. Auch ist dieser Begriff von der praktischen Zweckmäßigkeit (der menschlichen Kunst oder auch der Sitten) ganz unterschieden, ob er zwar nach einer Analogie mit derselben gedacht wird.
V Das Prinzip der formalen Zweckmäßigkeit der Natur ist ein transzendentales Prinzip der Urteilskraft
Ein transzendentales Prinzip ist dasjenige, durch welches die allgemeine Bedingung a priori vorgestellt wird, unter der allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis überhaupt werden können. Dagegen heißt ein Prinzip metaphysisch, wenn es die Bedingung a priori vorstellt, unter der allein Objekte, deren Begriff empirisch gegeben sein muß, a priori weiter bestimmet werden können. So ist das Prinzip der Erkenntnis der Körper, als Substanzen und als veränderlicher Substanzen, transzendental, wenn dadurch gesagt wird, daß ihre Veränderung eine Ursache haben müsse; es ist aber metaphysisch, wenn dadurch gesagt wird, ihre Veränderung müsse eine äußere Ursache haben: weil im ersteren Falle der Körper nur durch ontologische Prädikate (reine Verstandesbegriffe), z. B. als Substanz, gedacht werden darf, um den Satz a priori zu erkennen; im zweiten aber der empirische Begriff eines Körpers (als eines beweglichen Dinges im Raum) diesem Satze zum Grunde gelegt werden muß, alsdann aber, daß dem Körper das letztere Prädikat (der Bewegung nur durch äußere Ursache) zukomme, völlig a priori eingesehen werden kann. – So ist, wie ich sogleich zeigen werde, das Prinzip der Zweckmäßigkeit der Natur (in der Mannigfaltigkeit ihrer empirischen Gesetze) ein transzendentales Prinzip. Denn der Begriff von den Objekten, sofern sie als unter diesem Prinzip stehend gedacht werden, ist nur der reine Begriff von Gegenständen des möglichen Erfahrungserkenntnisses überhaupt, und enthält nichts Empirisches. Dagegen wäre das Prinzip der praktischen Zweckmäßigkeit, die in der Idee der Bestimmung eines freien Willens gedacht werden muß, ein metaphysisches Prinzip; weil der Begriff eines Begehrungsvermögens als eines Willens doch empirisch gegeben werden muß (nicht zu den transzendentalen Prädikaten gehört). Beide Prinzipien aber sind dennoch nicht empirisch, sondern Prinzipien a priori: weil es zur Verbindung des Prädikats mit dem empirischen Begriffe des Subjekts ihrer Urteile keiner weiteren Erfahrung bedarf, sondern jene völlig a priori eingesehen werden kann.
Daß der Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur zu den transzendentalen Prinzipien gehöre, kann man aus den Maximen der Urteilskraft, die der Nachforschung der Natur a priori zum Grunde gelegt werden, und die dennoch auf nichts, als die Möglichkeit der Erfahrung, mithin der Erkenntnis der Natur, aber nicht bloß als Natur überhaupt, sondern als durch eine Mannigfaltigkeit besonderer Gesetze bestimmten Natur, gehen, hinreichend ersehen. – Sie kommen, als Sentenzen der metaphysischen Weisheit, bei Gelegenheit mancher Regeln, deren Notwendigkeit man nicht aus Begriffen dartun kann, im Laufe dieser Wissenschaft oft genug, aber nur zerstreut vor. »Die Natur nimmt den kürzesten Weg (lex parsimoniae); sie tut gleichwohl keinen Sprung, weder in der Folge ihrer Veränderungen, noch der Zusammenstellung spezifisch verschiedener Formen (lex continui in natura); ihre große Mannigfaltigkeit in empirischen Gesetzen ist gleichwohl Einheit unter wenigen Prinzipien (principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda)«; u. dgl. m.
Wenn man aber von diesen Grundsätzen den Ursprung anzugeben denkt, und es auf dem psychologischen Wege versucht, so ist dies dem Sinne derselben gänzlich zuwider. Denn sie sagen nicht, was geschieht, d. i. nach welcher Regel unsere Erkenntniskräfte ihr Spiel wirklich treiben, und wie geurteilt wird, sondern wie geurteilt werden soll; und da kommt diese logische objektive Notwendigkeit nicht heraus, wenn die Prinzipien bloß empirisch sind. Also ist die Zweckmäßigkeit der Natur für unsere Erkenntnisvermögen und ihren Gebrauch, welche offenbar aus ihnen hervorleuchtet, ein transzendentales Prinzip der Urteile und bedarf also auch einer transzendentalen Deduktion, vermittelst deren der Grund so zu urteilen in den Erkenntnisquellen a priori aufgesucht werden muß.
Wir finden nämlich in den Gründen der Möglichkeit einer Erfahrung zuerst freilich etwas Notwendiges, nämlich die allgemeinen Gesetze, ohne welche Natur überhaupt (als Gegenstand der Sinne) nicht gedacht werden kann; und diese beruhen auf den Kategorien, angewandt auf die formalen Bedingungen aller uns möglichen Anschauung, sofern sie gleichfalls a priori gegeben ist. Unter diesen Gesetzen nun ist die Urteilskraft bestimmend; denn sie hat nichts zu tun, als unter gegebenen Gesetzen zu subsumieren. Z. B. der Verstand sagt: Alle Veränderung hat ihre Ursache (allgemeines Naturgesetz); die transzendentale Urteilskraft hat nun nichts weiter zu tun, als die Bedingung der Subsumtion unter dem vorgelegten Verstandesbegriff a priori anzugeben: und das ist die Sukzession der Bestimmungen eines und desselben Dinges. Für die Natur nun überhaupt (als Gegenstand möglicher Erfahrung) wird jenes Gesetz als schlechterdings notwendig erkannt. – Nun sind aber die Gegenstände der empirischen Erkenntnis, außer jener formalen Zeitbedingung, noch auf mancherlei Art bestimmt, oder, so viel man a priori urteilen kann, bestimmbar, so daß spezifisch-verschiedene Naturen, außer dem, was sie, als zur Natur überhaupt gehörig, gemein haben, noch auf unendlich mannigfaltige Weise Ursachen sein können; und eine jede dieser Arten muß (nach dem Begriffe einer Ursache überhaupt) ihre Regel haben, die Gesetz ist, mithin Notwendigkeit bei sich führt: ob wir gleich nach der Beschaffenheit und den Schranken unserer Erkenntnisvermögen diese Notwendigkeit gar nicht einsehen. Also müssen wir in der Natur, in Ansehung ihrer bloß empirischen Gesetze, eine Möglichkeit unendlich mannigfaltiger empirischer Gesetze denken, die für unsere Einsicht dennoch zufällig sind (a priori nicht erkannt werden können); und in deren Ansehung beurteilen wir die Natureinheit nach empirischen Gesetzen, und die Möglichkeit der Einheit der Erfahrung (als Systems nach empirischen Gesetzen), als zufällig. Weil aber doch eine solche Einheit notwendig vorausgesetzt und angenommen werden muß, da sonst kein durchgängiger Zusammenhang empirischer Erkenntnisse zu einem Ganzen der Erfahrung stattfinden würde, indem die allgemeinen Naturgesetze zwar einen solchen Zusammenhang unter den Dingen ihrer Gattung nach, als Naturdinge überhaupt, aber nicht spezifisch, als solche besondere Naturwesen, an die Hand geben: so muß die Urteilskraft für ihren eigenen Gebrauch es als Prinzip a priori annehmen, daß das für die menschliche Einsicht Zufällige in den besonderen (empirischen) Naturgesetzen dennoch eine, für uns zwar nicht zu ergründende aber doch denkbare, gesetzliche Einheit, in der Verbindung ihres Mannigfaltigen zu einer an sich möglichen Erfahrung, enthalte. Folglich, weil die gesetzliche Einheit in einer Verbindung, die wir zwar einer notwendigen Absicht (einem Bedürfnis) des Verstandes gemäß, aber zugleich doch als an sich zufällig erkennen, als Zweckmäßigkeit der Objekte (hier der Natur) vorgestellt wird: so muß die Urteilskraft, die, in Ansehung der Dinge unter möglichen (noch zu entdeckenden) empirischen Gesetzen, bloß reflektierend ist, die Natur in Ansehung der letzteren nach einem Prinzip der Zweckmäßigkeit für unser Erkenntnisvermögen denken, welches dann in obigen Maximen der Urteilskraft ausgedrückt wird. Dieser transzendentale Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur ist nun weder ein Naturbegriff, noch ein Freiheitsbegriff, weil er gar nichts dem Objekte (der Natur) beilegt, sondern nur die einzige Art, wie wir in der Reflexion über die Gegenstände der Natur in Absicht auf eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung verfahren müssen, vorstellt, folglich ein subjektives Prinzip (Maxime) der Urteilskraft; daher wir auch, gleich als ob es ein glücklicher unsre Absicht begünstigender Zufall wäre, erfreuet (eigentlich eines Bedürfnisses entledigt) werden, wenn wir eine solche systematische Einheit unter bloß empirischen Gesetzen antreffen: ob wir gleich notwendig annehmen mußten, es sei eine solche Einheit, ohne daß wir sie doch einzusehen und zu beweisen vermochten.
Um sich von der Richtigkeit dieser Deduktion des vorliegenden Begriffs, und der Notwendigkeit, ihn als transzendentales Erkenntnisprinzip anzunehmen, zu überzeugen, bedenke man nur die Größe der Aufgabe: aus gegebenen Wahrnehmungen einer allenfalls unendliche Mannigfaltigkeit empirischer Gesetze enthaltenden Natur eine zusammenhängende Erfahrung zu machen, welche Aufgabe a priori in unserm Verstande liegt. Der Verstand ist zwar a priori im Besitze allgemeiner Gesetze der Natur, ohne welche sie gar kein Gegenstand einer Erfahrung sein könnte: aber er bedarf doch auch überdem noch einer gewissen Ordnung der Natur, in den besonderen Regeln derselben, die ihm nur empirisch bekannt werden können, und die in Ansehung seiner zufällig sind. Diese Regeln, ohne welche kein Fortgang von der allgemeinen Analogie einer möglichen Erfahrung überhaupt zur besonderen stattfinden würde, muß er sich als Gesetze (d. i. als notwendig) denken: weil sie sonst keine Naturordnung ausmachen würden, ob er gleich ihre Notwendigkeit nicht erkennt, oder jemals einsehen könnte. Ob er also gleich in Ansehung derselben (Objekte) a priori nichts bestimmen kann, so muß er doch, um diesen empirischen sogenannten Gesetzen nachzugehen, ein Prinzip a priori, daß nämlich nach ihnen eine erkennbare Ordnung der Natur möglich sei, aller Reflexion über dieselbe zum Grunde legen, dergleichen Prinzip nachfolgende Sätze ausdrücken: daß es in ihr eine für uns faßliche Unterordnung von Gattungen und Arten gebe; daß jene sich einander wiederum nach einem gemeinschaftlichen Prinzip nähern, damit ein Übergang von einer zu der anderen, und dadurch zu einer höheren Gattung möglich sei; daß, da für die spezifische Verschiedenheit der Naturwirkungen ebensoviel verschiedene Arten der Kausalität annehmen zu müssen, unserem Verstande anfänglich unvermeidlich scheint, sie dennoch unter einer geringen Zahl von Prinzipien stehen mögen, mit deren Aufsuchung wir uns zu beschäftigen haben, usw. Diese Zusammenstimmung der Natur zu unserem Erkenntnisvermögen wird von der Urteilskraft, zum Behuf ihrer Reflexion über dieselbe, nach ihren empirischen Gesetzen, a priori vorausgesetzt; indem sie der Verstand zugleich objektiv als zufällig anerkennt, und bloß die Urteilskraft sie der Natur als transzendentale Zweckmäßigkeit (in Beziehung auf das Erkenntnisvermögen des Subjekts) beilegt: weil wir ohne diese vorauszusetzen, keine Ordnung der Natur nach empirischen Gesetzen, mithin keinen Leitfaden für eine mit diesen nach aller ihrer Mannigfaltigkeit anzustellende Erfahrung und Nachforschung derselben haben würden.
Denn es läßt sich wohl denken: daß, ungeachtet aller der Gleichförmigkeit der Naturdinge nach den allgemeinen Gesetzen, ohne welche die Form eines Erfahrungserkenntnisses überhaupt gar nicht stattfinden würde, die spezifische Verschiedenheit der empirischen Gesetze der Natur, samt ihren Wirkungen, dennoch so groß sein könnte, daß es für unseren Verstand unmöglich wäre, in ihr eine faßliche Ordnung zu entdecken, ihre Produkte in Gattungen und Arten einzuteilen, um die Prinzipien der Erklärung und des Verständnisses des einen auch zur Erklärung und Begreifung des andern zu gebrauchen, und aus einem für uns so verworrenen (eigentlich nur unendlich mannigfaltigen, unserer Fassungskraft nicht angemessenen) Stoffe eine zusammenhängende Erfahrung zu machen.
Die Urteilskraft hat also auch ein Prinzip a priori für die Möglichkeit der Natur, aber nur in subjektiver Rücksicht, in sich, wodurch sie, nicht der Natur (als Autonomie), sondern ihr selbst (als Heautonomie) für die Reflexion über jene, ein Gesetz vorschreibt, welches man das Gesetz der Spezifikation der Natur in Ansehung ihrer empirischen Gesetze nennen könnte, das sie a priori an ihr nicht erkennt, sondern zum Behuf einer für unseren Verstand erkennbaren Ordnung derselben in der Einteilung, die sie von ihren allgemeinen Gesetzen macht, annimmt, wenn sie diesen eine Mannigfaltigkeit der besondern unterordnen will. Wenn man also sagt: die Natur spezifiziert ihre allgemeinen Gesetze nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit für unser Erkenntnisvermögen, d. i. zur Angemessenheit mit dem menschlichen Verstande in seinem notwendigen Geschäfte: zum Besonderen, welches ihm die Wahrnehmung darbietet, das Allgemeine, und zum Verschiedenen (für jede Spezies zwar Allgemeinen) wiederum Verknüpfung in der Einheit des Prinzips zu finden; so schreibt man dadurch weder der Natur ein Gesetz vor, noch lernt man eines von ihr durch Beobachtung (obzwar jenes Prinzip durch diese bestätigt werden kann). Denn es ist nicht ein Prinzip der bestimmenden, sondern bloß der reflektierenden Urteilskraft; man will nur, daß man, die Natur mag ihren allgemeinen Gesetzen nach eingerichtet sein wie sie wolle, durchaus nach jenem Prinzip und den sich darauf gründenden Maximen ihren empirischen Gesetzen nachspüren müsse, weil wir, nur so weit als jenes stattfindet, mit dem Gebrauche unseres Verstandes in der Erfahrung fortkommen und Erkenntnis erwerben können.
VI Von der Verbindung des Gefühls der Lust mit dem Begriffe der Zweckmäßigkeit der Natur
Die gedachte Übereinstimmung der Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer besonderen Gesetze zu unserem Bedürfnisse, Allgemeinheit der Prinzipien für sie aufzufinden, muß nach aller unserer Einsicht, als zufällig beurteilt werden, gleichwohl aber doch, für unser Verstandesbedürfnis, als unentbehrlich, mithin als Zweckmäßigkeit, wodurch die Natur mit unserer, aber nur auf Erkenntnis gerichteten, Absicht übereinstimmt. – Die allgemeinen Gesetze des Verstandes, welche zugleich Gesetze der Natur sind, sind derselben ebenso notwendig (obgleich aus Spontaneität entsprungen), als die Bewegungsgesetze der Materie; und ihre Erzeugung setzt keine Absicht mit unseren Erkenntnisvermögen voraus, weil wir nur durch dieselben von dem, was Erkenntnis der Dinge (der Natur) sei, zuerst einen Begriff erhalten, und sie der Natur, als Objekt unserer Erkenntnis überhaupt, notwendig zukommen. Allein, daß die Ordnung der Natur nach ihren besonderen Gesetzen, bei aller unsere Fassungskraft übersteigenden wenigstens möglichen Mannigfaltigkeit und Ungleichartigkeit, doch dieser wirklich angemessen sei, ist, soviel wir einsehen können, zufällig; und die Auffindung derselben ist ein Geschäft des Verstandes, welches mit Absicht zu einem notwendigen Zwecke desselben, nämlich Einheit der Prinzipien in sie hineinzubringen, geführt wird: welchen Zweck dann die Urteilskraft der Natur beilegen muß, weil der Verstand ihr hierüber kein Gesetz vorschreiben kann.
Die Erreichung jeder Absicht ist mit dem Gefühle der Lust verbunden; und, ist die Bedingung der erstern eine Vorstellung a priori, wie hier ein Prinzip für die reflektierende Urteilskraft überhaupt, so ist das Gefühl der Lust auch durch einen Grund a priori und für jedermann gültig bestimmt: und zwar bloß durch die Beziehung des Objekts auf das Erkenntnisvermögen, ohne daß der Begriff der Zweckmäßigkeit hier im mindesten auf das Begehrungsvermögen Rücksicht nimmt, und sich also von aller praktischen Zweckmäßigkeit der Natur gänzlich unterscheidet.
In der Tat, da wir von dem Zusammentreffen der Wahrnehmungen mit den Gesetzen nach allgemeinen Naturbegriffen (den Kategorien) nicht die mindeste Wirkung auf das Gefühl der Lust in uns antreffen, auch nicht antreffen können, weil der Verstand damit unabsichtlich nach seiner Natur notwendig verfährt: so ist andrerseits die entdeckte Vereinbarkeit zweier oder mehrerer empirischen heterogenen Naturgesetze unter einem sie beide befassenden Prinzip der Grund einer sehr merklichen Lust, oft sogar einer Bewunderung, selbst einer solchen, die nicht aufhört, ob man schon mit dem Gegenstande derselben genug bekannt ist. Zwar spüren wir an der Faßlichkeit der Natur, und ihrer Einheit der Abteilung in Gattungen und Arten, wodurch allein empirische Begriffe möglich sind, durch welche wir sie nach ihren besonderen Gesetzen erkennen, keine merkliche Lust mehr: aber sie ist gewiß zu ihrer Zeit gewesen, und nur weil die gemeinste Erfahrung ohne sie nicht möglich sein würde, ist sie allmählich mit dem bloßen Erkenntnisse vermischt, und nicht mehr besonders bemerkt worden. – Es gehört also etwas, das in der Beurteilung der Natur auf die Zweckmäßigkeit derselben für unsern Verstand aufmerksam macht, ein Studium: ungleichartige Gesetze derselben, wo möglich, unter höhere, obwohl immer noch empirische, zu bringen, dazu, um, wenn es gelingt, an dieser Einstimmung derselben für unser Erkenntnisvermögen, die wir als bloß zufällig ansehen, Lust zu empfinden. Dagegen würde uns eine Vorstellung der Natur durchaus mißfallen, durch welche man uns voraussagte, daß, bei der mindesten Nachforschung über die gemeinste Erfahrung hinaus, wir auf eine Heterogeneität ihrer Gesetze stoßen würden, welche die Vereinigung ihrer besonderen Gesetze unter allgemeinen empirischen für unseren Verstand unmöglich machte; weil dies dem Prinzip der subjektiv-zweckmäßigen Spezifikation der Natur in ihren Gattungen, und unserer reflektierenden Urteilskraft in der Absicht der letzteren, widerstreitet.
Diese Voraussetzung der Urteilskraft ist gleichwohl darüber so unbestimmt: wie weit jene idealische Zweckmäßigkeit der Natur für unser Erkenntnisvermögen ausgedehnt werden solle, daß, wenn man uns sagt, eine tiefere oder ausgebreitetere Kenntnis der Natur durch Beobachtung müsse zuletzt auf eine Mannigfaltigkeit von Gesetzen stoßen, die kein menschlicher Verstand auf ein Prinzip zurückführen kann, wir es auch zufrieden sind, ob wir es gleich lieber hören, wenn andere uns Hoffnung geben: daß, je mehr wir die Natur im Inneren kennen würden, oder mit äußeren uns für jetzt unbekannten Gliedern vergleichen könnten, wir sie in ihren Prinzipien um desto einfacher, und, bei der scheinbaren Heterogeneität ihrer empirischen Gesetze, einhelliger finden würden, je weiter unsere Erfahrung fortschritte. Denn es ist ein Geheiß unserer Urteilskraft, nach dem Prinzip der Angemessenheit der Natur zu unserem Erkenntnisvermögen zu verfahren, so weit es reicht, ohne (weil es keine bestimmende Urteilskraft ist, die uns diese Regel gibt) auszumachen, ob es irgendwo seine Grenzen habe, oder nicht; weil wir zwar in Ansehung des rationalen Gebrauchs unserer Erkenntnisvermögen Grenzen bestimmen können, im empirischen Felde aber keine Grenzbestimmung möglich ist.
VII Von der ästhetischen Vorstellung der Zweckmäßigkeit der Natur
Was an der Vorstellung eines Objekts bloß subjektiv ist, d. i. ihre Beziehung auf das Subjekt, nicht auf den Gegenstand ausmacht, ist die ästhetische Beschaffenheit derselben; was aber an ihr zur Bestimmung des Gegenstandes (zum Erkenntnisse) dient, oder gebraucht werden kann, ist ihre logische Gültigkeit. In dem Erkenntnisse eines Gegenstandes der Sinne kommen beide Beziehungen zusammen vor. In der Sinnenvorstellung der Dinge außer mir ist die Qualität des Raums, worin wir sie anschauen, das bloß Subjektive meiner Vorstellung derselben (wodurch, was sie als Objekte an sich sein mögen, unausgemacht bleibt), um welcher Beziehung willen der Gegenstand auch dadurch bloß als Erscheinung gedacht wird; der Raum ist aber, seiner bloß subjektiven Qualität ungeachtet, gleichwohl doch ein Erkenntnisstück der Dinge als Erscheinungen. Empfindung (hier die äußere) drückt ebensowohl das bloß Subjektive unserer Vorstellungen der Dinge außer uns aus, aber eigentlich das Materielle (Reale) derselben (wodurch etwas Existierendes gegeben wird), so wie der Raum die bloße Form a priori der Möglichkeit ihrer Anschauung; und gleichwohl wird jene auch zum Erkenntnis der Objekte außer uns gebraucht.
Dasjenige Subjektive aber an einer Vorstellung, was gar kein Erkenntnisstück werden kann, ist die mit ihr verbundene Lust oder Unlust; denn durch sie erkenne ich nichts an dem Gegenstande der Vorstellung, obgleich sie wohl die Wirkung irgendeiner Erkenntnis sein kann. Nun ist die Zweckmäßigkeit eines Dinges, sofern sie in der Wahrnehmung vorgestellt wird, auch keine Beschaffenheit des Objekts selbst (denn eine solche kann nicht wahrgenommen werden), ob sie gleich aus einem Erkenntnisse der Dinge gefolgert werden kann. Die Zweckmäßigkeit also, die vor dem Erkenntnisse eines Objekts vorhergeht, ja sogar, ohne die Vorstellung desselben zu einem Erkenntnis brauchen zu wollen, gleichwohl mit ihr unmittelbar verbunden wird, ist das Subjektive derselben, was gar kein Erkenntnisstück werden kann. Also wird der Gegenstand alsdann nur darum zweckmäßig genannt, weil seine Vorstellung unmittelbar mit dem Gefühle der Lust verbunden ist; und diese Vorstellung selbst ist eine ästhetische Vorstellung der Zweckmäßigkeit. – Es fragt sich nur, ob es überhaupt eine solche Vorstellung der Zweckmäßigkeit gebe.
Wenn mit der bloßen Auffassung (apprehensio) der Form eines Gegenstandes der Anschauung, ohne Beziehung derselben auf einen Begriff zu einem bestimmten Erkenntnis, Lust verbunden ist: so wird die Vorstellung dadurch nicht auf das Objekt, sondern lediglich auf das Subjekt bezogen; und die Lust kann nichts anders als die Angemessenheit desselben zu den Erkenntnisvermögen, die in der reflektierenden Urteilskraft im Spiel sind, und sofern sie darin sind, also bloß eine subjektive formale Zweckmäßigkeit des Objekts ausdrücken. Denn jene Auffassung der Formen in die Einbildungskraft kann niemals geschehen, ohne daß die reflektierende Urteilskraft, auch unabsichtlich, sie wenigstens mit ihrem Vermögen, Anschauungen auf Begriffe zu beziehen, vergliche. Wenn nun in dieser Vergleichung die Einbildungskraft (als Vermögen der Anschauungen a priori) zum Verstande (als Vermögen der Begriffe) durch eine gegebene Vorstellung unabsichtlich in Einstimmung versetzt und dadurch ein Gefühl der Lust erweckt wird, so muß der Gegenstand alsdann als zweckmäßig für die reflektierende Urteilskraft angesehen werden. Ein solches Urteil ist ein ästhetisches Urteil über die Zweckmäßigkeit des Objekts, welches sich auf keinem vorhandenen Begriffe vom Gegenstande gründet, und keinen von ihm verschafft. Wessen Gegenstandes Form (nicht das Materielle seiner Vorstellung, als Empfindung) in der bloßen Reflexion über dieselbe (ohne Absicht auf einen von ihm zu erwerbenden Begriff) als der Grund einer Lust an der Vorstellung eines solchen Objekts beurteilt wird; mit dessen Vorstellung wird diese Lust auch als notwendig verbunden geurteilt, folglich als nicht bloß für das Subjekt, welches diese Form auffaßt, sondern für jeden Urteilenden überhaupt. Der Gegenstand heißt alsdann schön; und das Vermögen, durch eine solche Lust (folglich auch allgemeingültig) zu urteilen, der Geschmack. Denn da der Grund der Lust bloß in der Form des Gegenstandes für die Reflexion überhaupt, mithin in keiner Empfindung des Gegenstandes, und auch ohne Beziehung auf einen Begriff, der irgendeine Absicht enthielte, gesetzt wird: so ist es allein die Gesetzmäßigkeit im empirischen Gebrauche der Urteilskraft überhaupt (Einheit der Einbildungskraft mit dem Verstande) in dem Subjekte, mit der die Vorstellung des Objekts in der Reflexion, deren Bedingungen a priori allgemein gelten, zusammenstimmt; und, da diese Zusammenstimmung des Gegenstandes mit den Vermögen des Subjekts zufällig ist, so bewirkt sie die Vorstellung einer Zweckmäßigkeit desselben in Ansehung der Erkenntnisvermögen des Subjekts.
Hier ist nun eine Lust, die, wie alle Lust oder Unlust, welche nicht durch den Freiheitsbegriff (d. i. durch die vorhergehende Bestimmung des oberen Begehrungsvermögens durch reine Vernunft) gewirkt wird, niemals aus Begriffen als mit der Vorstellung eines Gegenstandes notwendig verbunden, eingesehen werden kann, sondern jederzeit nur durch reflektierte Wahrnehmung als mit dieser verknüpft erkannt werden muß, folglich, wie alle empirische Urteile, keine objektive Notwendigkeit ankündigen und auf Gültigkeit a priori Anspruch machen kann. Aber, das Geschmacksurteil macht auch nur Anspruch, wie jedes andere empirische Urteil, für jedermann zu gelten, welches, ungeachtet der inneren Zufälligkeit desselben, immer möglich ist. Das Befremdende und Abweichende liegt nur darin: daß es nicht ein empirischer Begriff, sondern ein Gefühl der Lust (folglich gar kein Begriff) ist, welches doch durch das Geschmacksurteil, gleich als ob es ein mit dem Erkenntnisse des Objekts verbundenes Prädikat wäre, jedermann zugemutet und mit der Vorstellung desselben verknüpft werden soll.
Ein einzelnes Erfahrungsurteil, z. B. von dem, der in einem Bergkristall einen beweglichen Tropfen Wasser wahrnimmt, verlangt mit Recht, daß ein jeder andere es ebenso finden müsse, weil er dieses Urteil, nach den allgemeinen Bedingungen der bestimmenden Urteilskraft, unter den Gesetzen einer möglichen Erfahrung überhaupt gefället hat. Ebenso macht derjenige, welcher in der bloßen Reflexion über die Form eines Gegenstandes, ohne Rücksicht auf einen Begriff, Lust empfindet, obzwar dieses Urteil empirisch und ein einzelnes Urteil ist, mit Recht Anspruch auf jedermanns Beistimmung; weil der Grund zu dieser Lust in der allgemeinen obzwar subjektiven Bedingung der reflektierenden Urteile, nämlich der zweckmäßigen Übereinstimmung eines Gegenstandes (er sei Produkt der Natur oder der Kunst) mit dem Verhältnis der Erkenntnisvermögen unter sich, die zu jedem empirischen Erkenntnis erfordert werden (der Einbildungskraft und des Verstandes), angetroffen wird. Die Lust ist also im Geschmacksurteile zwar von einer empirischen Vorstellung abhängig, und kann a priori mit keinem Begriffe verbunden werden (man kann a priori nicht bestimmen, welcher Gegenstand dem Geschmacke gemäß sein werde, oder nicht, man muß ihn versuchen); aber sie ist doch der Bestimmungsgrund dieses Urteils nur dadurch, daß man sich bewußt ist, sie beruhe bloß auf der Reflexion und den allgemeinen, obwohl nur subjektiven, Bedingungen der Übereinstimmung derselben zum Erkenntnis der Objekte überhaupt, für welche die Form des Objekts zweckmäßig ist.
Das ist die Ursache, warum die Urteile des Geschmacks ihrer Möglichkeit nach, weil diese ein Prinzip a priori voraussetzt, auch einer Kritik unterworfen sind, obgleich dieses Prinzip weder ein Erkenntnisprinzip für den Verstand, noch ein praktisches für den Willen, und also a priori gar nicht bestimmend ist.
Die Empfänglichkeit einer Lust aus der Reflexion über die Formen der Sachen (der Natur sowohl als der Kunst) bezeichnet aber nicht allein eine Zweckmäßigkeit der Objekte im Verhältnis auf die reflektierende Urteilskraft, gemäß dem Naturbegriffe am Subjekt, sondern auch umgekehrt des Subjekts in Ansehung der Gegenstände ihrer Form, ja selbst ihrer Unform nach, zufolge dem Freiheitsbegriffe; und dadurch geschieht es: daß das ästhetische Urteil, nicht bloß als Geschmacksurteil, auf das Schöne, sondern auch, als aus einem Geistesgefühl entsprungenes, auf das Erhabene bezogen wird, und so jene Kritik der ästhetischen Urteilskraft in zwei diesen gemäße Hauptteile zerfallen muß.
VIII Von der logischen Vorstellung der Zweckmäßigkeit der Natur
An einem in der Erfahrung gegebenen Gegenstande kann Zweckmäßigkeit vorgestellt werden: entweder aus einem bloß subjektiven Grunde, als Übereinstimmung seiner Form, in der Auffassung (apprehensio) desselben vor allem Begriffe, mit den Erkenntnisvermögen, um die Anschauung mit Begriffen zu einem Erkenntnis überhaupt zu vereinigen; oder aus einem objektiven, als Übereinstimmung seiner Form mit der Möglichkeit des Dinges selbst, nach einem Begriffe von ihm, der vorhergeht und den Grund dieser Form enthält. Wir haben gesehen: daß die Vorstellung der Zweckmäßigkeit der ersteren Art auf der unmittelbaren Lust an der Form des Gegenstandes in der bloßen Reflexion über sie beruhe; die also von der Zweckmäßigkeit der zweiten Art, da sie die Form des Objekts nicht auf die Erkenntnisvermögen des Subjekts in der Auffassung derselben, sondern auf ein bestimmtes Erkenntnis des Gegenstandes unter einem gegebenen Begriffe bezieht, hat nichts mit einem Gefühle der Lust an den Dingen, sondern mit dem Verstande in Beurteilung derselben zu tun. Wenn der Begriff von einem Gegenstande gegeben ist, so besteht das Geschäft der Urteilskraft im Gebrauche desselben zum Erkenntnis in der Darstellung (exhibitio), d. i. darin, dem Begriffe eine korrespondierende Anschauung zur Seite zu stellen: es sei, daß dieses durch unsere eigene Einbildungskraft geschehe, wie in der Kunst, wenn wir einen vorhergefaßten Begriff von einem Gegenstande, der für uns Zweck ist, realisieren, oder durch die Natur, in der Technik derselben (wie bei organisierten Körpern), wenn wir ihr unseren Begriff vom Zweck zur Beurteilung ihres Produkts unterlegen; in welchem Falle nicht bloß Zweckmäßigkeit der Natur in der Form des Dinges, sondern dieses ihr Produkt als Naturzweck vorgestellt wird. – Obzwar unser Begriff von einer subjektiven Zweckmäßigkeit der Natur in ihren Formen, nach empirischen Gesetzen, gar kein Begriff vom Objekt ist, sondern nur ein Prinzip der Urteilskraft sich in dieser ihrer übergroßen Mannigfaltigkeit Begriffe zu verschaffen (in ihr orientieren zu können): so legen wir ihr doch hiedurch gleichsam eine Rücksicht auf unser Erkenntnisvermögen nach der Analogie eines Zwecks bei; und so können wir die Naturschönheit als Darstellung des Begriffs der formalen (bloß subjektiven), und die Naturzwecke als Darstellung des Begriffs einer realen (objektiven) Zweckmäßigkeit ansehen, deren eine wir durch Geschmack (ästhetisch, vermittelst des Gefühls der Lust), die andere durch Verstand und Vernunft (logisch, nach Begriffen) beurteilen.
Hierauf gründet sich die Einteilung der Kritik der Urteilskraft in die der ästhetischen und teleologischen; indem unter der ersteren das Vermögen, die formale Zweckmäßigkeit (sonst auch subjektive genannt) durch das Gefühl der Lust oder Unlust; unter der zweiten das Vermögen, die reale Zweckmäßigkeit (objektive) der Natur durch Verstand und Vernunft zu beurteilen, verstanden wird.
In einer Kritik der Urteilskraft ist der Teil, welcher die ästhetische Urteilskraft enthält, ihr wesentlich angehörig, weil diese allein ein Prinzip enthält, welches die Urteilskraft völlig a priori ihrer Reflexion über die Natur zum Grunde legt, nämlich das einer formalen Zweckmäßigkeit der Natur nach ihren besonderen (empirischen) Gesetzen für unser Erkenntnisvermögen, ohne welche sich der Verstand in sie nicht finden könnte: anstatt daß gar kein Grund a priori angegeben werden kann, ja nicht einmal die Möglichkeit davon aus dem Begriffe einer Natur, als Gegenstande der Erfahrung im allgemeinen sowohl, als im besonderen, erhellet, daß es objektive Zwecke der Natur, d. i. Dinge die nur als Naturzwecke möglich sind, geben müsse; sondern nur die Urteilskraft, ohne ein Prinzip dazu a priori in sich zu enthalten, in vorkommenden Fällen (gewisser Produkte), um zum Behuf der Vernunft von dem Begriffe der Zwecke Gebrauch zu machen, die Regel enthält; nachdem jenes transzendentale Prinzip schon den Begriff eines Zwecks (wenigstens der Form nach) auf die Natur anzuwenden den Verstand vorbereitet hat.
Der transzendentale Grundsatz aber, sich eine Zweckmäßigkeit der Natur in subjektiver Beziehung auf unser Erkenntnisvermögen an der Form eines Dinges als ein Prinzip der Beurteilung derselben vorzustellen, läßt es gänzlich unbestimmt, wo und in welchen Fällen ich die Beurteilung, als die eines Produkts nach einem Prinzip der Zweckmäßigkeit, und nicht vielmehr bloß nach allgemeinen Naturgesetzen anzustellen habe, und überläßt es der ästhetischen