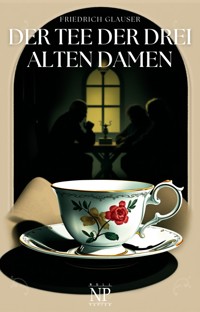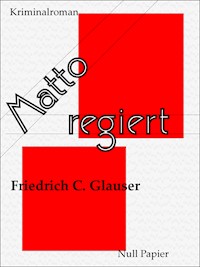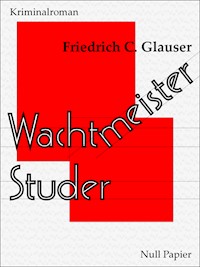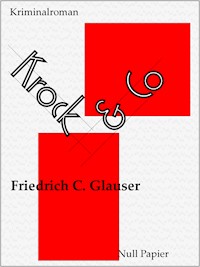
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wachtmeister Studer bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Wachtmeister Studer verheiratet seine Tochter in die Ostschweiz. Doch während die fröhliche Gesellschaft zu Abend isst, geschieht vor der Gaststube ein Mord, der den Fahnder in die fremden Verhältnisse eines Appenzeller Dorfes hineinzieht. Die Polizei vor Ort hat schnell einen vermeintlichen Täter verhaftet, doch Studer wittert komplexere Zusammenhänge und unternimmt seine eigenen Nachforschungen. Plötzlich nimmt die provinziell scheinende Angelegenheit internationale Züge an. Pressestimmen »Wird Glauser auch genug gelesen? Wir fürchten, nein - sonst ließe sich nicht überall so viel inhaltsleeres Zeug als Krimi verkaufen.« [T. Klingenmaier Stuttgarter Zeitung] »Glauser ist ein genauer Beobachter. Glauser beherrscht sein Handwerk. Er ist ein Schriftsteller, den es zu entdecken gilt. Wir empfehlen.« [HK Blitz! Leipzig] »Für Glauser war die Form des Kriminalromans ein Mittel, sich für die verschiedensten Themen einzusetzen. Es waren und es sind Themen, die ihm von eigenen Erfahrungen aufgedrängt wurden: Strafvollzug, Rauschgiftsüchtigkeit, Bedrängnis im Außenseitertum.« [Tages-Anzeiger] Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Friedrich Glauser
Krock & Co
Ein Wachtmeister Studer Kriminalroman
Friedrich Glauser
Krock & Co
Ein Wachtmeister Studer Kriminalroman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Morgarten, Zürich, 1939 4. Auflage, ISBN 978-3-954182-84-8
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Epilog
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Wachtmeister Studer bei Null Papier
Wachtmeister Studer
Matto regiert
Die Fieberkurve
Der Chinese
Krock & Co
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die Romane mit Wachtmeister Studer bei Null Papier
Wachtmeister Studer
Matto regiert
Die Fieberkurve
Der Chinese
Krock & Co
Andere Kriminalromane von Friedrich C. Glauser
Der Tee der drei alten Damen - Eine Kriminalgeschichte
Autor
Friedrich Charles Glauser (✳ 4. Februar 1896 in Wien; † 8. Dezember 1938 in Nervi bei Genua) war ein Schweizer Schriftsteller. Er gilt als einer der ersten deutschsprachigen Krimiautoren.
Schriftsteller zu sein, hieß für Friedrich Glauser zunächst, Gedichte zu schreiben. In der lyrischen Form glaubte er, sein inneres Erleben ausdrücken zu können. Vorbilder waren für ihn Stéphane Mallarmé und Georg Trakl; der Ton entspricht dem expressionistischen Tenor der Zeit am Ende des Ersten Weltkrieges. Doch keiner dieser Texte wurde gedruckt. Für die Sammlung seiner Gedichte, die Glauser 1920 zusammenstellte, fand sich kein Verleger. Seine Gedichte wurden daher erst posthum veröffentlicht.
In den letzten drei Lebensjahren schrieb Glauser fünf Kriminalromane, in deren Mittelpunkt Wachtmeister Studer steht, ein eigensinniger Kriminalpolizist mit Verständnis für die Gefallenen der Gesellschaft.
Der Kriminalroman »Matto regiert« spielt in einer psychiatrischen Klinik und man merkt ihm genauso wie den anderen Romanen an, dass der Autor eigene Erlebnisse verarbeitet hat. Mit eindringlichen Milieustudien und packenden Schilderungen der sozialpolitischen Situation gelingt es ihm, den Leser in seinen Bann zu schlagen.
Glauser ist nach der Auffassung von Erhard Jöst »einer der wichtigsten Wegbereiter des modernen Kriminalromans«. Seine Romane und drei weitere Bände mit Prosatexten wurden zwischen 1936 und 1945 veröffentlicht.
Glausers Nachlass befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern.
Bei einer Umfrage im Jahr 1990 unter 37 Krimifachleuten nach dem »besten Kriminalroman aller Zeiten« landete Wachtmeister Studer als bester deutschsprachiger Krimi auf Platz 4.
1.
WARUM WAR man nachgiebig gewesen? Warum hatte man Frau und Tochter den Willen gelassen? Jetzt stand man da und sollte womöglich die Verantwortung auf sich nehmen, weil man eigenmächtig gehandelt hatte und die Leiche nicht im Gärtlein geblieben war, hinterm Haus, dort, wo sie aufgefunden worden war…
Der Tote lag auf dem weißgescheuerten Tisch im Vorkeller des Hotels zum Hirschen, und über das helle Holz schlängelte sich ein schmaler Streifen Blut. Langsam fielen die Tropfen auf den Zementboden – es klang wie das Ticken einer altersmüden Wanduhr.
Der Tote: Ein junger Mann, sehr groß, sehr schlank, bekleidet mit einem dunkelblauen Polohemd, aus dessen kurzen Ärmeln die Arme ragten, lang und blond behaart, während die Beine in hellgrauen Flanellhosen steckten.
Und neben seinem Kopfe lag das Mordinstrument. Kein Messer, kein Revolver… Eine ungewöhnliche, eine noch nie gesehene Waffe: die Speiche eines Velorades, an einem Ende spitz zugefeilt. Sie war nicht leicht zu entdecken gewesen, denn sie hatte im Körper des Toten gesteckt und kaum aus der Haut herausgeragt. Erst als Studer mit der flachen Hand über den Rücken der Leiche gefahren war, hatte er sie fühlen können. Fast senkrecht war sie in den Körper gestoßen worden, dicht unter dem linken Schulterblatt, und nirgends herausgekommen – weder an der Brust noch am Bauch. Wie viele lebenswichtige Organe dieser Spieß durchbohrt hatte, würde der Arzt erst bei der Leichenöffnung feststellen können…
So wenig ragte das stumpfe Ende aus dem Rücken heraus, dass es eine Zange gebraucht hatte, um die Mordwaffe aus der Wunde zu ziehen.
Doch – um eine erste Frage aufzuwerfen – wie war der Mörder mit diesem Spieß umgegangen? Es musste doch ein Griff vorhanden gewesen sein – im Augenblick, da der Stich ausgeführt worden war. Hatte man ihn abgeschraubt? Nachher? Es schien fast so, denn eine kaum sichtbare, spiralig verlaufende Linie war in den stumpfen Teil eingeschnitten… Mechanikerarbeit, ohne Zweifel!
Wachtmeister Studer, von der Berner Fahndungspolizei, hätte ums Leben gerne eine Brissago angezündet, aber das ging nicht an, hier, gerade neben dem Toten. So blieb nichts anderes übrig, als hin und her zu laufen im schmalen und kurzen Raum, den eine Birne, baumelnd an einem staubigen Draht, mit einem grausam hellen Licht überschüttete. Und dazu dem Albert Vorträge zu halten…
Jedes dieser Selbstgespräche begann mit der Feststellung:
»Lü Bärtu! Worum, zum Tüüfu, hei mr uff d’Wybervölcher g’lost!«
Albert Guhl, ein kräftiger, breitschultriger Bursche, siebenundzwanzigjährig, Korporal an der Thurgauer Kantonspolizei und in Arbon stationiert, hatte heute Studers Tochter geheiratet.
– Hätte man, fuhr der Berner Wachtmeister zu fragen fort, die Hochzeit nicht gerade so gut in Bern feiern können? Nein, es hatte müssen durchgestiert werden, dass sie in Arbon stattfand. »Weil deine Mutter eine alte Frau ist und sich vor dem Reisen fürchtet? Gut, das ist ein Grund! Ein stichhaltiger?«
Albert Guhl schwieg. Und Studer hob seine mächtigen Schultern – die Hände machten die Bewegung mit und fielen dann klatschend gegen seine Oberschenkel…
»Und jetz?« fragte er weiter. Langsam näherte er sich dem Tisch, bückte sich und sah dem Toten ins Gesicht…
Ein unangenehmes Gesicht! Die Nase lang und gebogen, wie ein Geierschnabel, zwei Furchen gruben sich ein von den Nasenflügeln bis zu den Mundwinkeln, die fleischigen Lippen waren geschürzt, entblößten die Zähne – und es sah aus, als lächle der Tote mit all seinen Goldplomben. Und der Blick, bevor dem Toten die Augen zugedrückt worden waren! Studer erinnerte sich an ihn: geladen mit Hohn, im Tode noch!
Sah es nicht aus, als wolle sich der Ermordete lustig machen über die Überlebenden? Kaum hatte der Wachtmeister diese Frage gedacht, stellte er sie laut. Und Albert, der Schwiegersohn, nickte, nickte – aber er tat den Mund nicht auf.
Ob er das Reden verlernt habe, wollte Studer wissen.
Albert sah auf, schüttelte den Kopf und dann sagte er, bescheiden, ohne jeglichen Vorwurf:
»Wir hätten ihn liegenlassen sollen, Vatter.«
»Liegenlassen!… Liegenlassen!…« Studer ahmte gehässig den Tonfall des Jungen nach. »Liegenlassen! Damit die Bauern vom Dorf den Boden vertrampeln? Hä? Damit man gar keine Spuren mehr findet? Hä?«
»Spuren!« meinte Albert leise, mit viel versöhnlichem Respekt, der dem Wachtmeister wohltat. »Ich glaub, Vatter, dass man auf dem Boden nicht viel Spuren entdecken kann…«
– Weil er trocken sei wie–n–es Chäferfüdle? Hä? Das wolle der Junge wohl sagen? Dann solle er sich merken, dass ihm, dem Wachtmeister Studer (»mir, nur ein Wachmeischter Studer«, betonte er) die Aufklärung eines ähnlichen Falles gelungen war: da sei der Tote auf einem ebenso trockenen Boden gelegen – auf einem Waldboden! (Doch eigentlich war aller echte Ärger aus Studers Stimme verschwunden. – Der Wachtmeister tat nur so. Und Albert merkte dies ganz gut – er lächelte…) – Ganz recht! Auf einem Waldboden! Mit Tannennadeln drauf! wiederholte Studer und stieß seine Fäuste so tief in die Hosentaschen, dass in der plötzlichen Stille deutlich das Geräusch zerreißenden Stoffes zu hören war…
»Sauerei!« murmelte der Wachtmeister. – Nun werde er sein Portemonnaie verlieren… Und warum, seufzte er weiter, um der Tuusigsgottswille warum hatte man den Ausflug ausgerechnet nach diesem Schwarzenstein machen müssen?
»Aber Vatter!« sagte Albert. »Ihr habt doch selber den Hirschen zu Schwarzenstein vorgeschlagen!«
Studer brummte. Es stimmte, leider! Er hatte das Hotel vorgeschlagen. An der Mittagstafel in Arbon war von dem alten Brauch die Rede gewesen; am Hochzeitstag, hieß es, sei es Sitte, mit Kutschen irgendein Dörflein im Appenzellerland aufzusuchen… Und da war dem Wachtmeister eingefallen, dass in Schwarzenstein ein Schulschatz von ihm wirtete. Alte Liebe rostet nicht, sagt man, und somit waren nicht nur zwei Frauen (Studers Gattin und Tochter) am traurigen Ausgang des Festes schuld, sondern drei. Denn das Ibach Anni (jetzt hieß es übrigens Frau Anna Rechsteiner) musste man dazu zählen, das vor… – vierzig? – achtunddreißig? – kurz, vor vielen Jahren mit dem Studer Köbu in einem Dorfe des Emmentals zur Schule gegangen war…
Das arme Anni! Vor zehn Jahren hatte es den Karl Rechsteiner in St. Gallen zum Mann genommen, und das Ehepaar hatte dann das Hotel in Schwarzenstein gekauft, denn viele Feriengäste kamen im Sommer hier herauf. Zuerst war alles gut gegangen. Aber dann war der Mann krank geworden vor drei Jahren, und zwischendrin hatte er ins Südtirol fahren müssen – zur Kur.
»Auszehrung«, sagte Dr. Salvisberg, der den Kranken behandelte.
Und wirklich, der Rechsteiner sah schlecht aus. Studer hatte ihm, begleitet vom Anni, am Nachmittag einen Besuch abgestattet, und seither wurde er das Bild des Mannes nicht los. Das Gesicht vor allem: glatt, spitz, die linke Hälfte kleiner als die rechte –, die Hautfarbe… wie Lätt…
Ja, das Anni hatte es nicht leicht. Es hieß freundlich sein mit den Feriengästen, den kostbaren, damit sie übers Jahr nicht ausblieben! Denn sie brachten Geld ins Haus – und der kranke Rechsteiner brauchte viel! Für Arzt, Apotheke, Kuren.
Und nun dieser Mord! Er konnte die Feriengäste vertreiben – wer wohnt gern in einem Hotel, in dem ein Mord passiert ist? Ein solch geheimnisvoller noch? Für die Zeitungen war solch ein ›sensationelles‹ Verbrechen ein gefundenes Fressen! Und so hatte denn das Anni den Wachtmeister um Beistand gebeten. Konnte man solch eine Bitte abschlagen? Besonders noch, wenn sie von einem Schulschatz kam?
Ja, das Anni! Schon in der Schule hatte das Meitschi viel Mut und Tapferkeit gezeigt. Und wacker war es geblieben. Keine Klage, nur eine schüchterne Bitte, nicht einmal das – eine Behauptung eher: Der Jakob werde schon alles richtig machen…
Wieder stand Studer neben dem Tisch und betrachtete den Toten… Kopfschüttelnd nahm er die sonderbare Waffe in die Hand, trat unter die Lampe und untersuchte sie dort eingehend.
Und plötzlich machte er seine erste Entdeckung.
»Bärtu!« rief er leise. Als der Schwiegersohn neben ihm stand, hielt Studer zwischen Daumen und Zeigefinger ein steifes graues Haar. »Lüg einisch!«
»Hm!« meinte Albert.
– Was er mit seinem ›Hm‹ sagen wolle, erkundigte sich Studer gereizt. Ob die Thurgauer alle es vernälts Muul hätten? Was sei das für ein Haar?
»Kein Menschenhaar«, sagte der Albert vorsichtig.
Der Wachtmeister schnaufte verächtlich.
– Dass es kein Menschenhaar sei, könne ein zweijähriges Büebli sehen. Aber von was für einem Tier denn? Geiß? Lamm? Küngel? Pferd? Kuh?
Das Haar, das der Wachtmeister noch immer zwischen Daumen und Zeigefinger drehte, war dünn, steif und glänzend. Lang wie Studers Zeigefinger.
Albert meinte schüchtern, es sehe aus wie ein Hundehaar – worauf er zur Antwort erhielt, ein Polizist habe nicht zu raten, sondern er müsse seine Behauptungen auch beweisen können. Wie er auf den Gedanken gekommen sei, es könne ein Hundehaar sein?
– Weil bei der Ankunft der Gesellschaft ein langhaariger Hund um die Beine der Pferde gesprungen sei, dessen Fell exakt diese Farbe gehabt habe. Ja, auch die Länge des Haares stimme…
Studer nickte, klopfte seinem Schwiegersohn auf die Schulter und meinte: – Vielleicht werde doch noch etwas Rechtes aus ihm. Dann ging er zur Türe der Kellerkammer, riss sie auf, und der Zurückbleibende hörte Schritte, die eine Treppe hinanstiegen.
Nach fünf Minuten etwa war der Wachtmeister zurück. Er schob vor sich her ein kleines Männchen mit einer roten Knollennase, deren Gewicht den Kopf des Mannes nach vorne zog.
»Hocked ab«, sagte Studer und stellte einen Stuhl in die Mitte des Raumes, so zwar, dass der Sitzende den Toten nicht sehen konnte.
Und Wachtmeister Studer von der Berner Kantonspolizei begann wieder einmal jenes Spiel, von dem er in schwachen Stunden behauptete, es verderbe den Charakter – doch war es ihm dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen, dass er die Pensionierung vielleicht nur deshalb abgelehnt hatte, weil er es nicht missen konnte… Erstens gab es ihm Macht über seine Mitmenschen und zweitens kannte er dessen Regeln besser als mancher Untersuchungsrichter.
Das Spiel begann mit den üblichen Fragen.
»Name?« – »Küng Johannes.« – »Alter?« – »Neunundfünfzig.« – »Beruf?« – »Stallknecht.« – Also er habe die Leiche gefunden? – Ja. – Wo? – Im Garten hinterm Haus. – »Um welche Zeit?«
Das Männlein schwieg. Es rieb mit einem schwarzen Zeigefinger an seiner dicken Nase, stellte dann diese Beschäftigung ein, um eine riesige silberne Zwiebel mit viel Mühe – der grüne Schurz war ihm dabei im Weg – aus dem Gilettäschli zu ziehen; die Uhr wurde lange angestarrt und dann mit leiser Stimme geantwortet: »Viertel vor zehni!« Hierauf verschwand die Zwiebel.
»Sicher?« fragte Studer. »Wills Gott!« antwortete das Mannli. –Warum es dann bis Viertel ab zehn gedauert habe, bis die Wirtin benachrichtigt worden sei? – Er habe, erklärte Küng, zuerst den Pferden noch Haber geben müssen, denn die Gäste hätten doch um halb elf abfahren wollen.
– Und da sei der Tote einfach im Gärtli liegengeblieben? – Nicken, langes, schweigsames Nicken.
»Gut… Und habt Ihr den Toten erkannt?«
Wieder das schweigende Nicken, das den Wachtmeister langsam ungeduldig machte.
»So red doch, Küng!« sagte er ärgerlich. »Wer war’s?«
»Stieger hat er geheißen. Er ist jemanden besuchen kommen. Über den Sonntag. Der Stieger hat in St. Gallen gearbeitet. – Und die andere auch. Ich glaub«, Küng kratzte an seiner Nase, »ich glaub, sie arbeiten beide auf dem gleichen Büro.«
»Die andere?« fragte Studer. »Wie heißt sie?«
»Loppacher! Martha Loppacher. Sie hat Ferien, Erholungsferien hat sie gemacht – weil sie krank war… Vier Wochen ist sie schon hier.«
Schweigen. Studer hatte sein Notizbuch gezogen und schrieb die Namen ein mit seiner winzigen Schrift.
›Stieger‹, schrieb er, malte ein Kreuz hinter den Namen und ›Loppacher Martha‹. Dann wurde ihm plötzlich bewusst, dass alles bis jetzt wirklich nur ein Spiel gewesen war, denn was er da gefragt hatte, wusste er schon. Aber es war so viel anderes dazugekommen: Aufregung, das Schreien der Frauen, der Transport der Leiche. So fühlte der Wachtmeister das Bedürfnis, Ordnung in seine verwirrten Gedanken zu bringen.
»Vier Wochen?« fragte er gedankenvoll. »Und was hat sie in der Zeit getrieben?«
»Hä… Spaziergäng g’macht, g’lese… ond off de Wees g’schlofe… Ond karisiert…«
Studer blickte zu seinem Schwiegersohn hinüber, aber dem schien nichts aufgefallen zu sein. So musste sich denn der Wachtmeister ganz allein an der Ausdrucksweise des Küng Johannes ergötzen.
»Karessiert?« wiederholte er. »Wie meinet Ihr das?«
»Eh de Narre g’macht mit de Mannsbilder.«
»Mit wem? Mit allen? Oder nur mit einem?«
»B’sonders mit’s Grofe-n-Ernst. Isch gar en suubere Feger, de Grofe-n-Ernst…«
– Wie heiße der Mann? Graf Ernst? Und was treibe er? – Er sei Velohändler… – Was sei er? Velohändler? – Ja, Velohändler. – Und habe der Graf Ernst etwa einen Hund? – »Seb glob i!« – Was für einen Hund? – Die Herren hätten ihn sicher gesehen. Bei der Ankunft sei er um die Beine der Rosse gesprungen…
Studer sah den Hund deutlich vor sich: Eine Art Spitz, kein reinrassiges Tier, mit einem grauen Fell; dicht standen die starren Haare.
Velohändler? – Die Waffe war die Speiche eines Fahrrades! Und dieser Velohändler hatte auch noch einen Hund?… Halt! Ein Hundehaar und eine Speiche waren noch keine Beweise?… Nein! Es gehörte noch mehr dazu…
Vor allem musste man diesen Graf Ernst kennenlernen. Was hatte der Küng behauptet? Der Mann sei ein… ein… richtig! »En suubere Feger.« Darunter stellte sich Wachtmeister Studer einen Dorfgückel vor, einen hübschen, nicht sehr gescheiten Burschen, der es verstand, den Frauenzimmern schön zu tun. Umso erstaunter war er, als er auf seine Frage nach dem Alter des Graf Ernst die Antwort erhielt, der Mann sei über fünfzig.
»Über fünfzig?« wiederholte Studer erstaunt. Ob das nicht ein wenig alt sei für »en suubere Feger«? Da platzte das Mannli mit der roten Kartoffelnase los, es lachte und lachte. Dies Lachen aber machte den Wachtmeister wild, denn Studer verstand, dass man ihn verspotten wollte… Es war die Strafe dafür, dass er sich, als Berner Fahnder, in einem fremden Kanton mit einem Mordfall beschäftigte. Aber, weiß Gott, er hatte es ja nur getan, um dem Anni Ibach, dem Schulschatz aus vergangenen Zeiten, zu helfen!
Dieser Küng Johannes war das erste spürbare Hindernis. Wäre es nicht gescheiter, den Schwiegersohn vorzuschicken? Der stammte aus der Nähe und kannte die Gebräuche besser, auch die Sprache… Nein! Gerade dem Schwiegersohn musste man zeigen, dass man noch nicht zum alten Eisen gehörte, dass die ›Gäng-gäng‹, wie sie in der Ostschweiz die Berner nannten, keine Dubel waren…
2.
Die Hitze im Vorkeller war schier unerträglich. Fliegen summten um die Lampe, setzten sich auf das Gesicht des Toten, liefen über seine nackten Arme.
Dem Wachtmeister war das Spiel plötzlich verleidet. Studer hätte keinen Grund für seine plötzliche Müdigkeit angeben können. Er hatte den Verleider! Basta! Morgen kam der Verhörrichter mit seinem Aktuar und dem Chef der Appenzeller Kantonspolizei. Mochten die Herren sich dann weiter um den Fall kümmern. Das einzig Langweilige an der Sache war, dass niemand das Hotel verlassen durfte und die Hochzeitsgesellschaft deshalb hier übernachten musste… Ein teurer Ausflug würde das werden! Drei Kutscher, sechs Pferde… und die Hochzeitsgesellschaft: die Mutter des Albert, zwei Onkel, drei Tanten… Aus Bern waren nur die Eltern der jungen Frau mitgekommen. Studer nahm sich vor, mit der Mutter seines Schwiegersohnes die Kosten des Ausfluges zu teilen.
Er warf noch einen Blick auf den Toten und jagte den Albert und den Küng zur Tür hinaus; dann verlangte er von der Wirtin ein Leintuch, um die Leiche zuzudecken. Lange, sehr lange starrte er in das Gesicht des Toten. »Gemein!« flüsterte er. »Gemeinheit… Das ist das richtige Wort!« Und bedeckte das Antlitz endlich…
Dann löschte er endgültig das Licht, versperrte die Tür und begab sich in den ersten Stock. Seine Frau lag schon im Bett; darum trat er auf den Balkon hinaus, zündete eine Brissago an und blickte über das stille Land.
Die Straße war ein langes weißes Band, das sich rechts und links in der Dunkelheit verlor. Ein Bach plätscherte… Die Juninacht roch nach gemähten Wiesen, Blumen und verzetteltem Mist. Noch ein anderer Geruch drängte sich auf, den Studer zuerst nicht kannte. Aber dann wusste er plötzlich, was es war: Es roch deutlich nach rostigem, altem Eisen, das die Sonne erhitzt hat und nun die tagsüber aufgespeicherte Wärme ausatmet. Der Wachtmeister beugte sich vor und sah rechts von der Wirtschaft, am Straßenrand, einen baufälligen Schuppen. Und nun – ein Wolkenvorhang zerriss plötzlich, der Mond, nicht größer als ein Zitronenschnitz, streute sein Licht über die Landschaft – war rund um den Schuppen ein Gewirr zu sehen: Alte Räder, viel Draht, rostige Fassreifen… Auf der Schuppenwand aber schimmerte ein weißes Schild, auf dem mit dunklen Buchstaben stand:
Ernst Graf, Velohändler
Soso! »De Grofe-n-Ernst« – wohnte gerade neben dem Hotel ›zum Hirschen‹.
Im Schlafzimmer meinte eine verschlafene Stimme, der Vater solle doch ins Bett kommen. Morgen sei auch noch ein Tag. Da warf Wachtmeister Studer von der Berner Kantonspolizei seufzend die nur halb gerauchte Brissago fort, sodass sie auf der Straße unten wie ein missratenes Feuerwerk ein paar Funken von sich gab.
– Hoffentlich, meinte das Hedy noch, bringe diese Mordgeschichte den Kindern kein Unglück.
»Chabis!« sagte Studer, der nur im geheimen ein wenig abergläubisch war. Dann legte er den Kopf auf die gefalteten Hände und starrte in die Dunkelheit. Der Mond wanderte – nun schien er ins Zimmer und der Wachtmeister fand, er gleiche jemandem… Er grübelte, grübelte. Und plötzlich wusste er es: Der Rechsteiner, der kranke Wirt des Hotels ›zum Hirschen‹ hatte ein unregelmäßiges Gesicht, wie der Mond, der am Abnehmen war.
3.
Studer erwachte um halb vier. Draußen war es schon hell. Er stand leise auf, um seine Frau nicht zu wecken, nahm dann seine schwarzen Schnürschuhe in die Hand, schlich hinaus und über den Gang die Treppen hinab. An der Tür des Vorkellers blieb er eine Weile stehen, lauschte… Im ganzen Hause herrschte die gleiche Stille wie hinter der Tür. Sachte schloss Studer auf, trat in den Vorkeller und blieb vor dem Tisch stehen. Er wusste selbst nicht, was er hier wollte. Aber plötzlich kam ihm in den Sinn, dass er am Abend vorher die Kleider der Leiche nicht untersucht hatte. Er schlug das weiße Leintuch zurück – das Taschendurchsuchen würde nicht schwierig sein. Es kamen ja nur die Hosen in Frage…
Ein Portemonnaie… Vier Zwanzigernoten, drei Fünfliber, Münz… Ein Nastuch. Ein Sackmesser an einer Kette… In der hinteren Tasche ein dickes Portefeuille.
Briefe, Briefe, Briefe… »Herrn Jean Stieger, Sekretär, Bahnhofstraße 25, St. Gallen…«
Hm. Der Herr Stieger konnte sich nicht Johann oder Hans nennen wie ein gewöhnlicher St. Galler. Sondern ›Jean‹! Er hatte sich wohl eingebildet, es sei vornehmer.
Auf allen Briefumschlägen die gleiche Schrift. Zwanzig Umschläge – aber alle leer!