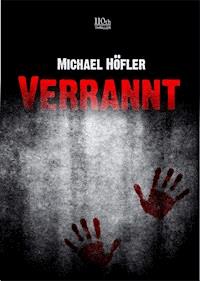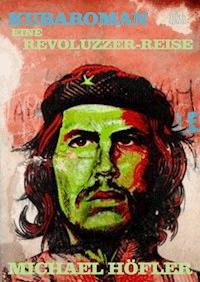
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Moritz (30) ist frustriert von der Sinnlosigkeit seines beruflichen Schaffens und wird von seiner Freundin Leni aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Eine spontane Reise nach Kuba soll ihm Ablenkung verschaffen. Doch dort trifft er auf Marta, in die er sich verliebt, und die ihn für ihre Sache begeistert. So wird Moritz zum Revoluzzer im Kampf gegen aufkeimenden Kapitalismus und Prostitution. Nach mehreren Aktionen gerät Moritz ins Visier der kubanischen Polizei und sein persönliches Abenteuer nimmt seinen Lauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KUBAROMAN
Eine Revoluzzer-Reise
von
Michael Höfler
Dem kubanischen Volk und der Gerechtigkeit.
Impressum
Cover: Karsten Sturm-Chichili Agency
Foto: fotolia.de
© 110th / Chichili Agency 2015
EPUB ISBN 978-3-95865-151-7
MOBI ISBN 978-3-95865-152-4
Urheberrechtshinweis
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Kurzinhalt
Moritz (30) ist frustriert von der Sinnlosigkeit seines beruflichen Schaffens und wird von seiner Freundin Leni aus der gemeinsamen Wohnung geworfen. Eine spontane Reise nach Kuba soll ihm Ablenkung verschaffen. Doch dort trifft er auf Marta, in die er sich verliebt, und die ihn für ihre Sache begeistert. So wird Moritz zum Revoluzzer im Kampf gegen aufkeimenden Kapitalismus und Prostitution. Nach mehreren Aktionen gerät Moritz ins Visier der kubanischen Polizei und sein persönliches Abenteuer nimmt seinen Lauf.
Über den Autor
Michael Höfler stammt seit 1971 aus München und lebt seit 2006 in Dresden. Er schreibt ironische Gedichte, satirische Kurzprosa u.a. für Titanic, Kurzgeschichten und Romane. Seine Semmeln verdient er in der psychologischen Forschung. Außerdem ist er Politiker für die Partei „Die PARTEI“.
Reisefrost
Ich musste nach Prag, weil ich fort musste. Fort aus Deutschland, hin nach Kuba. Vom Land der Devisen auf die Insel der Insolvenz. Von Leistungsterror und Gier zu Genügsamkeit und Glück. Mein Zug, der EC Alois Negrelli, nannte sich nach einem österreichischen Ingenieur, der „den schleusenlosen Suezkanal projektierte“.
Ich hatte mich dem „Projektieren“ verweigert, es nicht verstanden, die Dinge zu kanalisieren und eine Brücke zu bauen. Da eine Brücke an zwei divergierenden Polen schwer hält, saß ich alleine im Zugabteil. Aber nach Zwischenmenschlichem war mir erstmal nicht. Hoffentlich änderte sich das, wäre ich erstmal in humaneren Gefilden. Als nutzloser Germanist konnte ich die Dinge immerhin in Worte fassen.
Ich versuchte, mein von den Umständen umgewälztes Gehirn in den Entspannungsmodus zu dösen, aber eine Stimme quälte sich unerbittlich langsam aus dem Lautsprecher: „Unser Eurocity kommt heute erst um neunzehn Uhr fünfzehn zur Abfahrt.“
Plagte den Sprecher neben seinem Satzkonstrukt die eigene sächsische Intonation, oder war es ein Effekt der K&K-Technik des Retrozugs? Mit dem folgenden Tschechisch und dem Englisch anderer Stimmen kam das Gerät gut zurecht.
Kurz darauf, es war acht Uhr abends, blickte ich dem zur sächsischen Stimme gehörenden Bahnmann ins Angesicht. Die knochigen Schultern fast bis zu den Ohren hochgezogen stand er in meinem Abteil und kündigte eine Verspätung an. Ich bedankte mich für die persönliche Mitteilung, meinte, das sei kein Problem, da mein Flugzeug in Prag erst um sieben Uhr morgens fliege. Er parierte „das is keen Problem für unsern Zuch“, und ließ sich trotz der Banalität seiner Aussage keine Ironie anmerken. Aus dem Gebläse der Lüftung pfiff es unleidlich kalt, bald würde ich klangvolles Spanisch hören.
In dem samtroten Speisewagen dürfte schon manch Offizier einer Operettenarmee seinen Ranzen gepflegt haben. Meinem flachen Wanst empfahl der Kellner mit dem essgeübten Bauch: „Schweinbraten mit Knädel wird gern genommen, mein Herr“. Wo ich selbst gerade so gar keins hatte, versprach ich mir auch vom Verzehr eines Schweins keines.
Die Tischständer priesen Gerichte an, die die bewährte tschechische Fettküche mit dem Firlefanz drübergestreuter Kräuter und draufgetupfter Sahnekleckschen kombinierten. Auf der Speisekarte las ich „Transkarpatischer Borschtsch mit Sauersahne“, wollte lachen, aber meine Mundwinkel wollten nicht nach oben.
Dabei hatte ich vor vier Jahren, 2009, meine nun frische Ex-Freundin Leni bei unserem Kennenlernen auf der Party einer russischen Bekannten mit meiner flüssigen Aussprache des Doppel-„Sch“ erheitert. Bis die Gastgeberin mit dem Hinweis interveniert hatte, dass bereits ein einfaches „Sch“ der korrekten Intonation genüge.
Lenis „Sch“ war eher ein „Ch“, ihr „Borscht“ klang trocken; und nachdem sie mit ihrem Weinglas gegen meinen Rumpf gestolpert war und „meine Schuld“ gesagt hatte, hätte ich ihr allein der Aussprache wegen noch ganz anderes vergeben. Sofort verliebte ich mich in diesen Fehler. Wir unterhielten uns noch den ganzen Abend lang über die Modulationsspezifika verschiedener Idiome, über Lippen-, Zungen- und Gaumenlaute, ehe wir uns mit einem langen Kuss verabschiedeten, der alle drei Sprachwerkzeuge vereinte. Monatelang konnte ich dann nicht umhin, sie erstmal ausgiebig abzuknutschen, wenn ich sie mit ihrem spitzen Kinn und dem sanften Überbiss erblickte. Sex mit ihr war Nachtisch. Ein Jahr später trug sie eine süße Frucht im Bauch.
Um meinen auf dem Grund angelangten Glückshormonpegel zu heben, entschied ich mich für Schokoladenpalatschinken. Die schokoüberzogenen Gabelhappen spülte ich mit direkt trinkbarer Schokolade hinunter. Der Preis von drei Euro zwanzig fraß mir kein Loch ins Portemonnaie. Sparen war sinnlos, wo Leni mein Geld für unser dreijähriges Söhnchen Benni ablehnte. Ich war ein Nichtsnutz. Das stand fest und musste so bleiben.
Nach meinem Rauswurf bei ihr vor zwei Wochen hatte ich meinen Blues im Atelier meines Künstlerfreundes Rick gepflegt in einem 20qm-Raum ohne Bodenbelag und Fensterdichtung, der Raum in einem brachliegenden Ex-Amt der Staatssicherheit. Neben meiner Matratze Ricks Leinwände, Skulpturen, Malutensilien, Hämmer und Meißel. Zum Wohnen besaß ich noch einen Sessel und eine Elektroheizung aus dem Baumarkt, zum Waschen fließend kaltes Wasser. Wenn es mir zu lange dauerte, bis die Heizung wirkte, übte ich mich in den langen Gängen, Regalsälen und Maschinenräumen in Crossgolf und versuchte, mich der Sinnlosigkeit meines Tuns zu erfreuen. Immerhin trainierten diese Umstände mich Westberliner für den Spartanismus Kubas.
Ein barhäuptiger, tschechischer Schaffner mit großen Ohrläppchen trat an meinen Tisch. Er setzte mir auseinander, dass der Zug einer defekten Oberleitung wegen die andere Seite eines zischlautintensiven Flusses befahren müsse. In Kuba hätte ich nun sicher stundenlang dem Flicken der Leitung zusehen können.
Mein Mentalradio versuchte mich schon seit Tagen mit dem Ohrwurm „Hasta Siempre“ auf Dauerschleife einzustimmen, diesem zuckersüßen Lied, das seiner Lieblichkeit zum Trotz keine Karibikschönheit, sondern den „commandante Che Guevara“ „bis in alle Ewigkeit“ besingt. Mir gefiel der Ausdruck des Aufbegehrens darin.
In Deutschland hätte es zehnmal genug Grund dafür gegeben. Mensch-, tier- und naturverzehrendes Konsumieren und Wirtschaftswachstum waren alternativlos, denn alles baute darauf auf. Was funktionierte, bereicherte die Betuchten, was danebenging, wurde sozialisiert. Wer nur passiven Widerstand leistete, war ein Volksschädling. Und kein Che Guevara in Sicht, der dem Volk seine Abermilliarden zurückgab.
Auf der Suche nach einem Reiseziel in eine bessere Welt hatte sich Kuba in meinen Gedanken festgesetzt. Dort taten es fünfzig Jahre alte Straßenkreuzer noch, der Staat schützte seine Bürger mit Einheitslöhnen vor Leistungsdruck, und das Kapital konnte nicht jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben; wussten die Kubaner doch, die Schweinebucht zu verteidigen.
Vielleicht war angesichts meiner Nutzlosigkeit aber auch eine persönliche Revolution fällig.
Kurz vor Mitternacht rollte der Zug im Prager Hauptbahnhof ein. Die blondgesträhnte Dame am Schalter „domestic connections“ beantwortete meine auf Englisch gestellte Frage nach einer Verbindung zum Flughafen mit einem sparsamem „no“. Der zweistündigen Verspätung sei Dank fuhr tatsächlich kein „Airport-Express“-Bus mehr. Ich nahm’s als Entschleunigungstraining für knapp drei Wochen Kuba. Am internationalen Schalter hatte ein Kerl meines Alters mit farblosem Irokesenschnitt hörbar Freude an seinem Englisch und stattete mich mit dem Computerausdruck einer Alternativverbindung aus.
Fröstelnd verharrte ich in meiner sommerfrischen Windjacke an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Bahnhof. Eine dicke Joppe zwei Wochen lang durchs tropische Kuba zu schleppen, hätte wenig Sinn gemacht. Nach einer Weile, meine Zehen vermeldeten einen Anflug von Taubheit, versuchte ich, meine Mentaltemperatur durch Gedanken an Afroamerikaner, Vodoo und Bikinischönheiten zu erhöhen. Da beschimpfte mich vom Straßenrand her ein junges Weib in wüstem Tschechisch und warf seine Rastalocken um sich. Offenbar galt sein Zorn meinem sinnfreien Herumstehen in Segelschuhen und Zellstoffhose.
Das Warten im Frost erweckte mein Bewusstsein. Beruflich und privat hatte ich alles drangegeben. Diese Gewissheit sollte wehtun, tat es aber in diesem Moment nicht. Ich war ein unbedeutender Mensch unter Milliarden auf einem Planeten, der um einen von zehn Trilliarden Sternen kreiste. Zudem stand ich gerade um kurz vor Mitternacht vor einer leeren Straßenbahnhaltestelle in Prag. Welt und Sterne drehten sich weiter, egal wo ich stand, und wie es mir ging. Glück oder Unglück hingen davon ab, wie wichtig ich mich nahm. Kleines Ego, kleines Unglück.
Außerhalb der Prager Altstadt mit ihren prächtigen Altbauten und Jugendstilcafés schaukelte mich die Retrostraßenbahn durch ein Betongebirge ausgesucht scheußlicher sozialistischer Klötze. So hässlich konnte es in Kuba nicht zugehen, verwohnten sie dort doch noch all die mondänen Kolonialbauten.
An einem in Zugluft gehüllten Platz konterkarierte ein schirmbemützter Fahrer durch sein Schlafen im verschlossenen Gefährt mein Umsteigen in den Flughafenbus. Nochmaliges Bewusstseinsschärfen durch stoisch-konzentriertes Verharren machte keinen Sinn. So schreckte den Fahrer mein Klopfen auf, worauf er mir missvergnügt bedeutete, dass ich weiter vorne an der Straße einzusteigen habe, sobald die Zeit dafür gekommen sei. Zwanzig Minuten lang fror ich wie vor der Auslage eines Kachelofenladens.
Meine Reiseunterlagen enthielten keinen Hinweis, ob ich zu Terminal 1, 2 oder 3 musste. Um die Haltestellen der zuerst erreichten Terminals 3 und 2 erblickte ich nur Dunkelheit, und so stieg ich bei Terminal 1 aus. Optikfreie Parkhäuser und austauschbare Eine-Nacht-Hotels warteten mir auf, während Schneewehen meinen Horizont verkürzten. Allen Freunden hatte ich stolz verkündet, dass mit der Abreise der Winter für mich beendet sei.
Einige Minuten später und einige Grad Körpertemperatur weniger machte ich ein Gebäude aus, groß und hell genug, um ein Terminal zu beherbergen. Drinnen, im fast leeren Wartesaal, drehte ein Markensonnenbrillen-Träger zufällige Runden mit einem fabrikneuen Bohnerfahrzeug. Die Lautstärke sprach für eine hohe Putzleistung. Hightech säuberte die Halle, zum Schlafen war es zu kalt; ich übte mich im Nichtstun.
Vor dem Umsteigen tags darauf in Paris machte ich mir den Spaß, überall, wo das Flugpersonal nur durchließ, wer sich zur business/first class oder ̶ im neuen Dummsprech der Priviligierten ― zur „sky priority“ zählte, zu fragen, wo denn wohl gemeines Volk passieren dürfe. Ab dem zweiten Mal reihte ich mich einfach falsch ein und übersetzte den unvermeidlichen Verweis in die economy class laut in „Klasse der normalen Menschen“.
Andererseits ging es in Ordnung, dass die Großkopferten Mondpreise zahlten, um die Nase hoch tragen zu können und damit mein Ticket erschwinglich zu machen. Die Air France, mit der ich flog, bot gar eine „Premium Economy Class“ an die gleichen eng platzierten Sitze, aber durch eine an die Decke montierte Plastikscheibe abgetrennt. Damit die Mittelschicht sah, dass sie Aufstiegschancen besaß und die Gefilde der Teuertickets anzustreben hatte.
In der Einstiegsschlange für die Holzklasse stand ein Landsmann und Kubaprofi, die überlangen Arme vollständig tätowiert; er besprach einen des Deutschen mächtigen Echtkubaner. Dieser erfuhr, was der beste kubanische Rum sei, wo man sich vor Touristenabzocke vorzusehen habe, und dass es oft an Windeln mangle, niemals jedoch an Damenpflegeprodukten.
An Windeln hatte es unserem Goldköpfchen und Rotbäckchen Benni nie gefehlt. Allerdings hatte Leni auf der Ansicht bestanden, ein Baby benötige heute neben Windeln und Liebe auch Hightech im Kinderwagen, eine aus der Molekularküche gespeiste Breizubereitung und spätestens als Kleinkind Yoga, sowie Elektronikspielsachen, die die zarten Neuronen beschleunigten.
Mein Argument, dass Kinder einfach nur Kind sein sollten, prallte von Lenis Doktrin ab, dass jede verpasste Förderungschance eine unrevidierbare Unterlassungssünde sei. Diese Ansicht verstärkte Leni, indem sie sich mit gleichgesinnten Müttern sozialisierte. Bei meiner Minderheitsansicht blieb mir nur passiver Widerstand. Wenn ich allein mit Benni war, weil Leni arbeitete, gab es normalen Brei. Vermehrtes Rülpsen infolgedessen genügte mir an Krankheitssymptomatik, um ihn nicht zur Kleinkind-Wellness bzw. zum „freien Tanzen“ zu bringen.
Mein Favorit in der Unterhaltungsbox am Vordersitz im Flugzeug war das Wellness-Programm für die in der Holzklasse eingepferchten Passagiere. Nach der ersten Übung, Hände falten und reiben, vermutete ich allerdings schon, wie es weiterginge und schloss nach einer Runde Augenmassage die Sehorgane.
Dazu wehte den ganzen Zehn-Stunden-Flug in die Karibik über der Winterwind der Klimaanlage. Auf dem Vordersitz setzte der Kubaexperte seinem Nachbarn lautstark den gerade unvermeidlichen Pferdefleischskandal auseinander.
Als Verweigerer des Fleisches aus Tierfabriken freute ich mich auf das Biofleisch in Kuba, denn des technischen Rückstands wegen musste dort alles Tierische vollbio sein. Dank US-Wirtschaftsembargo war seit 1960 kaum Technologie nach Kuba gelangt, Kuba zu bio gezwungen. So war nun eine schöne Fleischdiät auf die USA fällig.
Bienvenudo!
Der Flughafen Havanna erlaubte als einer der letzten der Welt das Rauchen. Zumindest praktizierte dies eine Gruppe braunhäutiger Einheimischer vor mir in der fensterfreien, irgendwann mal in einem Erdton gestrichenen Halle. Die Warteschlangen vor der Passkontrolle erstreckten sich über die gesamte Raumausdehnung.
Als Gelegenheitsraucher gefiel mir der Anlass, ich bat die Einheimischen auf Pseudospanisch, auf Englisch, dann per Handzeichen um eine Fluppe. Ein Vollbartträger mit ausgewaschenem T-Shirt reichte mir eine und steckte sie mir an. Ich saugte so langsam ich konnte, sagte „Kuba“, drehte Däumchen und lächelte. Der Gesichtsbehaarte meinte „si, amigo“ und streckte den Daumen hoch. Ich schloss mit Kuba Freundschaft, ehe ich richtig angekommen war.
Eine leidliche Stunde später, Ortszeit halb fünf nachmittags, stand ich vor einem der 22 Schalterhäuschen, durch die man ins Land gelangte. In schlechtem Spanisch vermochte ich zu sagen, dass ich schlecht Spanisch sprach. Mit meinem Bemühen, es dennoch zu versuchen, wollte ich bei dem mit zwei Silbersternen auf der Schulter dekorierten Seňor Beamten punkten. Zudem wusste ich auf Spanisch zu siezen und damit eine in diesem Sprachraum selten gewährte Respektsgeste zu erweisen.
Beides schien nötig, denn vor einer Woche hatte ich mich geweigert zu glauben, dass die Kubaner auf den Nachweis einer privaten Auslandskrankenversicherung bestanden. So war die Police, vor drei Tagen für neun Euro telefonisch erworben, bis zur Abreise nicht an Ricks Privatadresse geliefert worden. Das Geld hatte ich rausgeworfen; andererseits konnten die neun Euro kaum die Verwaltungskosten, geschweige denn einen möglichen Versicherungsfall, decken. Damit musste ich der Ergo, der Assekuranz mit den Nutten-Incentives, immerhin minimal geschadet haben.
Der schnauzbärtige Seňor parierte mein „buenas dias“ mit einem „buenas tardes“ guten Abend. Später kam mir, dass man sich im spanischen Sprachraum schon ab Mittag einen guten Abend wünscht. Statt mein Stammelspanisch zu erwidern, wies mich der Dienstmann auf Englisch an, einen Schritt zurückzutreten, worauf eine Minikamera ein Foto von mir schoss. So unsortiert wie meine dunkelblonden Locken auf dem Kopf klebten, die Augen vom Schlafentzug geschrumpft, sah ich meinem Ausweisbild gerade nicht besonders ähnlich. Ich hoffte, dass dem Obrigkeitsmann die Leberflecke auf der Wange auffielen.
Er las mir mein Geburtsdatum, 5.6.1982, vor. Dann bestand er darauf, meine Bordkarte mit dem Gepäckabschnitt zu sehen. Ruhig griff ich in meinen überpackten Minirucksack. Schließlich zog ich das zerfledderte Stück aus einer Untiefe der Gesäßtasche und strich es auf der Ablage vor dem Beamten glatt. Er hörte auf, mit den Fingerspitzen auf das Holz zu trommeln, hob das Dokument mit Daumen und Zeigefinger hoch, sprach langsam meinen Namen Moritz Klingbeil, blickte noch mal maßvoll despektierlich auf den Gepäckabschnitt und sagte „danke und Willkommen!“. Als sich hinter Schalter und mir die Durchgangstür schloss, verstand ich, dass der desolate Zustand meiner Bordkarte mich ins Land gebracht hatte.
Vor mir warteten zwei Dutzend Hotelabgesandte den Gästen mit mehrheitlich handgemachten Namensschildern auf. Die Größe der Empfangshalle glich gerade mal der einer Gymnasiumaula; Schlangen wanden sich vor den Devisenwechselschaltern, um Platz zu finden.
Draußen lockten die vom Flugkapitän versprochenen 27 Grad. Ich atmete jedes einzelne ein. Königspalmen bestätigten, dass ich an den richtigen Ort gereist war.
Hier galt es fürs Taxi ins 27 Kilometer entfernte Centro Habana anzustehen. Ich reihte mich in eine der drei Schlangen ein. Ein Brillenträger mit im Richtungsweisen geübten Armen dirigierte die eintreffenden gelben, roten und andersfarbigen, privaten, Taxis abwechselnd zu den Reihen.
Für mich sah er nach dreißig Minuten einen lange gebrauchten Lada vor. Ich zahlte dem niedrigfrequent kaugummikauenden Fahrer den Standardtarif von 25 Dollar in der gleichwertigen Währung „Peso convertibile“, kurz „CUC“.
Zwar gab es keinen der Ökologie zuträglichen Kollektivbus, aber ein schwedisches Seniorenpaar durfte zum gleichen Preis in den Lada steigen. Er trug sein graues Resthaar fingerlang und in zufällige Richtungen frisiert, sie ihr dickes Aschblond zusammengesteckt. Ihrem Jacket mit Blassblumenmuster nach wären sie besser in großer Gruppe gereist.
Die Frau Elisabeth, wie sie sogleich erwähnte, führte als Zusatzgepäck den Rollstuhl mit, in dem sie saß, dafür war ihr zweiter Koffer verlustig. Die zwei vorhandenen Koffer der beiden passten samt zusammengefaltetem Rollstuhl gerade noch hinten in den Lada. Ein Stoffseil half ihn zuzubekommen. Schließlich assistierte ich Elisabeths Mann, Anders, seine kräftige Frau und die Gepäckstücke auf die Rückbank des Ladas zu hieven.
Anders erklärte in akzentfreiem Deutsch: „Der Koffer von Elisabeth ist gelb mit rotem und blauem Gurt umgewickelt wie meiner, aber jetzt woanders unterwegs. Wir haben aber schriftliche Bestätigung, dass Koffer morgen an Flughafen ist.“
Im an Überfluss armen Kuba passten sie bestimmt besser auf ihre Habseligkeiten auf, führten aber weniger genau Buch.
Der Fahrer trat mit Bedacht auf die fragilen Pedale von Gas und Kupplung, fingerte den Gang ein, und es ging los. Um uns klobige Blechkarossen in Olivgrün, Blassrot und Stahlblau, zwar noch keine tiefergelegten Cadillacs und Chevrolets, aber Fords mit ausladenden Felgen und lenkradgroßen Rundscheinwerfern. Ästhetisch konturiert wie Jahrzehnte vor der Globalisierung. Die heile Welt wurde von den Rußwolken kaum getrübt, die sie hinter sich her zogen; nur eine Minderheit besaß hier ein Automobil.
Elisabeth neben mir stupste mich an. Ein Hund wachte auf dem Dach eines Hauses; es sah aus, als vertrüge es kein Pfund Last mehr. Anders erzählte, dass Elisabeth Guerilla-Gärtnerei an den Schnittstellen der unschönen Schnellstraßen im Zentrum Göteborgs betrieb. Drei Freundinnen trügen sie vom Straßenrand aufs brache Grün der Kreuzungsinseln, und zu viert säten und pflegten sie Sonnenblumen, Mohn und Wildblumen. Ich konnte immerhin beisteuern, dass mir beim Crossgolfen in Dresden noch keine Guerilla-Pflanzen in den Weg gekommen waren.
Standhafte Behausungen wechselten sich mit partiell bis vollständig einsturzreifen Schuppen und elenden Bretterhütten, aber auch mit gepflegten Kolonialvillen ab. Vor einer Hütte steckten eifrige Weiber diverse Schnittblumen zusammen, mancher Handel schien zu florieren.
Elisabeth und Anders mussten aussteigen, sie hatten sich in einem Stadtrandhotel einquartiert. Ich wünschte ihnen eine erfreuliche Reise, sie mir „nette Bekanntschaften“.
Elisabeths Frage nach dem Grund meines Alleinreisens hatte ich wahrheitsgemäß mit der Trennung von Leni beantwortet. Beide lächelten sie mich nun wohlwollend an; mir gefiel, wie ungewöhnlich sie unterwegs waren. Fast hätte ich ihnen noch zu ihrem Mut gratuliert, mit Rollstuhl in ein Land wie Kuba zu reisen, merkte aber noch, dass manch sensibel Gemeintes eine Gemeinheit ergibt.
An einer Ampel lieferten sich zwei Herren einen Lautstärkewettbewerb in Simultanbeschimpfung. Neben ihnen hielt ein dottergelber, Lkw-artiger Schulbus mit schwarzen Längsstreifen; ich kannte die Art Gefährt aus US-amerikanischen Filmen. Das Schulsystem musste in Kuba besser und für die Armen zugänglicher sein.
Schlichter Beton dominierte den Baustil, als das karibische Meer hinter einer Schnellstraße auftauchte, der berühmten Küstenavenue Malecon. Ohne dass der Blick durch Menschen, Pflanzen oder sonst was abgelenkt wurde, faltete sich das hässlichst-bizarrste Betongebirge auf, das ich bislang gesehen habe Filme eingeschlossen. Dagegen konnte Prag einpacken. Die Betonwürfel grauten dem Auge. Als wolle man die folgenden Generationen gänzlich vom Bau jedweder Behausungen abbringen. Ein Hochhaus glich mit seinen Lüftungslamellen einer achtzig Meter hohen Küchenreibe, und inmitten anderer Suizidarchitektur thronte ein stolzer Reiter auf hohem Ross. Überhängende Betontribünen harrten neben einer abgegrasten Wiese ihrem Einsturz, daneben ragten mehrere Dutzend wohnblockhohe Zementspitzen in den Himmel. Weitschweifende Bögen aus Stahlrohren stellten schließlich den Versuch dar, die Umgebung künstlerisch aufzuwerten.
Der Taxifahrer sagte „hier ist die amerikanische Botschaft“ und meinte einen Zementquader, der hier immerhin nicht negativ auffiel. Kleine Sühne der USA für ihr Wirken in Kuba vor und nach der Befreiung von den Spaniern, wenn man dem Geschmack Absicht unterstellte.
1895 hatten die USA den Kubanern geholfen, die spanischen Besatzer rauszuwerfen, um danach ihrerseits das Land von allem zu erleichtern, was die Spanier ins Land getrieben hatte und sich in Bares verwandeln ließ. Havanna durfte sich mit dem Beinamen „Paris der Tropen“ respektive „Bordell Floridas“ schmücken. Ex-Sergeant und Präsident Fulgencio, der Schlächter“, Batista hatte 1959 höchstselbst mit angepackt und nach der Niederlage seiner Truppen gegen Fidel Castro, Che Guevara und Co. vierzig Millionen in bar in die dominikanische Republik exportiert.
Das Taxi bog ab. Im Halbdunkel ging es vorbei an augenscheinlich nie gestrichenen Blocks, leeren Läden und durch die Häuserflucht einer Avenida, deren prächtige Vergangenheit den Fassaden die Form gegeben hatte. Pittoresk verengte sie sich zum Fluchtpunkt des wolkendurchsetzten Horizonts in Orangerot.
Nach einigen Abbiegemanövern und zweimaliger Passantenbefragung fand der Taxifahrer meine Unterkunft, die Casa Maria. Eine der auf der Straße parlierenden Damen war bereits die Tochter meiner Herbergsmutter Marias. Teresa hatte braunes, wellig geföhntes Haar und zog ein Bein etwas nach. Obschon sie mein Alter haben durfte, gerierte sie sich mehr wie eine Seňora denn wie eine Seňorita.
Es dauerte, ehe sie ein Vorhängeschloss am gusseisernen Tor aufgesperrt und einen mächtigen Riegel beiseitegeschoben hatte. Mein Blick fiel auf den Riesenbalkon des Hauses gegenüber. Vor Jahrzehnten mussten die einzelnen Parzellen Anstriche in Orange-, Rot- und Brauntönen erhalten haben. Wie in Deutschland überblickten Senioren von oben die Straße, doch hier gingen die Blicke entspannt ins Nichts. Eine Loggia wurde von rot-weiß gestreiften Markisen überdeckt, wie ich sie von der Adria kannte.
Mit einem Urlaub dort hatte ich Leni und Benni überraschen wollen, bevor ich erfahren hatte, dass es da längst nicht mehr so idyllisch wie in meiner Erinnerung von 1988 zuging. Stattdessen mussten nunmehr Nepp und Prostitution regieren.
Für den Urlaub zu dritt hatte ich beim Kellnern im gerade beliebtesten Restaurant des Dresdner Ausgehviertels Neustadt einiges Trinkgeld angespart.
Nach unserem Trennungskrach wollte Leni nichts mehr von meinen inzwischen auf Kroatien umdisponierten Urlaubsplänen wissen. Schließlich stand fest, dass ich verantwortungslos in den Tag lebte. Da könne ich mir auch Zahlungen für Bennis Unterhalt sparen.
Genau auf das in den Tag leben aber sollte ich mich nun freuen. Meine im Internet herausgeputzte Herberge erkannte ich erst im ersten Stock, wo sich der weitläufige, mit diversen Sitzgruppen aus Dunkelholz im Kolonialstil möblierte Empfangs- und Aufenthaltsraum auftat. Ich entdeckte die goldumsäumten Spiegel, die Portraits von Familienmitgliedern und Heiligen und die beiden altrosa lackierten Säulen.
Teresa zeigte mir mein Zimmer, es lag neben drei anderen entlang des sich dahinter erstreckenden Balkons. Der Raum war groß, am größten in der dritten Dimension, die Massivholzverkleidung der Decke fünf Meter über dem Boden. Für 22 Euro pro Nacht schlossen gusseiserne Girlanden das Doppelbett ab, es gab einen Safe, eine Minibar und je einen Minikronleuchter in Zimmer und Bad.
Nachdem Teresa mir unter ausdrucksarmer Mimik alle technischen Abläufe um Schlüssel und Codes erklärt und mich angewiesen hatte, kein Gesinde von der Straße und auch sonst niemanden reinzulassen, wollte sie Bares sehen.
Es meldeten sich Hunger und Durst, um gestillt zu werden. Der nahe Supermarkt war schon zu, seine Regale hätten allerdings im Kapitalismus einen Räumungsverkauf, genauer: dessen Ende, vermuten lassen. Es gab keine bunten Werbeschilder, nur fahles Licht und Menschen auf der Straße. Doch auf den zweiten Blick taten sich in vielen Häusern Nischen- und Fensterläden auf. Hinter offenen Fenstern offerierten Einheimische auf Blechtabletts eine Handvoll Sandwiches, Burger, Hotdogs oder Teigtaschen, sowie handverlesene Getränkedosen aus antiken Kühlschränken. Alles lokaler Herkunft. Für mich gab es das Menü Schinkentoast mit Orangenlimonade, und es schmeckte.
Einer steinernen Bäckerei mit Dickbrettregalen kaufte ich zwei Stückchen Kuchen ab. Doch die Bäckersfrau wollte sie mir erst aushändigen, nachdem ich eine Plastiktüte aus meinem Kleinrucksack zum Einpacken auf der Theke flachgedrückt hatte. Plastik war hier ein teures Gut, auf den Weltmeeren schwamm es in Ensembles von Ländergröße herum und füllte die Mägen von Fischen und Vögeln.
Ich bezahlte jeweils in CUC und bekam als Wechselgeld Volks-Pesos. In einer Richtung waren die beiden Währungen konvertibel.
Dunkelheit hatte sich inzwischen der Stadt bemächtigt und ich mir von der Herberge nur Name und Hausnummer eingeprägt, von der Straße nur den Anfangsbuchstaben L. Doch ein Viertel lernt man am besten kennen, indem man sich verläuft.
Ich frug Passanten und Herumstehende nach meiner casa bzw. gab ihren Namen als Antwort auf die Frage, was ich denn suche. Mehrere hätten eine andere casa für mich gehabt, einer wollte mich sogleich zu einer führen, freilich kannte niemand die Casa Maria. Ein bestens deutsch parlierender Schotte eröffnete mir in einer Art Nachtkantine, dass ich in dieser für ganze sieben CUC hätte prima nächtigen können. Allerdings zu dritt in einer Bude. Mit den Klischees seines Landes sollte man verantwortungsvoll umgehen.
Ich sah einen alten Herrn mit großem Kopf und schmalem Körper. Er zog zwei Hundewelpen in einem zusammengenagelten Anhänger hinter sich her. Der Mann pfiff vergnügt, grüßte mich unbekannterweise. Die Hunde guckten neugierig, während sie ihre Pfötchen auf das Holzbrett des Anhängers stützten.
Hier im Stadtzentrum wirkte alles ärmlich. Umso geschäftiger wuselten die Menschen umher, hatten einen Draht, einen Karton oder ein Stück Seil füreinander oder wussten lautstark Informationen weiterzugeben. „Sociolismo“, wie ich gelesen hatte: Sie bildeten soziale Netzwerke, um in jeder Not- und Mangelsituation aufgefangen zu werden. So ähnlich musste es zu Beginn menschlichen Wirtschaftens, im „Ur-Kommunismus“, zugegangen sein dem System des langfristigen Ausgleichs. Die von praktisch allen Ökonomen herbehauptete Art von Tauschwirtschaft, wo nach jedem Tausch die Tauschpartner quitt auseinandergegangen seien, hat es nie gegeben, wie ich in einem Buch namens „Schulden die ersten 5000 Jahre“ gelesen hatte.
Irgendwann hatten mich dann meine Beine von allein zur Casa Maria getragen. Aus der Minibar im Zimmer öffnete ich eine Dose „Bucanero“, namentlich Seeräuberbier. Ich begann einen Gedanken um Piraterie und Umverteilung, nickte aber während des Trinkens noch im Sitzen ein. Davon, dass ich bald selbst ein Revoluzzer sein sollte, träumte ich nicht mal.
Bessere Welt
Am nächsten Morgen leuchteten die Fassaden in ihren blassen Restfarben. Der Anblick des Meeres bedeutete, dass ich nur ein paar Blocks von Malecon und Meer entfernt wohnte. Meine Füße liefen von selbst in die Richtung. Einen Block weiter hatte jemand ein Seil über die Straße gespannt. Daran hingen zwei Dutzend abgetretene Schuhe, zusammengebunden an den Schnürsenkeln. Aktionskunst, die die Vergänglichkeit des Konsums zeigte? Ich fragte einen alten Mann, der auf der Bordsteinkante ein Stück Draht zu einer Art Dreikantschlüssel zurechtbog. Seiner Antwort entnahm ich, dass die Straßenjugend so ihr nicht mehr benötigtes Schuhwerk entsorgte. Die, die sie nun trugen, mussten besser sein.
Kurz vor der Malecon verpassten zwei schwarze Arbeiter einer Hausfront einen mintgrünen Anstrich. In einem Laden daneben formte eine schwarze Seňora die Lippen ihres Furchengesichts zu einem Kussmund. Sie musste mich meinen. Charmant von ihr, so abwegig ihr Flirten auch war.
Ich bog in den Malecon Richtung Westen. Für eine Flaniermeile waren hier seine Fahrbahn zu breit und das Trottoire zu schmal. Dafür ging es an prächtigen Bögen- und Säulenfronten entlang, teils mit arabischen Ornamenten.