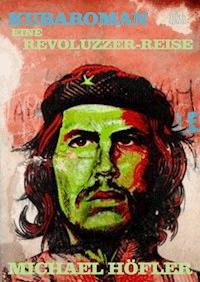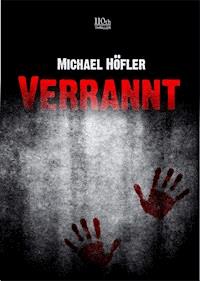
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der achtjährige Tobias zwingt seinen jüngeren Bruder Dennis zu einer Mutprobe. Das dadurch ausgelöste Unglück lässt Tobis angeborenen Idealismus zur Verbissenheit werden. Als junger Neurochirurg verrennt er sich in seinem Streben nach medizinischem Fortschritt, zerstört sein Leben und das eines Patienten, während Dennis sich ungeahnt entwickelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verrannt
Roman
von
Michael Höfler
Impressum
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
EPUB ISBN 978-3-95865-095-4
MOBI ISBN 978-3-95865-096-1
© 110th / Chichili Agency 2014
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Prolog
Alfons Gigl hätte noch ein halbes Jahr gehabt. Mindestens. Sechs, sieben, acht Monate im Kreise seiner Familie, die ihn umsorgt, getröstet, begleitet hätte. Noch einmal mindestens wären seine Frau, seine beiden Söhne und die drei Enkel mit ihm durch die Heide bei Bad Tölz gegangen, wo er die Wildblüten gesehen hätte und nebenan das späte Laub mit seinen prächtigen Farben, kurz bevor es herabfällt. Vielleicht wäre Alfons Gigl sogar noch ein Frühling vergönnt gewesen.
Freunde und Familie hätten mit ihm ihre Trauer um sein Schicksal teilen können so wie er mit ihnen seine Angst vor dem Tod und die Hoffnung auf ein Wiedersehen danach. Sie wären beisammen gesessen unter Erinnerungen an die schönsten, bewegendsten, anrührendsten Momente seines Lebens. Vor allem aber hätten sie sich von ihm verabschieden können.
Der Tumor mit den heimtückischen Ablegern wäre sein Tod gewesen ― später, aber dank moderner Schmerzmedizin hätte er nicht leiden müssen. Stattdessen habe ich wie ein Irrer versucht, die tödlichen Zellen aus seinem Gehirn zu schneiden. Um die Unbill in meinem eigenen auszumerzen. Weil ich fast dreißig Jahre zuvor bereits mit dem Ziel zu helfen zwei Leben zerstört hatte, wie ich glaubte, und in der Folge ein weiteres.
Erster Teil
1.
Mein Bruder Dennis war mit seinen froschartig rollenden Augen und den in alle Richtungen wuchernden Locken das selige Kinderleben in Person. Am Rosenmontag 1981 kasperten die Worte „kein Hosenschontag“ aus dem stets halboffenem Mund. Er konnte sein Clownkostüm nicht finden. Pullis und Hosen flogen über seine Schulter, aber der bunte Flickenumhang war nicht dabei. Gleichzeitig murmelte er Dinge wie „Spaßvogel, Sahnekogel“ oder „einen Clown kannst nicht versau´n“. Dabei muss ich mein Gewicht im Sekundentakt von einem Bein aufs andere verlegt haben, weil wir vor dem Kinderfasching in der Turnhalle noch dringend etwas zu erledigen hatten.
Meine Indianersachen hatte ich längst an: Die Hose mit den Fransen an den Seiten und das Hemd mit den roten und weißen Karos auf der Brust. Dieses Gewand wäre meine zweite Haut geworden, hätte der Fasching länger als eine Woche gedauert. Es sollte den Tag nicht überleben.
Ich liebte das Indianerkleid derart, dass ich es draußen keine halbe Stunde sauber halten konnte. Mama sagte immer schon prophylaktisch: „Wildleder ist nie richtig sauber zu kriegen!“
Als Indianer musste ich freilich im Staub der Straßen und Felder gegen Cowboys kämpfen, sonst hätte ich gleich ein Matrose sein können, der, wie ich fand, nur langweilig auf seinem Schiff herumstand. Wenn die Apachen durch die Prärie streiften, trugen sie schwerlich saubere Klamotten, der Dreck der Erde glich sie der Umgebung an.
Ich muss bereits meine Silberbüchse mit einer frisch eingespannten Tausendschussrolle gehalten haben. „Genau die gleiche wie Winnetou“, hatte Papa versichert, als ich sie zwei Wochen davor bei meinem Geburtstag ausgepackt hatte.
Dennis wühlte die Kiste durch, in der er Playmobil und Lego aufbewahrte. Mama kam freudestrahlend ins Zimmer, hielt den Flickenumhang mit dem forschen Ordnungshabitus von Ariels Klementine hoch: „Ich habe deinen Anzug nochmal gebügelt“. Wie immer, wenn alles ordentlich und sauber war, lächelte sie. Dann stülpte sie Dennis das Clown-Kostüm über den Kopf. Ich schämte mich an Dennis’ Stelle, aber er ließ sich derlei gefallen.
Die Clownperücke zog sich Dennis selbst über den Lockenkopf, aber falsch herum. Er grinste albern, man sah vom Gesicht nur Mund und Kinn. „Lässig, oder?“, fand er. Ich drehte ihm den Kopfschmuck richtig herum, damit er die schwarzen Charlie-Chaplin-Schuhe sah, in die er noch schlüpfen musste.
„Mein Bruder“, nannte ich ihn. Wie Winnetou Old Shatterhand. Dabei hatte ich keinen Cowboy oder wenigstens Trapper zum Bruder, sondern einen albernen Clown.
Ein Clown im Wilden Westen war so nützlich wie Leuchtraketen, wenn man auf hoher See vor Piraten auf der Flucht war. Dafür stellte ein Clown mich vor die Aufgabe, ihn mit meiner Silberbüchse zu schützen, ihm zu helfen, wenn ihn Banditen, Räuber, böse Menschen bedrohten. Später als Arzt sollte ich weit komplexere Instrumente als Hilfsmittel an die Hand bekommen.
„Jetzt schick dich endlich! Wir müssen noch zu den Giesebrechts!“, drängte ich Dennis. In einer dreiviertel Stunde begann die Faschingsparty in der Turnhalle, und Giesebrechts wohnten einige Straßen dahinter. „Giesebrechts, Miesepechs“, dichtete Dennis. Aus jedem Namen machte er einen komischen Reim.
Lukas Giesebrecht ging in die 3a, meine Parallelklasse, und Dennis in die erste. Tags zuvor hatte Lukas Dennis hinten am Schulranzen gepackt und mit dem Gesicht in einen Haufen Hundescheiße getaucht. Als ich hinrannte, floh Lukas und lachte im Weglaufen dreckig. Wir wuschen dann Dennis’ Gesicht gründlich im Bach, ehe wir nach Hause kamen. Mama sollte nichts mitbekommen, sie hätte nur unnötigen Aufhebens gemacht. Als großer Bruder konnte ich solche Dinge selbst regeln.
An diesem Tag musste Lukas allein zuhause sein, denn seine Mutter ging samstagnachmittags schwimmen und der Vater zu den Bayern ins Stadion.
Zuvor beim Gassigehen hatte Carlos eine Riesenwurst gelegt, so dick und lang, wie es nur ein Bernhardiner hinbekam und mit der Konsistenz eines halbfrischen Kuhfladens wie bei Opa und Oma in Huglfing. Aber die Wurst stank weitaus ärger. Als ich sie mit einem Taschentuch aufhob, musste ich mir mit der anderen Hand die Nase zuhalten, wobei sie in zwei gleichgroße Teile zerbrach. Ich wickelte die Scheißehälften in die Seiten der Zeitung mit den großen Buchstaben aus dem Mülleimer und legte sie in den Schuhkarton, den ich mithatte. Es würgte mich, und ich musste tief durchatmen, um nicht zu erbrechen.
Wir läuteten an allen Klingeln im achten Stock, um ins Haus zu gelangen, Giesebrechts wohnten im fünften. „Dennis, klopf du, ich halte mich zum Anzünden bereit“, entschied ich oben. Dennis klopfte vorsichtig. „Du musst das lauter machen, das hört er doch gar nicht!“. Nun pochte er mit dem ganzen Umfang seiner Miniaturfaust an die Tür. „Wer da?“, hörte man Lukas von drinnen. Ich drehte fest am Rad meines Feuerzeugs, sogleich brannte die Zeitung, und die Überschrift „Flammen auf der Ostsee“ wurde pechschwarz. „Als nächstes brennst du!“, rief ich, so laut ich konnte, Richtung Tür, packte Dennis an der Hand und zog ihn die Stufen hinunter. Wir versteckten uns in der Treppenhausecke ein Stockwerk tiefer, von wo wir Lukas’ Tür gerade noch sehen konnten.
Sie ging auf, während das Paket heftig loderte. Brennender Hundekot stinkt noch ärger als der frischste gefüllte Düngercontainer; sogar Stinkbomben können dagegen nicht anriechen. Lukas blickte so blöde aus der Wäsche wie Klementine und unsere Sportlehrerin Frau Scholzhuber zusammen. Er schrie „Bäähhhh!“, legte die Hand um den Hals und verschwand unter würgenden Kieferbewegungen in der Wohnung.
Dennis begann zu husten, benötigte beide Hände, um sich die Nase zuzuhalten. „Boooah, so eine Kacke!“, kam es mühsam aus ihm. Mit der zugehaltenen Nase klang er wie ein verstimmtes Lamm.
„Lass uns eine Fliege machen“, sagte ich, und wir überschlugen uns fast vor Lachen und Stolpern, als wir die Treppen hinunter rannten.
„So, und nun kommst du endlich mit über den Spinnerbogen“, entschied ich. Bisher hatte er sich nie getraut, die Abkürzung zur Straße Richtung Turnhalle zu nehmen. Wenn er sich nicht bald zusammenriss, bliebe er für immer der Junge, den die anderen in den Schwitzkasten nahmen. Sogar Ronja aus seiner Klasse legte ihn beim Raufen aufs Kreuz. Ein Mädchen!
„Spinnerbogen“ nannten wir das seltsame bogenförmige Bauwerk aus Beton, das ein Kunstwerk von Spinnern war, wie Papa uns erklärt hatte. Jemand musste eine lange dünne Scheibe von einer grauen, zur Mitte hochgebogenen Brücke abgeschnitten haben, so kam es uns vor. Ein riesiger Indianerbogen ohne Pfeil, um den jemand von oben bis unten Beton gegossen hatte.
An den Seiten des Bogens waren mit der Zeit immer mehr Farbkleckse dazugekommen. Zufällig wusste ich, dass die Ritzer-Brüder mit ihren Farbdosen, die sie in der Tankstelle klauten, die Täter waren. Im Winter zogen sie Dennis die Mütze ins Gesicht. Davor fragten sie: „Schisshase, hast du Paris schon mal bei Nacht gesehn?“ Wenn Dennis nein sagte, meinten sie: „Dann wird’s Zeit!“. Antwortete er ja, hieß es: „Dann siehst du’s gleich nochmal!“
„Ich hab keine Lust“, schützte Dennis Langweile vor. Dabei war er ein Schisser. „Und ich habe keine Lust, wegen dir Angstbenny den Umweg um die drei Blocks zu laufen.“
Der Bogen stand genau zwischen den beiden einzigen Häusern, zwischen denen der Weg nicht durch Dornenbüsche versperrt war. Auch links und rechts des Spinnerbogens wuchsen drei Meter große Büsche, wir konnten nur über den Bogen durchkommen.
Ich legte mir die Silberbüchse mit dem Band um die Schulter, machte meinen Rücken rund wie eine Katze, damit ich mit Händen und Füßen Halt bekam. Ich drückte mich mit den Beinen ab und zog mich mit den Armen hoch. Oben, wo es flach ist, stand ich auf, drehte mich vorsichtig um und breitete wie ein Seiltänzer langsam die Arme aus. Ich sah auf die Büsche links und rechts hinunter. Ich nahm die Silberbüchse vom Rücken und schoss in die Luft. Wie Winnetou, wenn er mit seinen Apachen angriff.
„Willst du endlich ein Mann sein oder immer ein Waschweib bleiben?“, rief ich Dennis zu. Er stand noch immer unten. „Waschweib, Klatschleib“, dichtete er und robbte los. Mit der Hingabe eines Faultiers rutschte er voran. Nach ein paar Metern blieb er liegen wie Mamas gefüllter Wäschesack.
„So wird das nichts, weiter! Und schneller!“ Er schob seinen kleinen Körper trotzig voran, bis er nur noch drei Meter von mir weg war. „Du kannst jetzt aufstehen.“
Wie ein verschreckter Straßenkater blickte er zu mir hoch. Ich ging die zwei Schritte zu ihm, sagte genervt „Jetzt komm, steh auf!“ und packte seine Hand.
Er stand. Aber unbeweglich wie ein Storch. „Jetzt gehe!“ Ich hielt seine Hand hoch, seitlich, wie ein Mann beim Opernball die einer Frau. Dennis setze einen Fuß hinter den anderen, alberte mit zittriger Stimme: „Seiltänzer, Schulschwänzer“.
„Super, Dennis, bist doch kein Schisser!“
Nun standen wir beide ganz oben. „Jetzt du allein!“, befahl ich, ließ ihn los und ging ein paar Schritte voran. Die Stirn unter Dennis’ roter Perücke runzelte sich. Sein kleiner Mund ging noch weiter auf als sonst, und er guckte ein großes Loch in die Luft. „Hab dich nicht so, mach einfach immer nur einen Schritt.“
Er trat mit dem hinteren Fuß nach vorne, setze ihn auf. Dabei traf er mit seinem riesigen Schuh den Betonstreifen nur zur Hälfte. Ich sah, wie er wankte. Schnell griff ich mit der Hand nach ihm, bekam ihn am Unterarm zu fassen. Doch ich konnte ihn nicht halten. Seine Hand krallte sich an meinen Arm, er zog mich mit zur Seite. Ich spürte, dass ich selbst abzustürzen drohte. Machte meine Hand auf, ließ seine los. Er kippte zur Seite. Und fiel. Es zog mich im Bauch, als ob ich selbst stürzte. Ich schwankte, balancierte, konnte mich halten. Zugleich hörte ich Dennis’ Schrei, sah wie sein Körper sich nach unten drehte, der Kopf voran. Es knirschte und krachte, als er ins Gebüsch fiel.
„Dennis!“ „Denniiissss!“ Ich starrte nach unten. Aber zwischen den vielen Ästen und Zweigen erkannte ich nur seinen bunten Flickenanzug und die rote Clownperücke. Nichts bewegte sich. Und es war totenstill.
Lieber Gott, lass mich sterben, aber mach, dass Dennis lebt! Dennis, bitte! Nächste Woche sollte er in die zweite Klasse kommen. „Erste Klasse, Babyflasche — zweite Klasse, Untertasse“, hatten wir gerufen.
Heulend trottete ich den Bogen hinunter, spürte den feisten Geschmack des Rotzes auf meinen Oberlippen. Mit der Silberbüchse versuchte ich, mich durchs Gebüsch zu Dennis durchzuschlagen. „Dennis, sag was! Bitte! Damit ich weiß, dass du nicht tot bist!“ Es blieb still. Nur das Knacken der Zweige. Geräusche, die ich selbst machte. Stacheln und spitze Zweige zerrten an Ärmeln, Hose, Brust. Mein Indianerkostüm war hundertfach festgetackert von den Dornen des Buschs. Ich kam nicht weiter. Auch die Silberbüchse steckte fest. Es musste an Händen, Hals und im Gesicht kratzen. Ich spürte nichts.
„Tobi!“, vernahm ich die Stimme einer Frau von hinten. Sie klang erschrocken. „Was machst du da?“
Ich kannte sie, aber wer war’s? „Denniiiis“, schluchzte ich und brachte das s kaum noch heraus. Ich spürte große Hände um den Bauch, sie packten mich, zogen an mir, rissen mich nach hinten. Ich musste die Silberbüchse zurücklassen, aber sie hatte ohnehin versagt.
Frau Giesebrecht starrte mich entgeistert an: „Tobias, um Himmels willen! Deine Sachen sind ja ganz zerrissen und du blutest überall.“ Sie holte ein Stofftaschentuch heraus und tupfte mein Gesicht ab. Ich stand nur da und blickte zur Erde. „Was hast du bloß in dem Gebüsch verloren?“
Ich hob nicht den Kopf, nur den Arm, deutete in den Busch, schluchzte: „Dennis ist da drin. Er ist tot! Ich habe ihn umgebracht!“
2.
„Es wird alles gut, mein Schatz“, versprach Mama und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Doch sie klang, als weinte sie auch. Weinte wie ich. Ich will sterben, wünschte ich, merkte, dass es kein fieser Traum war, aus dem ich aufwachen konnte.
Papa war schnell gekommen. Gleich nach der Feuerwehr und dem Notarzt. „Ich habe ihn getötet“, hatte ich gleich gestanden. Papa blickte versteinert, ich war bereit für jede Strafe. Aber er nahm mich einfach in den Arm, drückte mich an seinen Bauch.
Frau Giesebrecht sollte mich nach Hause bringen, während die Feuerwehr sich mit riesigen Scheren und einer Motorsäge durch das Gebüsch kämpfte. Ich protestierte: „Lasst mich hier bleiben, ich muss Dennis helfen!“
Als Frau Giesebrecht mich an der Hand nahm, wollte ich mit Händen und Füßen um mich schlagen. Stattdessen trottete ich mit ihr mit und vergrub mein Gesicht im Ellbogen.
„Was ist mit ihm, ist er tot?“, wollte ich zum hundertsten Mal von Mama wissen. Ihre sonst so gütig strahlenden Augen sahen blass und müde aus, dennoch streichelten ihre weichen Hände meinen Nacken. Es fühlte sich merkwürdig an, in dem Moment den Pfirsichgeruch ihrer hellblonden, gewellten Haare zu riechen. Sie wischte sich über die Augen, schnäuzte, versprach: „Sein Schutzengel wird ihm helfen. Ganz bestimmt.“
Das Telefon klingelte. Ich streckte den Kopf hoch. „Vetter“, meldete sich Mama. Sie schwieg eine Weile. Dann sagte sie „Tschüss Schatz“, legte auf und kam zu mir. Sie verkündete „Dennis lebt“, bemühte sich um ein Lächeln und streichelte meinen Hinterkopf. Nun fing sie selbst an, hörbar, wenn auch leise, zu weinen. Nachdem sie geschnäuzt hatte, sagte sie: „Sie haben ihn fertig operiert, sagt Papa. Die Ärzte sind sich sicher, er wird es schaffen.“
Papa stellte mir einen Nusscremetoast und eine Tasse Kakao zum Frühstück hin. „Nun iss was, Tobi!“, munterte mich Mama auf.
„Ich esse erst wieder, wenn Dennis auch essen kann!“
„Dennis isst schon wieder“, behauptete Papa. „Aber nicht wie du etwas Festes mit Messer und Gabel und dem Mund, sondern Flüssignahrung durch einen Schlauch, der in seinem Arm steckt.“
Ich glaubte Papa nicht, obwohl er immer die Wahrheit sagte. Skeptisch holte ich mir einen Strohhalm aus dem Schrank und trank damit von dem Kakao.
„Wie haben die Ärzte ihn operiert?“
Papa erklärte: „Er hatte eine Blutung im Kopf, sie mussten ihm den Schädel öffnen, um den Druck zu lindern.“
Mein Blutsbruder, dachte ich abermals und kämpfte gegen meine Tränen.
„Wenn wir alle für ihn beten, wird er gesund, mein Schatz“, sprach Mama. Sie küsste mich auf die Stirn, wo drei kleine Pflaster klebten, mit denen sie mich am Vortag versorgt hatte. Mir wurde warm im Rücken. Dabei konnte ich nicht verstehen, warum meine Eltern so lieb zu mir waren. Sie hätten mich bestrafen müssen, wo allein ich schuld war.
„Ich will sofort zu Dennis!“
Papa antwortete: „Wir gehen erstmal vormittags alleine hin, nachmittags darfst du mitkommen.“
„Nein! Ich muss sofort dabei sein!“
Papa blickte zu Mama, aber sie schwieg.
„Na gut, dann kommst du gleich mit.“
Noch nie hatte ich so ein riesiges Krankenhaus gesehen. Genau genommen war ich in noch gar keinem gewesen, aber so groß hatte ich mir es nicht vorgestellt. Ärzte und Ärztinnen in weißen Kitteln liefen endlose Gänge entlang, manche trugen Eisenkopfhörer um den Hals ― Stethoskope zum Atem abhören, wie Papa erklärte. Und alle schienen es eilig zu haben.
In dem Laden am Eingang gab es Blumen, Süßigkeiten und Kuscheltiere. Zuhause hatte ich mein Sparschwein geschlachtet und nun genau acht Mark 73 in der Hosentasche. In einem Regal saß ein kleiner Teddybär auf seinem Po und streckte Ärmchen und Beinchen nach vorne. Um seine runden Backen schien er zu lachen. Ich nahm den Teddy aus dem Regal und sagte zu der Verkäuferin „den will ich“. „Kostet neunfuchzig, junger Mann.“ Mein Geld reichte nicht, doch ich musste Dennis unbedingt diesen Teddy schenken.
Papas warme Hand legte sich auf meinen Kopf, er drückte der Verkäuferin einen Zehn-Mark-Schein in die Hand, sagte „stimmt so“. Mama kaufte noch einen riesigen Strauß aus weißen und gelben Blumen.
„Dennis!“, rief ich meinem Bruder entgegen, nachdem ich die Tür aufgerissen hatte und an sein Bett stürmte. Doch dann erschrak ich, denn ich erkannte ihn kaum: Die linke Hälfte seines Kopfes war eine Glatze. Kahl wie der Mittelteil seiner Clownperücke. Seitlich am Hinterkopf klebte ein Riesenpflaster, an seinem Arm hingen durchsichtige Plastikschläuche. In das Bett hätte er zweimal gepasst, und überall standen Apparate, die blinkten und piepten.
„Dennis“, sagte ich erschrocken, küsste ihn vorsichtig auf die rechte Backe und streichelte seine Schulter. „Es tut mir so leid“, kämpfte ich gegen die Tränen, die aus meinen Augen schossen, und setzte ihm den Teddy auf den Bauch. Der Teddy lachte ihn an. Dennis’ Gesicht war dick und rot und gleichzeitig weiß. Zuerst blickte er fragend auf den Teddy, dann auf mich. Er lächelte. Wie ein Fisch, mit weit geöffnetem runden Mund, bewegte er stumm die Lippen auf und zu. „Dennis, sag doch was!“, ermunterte ich ihn. Er grinste kurz, fast wie nach unserem Streich gestern. Dann zuckte er mit der Schulter. Als wolle er sich dafür entschuldigen, dass er nicht mit mir sprechen konnte.
Dabei war ich es, der sich für alles zu entschuldigen hatte. Wahrscheinlich konnte er gar nichts für seine Ängstlichkeit. Er war einfach als Schisser auf die Welt gekommen. Und ich hatte ihn zu einer Mutprobe gezwungen, die ihn schwer verletzt hatte.
Mama küsste Dennis vorsichtig auf die Stirn und streichelte seinen Bauch. Er bewegte sich kaum. Säuberlich sortierte sie die Sachen, die sie mitgebracht hatte, in seinen Nachttisch: Den hellblauen Goofy-Schlafanzug, Unterhosen, T-Shirts, seine Cord-Puschen, usw.
Es klopfte an der Tür. Zwei Ärzte und eine Krankenschwester kamen herein. Sie stellten sich um Dennis’ Bett, Papa entschied: „Wir müssen jetzt wieder gehen.“
Ich widersprach: „Nein, ich bleib bei Dennis!“
Papa zog mich an der Handfessel: „Komm, wir besuchen ihn morgen wieder.“
Ich musste gehorchen. „Bis morgen, mein ehemaliger Schisshase“, rief ich Dennis im Fortgehen über die Schulter zu.
Auf dem Gang schoben andere Ärzte einen Jungen in einem Bett vor sich her. Ich erschrak abermals. Sein Gesicht war kaum zu erkennen, so viele rote und gelbe Blasen wucherten auf seiner Haut. Was davon zu erkennen war, sah gleichzeitig feucht und vertrocknet aus. „Was hat er?“, wollte ich wissen. „Verbrennungen“, antwortete Papa und zog mich weiter. Ich musste an Lukas Giesebrecht denken. Ihn hätte es noch schlimmer erwischen können als Dennis.
3.
Das Paket war riesig. Wenn man es auf den Kopf stellte, reichte es Dennis fast bis zur Hüfte. Grüne und blaue Karos bedeckten das honiggelbe Geschenkpapier. Dennis griff sich das Paket, hob es langsam hoch und schüttelte es zaghaft. Eine kleine Sinfonie aus feinen Klackergeräuschen erklang. Inzwischen konnte er wieder alles bewegen, aber vieles sah wie Zeitlupe aus.
Er formte die Lippen, bewegte die Zunge, so als wollte er „Lego“ sagen. Er strahlte bis über beide Ohren, nahm einen Buntstift und ritzte damit die Verpackung auf. „Das schöne Papier“, hätte Mama normalerweise gesagt; aber diesmal schwieg sie. Stattdessen kullerte eine Freudenträne ihre Wange herunter.
Als Dennis erkannte, dass es sich um eine Lego-Burg handelte, legte er hintereinander Mama und Papa die Wange an den Bauch. Er zerlegte den Rest des Kartons, befreite die Burg von ihrer Verpackung und begann, Steine in den Noppenboden zu stecken. Dabei verschwendete er keinen Blick für die Anleitung.
Ich wollte ihn nicht stören, doch platzte ich vor Neugier, wie er mein Geschenk fände. „Dennis, ich habe auch was für dich.“ Augenblicklich drehte er sich um und sah mich rundäugig an. Ich drückte ihm mein ― viel kleineres ― Päckchen in die Hände. Zwischen uns drängte sich Carlos und schnupperte daran. Als hätte ich eine Bockwurst verpackt. Was er da wohl roch? Ich packte sein schwarzes Halsband und zog ihn weg. In das Krankenhaus, das Mama und Papa „Reha“ nannten, durfte er, anders als in das erste Krankenhaus, mitkommen.
Dennis drehte das Päckchen zwischen den Händen, es klackerte gröber als das von Mama und Papa. Mit großen Fragezeichen in den Augen blickte er mich an. Er riss es auf und sah die Kassette: „Das Aztekenschwert“ von den Drei Fragezeichen.
Vor dem Unfall hatte er sich die Folge „Der Monsterberg“ aus der Bücherei geliehen. Es ging um ein zotteliges Tier, das im Bergwald Kaliforniens die Einwohner erschreckte. Als wir nach dem Anhören den Isarberg im Herzogpark hochstiegen, rief Dennis auf einmal: „Das Bergmonster!“ Er zeigte auf einen Mann mit ungepflegten Haaren und brauner Langfelljacke, der uns entgegen kam. Ich hätte laut kichern können, wäre es mir nicht so peinlich gewesen, wie merkwürdig der Mann uns ansah.
Nach zwei Monaten war Dennis immer noch in der Reha. Von seinem Zimmer aus sah man die Laubbäume des Parks, der zum Krankenhaus gehörte. Er hatte ein eigenes Zimmer, in dem inzwischen gut die Hälfte seiner Spielsachen verstreut lagen.
Überhaupt drehte sich nun alles um Dennis. Mama versorgte ihn mit frisch gewaschener Kleidung ― für jeden Tag einen kleinen Stapel. Beim Essen sprachen Mama und Papa immer wieder über Betreuungsangebote, wie sie es nannten. Er sollte optimal gefördert werden. Ich verstand nicht genau, was sie meinten.
Doch ich kapierte, dass sie sich kaum noch für mich interessierten. Wenn ich Einsen und Zweien nach Hause brachte, sagte Mama „prima“ und spülte weiter, während Papa kaum hörbar hinter seiner großen Zeitung grunzte. Es machte mich traurig. Doch dann sah ich auf Dennis’ leeren Stuhl. Ich musste alles dafür tun, dass er bald wieder darauf säße und Reime machte wie „Leberknödel, Eberdödel“. Dann würde sich auch wieder jemand für mich interessieren.
Zwei Wochen vor unserem Besuch hatten die Ärzte das Loch in Dennis’ Kopf zugenäht. Durch das Loch konnte der durch den Aufprall entstandene Druck im Kopfinneren entweichen, hatte Papa erklärt ― wie die Luft aus einem Ballon, der zu fest aufgeblasen ist. Es klang logisch. Und einfach. In dem Moment hatte ich zum ersten Mal die Idee, Arzt zu werden.
Dennis sprang auf und schob die Kassette in den Rekorder. Wir hörten die Titelmelodie „Die Drei Fra – ge - zeichen ... Die Drei Fra – ge – zeichen“. Dann sprach Alfred Hitchcock:
Als Justus Jonas und Bob Andrews nach dem Unterricht die Schule verließen, machte ihr Freund Peter Shaw sie darauf aufmerksam, dass Diego Alvaro auf sie wartete. Doch als die Drei Fragezeichen auf den Parkplatz der Schule kamen, sahen sie zuerst einmal nur ihren Erzfeind Skinny Norris und einen ständigen Cowboy.
„Ständiger Cowboy“ klang komisch, doch Dennis’ Pupillen wuchsen, und er begann, die Lippen zu bewegen. Auf einmal tönte etwas aus ihm — etwas, das wie „Kau“ klang. Ich konnte es kaum glauben, zum ersten Mal hatte Dennis wieder gesprochen. Mama und Papa standen mit halboffenen Mündern da, schauten, als hätten sie falsch gehört. Doch „Kau“ kam es nochmal aus Dennis’ Mund und nach ein paar Sekunden: „Boy ... boy ... Cowboy.“ Mama und Papa umarmten ihn und nahmen mich dazu.
Als wir uns verabschiedeten, war ich glücklich wie seit Monaten nicht mehr. Der Unfall hatte ihn vielleicht doch vom Clown zum Cowboy gemacht.
Jeden Tag hatten wir Dennis in der Reha besucht. Und jedes Mal hatte ich jeden Mann und jede Frau in weißem Kittel gefragt, wann Dennis endlich wieder spräche. Alle hatten sie Dinge geantwortet wie „Geduld, mein Junge“.
Eine Frau kam jeden Tag und machte eigenartige Übungen mit ihm. Sie ähnelte Mama ein wenig mit ihren hochstehenden Augenbrauen und der langen, schlanken Nase, obwohl ihr blonder Pferdeschwanz schon leicht ergraut war.
Einmal war ich dabei. Die Frau sprach ihm langsam Wörter wie „Papa“, „Mama“ und „Auto“ vor. Dabei gingen ihre Lippen auf und zu wie die eines Froschs, nur noch langsamer. Dennis sah sie gelangweilt an, aber machte ihre Lippenbewegungen nach. Er ist doch kein Kleinkind, dachte ich, doch die Frau schien zu wissen, was sie tat.
„Wann spricht er endlich wieder?“, wollte ich von ihr wissen. Sie zog mich aus dem Zimmer, ließ mich auf einem Hocker Platz nehmen und kauerte sich vor mich, sodass sie mir genau in die Augen blickte. Sie fasste mich an beiden Händen: „Als dein Bruder zur Welt kam, hat er auch noch nicht gesprochen. Und deine Eltern hatten keine Ahnung, wann er damit anfangen würde. Trotzdem haben sie monatelang mit ihm geredet, ohne eine Antwort zu bekommen. Am Anfang hat er nur einzelne Silben gesagt, die keinen Sinn ergaben. Später klangen die Silben wie Wörter, und dann wurden einfache Sätze daraus. Die Sätze enthielten immer weniger Fehler, und schließlich konnte er kompliziertere Dinge sagen. Dein Bruder ist gerade wie ein siebenjähriges Baby, das das Sprechen neu lernen muss. Je mehr er hört, und je mehr du mit ihm sprichst, umso schneller und besser wird er es wieder lernen.“
Darauf war mir die Idee mit der Kassette gekommen.
Als wir Dennis drei Wochen später aus der Reha nach Hause holten, klebte immer noch das große Pflaster links hinten auf seinem Kopf. Die Haare waren kaum nachgewachsen. Mit seinen schwarzen Locken auf der anderen Kopfseite glich er einem Irokesen, nur dass die Haare nicht bunt waren. Den Kopf durfte er weiterhin nicht duschen. Mama tupfte ihm vorsichtig mit dem Waschlappen das Gesicht ab. Dennis runzelte die Stirn und fasste sich an die Schläfe. Er biss die Zähne zusammen, zischte wie eine Schlange.
Nachdem ich ein paar Mal zugeschaut hatte, machte ich es Mama mit dem Waschlappen nach. Dennis verzog nun kaum noch das Gesicht. „Bist ein starker Indianerjunge“, lobte ich ihn. „Ich nenne dich nun Tapferer Bär.“ Dennis grinste, boxte mir die Faust in die Seite und meinte: „Bäh, bäh ... Bär.“
Durch Dennis’ erste Sprechversuche wurde ich freilich ungeduldig: „Kann er jetzt wieder in die Schule gehen?“
„So schnell geht das nicht“, erwiderte Papa. „Wir müssen ihm Zeit geben. Nächstes Schuljahr kann er dann hoffentlich eine besondere Schule besuchen.“
„Er muss in die Sonderschule!?“
Wenn sich jemand in der Schule beim Vorlesen dumm anstellte, hänselten wir ihn: „Du kommst in die Sonderschule!“ Falls es die Sonderschule wirklich gab, mussten dort lauter Volldeppen hingehen.
„Wenn Dennis in die Sonderschule muss, bleibt er für immer der Verlierer“, protestierte ich. „Keiner wird ihn ernst nehmen, und er wird immer der Trottel für andere sein. Und alles ist meine Schuld!“
Lernt man nichts Vernünftiges, wird man später nur Hilfsarbeiter und verdient so wenig Geld, dass man sich nur Lumpenkleider kaufen kann, hatte Mama immer gewarnt.
Papa versuchte, mich zu drücken, meinte: „Du hast keine Schuld.“
„Doch!“, wusste ich es besser und riss mich los. „Wenn ich ihn nicht gezwungen hätte, über den Bogen zu klettern, hätte es in seinem Kopf nicht geblutet! Wenn ich ihn wenigstens festgehalten hätte!“
„Du wolltest ihm dadurch helfen, weniger ängstlich zu werden“, beschwichtigte Mama.
Papa ergänzte: „Wir machen alle Fehler im Leben. Manchmal haben kleine Dinge große Auswirkungen. Stell dir vor, ich trete gegen einen Fußball, der Ball durchschlägt zufällig eine Fensterscheibe und die Scherben verletzen einen Mann in dem Raum dahinter, so dass der ins Krankenhaus muss.“
Papa trat nie fest gegen einen Ball. Aber er verkaufte Versicherungen und kannte sich daher mit kaputten Scheiben aus.