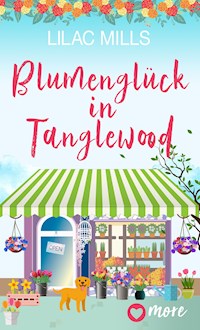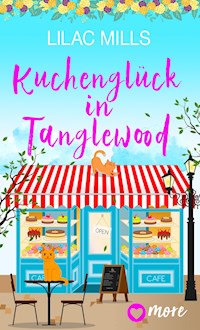
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tanglewood und Liebesglück
- Sprache: Deutsch
Neuanfang in Tanglewood.
Für Konditorin Stevie gab es schon einmal bessere Zeiten. Gerade ist ihre geliebte Großtante Peggy gestorben und dann hat sie hat auch noch ihren Job und die Liebe ihres Lebens verloren. Traurig und alleine kämpft sich Stevie durch den Alltag, als ein Anruf von Peggys Anwalt alles durcheinanderwirbelt. Großtante Peggy hat ihr nicht nur Geld vererbt, sie gibt ihr auch den Rat, das Leben endlich wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Als Stevie entdeckt, dass in dem Dorf Tanglewood ein kleiner Teeladen zum Verkauf steht, beschließt sie, Peggys Rat anzunehmen und ihr Leben umzukrempeln. Doch in Tanglewood ist nicht alles so idyllisch, wie es auf den ersten Blick scheint, und Stevie muss einige Hindernisse überwinden. Und dann ist da auch noch der gutaussehende, aber entsetzlich mürrische Hofbesitzer Nick, der Stevie immer wieder in die Quere kommt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Für Konditorin Stevie gab es schon einmal bessere Zeiten. Gerade ist ihre geliebte Großtante Peggy gestorben und dann hat sie hat auch noch ihren Job und die Liebe ihres Lebens verloren.
Traurig und alleine kämpft sich Stevie durch den Alltag, als ein Anruf von Peggys Anwalt alles durcheinanderwirbelt. Großtante Peggy hat ihr nicht nur Geld vererbt, sie gibt ihr auch den Rat, das Leben endlich wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Als Stevie entdeckt, dass in dem Dorf Tanglewood ein kleiner Teeladen zum Verkauf steht, beschließt sie, Peggys Rat anzunehmen und ihr Leben umzukrempeln.
Doch in Tanglewood ist nicht alles so idyllisch, wie es auf den ersten Blick scheint, und Stevie muss einige Hindernisse überwinden. Und dann ist da auch noch der gutaussehende, aber entsetzlich mürrische Hofbesitzer Nick, der Stevie immer wieder in die Quere kommt …
Auftakt der großen »Tanglewood und Liebesglück« Reihe von Lilac Mills!
Über Lilac Mills
Lilac Mills lebt mit ihrem sehr geduldigen Ehemann und ihrem unglaublich süßen Hund auf einem walisischen Berg, wo sie Gemüse anbaut (wenn die Schnecken sie nicht erwischen), backt (schlecht) und es liebt, Dinge aus Glitzer und Kleber zu basteln (meistens eine Sauerei). Sie ist eine begeisterte Leserin, seit sie mit fünf Jahren ein Exemplar von Noddy Goes to Toytown in die Hände bekam, und sie hat einmal versucht, alles in ihrer örtlichen Bibliothek zu lesen, angefangen bei A und sich durch das Alphabet gearbeitet. Sie liebt lange, heiße Sommer- und kalte Wintertage, an denen sie sich vor den Kamin kuschelt. Aber egal wie das Wetter ist, schreibt sie oder denkt über das Schreiben nach, wobei sie immer an herzerwärmende Romantik und Happy Ends denkt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Peggy’s Tea Shoppe
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Impressum
Darf es ein bisschen more sein?
Lilac Mills
Kuchenglück in Tanglewood
Aus dem Englischen übersetzt von Julia Brinkkötter
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Impressum
Kapitel 1
Schwarz war einfach nicht Stevies Farbe. Es passte nicht zu ihr. Viel wohler fühlte sie sich in Weiß – genauer gesagt in ihrer weißen Kochuniform –, aber die hätte sie wohl kaum zu einer Beerdigung tragen können, oder? Andererseits hätte ihre Großtante Peg sich wahrscheinlich köstlich darüber amüsiert, wenn Stevie so aufgekreuzt wäre.
Sie versuchte, die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken, und musste an Pegs letzte Worte denken.
»Sei nicht traurig, mein Schatz«, hatte Peggy gesagt. »Ich bin bereit, zu gehen. Ich hatte ein langes und erfülltes Leben. Und der Tod gehört zum Leben dazu, Stevie.«
»Sch!«, hatte Stevie ihr entgegnet. »Du stirbst nicht. Das lasse ich nicht zu.«
Unter großer Anstrengung hatte ihre Tante ein Lachen herausgebracht. »Leider ist es nicht an dir, das zu entscheiden, mein Liebes. Nun blas nicht Trübsal, und tu mir lieber einen Gefallen, ja?«
»Alles, was du willst«, hatte Stevie unter Tränen geantwortet.
»Du hast nur dieses eine Leben, also mach was draus, was dich glücklich macht. Sonst komme ich als Geist wieder und suche dich heim.«
Dann war Peg in sich zusammengesunken und sanft entschlafen.
Wie könnte ich jetzt nicht traurig sein?, fragte Stevie sich zum hundertsten Mal seit diesem schlimmen Abend. Peg war wie eine Großmutter für sie gewesen, viel mehr, als ihre eigene Großmutter es je gewesen war. Schade nur, dass Mama das nicht so sieht, dachte sie und sah aus dem Augenwinkel zur Frau hinüber, die neben ihr stand. Der Traurigkeit konnte man ihre Mutter sicher nicht beschuldigen; um ehrlich zu sein, war sie wohl eher gelangweilt. Für Hazel war Peggys Beerdigung nicht mehr als eine Pflichtveranstaltung, die es hinter sich zu bringen und dann gleich abzuhaken galt.
Einen Moment lang mochte sie ihre Mutter gar nicht leiden. Und auf ihre Schwester war sie gerade auch nicht so gut zu sprechen. Keiner ihrer Verwandten wollte wirklich hier sein. Klar, wer ging schon gern auf Beerdigungen? Doch bei den beiden ging der Unwille so weit, dass sie es nicht einmal wirklich für notwendig erachteten, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Wahrscheinlich waren sie nur hier, um den Schein zu wahren. Schließlich hatte sich keine von ihnen zu Lebzeiten mit Tante Peg abgegeben. Warum also sollte Stevie jetzt nach dem Tod der alten Dame ein anderes Verhalten erwarten?
Karen lehnte sich an ihre Schulter, und Stevie lächelte ihr mit feuchten Augen zu. Wenigstens ihre Freundin hatte Peg gemocht, und das, obwohl sie nicht einmal mit der alten Dame verwandt war.
Karen flüsterte ihr zu: »Das ist eine sehr schöne Trauerfeier. Damit erweist du deiner Tante Peg Ehre.«
Nun entwich ihr doch eine Träne. Sie hatte recht, oder? Die Feier wurde ihrer Tante gerecht. Das Pflegeheim, in dem Peg ihre letzten sechs Lebensmonate verbracht hatte, hatte empfohlen, den Trauergottesdienst in der benachbarten Kapelle abzuhalten. Stevie hatte sich nicht nur einmal gefragt, ob das Altersheim mit voller Absicht neben die Kapelle gebaut worden war, damit der Priester regelmäßig mit Kundschaft versorgt wurde. Aber Stevie hatte sich für die kleine Kirche in der Nähe des alten Hauses ihrer Tante entschieden. Zwischen den Wohn- und Büroblocks ging das alte Gebäude fast unter, doch sie wusste, dass Peggy gelegentlich, und an Weihnachten immer, dort hingegangen war. Außerdem gab es dort noch die ein oder andere Person, die sich an die alte Dame erinnerte und zu ihrer Beerdigung kommen wollte, ohne dafür halb London durchqueren zu müssen.
Ihrer Mutter hingegen fiel nichts Besseres ein, als sich in einer Tour über die Kosten des Bestattungswagens zu beschweren, was für Stevie schwer nachvollziehbar war – immerhin rechnete der weder nach Kilometern ab, noch bezahlte Hazel ihn aus eigener Tasche. Peg hatte genug Geld zur Deckung der Bestattungskosten hinterlassen.
Wenigstens war ihre Mutter konsequent, das musste Stevie ihr lassen. Denn ihre Nörgelei galt Kosten jeder Art, insbesondere für die Blumen. Sogar jetzt hätte Stevie schwören können, dass ihre Mutter ihr gerade einen zwar unauffälligen, jedoch eindeutig vernichtenden Blick zuwarf. Doch Stevie ließ sich nicht beirren – denn Peggy hatte Blumen geliebt, also wollte sie daran definitiv nicht sparen. Das war das Einzige, was sie noch für ihre Tante tun konnte – abgesehen vom Verstreuen ihrer Asche. Aber daran wollte sie jetzt nicht denken …
»Hier.« Ihre Mutter drückte ihr ein Stofftaschentuch in die Hand. »Hör bitte auf, so zu schniefen.«
Mit mürrischem Blick nahm Stevie es an, und Karen legte einen Arm um ihre Schulter. Das letzte Lied wurde angestimmt, und der Gottesdienst neigte sich dem Ende zu. Oje, wie schrecklich Stevie die alte griesgrämige Dame vermissen würde! Was würde sie nun samstagmorgens tun? Seit ihre zunehmende Krankheit und Gebrechlichkeit Peg dazu gezwungen hatte, im Pflegeheim zu leben, hatte Stevie ihr jeden Samstag einen Besuch abgestattet. Sie hatte der alten Dame immer etwas zum Naschen mitgebracht und die Leihfrist auf ihr Bibliotheksbuch verlängert (es war immer nur eines, weil Peg mit schwindendem Sehvermögen darauf angewiesen war, dass man ihr vorlas). Außerdem hatte Stevie ihr immer einen Blumenstrauß geschenkt.
Wenigstens muss ich mich nicht um ihr Haus kümmern, dachte Stevie. Es war schon schwierig genug gewesen, die wenigen Besitztümer, die Peg mit ins Heim genommen hatte, in Ordnung zu bringen. Allerdings musste man der alten Frau zugutehalten, dass sie sich eigenständig und höchst effizient organisiert hatte, sobald ihr bewusst geworden war, dass sie nicht mehr für sich selbst sorgen konnte. Stevie hatte ihr noch angeboten, bei ihr einzuziehen, aber Peggy hatte sich eisern dagegen gewehrt, sich von ihr pflegen zu lassen.
Genau diese Unabhängigkeit war eines der Dinge, die Stevie so an Peggy geliebt hatte. Was sie selbst tun konnte, tat sie selbst, auch in ihrem hohen Alter. »Ich will dir nicht zur Last fallen« war ihr Lieblingssatz, und der brachte Stevie richtig auf die Palme. Tante Peg konnte doch niemals eine Last sein!
Schade nur, dass der Rest ihrer Familie das nicht so sah. Weder ihre Mutter noch ihre Schwester schienen je Zeit für die alte Frau zu haben. Na gut, ihre Mutter lud sie jedes Jahr zum Weihnachts- und Osteressen ein, aber das war’s auch schon – nichts als leere Gesten. Und seit Peggys Umzug ins Pflegeheim war ihre Mutter nur ein Mal und Fern ihres Wissens kein einziges Mal zu Besuch gekommen. Ja, ihre Schwester schien völlig vergessen zu haben, dass ihre Großtante überhaupt existierte.
So – jetzt war es tatsächlich vorbei. Diesen Tag hatte Stevie seit jenem Anruf der Pflegeleitung mit Schrecken erwartet, als es hieß, mit Tante Peg gehe es zu Ende, und wenn sie sich verabschieden wolle, müsse sie schnell herkommen. Und Stevie war froh, ganz am Ende bei ihr gewesen zu sein, ihrer Tante die Hand gehalten und ihr noch einmal gesagt zu haben, dass sie sie lieb habe, bevor sie ihren letzten Atemzug getan hatte.
Sie bedauerte nur, dass sie nicht noch mehr für Peg hatte tun können. Bei den unmöglichen Arbeitszeiten, die einem in der Gastronomie abverlangt wurden, und dadurch, dass das Restaurant am anderen Ende von London lag, war es schwierig gewesen, Peg öfter als lediglich jeden Samstag zu sehen.
Ihr einziger Trost war, dass Peggy gewusst hatte, wie gern Stevie sie hatte.
Kapitel 2
»Wie viel?«, platzte es aus Stevie heraus wie ein abgewürgter Schrei. Dabei verschluckte sie sich an ihrem Tee, so dass ihr die eine Hälfte aus dem Mund spritzte und die andere das Kinn hinunterlief. Mit einem lauten Klappern ließ sie ihre Tasse zurück auf die Untertasse fallen. »Das ist doch nicht Ihr Ernst!« Erschrocken riss sie die Augen auf. »Oder doch?«
Der etwas betagte Herr hinter seinem ebenso betagten Schreibtisch nickte ihr einmal zu. Sah er sie bloß mit solch funkelnden Augen an, weil er sich über sie amüsierte, oder war er tatsächlich froh, gute Nachrichten überbringen zu dürfen? Sie hoffte inständig auf Letzteres. Bitte mach, dass es wahr ist!
»Sind Sie sich sicher, dass der Name stimmt? Peggy Langtree?«, fragte Stevie.
Er nickte erneut.
»Aber sie hatte doch gar kein Geld – gerade genug für ihr Begräbnis. Das nannte sie ihre ›Sterbekasse‹, die sie in einer Vase auf der Fensterbank aufbewahrte.« Stevie lächelte.
»Sie besaß offensichtlich mehr, als Sie dachten«, bemerkte der Notar trocken.
»Was ist mit meiner Mutter und Fern? Jetzt sagen Sie mir nicht, sie hat ihnen den gleichen Betrag hinterlassen.« Bei dem Gedanken musste Stevie schlucken. »Dann muss sie ja stinkreich gewesen sein.«
Mr Gantly rutschte in seinem Stuhl vor, stützte die Ellbogen auf dem Schreibtisch ab und legte die Fingerspitzen aneinander. Ein leichter Geruch nach Mottenkugeln wehte zu ihr herüber.
»Nein«, sagte er mit Amtsmiene nach einem Moment der ehrfürchtigen Stille.
Stevie wartete darauf, dass er den Punkt weiter ausführte, doch das tat er nicht.
Sie klopfte mit den Fingern auf den Schreibtisch, wippte mit dem überschlagenen Bein und fragte schließlich: »Nein, sie hat meiner Mutter und Schwester nicht den gleichen Betrag hinterlassen, oder nein, sie war nicht stinkreich?«
»Ersteres. Sie hat Ihrer Mutter und Ihrer Schwester andere Beträge hinterlassen.«
Ah!, dachte Stevie. Sie war noch immer erschrocken, aber froh, dass Tante Peg auch ihnen etwas vermacht hatte. Wer hätte gedacht, dass die alte Dame auf so einem Haufen Geld gesessen hatte?
Der Notar räusperte sich, und der Hautlappen an seinem Hals wölbte sich noch tiefer über seinen Krawattenknoten. Wie alt war dieser Mann? Er erinnerte Stevie an die Schildkröte, die sie als Kind gehabt hatte. Der ausstreckbare Hals des Reptils war für sie unglaublich interessant gewesen. Jedes Mal, wenn dieses runzlige Wesen sich aus seinem Panzer heraustraute, hatte sie sein Köpfchen angestupst, so dass es sich gleich wieder zurückzog. Irgendwann hatte ihre Mutter ihr gesagt, dass Ralph, wie Stevie ihn eigentümlicherweise genannt hatte, weggelaufen sei. Wohl eher langsam weggeschlichen, hatte Stevie damals gedacht, aber das Ergebnis war ja dasselbe. Sie konnte es ihm nicht verübeln. Sie hätte sich auch weggeschlichen, hätte sie in seiner Haut gesteckt. Beziehungsweise in seinem Panzer.
Beinahe entwich ihr ein halb hysterisches Kichern. Doch sie hielt es zurück und widerstand dem Drang, Mr Gantly an die Nase zu stupsen, um zu sehen, wie sein Kopf reagieren würde. Sie stellte sich vor, wie er in seinem Hemdkragen verschwände und dann wieder hochschnellte.
Sie bemerkte, dass sie in Gedanken abschweifte (sicher war das dem Schrecken geschuldet), und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder dem alten Notar. Der wartete geduldig, noch immer mit dem Kinn auf den Fingerspitzen abgestützt und dem Ansatz eines Lächelns auf dem Gesicht. Stevies Wangen glühten, und sie blickte ihn mit großen Augen an. Sie kam sich vor wie ein Schulmädchen, das zum Direktor gerufen wurde, weil es etwas angestellt hatte; das Gefühl hatte sie einst sehr gut gekannt. Noch eine Weile verharrten sie so in der Stille, bis ihr klarwurde, dass er darauf wartete, dass sie eine Frage stellte. Und zwar nicht irgendeine Frage.
Stevie traute sich: »Wie viel hat sie meiner Mutter und Fern hinterlassen?«
Der Notar schüttelte traurig den Kopf. »Nicht annähernd so viel wie Ihnen. Eintausend Pfund. Pro Person.«
»Heilige Scheiße!« Kaum war ihr das entwischt, nahm Stevie die Hand vor den Mund und schob hinterher: »Äh, Entschuldigung.« Sie fragte sich, wie lange es wohl dauern werde, bis die Familie ihren Anteil an der nicht unerheblichen Beute einforderte. Sie hatte nicht fluchen wollen, aber nachdem er »pro Person« gesagt hatte, als würde das die Situation auch nur ansatzweise entschärfen, war es ihr herausgerutscht.
Mama und Fern werden ausrasten!, dachte sie. Sie würde ihre Erbschaft genau durch drei aufteilen müssen, sonst würde sie sich das für den Rest ihres Lebens vorhalten lassen müssen. Verdammt nochmal! Sie wollte ja nicht habgierig sein, aber unter den gegebenen Umständen konnte sie das Geld eigentlich gut gebrauchen.
»Das muss ich erst einmal verarbeiten«, versuchte sie ihr schlechtes Benehmen zu entschuldigen.
»Zweifellos«, stimmte Mr Gantly ihr in ruhigem Ton zu. Dann setzte er seine Brille auf und schob die Bügel hinter seine großen haarigen Ohren. Er blätterte ein, zwei Seiten um.
»Um jegliche Unklarheit aus dem Weg zu räumen, fasse ich noch einmal zusammen«, sagte er. »Peggy Langtree vermacht Ihnen zweihundertdreiundsechzigtausendeinundzwanzig Pfund und siebenundfünfzig Pence. Circa«, fügte er hinzu. »Mrs Taylor und Mrs Chalk vermacht sie jeweils eintausend Pfund. Und wenn Sie versuchen, etwas von Ihrem Erbanteil an Mrs Taylor oder Mrs Chalk abzugeben, geht das Geld ans Katzenheim«, ergänzte der Notar kurz und bündig.
»Aber, aber … das wird einen Höllenärger geben«, jammerte Stevie. »Warum hat Tante Peggy meiner Mutter und meiner Schwester das angetan?«
Mr Gantly griff über den Schreibtisch und tätschelte ihr die Hand. »Ich kenne die Beweggründe der verstorbenen Peggy Langtree nicht, aber vielleicht war sie der Meinung, Sie verdienten das Geld mehr als die beiden. Möglicherweise dachte sie auch, Sie könnten mehr damit anfangen.«
»Damit läge sie nicht falsch«, sagte Stevie. »Ich habe gerade meine Arbeitsstelle verloren.«
»Es tut mir leid, das zu hören. Dann kommt die Erbschaft also zu einem günstigen Zeitpunkt«, erwiderte Mr Gantly.
»Ich wurde von einem Londoner Doppeldeckerbus angefahren. Von so einem roten.«
Die Lippen des alten Mannes begannen, zu zucken.
»Sie glauben gar nicht, wie viele Witze es zu dem Thema gibt, dass irgendwer vom Bus überfahren wurde«, sagte Stevie. »Ich kenne sie alle.«
»Wurden Sie verletzt?«
»Ich habe mir das Bein gebrochen.«
»Da hatten Sie aber Glück.«
»Glück? Pah! Überfahren zu werden, würde ich nicht ›Glück‹ nennen. Das war ein einziges Unglück!« Stevie wusste, dass sie sich gerade unnötig ereiferte, konnte sich jedoch nicht zurückhalten. Wahrscheinlich stand sie noch unter Schock.
»Ich meine ja nur, es hätte viel schlimmer kommen können«, erklärte sich Mr Gantly und sah auf seine Armbanduhr.
»Nein, hätte es nicht! Ich habe meine Arbeit verloren.« Ihr stiegen die Tränen in die Augen, und sie kramte in ihrer riesigen Handtasche nach einem Taschentuch, zog aber statt eines Päckchens bloß eine Rolle Toilettenpapier hervor. Egal, das musste jetzt herhalten.
Als sie sich ein Stück abriss, runzelte Mr Gantly die Stirn und hielt ihr stumm die Taschentuchbox hin, die auf seinem Schreibtisch stand. Sie bediente sich – immerhin waren die Tücher sanfter zur Nase als Klopapier. Eigentlich könnte sie sich ja bald – mit über zweihundertfünfzigtausend Pfund auf dem Konto – ein, zwei eigene Schachteln mit echten Taschentüchern gönnen.
Sie schnäuzte sich. »Corky hat gesagt, man müsse sich leider von mir trennen.«
»Corky?«
»Corky Middleton. Der Name muss Ihnen doch ein Begriff sein?«
Mr Gantly schüttelte den Kopf. Die weichen Hautfalten unter seinem Kinn wackelten und wabbelten.
»Corky Middleton aus dem Fernsehen? Der Besitzer von The Melon?« Stevie ignorierte den zweiten, nun demonstrativen Blick des Notars auf die Uhr.
»Leider nein«, sagte er und erhob sich aus seinem quietschenden Bürosessel. Unter beträchtlicher Anstrengung schaffte er es in den – zunächst noch etwas wackligen – Stand.
»Das ist ja auch nur das berühmteste Restaurant mit Michelin-Stern in ganz London«, sagte sie und drehte sich in ihrem Stuhl um, um dem alten Mann auf seinem Weg zur Tür nachzusehen. »Als ich die Stelle ergattert habe, dachte ich wirklich, ich hätte es endlich zu etwas geschafft. Wie dumm von mir«, urteilte sie enttäuscht. »Ich bin Konditorin, und zwar eine verdammt gute. Aber dieser elende Corky hat mich einfach gefeuert, nur weil ich mir das Bein gebrochen habe!« Stevie machte keine Anstalten, zu gehen.
»Es tut mir leid, ich habe noch einen Termin.« Der Notar öffnete die Tür. Dann schnalzte er mit der Zunge. »Verzeihung, das hätte ich fast vergessen.« Er trottete zurück zu seinem Schreibtisch und wühlte in dem darauf befindlichen Kram herum, linste unter Umschläge und hob Werbeflyer für Pizzalieferdienste hoch. Stevie war sich nicht sicher, ob seine Haut dieses trockene, raschelnde Geräusch machte oder der Haufen Zettel.
»Ich vermisse sie wirklich«, sagte Stevie und schnäuzte sich erneut mit der Rotzfahne, die sie mittlerweile produziert hatte. »Tut mir leid. Ich will nicht weinen, aber ich kann nicht anders. Manchmal überkommt es einen, wissen Sie?« Sie machte eine Atempause, rümpfte die Nase und linste am Taschentuch vorbei zu ihm hinüber. »Sind Sie sicher, dass es etwas für mich war?«
»Ziemlich sicher. Ah, hier.« Er fand, wonach er gesucht hatte, und reichte es ihr.
Sie hielt einen unbeschrifteten cremefarbenen Umschlag in den Händen. »Ist das ihr Testament?«, fragte sie verblüfft. Das würde er doch sicherlich behalten müssen?
»Es ist ein Brief von Ihrer Tante.«
»Ah. Klar, das ergibt Sinn.« Stevie war nicht überrascht. »Hat sie ihn vor oder nach ihrem Tod geschrieben?« Kurz war Stevie der wahnsinnige Gedanke gekommen, ihre Tante hätte die Drohung wahr gemacht, sie nach ihrem Tod heimzusuchen.
Mr Gantly hob seine buschigen Augenbrauen.
»Entschuldigung«, murmelte Stevie, die wieder zur Besinnung gekommen war. »Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
»Ich bereite die Unterlagen in den nächsten Tagen vor, damit Sie sie unterzeichnen und wir das Geld auf Ihr Konto überweisen können«, sagte er.
Auf einmal war der Notar ganz förmlich, und Stevie wurde entlassen. Mit dem Brief an ihre Brust gedrückt, stand sie auf, drehte sich aber noch einmal zu dem älteren Mann in seinem staubigen alten Büro um und zögerte, zu gehen.
»Ja«, beantwortete er ihre unausgesprochene Frage. »Zweihundertdreiundsechzigtausendeinundzwanzig Pfund und siebenundfünfzig Pence. Viel Spaß damit.«
Kapitel 3
»Meine liebe Stevie«, begann der Brief, »ich bin tot.«
Ich weiß, dachte Stevie traurig. Ich war auf deiner Beerdigung.
»Du bekommst fast all mein Geld.«
Das weiß ich auch, der Notar hat es mir gesagt. Er sagte nur nicht, warum, überlegte sie.
»Du fragst dich jetzt, warum.«
Du hast es gleich erfasst, Tante Peg. Typisch, dir machte keiner was vor! Stevie lächelte beim Gedanken an Peggy, wie sie sie am liebsten in Erinnerung behielt: mit langen weißen Haaren, violetten Schnürstiefeln, rosa Jeansjacke (Wo um alles in der Welt hatte sie die aufgetrieben?) und einem Einkaufswagen, in dessen Kindersitz sie eine Plüschkatze vor sich herschob. Sie war ja wirklich herzensgut gewesen, allerdings auch ziemlich exzentrisch. Oder verrückt, je nach Standpunkt.
»Der Grund ist, dass du es verdienst und es noch dazu brauchst. Jetzt denkst du sicher, dass Geld nicht glücklich macht. Aber wenigstens könnte es dir das Leben etwas erleichtern. Meine einzige Bitte ist, dass du es mit Bedacht ausgibst und nicht für Tand und Tinnef verprasst.«
Tinnef? Was bitte ist Tinnef? Und wer hat gesagt, Geld macht nicht glücklich? Doch nur Leute mit massenweise Geld auf dem Konto!
»Nutze es für etwas, was du sonst nie tun könntest.«
Genau, beispielsweise Backpacking in Australien, drei Monate Karibik, ein BMW-Cabrio oder … Es gab so viele Möglichkeiten! Zum ersten Mal seit der Beerdigung verspürte sie eine positive Aufregung, wie Schmetterlinge, die ihr vom Bauch in die Brust flatterten.
»He! Ich weiß genau, woran du jetzt denkst, und das ist es, was ich mit sinnlosem Verprassen meine. Wenn das Geld erst einmal weg ist, stehst du mit leeren Händen da.«
Stevie sah vom Brief auf und seufzte. Na klar … Bei Erinnerungen an durchzechte Nächte, mit neuem Auto, vorzeigbarer Urlaubsbräune und Designermode im Kleiderschrank würde ich nicht von leeren Händen reden. Jetzt muss ich mich nicht mehr fühlen wie ein Häufchen Elend, und hey, vielleicht findet Steve dann auch wieder Interesse an mir. Steve und Stevie – sie fand damals schon, das klinge nach dem Shownamen einer Dragqueen.
Als sie sich wieder dem Brief widmete, tat sie dies mit gemischten Gefühlen von Widerwillen und Trost zugleich. Beim Lesen hatte sie das Gefühl, als spukte ihre tote Tante in ihrem Kopf und könnte ihre Gedanken lesen.
»Und denk gar nicht erst daran, wieder mit diesem Stephen zu poussieren. Er ist – und bleibt hoffentlich – Vergangenheit.«
Poussieren? Was für ein Wort war das denn? Vielleicht eine altmodische Art, zu sagen, dass man sich mit jemandem durch die Laken wälzt …
»Bitte nutze das Geld, um deinem Herzen zu folgen. Ich weiß, du wirst es sinnvoll ausgeben. Ich habe volles Vertrauen in dich. Du warst schon immer mein Liebling. Das sollte ich nicht sagen, aber es ist wahr. Ich hatte dich lieb wie eine Enkelin, und egal, wo ich jetzt bin, bleibst du für immer in meinem Herzen.
In Liebe, deine Tante Peggy.«
Der letzte Absatz gab Stevie den Rest. Sie legte den Brief ab, beugte sich vor, verschränkte die Arme auf dem Tisch und weinte sich die Augen aus.
Sie hatte zwar das Gefühl, die Hand der alten Dame auf ihrer Schulter zu spüren, begriff nun aber, dass ihre Tante wirklich von ihr gegangen war.
Als ihr Schluchzen sich allmählich in ein Schniefen und Schnaufen verwandelte, bedankte sich Stevie still bei ihrer Tante für ihre Großzügigkeit. Sogleich fragte sie sich, wie sie Hazel ihre Erbschaft erklären solle. Sie würde ihrer Mutter sagen müssen, was Peg getan hatte, und darauf freute sie sich ganz und gar nicht.
Hazel Taylor war keine böse Frau, aber sie hatte ihre Tante einfach nicht akzeptiert. Peg hatte nie geheiratet, dafür allerdings einen leichten Knall und ein Haus voller Katzen, in dem sie bis zu dem Tag, an dem sie ins Pflegeheim an der Stanley Road umziehen musste, gelebt hatte. Ah, und einen wirklich seltsamen Kleidungsstil hatte sie auch.
Stevies Mutter missbilligte das exzentrische Wesen ihrer Tante aufs Schärfste und ließ keine Gelegenheit aus, mit größter Schadenfreude zu erzählen, was Peg schon alles gewesen sei: Bordellwirtin in einem Striplokal; eine geschickte Einbrecherin während ihrer Anstellung im Nobelhotel; Nacktmodell für ein Schmuddelheft. Einmal hatte Stevie ihre Mutter gefragt, was sie damit meine, woraufhin Hazel angewidert die Nase gerümpft, »Pornographie« gewispert und sich geweigert hatte, das Thema weiter auszuführen.
Und Hazel verglich die etwas flatterhafte Stevie ständig mit Peggy (natürlich nicht in Bezug aufs Pornographische oder Kriminelle). Das vermittelte Stevie den Eindruck, dass, falls ihre Mutter ein Lieblingskind hatte, sie es sicherlich nicht war. Irgendwie konnte Stevie es ihr nicht einmal verübeln. Die vier Jahre ältere Fern war schon als Kind eine Diva gewesen und schien es gehasst zu haben, ihre Mutter mit der neugeborenen Stevie – diesem Schreihals mit rotem Kopf – teilen zu müssen. Anscheinend war Fern ein Musterbaby gewesen, das vom ersten Tag an die ganze Nacht durchschlief, nie schrie und so brav war, dass Hazel nicht einmal bemerkte, dass es da war.
Aber dass Stevie da war, bemerkte ihre Mutter sehr wohl! Stevie, so ihre Mutter, schlief fast nie und weinte ununterbrochen ohne erkennbaren Grund. Damit hatte sie ihre Mutter geradezu um den Verstand gebracht, wie sie Stevie im Jugendalter oft erzählte.
Außerdem war Fern vom Glück gesegnet. Von sehr viel Glück. So viel Glück, dass, wenn ihre Schwester ein Los kaufte, ihr der Hauptgewinn sicher war; dass sie nur ein einziges Mal im Lotto gespielt und gleich eine kleine Summe gewonnen hatte; dass ihr Versicherungsprämien für einen Kredit erstattet worden waren, den sie nie aufgenommen hatte; dass sie ordentlich Schadensersatz wegen Geschlechterdiskriminierung erhalten hatte, als sich herausstellte, dass ihr männlicher Arbeitskollege in der gleichen Stellung mehr verdiente als sie. Sie hatte einfach das Glück auf ihrer Seite.
Es ging auch nicht nur ums Geld. Die beiden Mädchen waren absolute Gegensätze. Fern hatte die Schule geliebt, Stevie hatte sie gehasst. Fern hatte mit Puppen gespielt, Stevie war auf Bäume geklettert, nicht selten von ihnen heruntergefallen und hatte sich dabei etwas gebrochen. Fern war im Vorschulkrippenspiel die Maria gewesen, Stevie eine Hälfte des Esels – und zwar die nicht so schöne Hälfte, mit Nigel Hemmings Furzpo direkt vor ihrer Nase. Mittendrin musste der Esel schnell von der behelfsmäßigen Bühne gelotst werden, weil Stevie fand, sie müsse ihr ständiges Wackeln des Eselsschwanzes noch mit lauten Pupsgeräuschen untermalen. Fern hatte ihre Schularbeiten ausnahmslos pünktlich abgegeben, Stevie immer wieder behauptet, der Hund habe ihre Hausaufgaben gefressen (»Aber ihr habt doch gar keinen Hund!«) … Und so weiter und so fort.
Als die beiden Mädchen größer wurden, war Stevies Schwester schnell klar, was sie wollte: heiraten und Kinder kriegen. Fern fand sehr schnell einen heiratstauglichen Mann in Form von Derrick »nennt mich Dezza« Chalk für ihre traditionelle weiße Hochzeit, auf der Stevie einen Gastauftritt als rosafarbenes Baiser hatte, und erzeugte mit minimalem Aufwand zwei Töchter. Die ältere hieß Jade, das jüngste Mitglied der Chalk-Familie hieß Macey, und beide waren augenscheinlich genauso perfekt wie ihre Mutter.
Und dann war da Stevie: arbeitslos, partnerlos und obdachlos. Arbeitslos wegen dieses dämlichen Busses, obdachlos, weil sie arbeitslos war und ihren Mietanteil für ihre völlig überteuerte Fünfer-WG nicht mehr aufbringen konnte, und partnerlos, weil Steve ein Arschloch war. Daher war Stevie vorübergehend zurück zu ihrer Mutter gezogen – nur, bis sie wieder Arbeit fände.
Eigentlich war es ja jetzt, da ihr Bein fast wieder heil war, an der Zeit, mit der Stellensuche zu beginnen. Denn, machen wir uns mal nichts vor, mit zweihundertfünfzigtausend Pfund hatte sie noch nicht für den Rest ihres Lebens ausgesorgt, oder? Und sobald sie eine neue Arbeitsstelle ergatterte, würde sie als Nächstes sofort zur Wohnungssuche übergehen.
Stevie fand ihren Plan sehr vernünftig und machte sich guten Mutes an die Arbeitssuche. Erst später, als sie den kostbaren Brief zusammengefaltet hatte, um ihn in die Schachtel zu legen, in der sie ihre Erinnerungsstücke aufbewahrte – darunter das winzige Fossil, das sie einmal im Cornwall-Urlaub gefunden hatte, eine gestohlene Locke von Steve und ihre allererste Valentinskarte (dass sie damals schon dreiundzwanzig war, musste ja keiner wissen) –, bemerkte sie das Postskriptum auf der Rückseite.
»PS: Sei nicht traurig. Ich habe dich nicht verlassen, auch wenn es sich so anfühlt. Und vergiss nicht: Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden …«
Ach, Peggy, was redest du altes Schreckgespenst da nur?, fragte sich Stevie mit einem liebevollen und traurigen Lächeln zugleich, während sie den Brief sorgsam weglegte.
Kapitel 4
Karen war schon seit dem Kindergartenalter Stevies beste Freundin. Sie war zierlich, dunkelhaarig, hübsch, superspaßig und schonungslos direkt. Aus ihrem Mund kamen keine Unwahrheiten, Umschweife oder Schmeicheleien. Wenn Stevie aussah wie Wurst in Pelle, dann sagte Karen es ihr. Wenn Stevie zweihundertdreiundsechzigtausend Pfund erbte und nicht wusste, was sie damit anstellen sollte, würde Karen auch dazu eine Meinung haben.
»Nicht dein Ernst? Wie kann man nur so ein Riesenschwein haben!«, sagte Karen und trank einen großen Schluck Wein.
Stevie wartete mit angehaltenem Atem auf den Ratschlag, der ihr Leben verändern könnte. Stattdessen hörte sie nur die Wiederholung in Zeitlupe: »So … ein … Riesen-… Schwein!« Und zum Abschluss: »Ich hasse dich.«
»Was soll ich nur damit anstellen?«, jammerte Stevie.
»Ach, komm schon! Da wird dir ja wohl selbst etwas einfallen. Du bist jung, frei, schön – hau die Kohle raus! Viel Spaß damit!«
»Das hat der Notar auch gesagt«, meinte Stevie betrübt.
»Wenn das Geld dich so betrübt, gib es deiner Mutter. Zwar hat sie es wohl nicht verdient, aber dafür muss sie dich gerade wieder zu Hause ertragen.«
»Es ist nicht meine Schuld, dass ich von einem Bus überfahren wurde und dann meine Arbeitsstelle und meinen Freund verloren habe!«, empörte sich Stevie mit glühenden Wangen.
Stevie sah, wie Karen sich auf die Lippen biss, um ein Lachen zu unterdrücken, und warf ihrer Freundin einen bösen Blick zu. Sie trank ihr Glas aus und nestelte in der Hosentasche ihrer Jeans herum.
»Noch eins?«, fragte sie. »Die Getränke gehen dann wohl auf mich.«
»Darauf kannst du wetten.« Karen reichte Stevie ihr Glas. »Diesmal ein Großes, bitte.«
Während Stevie darauf wartete, dass ihr Bier gezapft wurde (Wein war nicht so ihr Ding), starrte sie in ihr Portemonnaie und kam sich vor wie diese superwichtigen Geschäftsleute – reich auf dem Papier, aber keinen Penny in der Tasche. Sie kratzte die zehn Pfund fünfzig zusammen, nach denen der Barkeeper wartend die Hand aufhielt, und legte das Kleingeld Münze für Münze in seine Handfläche. Falls Karen und sie danach noch eine Runde bestellen wollten, müsste sie nachfragen, ob sie mit Karte zahlen könne. Dann müsste sie noch zittern, dass die Transaktion auch durchging, denn Peggys Geld war noch nicht auf ihrem Konto eingegangen.
»Als erste Investition könntest du mal was mit deinen Haaren machen«, schlug Karen vor, als Stevie mit den Getränken zurückkam.
»Warum? Was stimmt damit nicht?«
»Du hast sie ungefähr seit deinem zwölften Lebensjahr nicht mehr schneiden lassen.«
»Ich mag sie lang.«
»Meine Mutter würde sagen, du hast ein Vogelnest auf dem Kopf.«
Stevie beugte den Kopf, kramte ein Haargummi aus den Tiefen ihrer riesigen Handtasche hervor und kämmte sich mit den Fingern durch die Haare, bis sie sie ein wenig gebändigt hatte. »Besser?«, fragte sie und drehte den Kopf zu allen Seiten, um ihren Pferdeschwanz zu präsentieren.
Karen schnaubte. »Haarschnitt.«
»Aber –«
»Kein Aber. Lass sie dir am besten ungefähr hier abschneiden.« Karen pikste Stevie direkt über die Brust.
»Aua!«
»Und lass dir Strähnchen machen – helle, dunkle, egal was, Hauptsache, sie sind nicht mehr so orange wie eine Karotte.«
»Wie eine Karotte«, wiederholte Stevie trocken. Okay, der Spitzname »Karottenkopf« hatte sie durch die gesamte Schulzeit begleitet, aber seitdem hatte sich die Farbe doch etwas abgeschwächt. Oder etwa nicht?
»Und gönn dir gleich auch ein anständiges Glätteisen«, fügte Karen hinzu. »Du wärst überrascht, wie sexy du ohne diese kri- … Locken aussehen würdest.«
»Du wolltest gerade ›krisselig‹ sagen, oder?«, warf Stevie Karen vor, die daraufhin rot wurde.
»Schau mal, du feiges Hühnchen, ich sage das nur, weil du jetzt das Geld hast, um etwas zu unternehmen. So gut auszusehen, kostet ein Vermögen.« Karen schüttelte ihre glänzende dunkle Haarpracht. Plötzlich verspürte Stevie das drängende Bedürfnis nach einem Haarschnitt. »Bisher konntest du es dir nicht leisten. Ach, was sag ich, mit diesem Taugenichts von Schnorrerfreund konntest du dir ja kaum die Miete leisten. Gönn dir mal was. Du bist es wert.«
Stevie wusste, Karen wollte ihr nur helfen. Aber es wurmte sie schon ein wenig, dass sie ihr erst jetzt sagte, dass sie ihre Haare für eine Katastrophe halte. Sie hätte früher etwas sagen können, statt sie in dem Glauben herumlaufen zu lassen, sie sähe so in Ordnung aus.
»Sonst noch was?«, knurrte sie durch die fest zusammengebissenen Zähne.
»Jetzt, wo du’s sagst – wie wäre es mit ein paar neuen Klamotten? Du hast so eine tolle Figur. Warum zeigst du sie nicht?«
»Weil sich nie die Gelegenheit ergibt«, beschwerte sich Stevie. »Meistens trage ich meine Kochuniform.«
»Sieh dich an – mit deinen tollen Kurven. Die zu verstecken, gehört verboten.« Karen musterte Stevie demonstrativ von oben bis unten.
Stevie sah an sich herunter: Jeans und Schlabberpulli. »Das waren die einzigen sauberen Sachen, die ich finden konnte.«
»Eben! Ergo, du brauchst neue Klamotten.«
»Ergo? Hä? Tante Peg hat mich gewarnt, das Geld nicht sinnlos zu verprassen«, sagte Stevie.
»Etwas für dich selbst auszugeben, hat nichts mit Verprassen zu tun. Das ist eine Investition in deine Zukunft.«
»Welche Zukunft?« Sie lebte von Tag zu Tag und war schon froh, wenn sie die Stunden zwischen Frühstück und Schlafengehen ohne größere Pannen überstand. An die Zukunft verschwendete sie nicht viele Gedanken. Na gut, manchmal träumte sie davon, eines Tages ihr eigenes Restaurant zu besitzen und ins Fernsehen zu kommen, genau wie Corky Middleton.
»Deine –« Karen unterbrach sich selbst und atmete laut auf. »Ich habe eine Idee!«
Stevies Begeisterung hielt sich in Grenzen.
»Willst du sie nicht wenigstens hören?«, bat Karen nachdrücklich.
»Dann sag’s halt. Wenn’s sein muss«, antwortete sie schroff.
Karen ignorierte Stevies Tonfall. »Warum suchst du dir nicht einfach was Eigenes?«, rief sie mit einem erwartungsvollen Blick, als hätte sie gerade ein Kaninchen aus dem Hut gezogen und würde »Tadaa!« schmettern.
»Was? Du meinst, ich soll bei meiner Mutter ausziehen? Das habe ich ja vor, nur nicht sofort. Erst will ich eine neue Arbeit finden. Außerdem bekomme ich da meine Sachen – manchmal – gewaschen und gebügelt, ich muss nicht viel Miete zahlen, und ich –«
»Jetzt halt mal eine Minute den Rand«, unterbrach Karen sie. »Ich meinte ein eigenes Restaurant.«
»Ja, klar, und wo finde ich den Idioten, der mir erlaubt, ein Restaurant zu leiten? Dafür muss man sich die Karriereleiter hocharbeiten, und ich bin erst irgendwo auf der mittleren Sprosse. Es sieht auch nicht danach aus, als käme ich noch viel höher«, ergänzte sie. Dann sagte sie ganz fröhlich: »Aber hey, ich kann ja immer noch zu McDonald’s wechseln. Hätten Sie gern Pommes frites dazu?«, fragte sie mit fiepsiger Stimme.
Karen schüttelte verzweifelt den Kopf und lehnte sich vor. »Genau … dafür … sollst … du … das … Geld … ausgeben«, sagte sie sehr, sehr langsam und deutlich, als würde sie mit einem kleinen Kind sprechen.
Da fiel der Groschen endlich.
»Ach so? Ach so! Jetzt verstehe ich. Ja! Ja, das könnte ich machen, oder? Oh. Nein, kann ich nicht. Ein Restaurant in Betrieb zu nehmen, würde viel mehr als zweihundertdreiundsechzigtausend Pfund kosten, ganz zu schweigen davon, dass ich keine Geschäftserfahrung habe und ganz mies in dem ganzen Personalkram wäre. Außerdem: Wo sollte dieses Lokal sein? In London könnte ich mir nicht einmal eine Besenkammer leisten. Ich müsste auch viel Zeit und Übung in Hauptgerichte und so was stecken, weil ich seit Ewigkeiten hauptsächlich mit Backwaren zu tun hatte, und …«
»Sch!«, sagte Karen bestimmt.
Ausnahmsweise gehorchte Stevie.
»Denk kleiner«, warf Karen in den Raum und lehnte sich dann erwartungsvoll zurück.
»Was meinst du mit ›kleiner‹? Einen Imbiss? Einen Food Truck? Oder ein Café? Vielleicht mit Kaffee, Tee, Gebäck und kleinen Speisen – wie in einem Tea Shop … Ja, ein Tea Shop! Das ist es!« Stevie sprang von ihrem Stuhl auf und breitete die Arme aus. Sie riss begeistert die Augen auf.
»Ja! Ja!«, rief sie und fühlte sich plötzlich so inspiriert, dass sie herumwirbelte und nur am Rande bemerkte, dass das ganze Pub still und regungslos wurde und sie neugierig anstarrte. Karen konnte kaum auf einen Kommentar vom Nachbartisch antworten (»Hat Ihre Freundin einen Anfall?«), als das Unvermeidbare eintrat: Stevie schlug einem Mann, der nichts ahnend hinter ihr stand, das Bierglas aus der Hand. Sie beförderte es gut drei Meter weit durch die Luft und besprenkelte so alle darunter befindlichen Gäste großzügig mit goldgelber Flüssigkeit.
»Oje, äh … Das tut mir so leid.« Stevie kramte in ihrer Tasche herum und zog ein langes Stück Klopapier heraus. Den irritierten Blick des Mannes, dessen Getränk sie ins All geschickt hatte, nahm sie nur am Rande wahr. Sie tupfte, wenig erfolgreich, mit dem inzwischen klatschnassen Papierklumpen seinen reichlich begossenen Kopf ab.
»Komm. Es wird Zeit, dass wir gehen.« Karen packte sie am Oberarm und zerrte sie zur Tür hinaus, wobei Stevie sich vielmals in die Runde entschuldigte.
Dann wurde Stevie still und starrte Karen an. Karen starrte teilnahmslos zurück.
»War das jetzt eine gute Idee oder eine gute Idee?«, fragte Karen schließlich.
»Möglicherweise. Ich bin mir nicht sicher«, antwortete Stevie, biss sich auf die Lippen und grinste schelmisch. »Klar. Sie ist genial.«
Karen gab ihr einen neckischen Klaps auf den Kopf. »Komm. Jetzt heißt es planen, planen, planen«, sagte sie und stapfte die Straße runter.
Stevie folgte ihr aufgeregt tänzelnd über den Bürgersteig und versuchte dabei, nicht auf die Fugen zu treten. Sicher ist sicher. Denn ihr stand noch die unheilvolle Aufgabe bevor, ihrer Mutter und ihrer Schwester zu erzählen, dass Stevie – im Gegensatz zu den beiden – reich beerbt worden war. Und auf dieses Gespräch freute sie sich noch immer ganz und gar nicht.
Kapitel 5
»Mama?« Stevie wagte einen Schritt in die Küche. Sie war sich des nervös-fiepsigen Klangs ihrer Stimme bewusst, aber anders bekam sie es nicht heraus.
»Was denn, Stevie? Ich habe es eilig.«
»Ich weiß. Du hast einen Termin beim Notar.«
»Ich bin etwas überrascht, dass er dich nicht dabeihaben wollte. Immerhin hat er sowohl mich als auch Fern zu sich gebeten.«
»Ähm … Also … Was das angeht …«
»Natürlich kann ich es deiner Tante nicht verübeln. Wer will sein hart verdientes Geld schon sinnlos verprassen lassen?«
Schon wieder dieses Wort verprassen!
»Aber keine Sorge, ich lasse dich nicht verhungern«, ergänzte ihre Mutter großzügig. »Also, was wolltest du von mir? Ich bin spät dran.«
Stevie überlegte hin und her. Vielleicht sollte sie ihrer Mutter überhaupt nichts erzählen und Mr Gantly die Drecksarbeit für sie erledigen lassen. Andererseits befürchtete sie, dass sie es ernsthaft bereuen könnte, wenn sie zuließe, dass ihre Mutter so überrumpelt wurde. Daher nahm sie all ihren Mut zusammen und platzte damit heraus: »Ich bekomme alles.«
»Was bekommst du, Schatz? Wo zum Teufel ist mein Schlüssel?« Hazel suchte mit den Augen die Küchenarbeitsplatte ab, während sie die Taschen ihres Regenmantels abtastete.
»Das Geld. Tante Peg hat es mir hinterlassen.«
»Wovon sprichst du, Liebes? Sei ein Schatz, und hilf mir, meinen Schlüssel zu finden. Ich hätte schwören können, dass ich ihn hierhingelegt habe. Ich bin gestern Abend von meinem Floristikkurs nach Hause gekommen, habe meinen Mantel abgelegt, meine – Ah! Jetzt weiß ich’s: im Bad. Ich musste dringend zur Toilette. Da muss ich ihn liegen gelassen haben. Gehst du ihn bitte schnell für mich holen?«
»Okay. Aber hör mir mal zu, Mama. Ich war gestern beim Notar. Er hatte mich zu sich gebeten. Tante Peg hat mir praktisch alles hinterlassen.« Kaum hatte Stevie das ausgesprochen, nahm sie die Beine in die Hand und ergriff die Flucht. Sie stürzte sich ins Treppenhaus, sprintete ins Bad und schlug die Tür hinter sich zu.
Der Schlüssel ihrer Mutter lag auf der Ablage am Waschbecken. Stevie umschloss ihn mit der Faust, drückte ihn an ihre Brust und lauschte nach dem Echo.
Stille.
Nach ein oder zwei Minuten wagte sie, die Tür zu öffnen und ihren Kopf hinauszustecken.
Noch immer nichts.
Alles war still. Sie schlich sich auf Zehenspitzen über den Treppenflur. Es blieb ruhig, auch als sie sich Stufe für Stufe hinunterwagte.
Ihre Mutter wartete immer noch ungeduldig an derselben Stelle. »Ich wollte gerade einen Suchtrupp losschicken. Ich dachte schon, du bist ins Klo gefallen. Mein Schlüssel?« Hazel streckte ihre Hand aus.
»Hast du gehört, was ich gesagt habe, Mama?«
»Hm?« Ihre Mutter war nun damit beschäftigt, ihre Tasche nach etwas anderem zu durchforsten.
»Über Tante Pegs Testament?«, hakte Stevie nach.
»Was ist damit?«
»Dass sie fast alles mir hinterlassen hat.«
»Sehr witzig, Schatz.« Hazel nahm das offenbar überhaupt nicht ernst.
»Mama!« Stevie ging ein paar Schritte nach vorn und stellte sich direkt vor die ältere Frau. »Das stimmt wirklich. Mr Gantly hat mich gestern zu sich gebeten.«
Hazel verengte die Augen zu Schlitzen. »Davon hast du gar nichts erzählt.«
»Ich war davon ausgegangen, euch auch dort anzutreffen. Als ihr dann nicht da wart und er mir sagte, Tante Peg habe mir ihr ganzes Geld hinterlassen – bis auf je tausend Pfund für dich und Fern –, war ich erst mal überfordert und sprachlos.«
»Klar warst du das! Ich hoffe doch, du hast ihm gesagt, dass das ungerecht von Tante Peg ist und alles durch drei aufgeteilt werden muss.«
Das klang vorhin aber noch anders, dachte Stevie. Als du vor kaum einer Minute noch davon ausgingst, dass Tante Peggys Erbe zwischen dir und Fern aufgeteilt werden würde, hast du irgendwie nichts von drei gerechten Teilen erwähnt, oder?, fuhr sie in Gedanken fort.
»Ja, habe ich«, seufzte Stevie. »Keine Chance.«
»Was meinst du mit ›keine Chance‹?«
»Wenn ich versuche, dir oder Fern etwas abzugeben, geht das ganze Geld ans Katzenheim, hat Mr Gantly gesagt.«
»Ach, was weiß der schon? Es ist dein Geld, und wem du es gibst, entscheidest du.«
»Offenbar nicht.«
Hazel stemmte die Arme in die Hüften. Ihr Mund formte sich zu einer geraden Linie. »Warum du?«, beschwerte sie sich.
Stevie zuckte mit den Schultern. Unter keinen Umständen konnte sie ihr verraten, was in Tante Pegs Brief stand, geschweige denn, was sie selbst vermutete: nämlich dass es daran liegen könnte, dass sich Stevie – im Gegensatz zu ihrer gleichgültigen Mutter – um die alte Dame gekümmert hatte.
»Du kriegst also fast alles, ja?«, fragte Hazel mit kritischem Blick.
Stevie zuckte erneut lediglich mit den Schultern; sie wollte keinen Streit, wusste ihn aber auch nicht zu verhindern.
»Und deine Schwester und ich bekommen je tausend Pfund?« Ihre Mutter tippte mit dem Fuß.
Stevie nickte einmal.
»Diese undankbare alte Schachtel!« Hazel schüttelte den Kopf. »Nach allem, was ich für sie getan habe!«
Stevie war kurz davor, nachzufragen, was genau ihre Mutter für Tante Peg getan habe, war aber klug genug, es sich zu verkneifen.
»Ich bin gespannt, was Fern dazu sagen wird«, fuhr Hazel fort. »Sie will einen Anbau.«
Fern will doch immer irgendetwas, dachte Stevie. Sie war nie zufrieden mit dem, was sie hatte, und schoss sich ständig auf die eine Sache ein, die ihr noch zu ihrem Glück fehlte: Wenn ich bloß so einen Luxuswhirlpool hätte, wäre ich glücklich; wenn ich bloß so einen neuen Smeg-Kühlschrank ergattern könnte, der praktisch alles kann, einschließlich Bügeln, wäre ich glücklich; und so weiter. Aber ihre Neuanschaffungen machten Fern nie glücklich. Sobald sie bekam, was sie so dringend und sehnlichst gewollt hatte, vergaß sie es sofort wieder und fand etwas Neues, was sie unbedingt haben musste. Sie hatte gerade erst den Garten landschaftlich gestalten lassen, und schon sprach sie von einem Anbau.
»Fern kann dazu sagen, was sie will«, erwiderte Stevie. »Das wird nichts ändern. Sie bekommt trotzdem nur tausend Pfund.«
Davon kann sie sich ein paar Tonnen Ziegel kaufen, dachte Stevie schadenfroh.
»Das wird ihr gar nicht gefallen«, prophezeite ihre Mutter. »Und mir gefällt es auch nicht. Ich bin froh, dass du mich vorgewarnt hast, bevor ich zu diesem Gantly gehe. Ich werde das nämlich anfechten.«
Das überraschte Stevie nicht sonderlich.
»Ich verstehe wirklich nicht, warum sie alles dir hinterlassen hat. Es ist ja nicht so, als würdest du etwas Nützliches damit anfangen«, fuhr Hazel fort.
Dass ihre Mutter offenbar so wenig Vertrauen in sie hatte, versetzte ihr einen Stich. »Da irrst du dich«, widersprach sie ihr. »Ich will damit ein eigenes Lokal eröffnen.«
Daraufhin verengten sich Hazels Augen noch weiter, bis sie nur noch Schlitze waren. »Wie viel hat Peg dir vermacht? Das hast du noch gar nicht gesagt.«
Stimmt, das war wohl irgendwie untergegangen. Nur wollte Stevie es jetzt ungern sagen. Aber hatte sie eine andere Wahl? Entweder würde ihre Mutter es von Mr Gantly oder auf anderem Wege erfahren. Da konnte sie es auch gleich hinter sich bringen.
»Zweihundertdreiundsechzigtausend Pfund«, sagte Stevie kleinlaut.
Hazel hielt eine Hand auf ihre Brust und schnappte nach Luft. Ihre Augäpfel traten bis zum Anschlag hervor. »Nie im Leben hatte sie so viel Geld!«
»Doch«, sagte Stevie traurig. Gerade wünschte sie, sie hätte nie etwas von Mr Gantly oder dem Geld erfahren. Es war den ganzen Ärger nicht wert. Da ihre Mutter jetzt von der Höhe des Nachlasses wusste, würde sie es nie auf sich beruhen lassen.
Und damit behielt Stevie recht, wie sich später herausstellte, als ihre Mutter mit Fern im Schlepptau von ihrem gar nicht mal so befriedigenden Notartermin zurückkehrte.
»Ich fasse es nicht, dass dir das alles einfach so in den Schoß fällt«, verkündete Fern, sobald sie Stevie erblickte. »Du musstest dafür doch keinen Finger krumm machen.«
Stevie warf einen Teig auf die Arbeitsplatte und knetete wütend auf ihn ein. Gerade Fern, die in ihrem Leben kaum gearbeitet hatte, hatte gut reden. Stevie hatte immerhin, seit sie von der Schule abgegangen war, jeden Tag (und oft nur für einen Hungerlohn) gearbeitet – bis sie sich das Bein gebrochen hatte und deshalb nicht arbeiten konnte. Fern hatte sich ein paar planlose Jahre lang mit diversen Aushilfsjobs über Wasser gehalten, bis sie sich Dezza und mit ihm das Leben gekrallt hatte, das sie sich immer gewünscht hatte. Mit der Geburt ihrer Kinder hatte Fern ihre Arbeit dann als erledigt betrachtet und war seither eine Society-Lady, die zum Lunch ausging und ihren Tag mit Shopping, Tennis und anderen Formen der Zerstreuung verbrachte, während die Kinder in der Schule waren. Fern war alles in den Schoß gefallen, und jetzt warf sie genau das Stevie vor.
Ich wette, sie ist neidisch, dachte Stevie und drosch unnachgiebig auf den Teig ein. Sie backte schon immer gern, um Frust abzubauen. An die erste Charge Gebäck hatte sie sich begeben, sobald ihre Mutter zur Tür hinausgefegt war. Ich wette, Fern würde gern mit mir tauschen, ging es Stevie durch den Kopf. Ich habe das ganze Geld und obendrein muss ich mich nicht mit dem Langweiler Dezza herumplagen. Wobei, vielleicht war die Sache doch nicht so klar.
Mit zweihundertdreiundsechzigtausend Pfund kam man in London nicht sehr weit und ganz sicher nicht an ein Eigenheim mit vier Schlafzimmern, einem Wohn- und einem Esszimmer in einer schicken Wohngegend wie Ferns. Genauso wenig konnte man damit zwei Kinder auf Privatschulen schicken. Mit dem Geld würde sie nicht einmal aufhören können, zu arbeiten, es sei denn, sie wollte in den nächsten vierzig Jahren nichts außer Toastbrot essen und nie wieder einen Fuß vor die Tür setzen.
Sie erinnerte sich an die mahnenden Worte ihrer Tante. Bloß nichts verschwenden, hatte Peg geschrieben. Aber wäre es wirklich Verschwendung, wenn sie sich gelegentlich einen Urlaub gönnen oder ihre uralte Schrottkiste von Kombi ersetzen würde? Würde es das Leben nicht einfach nur etwas erträglicher machen?
Plötzlich erschien ihr der Traum, mit dem Geld ein eigenes Geschäft zu gründen, sehr weit hergeholt. Es war eine ordentliche Summe, aber nicht genug, um sich damit irgendetwas aufzubauen. Zumindest nicht, wenn besagtes Geschäft über den Verkauf von Cupcakes aus einem Imbisswagen hinausginge (ein Gedanke, der Stevie und Karen so schnell gekommen, wie er wieder verworfen worden war).
Mit einem letzten dumpfen Schlag legte die enttäuschte Stevie den unschuldigen Brotteig gemeinsam mit ihren Träumen beiseite. Nach dem Abend im Pub mit Karen war Stevie für die Idee, ein eigenes Café zu eröffnen, noch Feuer und Flamme gewesen. Doch mittlerweile wich ihre Begeisterung wohl der Entscheidung, dass es vernünftiger wäre, sich Arbeit zu suchen und danach eine Bestandsaufnahme zu machen. Wenigstens würde sie sich jetzt zur Abwechslung einmal eine ordentliche Mietwohnung leisten können, die sie sich nicht mit einem Dutzend WG-Mitbewohnern teilen müsste (übertrieben gesagt). Erst war die Arbeitsstelle dran, dann eine Wohnung in erreichbarer Nähe. Denn sie wollte nicht drei Stunden täglich in der U‑Bahn verbringen, nur um zwischen Arbeit und Wohnung zu pendeln.
Das setzte natürlich voraus, dass sie in der Zwischenzeit ihre Mutter mit ihren zu erwartenden Vorwürfen in Dauerschleife ertragen würde.
Die Entscheidung war also gefallen. Stevie legte das Brot zum Ruhen in die Heizungskammer und kehrte dann in die Küche und die ernüchternde Realität zurück.
Kapitel 6
Genau das ist das Problem mit all diesen Londoner »Starköchen«, murrte Stevie. Sie kennen sich alle. Sie knallte das Telefon auf die Gabel und runzelte entnervt die Stirn. Das war jetzt die x‑te Version ein und derselben Leier: »Ich frage mich, warum Corky sich gezwungen fühlte, sich von Ihnen zu trennen.« Jeder schien den Text zu kennen. Ein Hit mit Ohrwurmpotenzial – bald auf CD im gut sortierten Fachhandel erhältlich, dachte sie sarkastisch.
Einige der Küchenchefs hatten ihr nicht einmal die Gelegenheit gegeben, die Sache mit dem gebrochenen Bein zu erklären, während andere sich die Geschichte zwar angehört, sie jedoch nur mit einem unverbindlichen »Hmmm« oder »Ich muss erst darüber nachdenken« abgespeist hatten. Am liebsten hätte sie ihnen nur noch trotzig entgegnet: »Das fasse ich dann mal als ein ›Nein‹ auf.« Aber sie hatte Angst, sich noch das letzte bisschen Chance auf eine Anstellung zu verspielen.