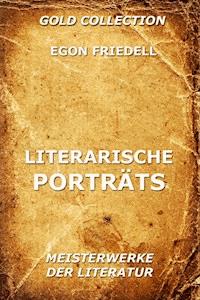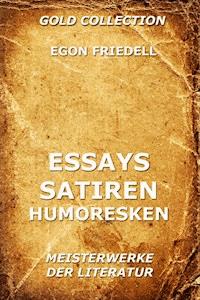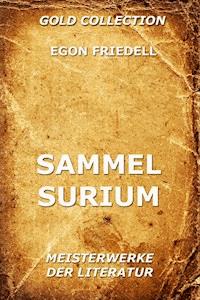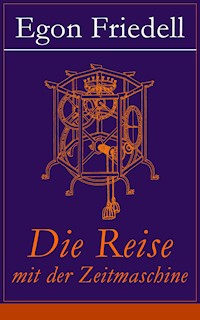0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Erstmals mit einem alphabetischem Index aller 794 Marginalien "Die Kulturgeschichte der Neuzeit" ist das große, mehrbändige Mammutwerk von Egon Friedell. Es spannt seinen Bogen über die Geschichte der abendländischen Kultur vom Ausgang des Mittelalters an bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs. Friedell war ein strenger Befürworter des anekdotischen und fragmentarischen Erzählens in der Geschichtsschreibung. Neben einem inhaltlichen Detailreichtum liefert sein Werk auch ausführliche und sehr lebendige Porträts von historischen Persönlichkeiten wie Martin Luther, Francis Bacon, William Shakespeare, René Descartes, Voltaire, Friedrich II., Immanuel Kant, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Franz Schubert oder Otto von Bismarck. Wer einen philosophischen und historischen Abriss der Thesen von Descartes, Bacon, Kant, Hegel, Schopenhauer oder Nietzsche sucht, wird hier ebenfalls fündig. Und wie nebenbei erläutert Friedell auch noch die wichtigsten Werke von Shakespeare, Goethe, Schiller, Dostojewski, Ibsen, Raffael, Rembrandt oder Monet. Darüber hinaus liefert er – für Historiker geradezu ein Novum – eine kurze Einführung in die wichtigsten naturwissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Erfindungen der Zeit – bis hin zu Einsteins Theorien. ("… die Masse eines Wasserstoffatoms verhält sich zur Masse eines Gramms Wasser wie die eines Postpakets von zehn Kilogramm zu der unseres Planeten …") Ähnlich wie in seinem anderem Opus-Magnum "Kulturgeschichte des Altertums" gibt uns der engagierte und geniale Dilettant (Max Reinhardt) hier ein mannigfaltiges, unterhaltsames und sehr lehrreiches Vademekum der Geschichte Europas zu Hand. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2390
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Egon Friedell
Kulturgeschichte der Neuzeit
Vollständige Fassung in fünf Bänden
Egon Friedell
Kulturgeschichte der Neuzeit
Vollständige Fassung in fünf Bänden
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 6. Auflage, ISBN 978-3-954188-91-8
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Einleitung
Was heisst und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte?
Erstes Buch – Renaissance und Reformation
Erstes Kapitel – Der Beginn
Zweites Kapitel – Die Seele des Mittelalters
Drittes Kapitel – Die Inkubationszeit
Viertes Kapitel – La Rinascita
Fünftes Kapitel – Das Hereinbrechen der Vernunft
Sechstes Kapitel – Die Deutsche Religion
Siebentes Kapitel – Die Bartholomäusnacht
Zweites Buch – Barock und Rokoko – Vom dreißigjährigen Krieg bis zum siebenjährigen Krieg
Erstes Kapitel – Die Ouvertüre der Barocke
Zweites Kapitel – Le grand siècle
Drittes Kapitel – Die Agonie der Barocke
Drittes Buch – Aufklärung und Revolution – Vom Siebenjährigen bis zum Wiener Kongress
Erstes Kapitel – Gesunder Menschenverstand und Rückkehr zur Natur
Zweites Kapitel – Die Erfindung der Antike
Drittes Kapitel – Empire
Viertes Buch – Romantik und Liberalismus – Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg
Erstes Kapitel – Die Tiefe der Leere
Zweites Kapitel – Das garstige Lied
Drittes Kapitel – Das Luftgeschäft
Fünftes Buch – Imperialismus und Impressionismus – Vom deutsch-französischen Krieg bis zum Weltkrieg
Erstes Kapitel – Der schwarze Freitag
Zweites Kapitel – Vom Teufel geholt
Epilog
Sturz der Wirklichkeit
Zeittafel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Sachbücher bei Null Papier
Aufstand in der Wüste
Das Leben Jesu
Vom Kriege
Geschmacksverirrungen im Kunstgewerbe
Ansichten der Natur
Über den Umgang mit Menschen
Die Kunst Recht zu behalten
Walden
Römische Geschichte
Der Untergang des Abendlandes
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die Krisis der Europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg
Widmung
Max Reinhardt gewidmet
… dass dies alles eben darum in einer Art wahr ist, weil es in einer Art falsch ist.Augustinus
Wer sich aber wundern sollte, dass nach so vielen Geschichtsschreibern auch mir die Abfassung einer solchen Schrift in den Sinn kommen konnte, der lese zuvor alle Schriften jener anderen durch, mache sich darauf an die meinige, und dann erst wundere er sich.Flavius Arrianos (95-180 n. Chr.)
Einleitung
Was heisst und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte?
Ausführlich zu schildern, was sich niemals ereignet hat, ist nicht nur die Aufgabe des Geschichtsschreibers, sondern auch das unveräußerliche Recht jedes wirklichen Kulturmenschen. Oscar Wilde
Der vergessene Stern
Durch die unendliche Tiefe des Weltraums wandern zahllose Sterne, leuchtende Gedanken Gottes, selige Instrumente, auf denen der Schöpfer spielt. Sie alle sind glücklich, denn Gott will die Welt glücklich. Ein einziger ist unter ihnen, der dieses Los nicht teilt: auf ihm entstanden nur Menschen.
Wie kam das? Hat Gott diesen Stern vergessen? Oder hat er ihm die höchste Glorie verliehen, indem er ihm freistellte, sich aus eigener Kraft zur Seligkeit emporzuringen? Wir wissen es nicht.
Einen winzigen Bruchteil der Geschichte dieses winzigen Sterns wollen wir zu erzählen versuchen.
Für diesen Zweck wird es nützlich sein, wenn wir vorher in Kürze die Grundprinzipien unserer Darstellung erörtern. Es sind Grundgedanken im eigentlichsten Sinn des Wortes: sie liegen dem Gesamtbau des Werkes zugrunde und sind daher, obschon sie ihn tragen, unterirdisch und nicht ohne weiteres sichtbar.
Alle Dinge haben ihre Philosophie
Der erste dieser Grundpfeiler besteht in unserer Auffassung vom Wesen der Geschichtschreibung. Wir gehen von der Überzeugung aus, dass sie sowohl einen künstlerischen wie einen moralischen Charakter hat; und daraus folgt, dass sie keinen wissenschaftlichen Charakter hat.
Geschichtschreibung ist Philosophie des Geschehenen. Alle Dinge haben ihre Philosophie, ja noch mehr: alle Dinge sind Philosophie. Alle Menschen, Gegenstände und Ereignisse sind Verkörperungen eines bestimmten Naturgedankens, einer eigentümlichen Weltabsicht. Der menschliche Geist hat nach der Idee zu forschen, die in jedem Faktum verborgen liegt, nach dem Gedanken, dessen bloße Form es ist. Die Dinge pflegen oft erst spät ihren wahren Sinn zu offenbaren. Wie lange hat es gedauert, bis uns der Heiland die einfache und elementare Tatsache der menschlichen Seele enthüllte! Wie lange hat es gedauert, bis der magnetische Stahl dem sehenden Auge Gilberts seine wunderbar wirksamen Kräfte preisgab! Und wie viele geheime Naturkräfte warten noch immer geduldig, bis einer kommt und den Gedanken in ihnen erlöst! Dass die Dinge geschehen, ist nichts: dass sie gewusst werden, ist alles. Der Mensch hatte seinen schlanken ebenmäßigen Körperbau, seinen aufrechten edlen Gang, sein weltumspannendes Auge seit Jahrtausenden und Jahrtausenden: in Indien und Peru, in Memphis und Persepolis; aber schön wurde er erst in dem Augenblick, wo die griechische Kunst seine Schönheit erkannte und abbildete. Darum scheint es uns auch immer, als ob über Pflanzen und Tiere eine eigentümliche Melancholie gebreitet sei: sie alle sind schön, sie alle sind Sinnbilder irgendeines tiefen Schöpfungsgedankens; aber sie wissen es nicht, und darum sind sie traurig.
Die ganze Welt ist für den Dichter geschaffen, um ihn zu befruchten, und auch die ganze Weltgeschichte hat keinen anderen Inhalt. Sie enthält Materialien für Dichter: Dichter des Werks oder Dichter des Worts: das ist ihr Sinn. Wer aber ist der Dichter, den sie zu neuen Taten und Träumen beflügelt? Dieser Dichter ist niemand anders als die gesamte Nachwelt.
Ästhetische, ethische, logische Geschichtschreibung
Man hat sich seit einiger Zeit daran gewöhnt, drei verschiedene Arten der Geschichtschreibung zu unterscheiden: eine referierende oder erzählende, die einfach die Begebenheiten berichtet, eine pragmatische oder lehrhafte, die die Ereignisse durch Motivierungen verknüpft und zugleich Nutzanwendungen aus ihnen zu ziehen sucht, und eine genetische oder entwickelnde, die darauf abzielt, die Geschehnisse als einen organischen Zusammenhang und Verlauf darzustellen. Diese Einteilung ist nichts weniger als scharf, weil, wie man auf den ersten Blick sieht, diese Betrachtungsarten ineinander übergehen: die referierende in die verknüpfende, die verknüpfende in die entwickelnde, und überhaupt keine von ihnen völlig ohne die beiden anderen zu denken ist. Wir können uns daher dieser Klassifikation nur in dem vagen und einschränkenden Sinne bedienen, dass bei jeder dieser Darstellungsweisen einer der drei Gesichtspunkte im Vordergrund steht, und in diesem Falle gelangen wir zu folgenden Ergebnissen: bei der erzählenden Geschichtschreibung, der es in erster Linie um den anschaulichen Bericht zu tun ist, überwiegt das ästhetische Moment; bei der pragmatischen Darstellung, die es vor allem auf die lehrhafte Nutzanwendung, die »Moral« der Sache abgesehen hat, spielt das ethische Moment die Hauptrolle; bei der genetischen Methode, die eine geordnete und dem Verstand unmittelbar einleuchtende Abfolge aufzuzeigen sucht, dominiert das logische Moment. Dementsprechend haben auch die verschiedenen Zeitalter je nach ihrer seelischen Grundstruktur immer eine dieser drei Formen bevorzugt: die Antike, in der die reine Anschauung am stärksten entwickelt war, hat die Klassiker der referierenden Geschichtschreibung hervorgebracht; das achtzehnte Jahrhundert mit seiner Neigung, alle Probleme einer moralisierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen, hat die glänzendsten Exemplare der pragmatischen Richtung aufzuweisen; und im neunzehnten Jahrhundert, wo die Tendenz vorherrschte, alles zu logisieren, in reine Begriffe und Rationalitäten aufzulösen, hat die genetische Methode die schönsten Früchte gezeitigt. Jede dieser drei Behandlungsarten hat ihre besonderen Vorzüge und Schwächen; aber so viel ist klar, dass bei jeder von ihnen ein bestimmtes Interesse das treibende und gestaltende Motiv bildet, sei es nun ästhetischer, ethischer oder logischer Natur: den entscheidenden, obschon stets wechselnden Maßstab des Historikers bildet allemal das »Interessante«. Dieser Gesichtspunkt ist nicht ganz so subjektiv, wie er aussieht: es herrschen über ihn, zumindest in demselben Zeitalter, große Übereinstimmungen; aber er ist natürlich auch keineswegs objektiv zu nennen.
Landkarte und Porträt
Man könnte nun meinen, dass bei der erzählenden Geschichtschreibung, wenn sie sich auf eine trockene sachliche Wiedergabe der Tatsachen beschränkt, das Ideal einer objektiven Darstellung noch am ehesten zu erreichen wäre. Aber schon die reine Referierung (die übrigens unerträglich wäre und, außer auf ganz primitiven Stufen, nie versucht worden ist) erhält durch die unvermeidliche Auswahl und Gruppierung der Fakten einen subjektiven Charakter. Hierin besteht eigentlich die Funktion alles Denkens, ja sogar unseres ganzen Vorstellungslebens, das ausnahmslos elektiv, selektiv verfährt und zugleich die der Wirklichkeit entnommenen Ausschnitte in eine bestimmte Anordnung bringt. Und diesen Prozess, den unsere Sinnesorgane unbewusst vollziehen, wiederholen die Naturwissenschaften mit vollem Bewusstsein. Aber es besteht hier doch ein kardinaler Unterschied. Die Selektion, die unsere Sinnesorgane und die auf ihren Meldungen aufgebauten Naturwissenschaften treffen, wird von der menschlichen Gattung nach strengen und eindeutigen Gesetzen entschieden, denen das Denken und Vorstellen jedes normalen Menschen unterworfen ist; die Auswahl des historischen Materials wird aber nach freiem Ermessen von einzelnen Individuen oder von gewissen Gruppen von Individuen, im günstigsten Fall von der öffentlichen Meinung eines ganzen Zeitalters bestimmt. Vor einigen Jahren hat der Münchener Philosoph Professor Erich Becher in seinem Werk »Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften« den Versuch gemacht, eine Art vergleichende Anatomie der Wissenschaften zu liefern, eine Art Technologie der einzelnen Disziplinen, die sich zu diesen etwa verhält wie eine Dramaturgie zur Kunst des Theaters. Dort findet sich der Satz: »Die Wissenschaft vereinfacht die unübersehbar komplexe Wirklichkeit durch Abstraktion … Der Historiker, der ein Lebensbild des Freiherrn vom Stein entwirft, abstrahiert von unzähligen Einzelheiten aus dessen Leben und Wirken, und der Geograf, der eine Gebirgslandschaft bearbeitet, abstrahiert von Maulwurfshügeln und Ackerfurchen.« Aber gerade aus dieser Gegenüberstellung sehen wir, dass Geografie und Geschichte sich eben nicht als gleichberechtigte Wissenschaften koordinieren lassen. Denn während es für Maulwurfshügel und Ackerfurchen ein ganz untrügliches Merkmal gibt, nämlich das einfache optische der Größe und Ausdehnung, lässt sich durch keine ebenso allgemeingültige Formel feststellen, was in der Biografie des Freiherrn vom Stein diesen quantités négligeables entspricht. Es ist ganz dem dichterischen Einfühlungsvermögen, dem historischen Takt, dem psychologischen Spürsinn des Biografen überlassen, welche Details er auslassen, welche er nur andeuten, welche er breit ausmalen soll. Geograf und Biograf verhalten sich zueinander wie Landkarte und Porträt. Welche Erdfurchen in eine geografische Karte aufzunehmen sind, sagt uns ganz unzweideutig unser geometrisches Augenmaß, das bei allen Menschen gleich und außerdem mechanisch kontrollierbar ist; welche Gesichtsfurchen in ein biografisches Porträt aufzunehmen sind, sagt uns nur unser künstlerisches Augenmaß, das bei jedem Menschen einen anderen Grad der Feinheit und Schärfe besitzt und jeder exakten Revision entbehrt.
Der geografischen Karte würde nicht einmal die historische Tabelle entsprechen, die die Fakten einfach chronologisch aneinanderreiht. Denn erstens ist es evident, dass eine solche Tabelle nicht mit derselben Berechtigung eine Wiederholung des Originals in verjüngtem Maßstabe genannt werden kann wie eine Landkarte. Und zweitens hätte eine solche amorphe Anhäufung von Daten nicht den Charakter einer Wissenschaft. Nach der doch wohl ziemlich unanfechtbaren Definition Bechers ist eine Wissenschaft »ein gegenständlich geordneter Zusammenhang von Fragen, wahrscheinlichen und wahren Urteilen nebst zugehörigen und verbindenden Untersuchungen und Begründungen«. Keine dieser Forderungen wird von einer solchen nackten Tabelle erfüllt: sie enthält weder Fragen noch Urteile noch Untersuchungen noch Begründungen. Mit demselben Recht könnte man einen Adresskalender, ein Klassenbuch oder einen Rennbericht ein wissenschaftliches Produkt nennen.
Wir gelangen demnach zu dem Resultat: sobald die referierende Geschichtschreibung versucht, eine Wissenschaft zu sein, hört sie auf, objektiv zu sein, und sobald sie versucht, objektiv zu sein, hört sie auf, eine Wissenschaft zu sein.
Fibelgeschichte
Was die pragmatische Geschichtschreibung anlangt, so bedarf es wohl kaum eines Beweises, dass sie das vollkommene Gegenteil wissenschaftlicher Objektivität darstellt. Sie ist ihrer innersten Natur nach tendenziös, und zwar gewollt und bewusst tendenziös. Sie entfernt sich daher von der reinen Wissenschaft, die bloß feststellen will, ungefähr ebenso weit wie die didaktische Poesie von der reinen Kunst, die bloß darstellen will. Sie erblickt im gesamten Weltgeschehen eine Sammlung von Belegen und Beispielen für gewisse Lehren, die sie zu erhärten und zu verbreiten wünscht, sie hat einen ausgesprochenen und betonten Lesebuchcharakter, sie will allemal etwas zeigen. Damit ist sie jedoch bloß als Wissenschaft verurteilt, wie ja auch die Lehrdichtung dadurch, dass sie keine reine Kunst ist, noch nicht jede Existenzberechtigung verliert. Das höchste Literaturprodukt, das wir kennen, die Bibel, gehört ins Gebiet der didaktischen Poesie, und einige der gewaltigsten Geschichtschreiber: Tacitus, Machiavell, Bossuet, Schiller, Carlyle, haben der pragmatischen Richtung angehört.
Unwissenschaftlichkeit der historischen Grundbegriffe
Als Reaktion gegen den Pragmatismus trat in der neuesten Zeit die genetische Richtung hervor, die sich zum Ziel setzt, die Ereignisse ohne jede Parteinahme lediglich an der Hand der historischen Kausalität in ihrer organischen Entwicklung zu verfolgen, also etwa in der Art, wie der Geologe die Geschichte der Erdrinde oder der Botaniker die Geschichte der Pflanzen studiert. Aber sie befand sich in einem großen Irrtum, wenn sie glaubte, dass sie dazu imstande sei. Erstens nämlich: indem sie den Begriff der Entwicklung einführt, begibt sie sich auf das Gebiet der Reflexion und wird im ungünstigen Fall zu einer leeren und willkürlichen Geschichtskonstruktion, im günstigen Fall zu einer tiefen und gedankenreichen Geschichtsphilosophie, in keinem Fall aber zu einer Wissenschaft. Die Vergleichung mit den Naturwissenschaften ist nämlich vollkommen irreführend. Die Geschichte der Erde liegt uns in unzweideutigen Dokumenten vor: wer diese Dokumente zu lesen versteht, ist imstande, diese Geschichte zu schreiben. Solche einfache, deutliche und zuverlässige Dokumente stehen aber dem Historiker nicht zu Gebote. Der Mensch ist zu allen Zeiten ein höchst komplexes, polychromes und widerspruchsvolles Geschöpf gewesen, das sein letztes Geheimnis nicht preisgibt. Die gesamte untermenschliche Natur trägt einen sehr uniformen Charakter; die Menschheit besteht aber aus lauter einmaligen Individuen. Aus einem Lilienkeim wird immer wieder eine Lilie, und wir können die Geschichte dieses Keims mit nahezu mathematischer Sicherheit vorausbestimmen; aus einem Menschenkeim wird aber immer etwas noch nie Dagewesenes, nie Wiederkehrendes. Die Geschichte der Natur wiederholt sich immer: sie arbeitet mit ein paar Refrains, die sie nicht müde wird zu repetieren; die Geschichte der Menschheit wiederholt sich nie: sie verfügt über einen unerschöpflichen Reichtum von Einfällen, der stets neue Melodien zum Vorschein bringt.
Zweitens: wenn die genetische Geschichtschreibung annimmt, ebenso streng wissenschaftlich Ursache und Wirkung ergründen zu können wie die Naturforschung, so befindet sie sich ebenfalls in einer Täuschung. Die historische Kausalität ist schlechterdings unentwirrbar, sie besteht aus so vielen Gliedern, dass sie dadurch für uns den Charakter der Kausalität verliert. Zudem lassen sich die physikalischen Bewegungen und ihre Gesetze durch direkte Beobachtung feststellen, während die historischen Bewegungen und ihre Gesetze sich nur in der Fantasie wiederholen lassen; jene kann man jederzeit nach prüfen, diese nur nach schaffen. Kurz: der einzige Weg, in die historische Kausalität einzudringen, ist der Weg des Künstlers, ist das schöpferische Erlebnis.
Und schließlich drittens erweist sich auch die Forderung der Unparteilichkeit als völlig unerfüllbar. Dass die Geschichtsforschung im Gegensatz zur Naturforschung ihre Gegenstände wertet, wäre noch kein Einwand gegen ihren wissenschaftlichen Charakter. Denn ihre Wertskala könnte ja objektiver Natur sein, indem sie, wie in der Mathematik, eine Größenlehre oder, wie in der Physik, eine Kräftelehre wäre. Aber hier zeigt sich der einschneidende Unterschied, dass es einen absolut gültigen Maßstab für Größe und Kraft in der Geschichte nicht gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass die Zahl 17 größer ist als die Zahl 3, dass ein Kreis größer ist als ein Kreissegment von demselben Radius; aber über historische Personen und Ereignisse vermag ich nicht Urteile von ähnlicher Sicherheit und Evidenz abzugeben. Wenn ich zum Beispiel sage, Cäsar sei größer als Brutus oder Pompejus, so ist das nicht beweisbarer als das Gegenteil, und in der Tat hat man jahrhundertelang diese für uns so absurde Ansicht vertreten. Dass Shakespeare der größte Dramatiker sei, der je gelebt hat, kommt uns ganz selbstverständlich vor, aber diese Meinung ist erst um die Wende des achtzehnten Jahrhunderts allgemein durchgedrungen; es war dieselbe Zeit, wo die meisten Menschen Vulpius, den Verfasser des »Rinaldo Rinaldini«, für einen größeren Dichter hielten als seinen Schwager Goethe. Raphael Mengs, in dem die Nachwelt nur noch einen faden und gedankenlosen Eklektiker erblickt, galt zu seinen Lebzeiten als einer der größten Maler der Erde; el Greco, in dem wir heute den grandiosesten Genius der Barocke anstaunen, war noch vor einem halben Menschenalter so wenig geschätzt, dass in der letzten Auflage von Meyers Konversationslexikon nicht einmal sein Name genannt wird. Karl der Kühne erschien seinem Jahrhundert als der glänzendste Held und Herrscher, während wir in ihm nur noch eine ritterliche Kuriosität zu sehen vermögen. In demselben Jahrhundert lebte Jeanne d’Arc; aber Chastellain, der gewissenhafteste und geistreichste Chroniqueur des Zeitalters, lässt in dem »Mystère«, das er auf den Tod Karls des Siebenten dichtete, alle Heerführer auftreten, die für den König gegen die Engländer kämpften, die Jungfrau erwähnt er aber überhaupt nicht: wir hingegen haben von jener Zeit kaum etwas anderes in der Erinnerung als das Mädchen von Orleans. Die Größe ist eben, wie Jakob Burckhardt sagt, ein Mysterium: »Das Prädikat wird weit mehr nach einem dunkeln Gefühle als nach eigentlichen Urteilen aus Akten erteilt oder versagt.«
Unterirdischer Verlauf der historischen Wirkungen
In der Erkenntnis dieser Schwierigkeit hat man nach einem anderen Wertmesser gesucht und gesagt: historisch ist, was wirksam ist; ein Mensch oder ein Ereignis ist umso höher zu veranschlagen, je größer der Umfang und die Dauer seines Einflusses ist. Aber hiermit verhält es sich ganz ähnlich wie mit dem Begriff der historischen Größe. Von der Schwerkraft oder der Elektrizität können wir in jedem einzelnen Falle genau sagen, ob, wo und in welchem Ausmaß sie wirkt, von den Kräften und Erscheinungen der Geschichte nicht. Zunächst, weil hier der Gesichtswinkel, von dem aus wir messen sollen, nicht eindeutig bestimmt ist. Für den Nationalökonomen wird die Einführung des Alexandriners eine sehr untergeordnete Rolle spielen, für den Theologen die Erfindung des Augenspiegels eine ziemlich geringe Bedeutung besitzen. Indes: hier ließe sich noch denken, dass ein wirklich universeller Forscher und Beobachter allen in der Geschichte wirksam gewordenen Kräften gleichmäßig gerecht wird, obschon sich einem solchen Unternehmen fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen. Viel schwerer aber wiegt der Einwand, dass ein großer Teil der historischen Wirkungen unterirdisch verläuft und oft erst sehr spät, bisweilen gar nicht ans Tageslicht tritt. Wir kennen die wahren Kräfte nicht, die unsere Entwicklung geheimnisvoll vorwärtstreiben; wir können einen tiefen Zusammenhang nur ahnen, niemals lückenlos beschreiben. Sueton schreibt in seiner Biografie des Kaisers Claudius: »Zu jener Zeit erregten die Juden auf Anstiften eines gewissen Chrestus in Rom Streitereien und Verdruss und mussten deshalb ausgewiesen werden.« Sueton war allerdings kein genialer Durchleuchter der Historie wie etwa Thukydides, sondern bloß ein ausgezeichneter Sammler und Erzähler von welthistorischem Tratsch, eine geschmackvolle und fleißige Mediokrität, aber gerade darum erfahren wir aus seiner Bemerkung ziemlich genau die offizielle Meinung des damaligen gebildeten Durchschnittspublikums über das Christentum: man hielt es für einen obskuren jüdischen Skandal. Und doch war das Christentum damals schon eine Weltmacht. Seine »Wirkungen« waren längst da und verstärkten sich mit jedem Tag; aber sie waren nicht greifbar und sichtbar.
Der Irrtum Rankes
Viele Geschichtsforscher haben daher ihre Ansprüche noch mehr herabgesetzt und vom Historiker bloß verlangt, dass er den jeweiligen Stand unserer Geschichtskenntnisse völlig objektiv widerspiegle, indem er sich zwar der allgemeinen historischen Wertmaßstäbe notgedrungen bedienen, aber aller persönlichen Urteile enthalten solle. Aber selbst diese niedrige Forderung ist unerfüllbar. Denn es stellt sich leider heraus, dass der Mensch ein unheilbar urteilendes Wesen ist. Er ist nicht bloß genötigt, sich gewisser »allgemeiner« Maßstäbe zu bedienen, die gleich schlechten Zollstöcken sich bei jeder Veränderung der öffentlichen Temperatur vergrößern oder verkleinern, sondern er fühlt außerdem den Drang in sich, alle Tatsachen, die in seinen Gesichtskreis treten, zu interpretieren, zu beschönigen, zu verleumden, kurz, durch sein ganz individuelles Urteil zu fälschen und umzulügen, wobei er sich allerdings in der exkulpierenden Lage des unwiderstehlichen Zwanges befindet. Nur durch solche ganz persönliche einseitige gefärbte Urteile nämlich ist er imstande, sich in der moralischen Welt, und das ist die Welt der Geschichte, zurechtzufinden. Nur sein ganz subjektiver »Standpunkt« ermöglicht es ihm, in der Gegenwart festzustehen und von da aus einen sichtenden und gliedernden Blick über die Unendlichkeit der Vergangenheit und der Zukunft zu gewinnen. Tatsächlich gibt es auch bis zum heutigen Tage kein einziges Geschichtswerk, das in dem geforderten Sinne objektiv wäre. Sollte aber einmal ein Sterblicher die Kraft finden, etwas so Unparteiisches zu schreiben, so würde die Konstatierung dieser Tatsache immer noch große Schwierigkeiten machen: denn dazu gehörte ein zweiter Sterblicher, der die Kraft fände, etwas so Langweiliges zu lesen.
Rankes Vorhaben, er wolle bloß sagen, »wie es eigentlich gewesen«, erschien sehr bescheiden, war aber in Wahrheit sehr kühn und ist ihm auch nicht gelungen. Seine Bedeutung bestand in etwas ganz anderem: dass er ein großer Denker war, der nicht neue »Tatsachen« entdeckte, sondern neue Zusammenhänge, die er mit genialer Schöpferkraft aus sich heraus projizierte, konstruierte, gestaltete, kraft einer inneren Vision, die ihm keine noch so umfassende und tiefdringende Quellenkenntnis und keine noch so scharfsinnige und unbestechliche Quellenkritik liefern konnte.
Alle Geschichte ist Legende
Denn man mag noch so viele neue Quellen aufschließen, es sind niemals lebendige Quellen. Sobald ein Mensch gestorben ist, ist er der sinnlichen Anschauung ein für allemal entrückt; nur der tote Abdruck seiner allgemeinen Umrisse bleibt zurück. Und sofort beginnt jener Prozess der Inkrustation, der Fossilierung und Petrifizierung; selbst im Bewusstsein derer, die noch mit ihm lebten. Er versteinert. Er wird legendär. Bismarck ist schon eine Legende und Ibsen ist im Begriff, eine zu werden. Und wir alle werden einmal eine sein. Bestimmte Züge springen in der Erinnerung ungebührlich hervor, weil sie sich ihr aus irgendeinem oft ganz willkürlichen Grunde besonders einprägten. Es bleiben nur Teile und Stücke. Das Ganze aber hat aufgehört zu sein, ist unwiederbringlich hinabgesunken in die Nacht des Gewesenen. Die Vergangenheit zieht einen Schleiervorhang über die Dinge, der sie verschwommener und unklarer, aber auch geheimnisvoller und suggestiver macht: alles verflossene Geschehen erscheint uns im Schimmer und Duft eines magischen Geschehens; eben hierin liegt der Hauptreiz aller Beschäftigung mit der Historie.
Jedes Zeitalter hat ein bestimmtes nur ihm eigentümliches Bild von allen Vergangenheiten, die seinem Bewusstsein zugänglich sind. Die Legende ist nicht etwa eine der Formen, sondern die einzige Form, in der wir Geschichte überhaupt denken, vorstellen, nacherleben können. Alle Geschichte ist Sage, Mythos und als solcher das Produkt des jeweiligen Standes unserer geistigen Potenzen: unseres Auffassungsvermögens, unserer Gestaltungskraft, unseres Weltgefühls. Nehmen wir zum Beispiel den Vorstellungskomplex »griechisches Altertum«. Es ist zunächst dagewesen als Gegenwart: als Zustand für die, die ihn miterlebten und miterlitten, und da war es etwas höchst Strapaziöses, Verdächtiges, Ungarantiertes, von heute auf morgen kaum zu Berechnendes, etwas, wovor man sehr auf der Hut sein musste und das doch sehr schwer zu fassen war, im Grunde nicht der unendlichen Mühe wert, die man darauf verwandte, und doch unentbehrlich, denn es war ja das Leben. Aber schon den Menschen der römischen Kaiserzeit erschien das frühere Griechentum als etwas unbeschreiblich Hohes, Helles und Kräftiges, sinnvoll und gefestigt in sich Ruhendes, ein unerreichbares Paradigma glücklicher Reinheit, Einfachheit und Tüchtigkeit, eine Wünschbarkeit ersten Ranges. Dann, im Mittelalter, wurde es etwas Trübes, Graues, bleifarbig Zerflossenes, höchst Unheimliches und von Gott Gemiedenes, eine Art Erdhölle voll Gier und Sünde, ein düsteres Theater der Leidenschaften. In der Vorstellung der deutschen Aufklärung wiederum war das alte Griechenland eine Art natürliches Museum, ein praktischer Kursus der Kunstgeschichte und Archäologie: die Tempel Antikensäle, die Marktplätze Glyptotheken, ganz Athen eine permanente Freiluftausstellung, alle Griechen entweder Bildhauer oder deren wandelnde Modelle, stets in edler und anmutiger Positur, stets weise und wohltönende Reden auf den Lippen, ihre Philosophen Professoren der Ästhetik, ihre Frauen heroische Brunnenfiguren, ihre Volksversammlungen lebende Bilder.1 An die Stelle dieser ebenso verehrungswürdigen wie langweiligen Gesellschaft hat das Fin de siècle den problematischen, ja hysterischen Griechen gesetzt, der nichts weniger als maßvoll, friedlich und harmonisch war, sondern von höchst bunter, opalisierender und gemischter Zusammensetzung, verstört von einem tiefen hoffnungslosen Pessimismus und gejagt von einer pathologischen Hemmungslosigkeit, die seine asiatische Herkunft verrät. Zwischen diese so heterogenen Auffassungen schoben sich zahlreiche Übergänge, Unterarten und Schattierungen, und es wird eine der Aufgaben unserer Darstellung sein, dieses interessante Farbenspiel des Begriffs »Antike« etwas genauer zu veranschaulichen.
Jedes Zeitalter, ja fast jede Generation hat eben ein anderes Ideal, und mit dem Ideal ändert sich auch der Blick in die einzelnen großen Abschnitte der Vergangenheit. Er wird, je nachdem, zum verklärenden, vergoldenden, hypostasierenden Blick oder zum vergiftenden, schwärzenden, obtrektierenden, zum bösen Blick.
Die geistige Geschichte der Menschheit besteht in einer fortwährenden Uminterpretierung der Vergangenheit. Männer wie Cicero oder Wallenstein sind tausendfach urkundlich bezeugt, haben genaue und starke Spuren ihres Wirkens in einer Fülle von Einzelheiten hinterlassen, und doch weiß bis zum heutigen Tage noch niemand, ob Cicero ein seichter Opportunist oder ein bedeutender Charakter, ob Wallenstein ein niedriger Verräter oder ein genialer Realpolitiker gewesen ist. Keinem der Männer, die Weltgeschichte gemacht haben, ist es erspart geblieben, dass sie gelegentlich Abenteurer, Scharlatane, ja Verbrecher genannt wurden: man denke an Mohammed, Luther, Cromwell, an Julius Cäsar, Napoleon, Friedrich den Großen und hundert andere. Nur von einem einzigen hat man dies noch nie zu behaupten gewagt, in dem wir aber eben darum keinen Menschen, sondern den Sohn Gottes erblicken.
Lebende Bilder – eine Mode des 18. Jahrhunderts: ein populäres Bild durch lebende Menschen mit Dekoration darstellen. Vgl. Goethes Wahlverwandtschaften. <<<
Homunculus und Euphorion
Das Beste am Menschen, sagt Goethe, ist gestaltlos. Ist es also schon bei einer einzelnen Individualität fast unmöglich, das letzte Geheimnis ihres Wesens zu entriegeln und das »Gesetz, wonach sie angetreten«, zu enthüllen, um wie viel absurder muss ein solches Unternehmen bei Massenbewegungen, Taten der menschlichen Kollektivseele sein, in denen sich die Kraftlinien zahlreicher Individualitäten kreuzen! Schon die Biologie, die es doch immerhin noch mit klar umgrenzten Typen zu tun hat, ist keine exakte Naturwissenschaft mehr und lebt von allerlei der philosophischen Mode unterworfenen Hypothesen. Wo das Leben beginnt, hört die Wissenschaft auf; und wo die Wissenschaft beginnt, hört das Leben auf.
Die Lage des Historikers wäre also vollkommen hoffnungslos, wenn sich ihm nicht ein Ausweg böte, der in einem anderen Wort Goethes angedeutet ist: »Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu tun hat.« Oder, um statt zwei goethischer Aperçus zwei goethische Gestalten zur Erläuterung heranzuziehen: der Historiker, der »wissenschaftlich«, bloß aus dem Stoff Geschichte aufbaut, ist Wagner, der in der Retorte den lebensunfähigen blutlosen Homunculus hervorbringt; der Historiker, der Geschichte gestaltet, indem er etwas aus eigenem hinzutut, ist Faust selbst, der durch die Vermählung mit dem Geist der Vergangenheit den blühenden Euphorion erzeugt; dieser ist freilich ebenso kurzlebig wie Homunculus, aber aus dem entgegengesetzten Grunde: weil zu viel Leben in ihm ist.
»Geschichte wissenschaftlich behandeln wollen«, sagt Spengler, »ist im letzten Grunde immer etwas Widerspruchsvolles … Natur soll man wissenschaftlich traktieren, über Geschichte soll man dichten. Alles andere sind unreine Lösungen.« Der Unterschied zwischen dem Historiker und dem Dichter ist in der Tat nur ein gradueller. Die Grenze, vor der die Fantasie haltzumachen hat, ist für den Historiker der Stand des Geschichtswissens in Fachkreisen, für den Dichter der Stand des Geschichtswissens im Publikum. Die Poesie ist auch nicht völlig frei in der Gestaltung historischer Figuren und Begebenheiten: es gibt eine Linie, die sie ohne Gefahr nicht überschreiten kann. Ein Drama zum Beispiel, das Alexander den Großen als Feigling und seinen Lehrer Aristoteles als Ignoranten schildern würde und die Perser im Kampf gegen die Mazedonier siegen ließe, würde dies mit dem Verlust der ästhetischen Wirkung bezahlen. In der Tat besteht auch immer ein sehr intimer Zusammenhang zwischen den großen Bühnendichtern und den maßgebenden Geschichtsquellen ihres Zeitalters. Shakespeare hat den Cäsar Plutarchs dramatisiert, Shaw den Cäsar Mommsens; Shakespeares Königsdramen spiegeln das historische Wissen des englischen Publikums im sechzehnten Jahrhundert ebenso genau wider wie Strindbergs Historien die Geschichtskenntnisse des schwedischen Lesers im neunzehnten Jahrhundert. Goethes »Götz« und Hauptmanns »Florian Geyer« erscheinen uns heute als fantastische Bilder der Reformationszeit; als sie neu waren, galten sie nicht dafür, denn sie fußten beide auf den wissenschaftlichen Forschungen und Anschauungen ihrer Zeit. Kurz: der Historiker ist nichts anderes als ein Dichter, der sich den strengsten Naturalismus zum unverbrüchlichen Grundsatz gemacht hat.
»Geschichtsromane«
Die zünftigen Gelehrten pflegen allerdings alle historischen Werke, die sich nicht mit dem geistlosen und unpersönlichen Zusammenschleppen des Materials begnügen, hochnäsig Romane zu nennen. Aber ihre eigenen Arbeiten entpuppen sich nach höchstens ein bis zwei Generationen ebenfalls als Romane, und der ganze Unterschied besteht darin, dass ihre Romane leer, langweilig und talentlos sind und durch einen einzigen »Fund« umgebracht werden können, während ein wertvoller Geschichtsroman in dem, was seine tiefere Bedeutung ausmacht, niemals »überholt« werden kann. Herodot ist nicht überholt, obgleich er größtenteils Dinge berichtet hat, die heute jeder Volksschullehrer zu widerlegen vermag; Montesquieu ist nicht überholt, obgleich seine Werke voll von handgreiflichen Irrtümern sind; Herder ist nicht überholt, obgleich er historische Ansichten vertrat, die heute für dilettantisch gelten; Winckelmann ist nicht überholt, obgleich seine Auffassung vom Griechentum ein einziger großer Missgriff war; Burckhardt ist nicht überholt, obgleich der heutige Papst für klassische Philologie, Wilamowitz-Moellendorff, erklärt hat, dass seine griechische Kulturgeschichte »für die Wissenschaft nicht existiert«. Denn wenn sich selbst alles, was diese Männer lehrten, als unrichtig erweisen sollte, eine Wahrheit wird doch immer bleiben und niemals überholt werden können: die der künstlerischen Persönlichkeit, die hinter dem Werk stand, des bedeutenden Menschen, der diese falschen Bilder erlebte, sah und gestaltete. Wenn Schiller zehn Seiten beseelter deutscher Prosa über eine Episode des Dreißigjährigen Krieges schreibt, die sich niemals so zugetragen hat, so ist das für die historische Erkenntnis fruchtbarer als hundert Seiten »Richtigstellungen nach neuesten Dokumenten« ohne philosophischen Gesichtspunkt und in barbarischem Deutsch. Wenn Carlyle die Geschichte der Französischen Revolution zum Drama eines ganzen Volkes steigert, das, von mächtigen Kräften und Gegenkräften manisch vorwärtsgetrieben, sein blutiges Schicksal erfüllt, so mag man das einen Roman und sogar einen Kolportageroman nennen, aber die geheimnisvolle Atmosphäre von unendlicher Bedeutsamkeit, in die dieses Dichterwerk getaucht ist, wirkt wie eine magische Isolierschicht, die es durch die Zeiten rettet. Und ist die kompetenteste Geschichtsdarstellung, die wir bis zum heutigen Tage vom Mittelalter besitzen, nicht Dantes unwirkliche Höllenvision? Und auch Homer: was war er anderes als ein Historiker »mit ungenügender Quellenkenntnis«? Dennoch wird er in alle Ewigkeit recht behalten, auch wenn sich eines Tages herausstellen sollte, dass es überhaupt kein Troja gegeben hat.
Alles, was wir von der Vergangenheit aussagen, sagen wir von uns selbst aus. Wir können nie von etwas anderem reden, etwas anderes erkennen als uns selbst. Aber indem wir uns in die Vergangenheit versenken, entdecken wir neue Möglichkeiten unseres Ichs, erweitern wir die Grenzen unseres Selbstbewusstseins, machen wir neue, obschon gänzlich subjektive Erlebnisse. Dies ist der Wert und Zweck alles Geschichtsstudiums.
Mögliche Unvollständigkeit
Wollten wir das Bisherige in einem Satz zusammenfassen, so könnten wir vielleicht sagen: was wir in diesem Buche zu erzählen versuchen, ist nichts als die heutige Legende von der Neuzeit.
In vielen gelehrten Werken findet sich im Vorwort die Bemerkung: »Möglichste Vollständigkeit war natürlich überall angestrebt, ob mir dies restlos gelungen, mögen die verehrten Fachkollegen entscheiden.« Mein Standpunkt ist nun genau der umgekehrte. Denn ganz abgesehen davon, dass ich die verehrten Fachkollegen natürlich gar nichts entscheiden lasse, möchte ich im Gegenteil sagen: möglichste Unvollständigkeit war überall angestrebt. Man wird vielleicht finden, dies hätte ich gar nicht erst anzustreben brauchen, es wäre mir auch ohne jedes Streben mühelos gelungen. Dennoch verleiht ein solcher bewusster Wille zum Fragment und Ausschnitt, Akt und Torso, Stückwerk und Bruchwerk jeder Darstellung einen ganz besonderen stilistischen Charakter. Wir können die Welt immer nur unvollständig sehen; sie mit Willen unvollständig zu sehen, macht den künstlerischen Aspekt. Kunst ist subjektive und parteiische Bevorzugung gewisser Wirklichkeitselemente vor anderen, ist Auswahl und Umstellung, Schatten- und Lichtverteilung, Auslassung und Unterstreichung, Dämpfer und Drücker. Ich versuche nur immer ein einzelnes Segment oder Bogenstück, Profil oder Bruststück, eine bescheidene Vedute ganzer großer Zusammenhänge und Entwicklungen zu geben. Pars pro toto: diese Figur ist nicht die unwirksamste und unanschaulichste. Oft wird ein ganzer Mensch durch eine einzige Handbewegung, ein ganzes Ereignis durch ein einziges Detail schärfer, einprägsamer, wesentlicher charakterisiert als durch die ausführlichste Schilderung. Kurz: die Anekdote in jederlei Sinn erscheint mir als die einzig berechtigte Kunstform der Kulturgeschichtschreibung. Dies hat schon der »Vater der Geschichte« gewusst, von dem Emerson sagt: »Weil sein Werk unschätzbare Anekdoten enthält, ist es bei den Gelehrten in Missachtung geraten; aber heutzutage, wo wir erkannt haben, dass das Denkwürdigste an der Geschichte ein paar Anekdoten sind, und uns nicht mehr beunruhigen, wenn etwas nicht langweilig ist, gewinnt Herodot wieder neuen Kredit.« Dies scheint auch die Ansicht Nietzsches gewesen zu sein: »Aus drei Anekdoten ist es möglich, das Bild eines Menschen zu geben« und die Absicht Montaignes: »Bei meinen geplanten Untersuchungen über unsere Sitten und Leidenschaften werden mir die Beweise aus der Fabel, wofern sie nur nicht gegen alle Möglichkeit verstoßen, ebenso willkommen sein wie die aus dem Reiche der Wahrheit. Vorgefallen oder nicht vorgefallen, zu Rom oder zu Paris, Hinz oder Kunz begegnet: es ist immer ein Zug aus der Geschichte der Menschheit, den ich mir aus dieser Erzählung zur Warnung oder Lehre nehme. Ich bemerke ihn, ich benutze ihn, sowohl nach Zahl wie nach Gewicht. Und unter den verschiedenen Lesarten, die zuweilen eine Geschichte hat, bevorzuge ich für meine Absicht die sonderbarste und auffallendste.«
Übertreibung
Dies führt uns zu einer zweiten Eigentümlichkeit aller fruchtbaren Geschichtsdarstellung: der Übertreibung. »Die besten Porträts«, sagt Macaulay, »sind vielleicht die, in denen sich eine leichte Beimischung von Karikatur findet, und es lässt sich fragen, ob nicht die besten Geschichtswerke die sind, in denen ein wenig von der Übertreibung der dichterischen Erzählung einsichtsvoll angewendet ist. Das bedeutet einen kleinen Verlust an Genauigkeit, aber einen großen Gewinn an Wirkung. Die schwächeren Linien sind vernachlässigt, aber die großen und charakteristischen Züge werden dem Geist für immer eingeprägt.« Die Übertreibung ist das Handwerkszeug jedes Künstlers und daher auch des Historikers. Die Geschichte ist ein großer Konvexspiegel, in dem die Züge der Vergangenheit mächtiger und verzerrter, aber umso eindrucksvoller und deutlicher hervortreten. Mein Versuch intendiert nicht eine Statistik, sondern eine Anekdotik der Neuzeit, nicht ein Matrikelbuch der modernen Völkergesellschaft, sondern ihre Familienchronik oder, wenn man will, ihre chronique scandaleuse.
Hierarchie der Kulturgebiete
Trägt demnach die Kulturgeschichte, was ihren Inhalt anlangt, einen sehr lückenhaften und fragmentarischen, ja einseitigen Charakter, so ist von ihrem Umfang das gerade Gegenteil zu fordern. Zum Gebiet ihrer Forschung und Darstellung gehört schlechterdings alles: sämtliche menschlichen Lebensäußerungen. Wir wollen uns diese einzelnen Ressorts in einer kurzen Übersicht vergegenwärtigen, wobei wir zugleich versuchen, eine Art Wertskala aufzustellen. Selbstverständlich ist dies das erste und das letzte Mal, dass wir uns einer solchen Schubfächermethode bedienen, die bestenfalls einen theoretischen Wert hat, im Praktischen aber vollständig versagt, denn es ist ja gerade das Wesen jeder Kultur, dass sie eine Einheit bildet.
Wirtschaft
Den untersten Rang in der Hierarchie der menschlichen Betätigungen nimmt das Wirtschaftsleben ein, worunter alles zu begreifen ist, was der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse dient. Es ist gewissermaßen der Rohstoff der Kultur, nicht mehr; als solcher freilich sehr wichtig. Es gibt allerdings eine allbekannte Theorie, nach der die »materiellen Produktionsverhältnisse« den »gesamten sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess« bestimmen sollen: die Kämpfe der Völker drehen sich nur scheinbar um Fragen des Verfassungsrechts, der Weltanschauung, der Religion, und diese ideologischen sekundären Motive verhüllen wie Mäntel das wirkliche primäre Grundmotiv der wirtschaftlichen Gegensätze. Aber dieser extreme Materialismus ist selber eine größere Ideologie als die verstiegensten idealistischen Systeme, die jemals ersonnen worden sind. Das Wirtschaftsleben, weit entfernt davon, ein adäquater Ausdruck der jeweiligen Kultur zu sein, gehört, genau genommen, überhaupt noch gar nicht zur Kultur, bildet nur eine ihrer Vorbedingungen und nicht einmal die vitalste. Auf die tiefsten und stärksten Kulturgestaltungen, auf Religion, Kunst, Philosophie, hat es nur einen sehr geringen bestimmenden Einfluss. Die homerische Dichtung ist der Niederschlag des griechischen Polytheismus, Euripides ein Abriss der griechischen Aufklärungsphilosophie, die gotische Baukunst eine vollkommene Darstellung der mittelalterlichen Theologie, Bach der Extrakt des deutschen Protestantismus, Ibsen ein Kompendium aller ethischen und sozialen Probleme des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts; aber manifestiert sich in Homer und Euripides in auch nur entfernt ähnlichem Maße das griechische Wirtschaftsleben, in der Gotik das mittelalterliche, in Bach und Ibsen das moderne? Man kann sagen – und man hat es oft genug gesagt –, dass Shakespeare ohne den Aufstieg der englischen Handelsmacht nicht denkbar gewesen wäre: aber kann man mit derselben Berechtigung behaupten, der englische Welthandel sei ein Ferment seiner Dramatik, ein Bestandteil seiner poetischen Atmosphäre? Oder ist etwa Nietzsche eine Übersetzung der emporblühenden deutschen Großindustrie in Philosophie und Dichtung? Er hat gar keine Beziehung zu ihr, nicht die geringste, nicht einmal die des Antagonismus. Und gar von den Religionen zu behaupten, dass sie »ebenfalls nur den jeweiligen durch die Produktionsverhältnisse bedingten sozialen Zustand widerspiegeln«, ist eine Albernheit, die lächerlich wäre, wenn sie nicht so gemein wäre.
Gesellschaft
Über dem Wirtschaftsleben erhebt sich das Leben der Gesellschaft, mit ihm in engem Zusammenhang, aber nicht identisch. Diese letztere Ansicht ist zwar häufig vertreten worden, und selbst ein so scharfer und weiter Denker wie Lorenz von Stein neigt ihr zu. Aber der Fall liegt doch etwas komplizierter. Zweifellos sind die einzelnen Gesellschaftsordnungen ursprünglich aus der Güterverteilung hervorgegangen: so geht die Feudalmacht im wesentlichen auf den Grundbesitz zurück, die Macht der Bourgeoisie auf den Kapitalbesitz, die Macht des Klerus auf den Kirchenbesitz. Aber im Laufe der geschichtlichen Entwicklung verschieben sich die Besitzverhältnisse, während die gesellschaftliche Struktur bis zu einem gewissen Grade erhalten bleibt. Das zeigt die Erscheinung jeder Art von Aristokratie. Der Geburtsadel war längst nicht mehr die wirtschaftlich stärkste Klasse, als er noch immer die gesellschaftlich mächtigste war. Es gibt heute auch schon eine Art Geldadel, der von den Besitzern der alten durch Generationen vererbten Vermögen repräsentiert wird: diese nehmen in der Gesellschaft einen weit höheren Rang ein als die meist viel begüterteren neuen Reichen. Ferner gibt es einen Beamtenadel, einen Militäradel, einen Geistesadel: lauter Gesellschaftsschichten, die sich niemals durch besondere wirtschaftliche Macht ausgezeichnet haben; und ebensowenig fließt die privilegierte Stellung der Geistlichkeit aus ökonomischen Ursachen.
Staat
Noch weniger als die Gesellschaft lässt sich der Staat mit der Wirtschaftsordnung identifizieren. Wenn man sehr oft behauptet hat, dass dieser nichts sei als die feste Organisation, die sich die bestehenden ökonomischen Verhältnisse in Form von Verfassungen, Gesetzen und Verwaltungssystemen gegeben haben, so hat man dabei vergessen, dass jedem Staatswesen, auch dem unvollkommensten, eine höhere Idee zugrunde liegt, die es, mehr oder weniger rein, zu verwirklichen sucht. Sonst wäre das Phänomen des Patriotismus unerklärlich. In ihm kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass der Staat eben keine bloße Organisation, sondern ein Organismus ist, ein höheres Lebewesen mit eigenen, oft sehr absurden, aber immer sehr reellen Daseinsbedingungen und Entwicklungsgesetzen. Er hat einen Sonderwillen, der mehr ist als die einfache mechanische Summation aller Einzelwillen. Er ist ein Mysterium, ein Monstrum, eine Gottheit, eine Bestie: was man will; aber er ist ganz unleugbar vorhanden. Deshalb haben die Empfindungen, die die Menschen diesem höheren Wesen entgegenbrachten, immer etwas Überlebensgroßes, Pathetisches, Monomanisches gehabt. Nicht bloß im Altertum, wo Staat und Religion bekanntlich zusammenfielen, und im Mittelalter, wo der Staat der Kirche untergeordnet war, aber eben dadurch eine religiöse Weihe empfing, sondern auch in der Neuzeit hat der Bürger im Vaterland in wechselnden Formen immer irgend etwas Sakrosanktes erblickt. Dies hat zu einer sehr einseitigen Überschätzung der politischen Geschichte geführt. Noch im achtzehnten Jahrhundert ist Weltgeschichte nichts gewesen als Geschichte »derer Potentatum«, und noch vor einem Menschenalter sagte Treitschke: »Die Taten eines Volkes muss man schildern; Staatsmänner und Feldherren sind die historischen Helden.« Bis vor kurzem hat man unter Geschichte nichts verstanden als eine stumpfe und taube Registrierung von Truppenbewegungen und diplomatischen Winkelzügen, Regentenreihen und Parlamentsverhandlungen, Belagerungen und Friedensschlüssen, und auch die geistvollsten Historiker haben nur diese alleruninteressantesten Partien des menschlichen Schicksalswegs erforscht, aufgezeichnet, zum Problem gemacht. Sie sind aber gar keines oder doch nur ein sehr subalternes, sie sind die einförmige Wiederholung der Tatsache, dass der Mensch zur einen Hälfte ein Raubtier ist, roh, gierig, verschlagen und überall gleich.
Sitte
Selbst wenn man die Geschichtsbetrachtung ausschließlich auf das Staatsleben beschränken wollte, wäre die Behandlungsart der politischen Historiker, die sich lediglich um Kriegsgeschichte und Verfassungsgeschichte zu kümmern pflegen, zu eng, denn sie müsste zumindest noch die Entwicklung der Kirche und des Rechts umfassen: zwei Gebiete, die man bisher immer den Spezialhistorikern überlassen hat. Und dazu kommt noch der höchst wichtige Kreis aller jener Lebensäußerungen, die man unter dem Begriff der »Sitte« zusammenzufassen pflegt. Gerade hier: in Kost und Kleidung, Ball und Begräbnis, Korrespondenz und Couplet, Flirt und Komfort, Geselligkeit und Gartenkunst offenbart sich der Mensch jedes Zeitalters in seinen wahren Wünschen und Abneigungen, Stärken und Schwächen, Vorurteilen und Erkenntnissen, Gesundheiten und Krankheiten, Erhabenheiten und Lächerlichkeiten.
Wissenschaft, Kunst, Philosophie, Religion
Im Reich des Geisteslebens, dem wir uns nunmehr zuwenden, nimmt die unterste Stufe die Wissenschaft ein, zu der auch alle Entdeckung und Erfindung sowie die Technik gehört, die nichts ist als auf praktische Zwecke angewendete Wissenschaft. In den Wissenschaften stellt jede Zeit sozusagen ihr Inventar auf, eine Bilanz alles dessen, wozu sie durch Nachdenken und Erfahrung gelangt ist. Über ihnen erhebt sich das Reich der Kunst. Wollte man unter den Künsten ebenfalls eine Rangordnung aufstellen, obgleich dies ziemlich widersinnig ist, so könnte man sie nach dem Grade ihrer Abhängigkeit vom Material anordnen, wodurch sich die Reihenfolge: Architektur, Skulptur, Malerei, Poesie, Musik ergeben würde. Doch ist dies mehr eine schulmeisterhafte Spielerei. Nur so viel wird sich mit einiger Berechtigung sagen lassen, dass die Musik in der Tat den obersten Rang unter den Künsten einnimmt: als die tiefste und umfassendste, selbstständigste und ergreifendste, und dass unter den Dichtungsgattungen das Drama die höchste Kulturleistung darstellt, als eine zweite Weltschöpfung: die Gestaltung eines in sich abgerundeten, vom Dichter losgelösten und zugleich zu lebendiger Anschauung vergegenwärtigten Mikrokosmos.
Als der Kunst völlig ebenbürtig ist die Philosophie anzusehen, die, sofern sie echte Philosophie ist, zu den schöpferischen Betätigungen gehört. Sie ist, wie schon Hegel hervorgehoben hat, das Selbstbewusstsein jedes Zeitalters und darin himmelweit entfernt von der Wissenschaft, die bloß ein Bewusstsein der Einzelheiten ist, wie sie die Außenwelt rhapsodisch und ohne höhere Einheit den Sinnen und der Logik darbietet. Darum hat auch Schopenhauer gesagt, der Hauptzweig der Geschichte sei die Geschichte der Philosophie: »Eigentlich ist diese der Grundbass, der sogar in die andere Geschichte hinübertönt und auch dort, aus dem Fundament, die Meinung leitet: diese aber beherrscht die Welt. Daher ist die Philosophie, eigentlich und wohlverstanden, auch die gewaltigste materielle Macht; jedoch sehr langsam wirkend.« Und in der Tat ist die Geschichte der Philosophie das Herzstück der Kulturgeschichte, ja, wenn man den Begriff, den ihr Schopenhauer gibt, in seinem vollen Umfange nimmt, die ganze Kulturgeschichte. Denn was sind dann Tonfolgen und Schlachtordnungen, Röcke und Reglements, Vasen und Versmaße, Dogmen und Dachformen anderes als geronnene Zeitphilosophie?
Die Erfolge der großen Eroberer und Könige sind nichts gegen die Wirkung, die ein einziger großer Gedanke ausübt. Er springt in die Welt und verbreitet sich stetig und unwiderstehlich mit der Kraft eines Elementarereignisses, einer geologischen Umwälzung: nichts vermag sich ihm entgegenzustemmen, nichts vermag ihn ungeschehen zu machen. Der Denker ist eine ungeheure geheimnisvolle Fatalität, er ist die Revolution, die wahre und wirksame neben hundert wesenlosen und falschen. Der Künstler wirkt schneller und lebhafter, aber nicht so dauerhaft; der Denker wirkt langsamer und stiller, aber dafür umso nachhaltiger. Lessings philosophische Streitschriften zum Beispiel in ihrer federnden Dialektik und moussierenden Geistigkeit sind heute noch moderne Bücher; aber seine Dramen haben schon eine dicke Staubschicht. Racines und Molières Figuren wirken heute auf uns wie mechanische Gliederpuppen, wie auf Draht gezogene Papierblumen, wie rosa angemalte Zuckerstengel; aber die freie und starke Luzidität eines Descartes, die grandiose und hintergründige Seelenanatomie eines Pascal hat für uns noch ihre volle Frische. Ja selbst die Werke der griechischen Tragiker haben heute ihren Patinaüberzug, der vielleicht ihren Kunstwert erhöht, aber ihren Lebenswert vermindert, während die Dialoge Platos gestern geschrieben sein könnten.
Die Spitze und Krönung der menschlichen Kulturpyramide wird von der Religion gebildet. Alles andere ist nur der massive Unterbau, auf dem sie selbst thront, hat keinen anderen Zweck, als zu ihr hinanzuführen. In ihr vollendet sich die Sitte, die Kunst, die Philosophie. »Die Religion«, sagt Friedrich Theodor Vischer, »ist der Hauptort der geschichtlichen Symptome, der Nilmesser des Geistes.«
Wir gelangen somit zu folgender Übersicht der menschlichen Kultur:
Der Mensch handelnd denkend gestaltend in Wirtschaft und Gesellschaft, in Entdeckung und Erfindung, in Kunst, Staat und Recht, Wissenschaft und Technik Philosophie, Kirche und Sitte Religion.
Wollten wir uns die Bedeutung der einzelnen Kulturgebiete in einem Gleichnis veranschaulichen, das natürlich ebenso hinkt wie alle anderen, so könnten wir das Ganze im Bilde des menschlichen Organismus zusammenfassen. Dann entspräche das Staatsleben dem Skelett, das das grobe, harte und feste Gerüst des Gesamtkörpers bildet, das Wirtschaftsleben dem Gefäßsystem, das Gesellschaftsleben dem Nervensystem, die Wissenschaft dem ausfüllenden Fleisch und bisweilen auch dem überflüssigen Fett, die Kunst den verschiedenen Sinnesorganen, die Philosophie dem Gehirn und die Religion der Seele, die den ganzen Körper zusammenhält und mit den höheren unsichtbaren Kräften des Weltalls in Verbindung setzt, beide auch darin ähnlich, dass ihre Existenz von kurzsichtigen und stumpfsinnigen Menschen oft geleugnet wird.
Der Stein der Weisen
Die Geschichtswissenschaft, richtig begriffen, umfasst demnach die gesamte menschliche Kultur und deren Entwicklung: sie ist stete Auffindung des Göttlichen im Weltlauf und darum Theologie, sie ist Erforschung der Grundkräfte der menschlichen Seele und darum Psychologie, sie ist die aufschlussreichste Darstellung der Staats- und Gesellschaftsformen und darum Politik, sie ist die mannigfaltigste Sammlung aller Kunstschöpfungen und darum Ästhetik, sie ist eine Art Stein der Weisen, ein Pantheon aller Wissenschaften. Sie ist zugleich die einzige Form, in der wir heute noch zu philosophieren vermögen, ein unerschöpflich reiches Laboratorium, in dem wir die leichtesten und lohnendsten Experimente über die Natur des Menschen anstellen können.
Der Repräsentativmensch
Jedes Zeitalter hat einen bestimmten Fundus von Velleitäten, Befürchtungen, Träumen, Gedanken, Idiosynkrasien, Leidenschaften, Irrtümern, Tugenden. Die Geschichte jedes Zeitalters ist die Geschichte der Taten und Leiden eines bestimmten niemals so dagewesenen, niemals so wiederkehrenden Menschentypus. Wir könnten ihn den Repräsentativmenschen nennen. Der Repräsentativmensch: das ist der Mensch, der nie empirisch erscheint, aber doch das Diagramm, den morphologischen Aufriss darstellt, der allen wirklichen Menschen zugrunde liegt, die Urpflanze gleichsam, nach der alle gebildet sind; oder wie in der Tierwelt die einzelnen lebenden Exemplare den Raubtiertypus, den Nagertypus, den Wiederkäuertypus übereinstimmend, aber niemals völlig rein verkörpern. Jede Zeit hat ihre bestimmte Physiologie, ihren charakteristischen Stoffwechsel, ihre besondere Blutzirkulation und Pulsfrequenz, ihr spezifisches Lebenstempo, ihre nur ihr eigentümliche Gesamtvitalität, ja sogar ihre individuellen Sinne: eine Optik, Akustik, Neurotik, die nur ihr angehört.
Die Geschichte der verschiedenen Arten des Sehens ist die Geschichte der Welt. Es gilt, Johannes Müllers Lehre von den spezifischen Sinnesenergien, wonach die Qualität unserer Empfindungen nicht von der Verschiedenheit der äußeren Reize, sondern von der Verschiedenheit unserer Aufnahmeapparate bestimmt wird, auch für die Geschichtsbetrachtung fruchtbar zu machen. Die »Wirklichkeit« ist immer und überall gleich: – nämlich unbekannt. Sie affiziert aber stets andere Sinnesnerven, Netzhäute, Hirnlappen, Trommelfelle. Dieses Bild von der Welt wandelt sich mit fast jeder Generation. Wir sehen dies daran, dass sogar das scheinbar Unveränderlichste, die Natur, fortwährend andere Gestalten annimmt. Sie ist einmal feindselig, wild und grausam und einmal einladend, intim und idyllisch, einmal exuberant und schwellend und einmal karg und asketisch, einmal pittoresk und zerfließend und ein andermal scharf konturiert und feierlich stilisiert, sie erscheint abwechselnd als die klarste logische Zweckmäßigkeit und als unfassbares Mysterium, als bloße dekorative Staffage für den Menschen und als der grenzenlose Abgrund, in den er versinkt, als das Echo, das alle seine Gefühle gesteigert wiederholt, und als eine stumme Leere, die er überhaupt kaum bemerkt. Wenn ein Zauberer käme, der die Gabe hätte, das Netzhautbild zu rekonstruieren, das eine Waldlandschaft im Auge eines Atheners aus der Zeit des Perikles abgezeichnet hat, und dann das Netzhautbild, das ein Kreuzritter des Mittelalters von derselben Waldlandschaft empfing, es würden zwei ganz verschiedene Gemälde sein; und wenn wir dann selber hingingen und den Wald anblickten, wir würden weder das eine noch das andere Bild in ihm wiedererkennen. Ja diese Tyrannei des Zeitgeistes geht sogar so weit, dass selbst die fotografische Kamera, dieser angeblich tote Apparat, der scheinbar ganz passiv und mechanisch das Lichtbild einträgt, unserer Subjektivität unterworfen ist. Auch das Objektiv ist nicht objektiv. Es ist nämlich eine ebenso unerklärliche wie unleugbare Tatsache, dass jeder Fotograf, ganz wie der Maler, immer nur sich selbst abbildet. Ist er ein ungebildetes und geschmackloses Vorstadtgehirn, so werden in seine Kamera lauter vulgäre und kitschige Figuren eintreten, ist er ein kultivierter, künstlerisch sehender Mensch, so werden seine Bilder vornehmen zarten Stichen gleichen. Infolgedessen werden spätere Zeiten in unseren Fotografien ebensowenig eine naturalistische Wiedergabe unserer äußeren Erscheinung erblicken wie in unseren Gemälden, sie werden ihnen wie ungeheuerliche Karikaturen vorkommen.
Der expressionistische Hund
Ja noch mehr: so unglaublich es klingen mag, der Schreiber dieser Zeilen besitzt seit einigen Jahren einen expressionistischen Hund! Ich behaupte, dass ein Geschöpf von einer so windschiefen und gleichsam betrunkenen Bauart, das aus lauter verzeichneten Dreiecken zusammengesetzt zu sein scheint, nie vorher in der Welt gewesen ist. Man wird dies für eine Einbildung halten; aber man mache es sich an einem Gegenbeispiel klar: wäre es möglich, den Mops, den repräsentativen Hund der Gründerjahre, jemals expressionistisch zu sehen? Zweifellos nicht; deshalb ist er ausgestorben, niemand weiß, warum und wieso. Und ebenso sind die Tage der Fuchsie gezählt, der Lieblingspflanze derselben Ära. Sie zieht sich bereits in die äußersten Vorstädte zurück, wo ja auch noch Romane von Spielhagen und Bilder von Defregger ihren Anwert finden. Und warum sind eine ganze Reihe höchst grotesker Fische, die eine so sonderbare Ähnlichkeit mit einem Unterseeboot oder einem menschlichen Taucher besitzen, erst im Zeitalter der Technik entdeckt worden? Die Beispiele ließen sich noch verhundertfachen. Es ist also keine Anmaßung, von Weltgeschichte zu reden, denn sie ist in der Tat die Geschichte unserer Welt oder vielmehr unserer Welten.
Seelische Kostümgeschichte
Unser Werk macht den Versuch, einen geistig-sittlichen Bilderbogen, eine seelische Kostümgeschichte der letzten sechs Jahrhunderte zu entwerfen und zugleich die platonische Idee jedes Zeitalters zu zeigen, den Gedanken, der es innerlich trieb und bewegte, der seine Seele war. Dieser Zeitgedanke ist das Organisierende, das Schöpferische, das einzig Wahre in jedem Zeitalter, obgleich auch er nur selten in der Wirklichkeit rein erscheint; vielmehr ist das Zeitalter das Prisma, das ihn in einen vielfarbigen Regenbogen von Symbolen zerlegt: nur hier und da tritt der Glücksfall ein, dass es einen großen Philosophen hervorbringt, der diese Strahlen in dem Brennspiegel seines Geistes wieder sammelt.
Und dies führt uns zu dem eigentlichen Schlüssel jedes Zeitalters. Wir erblicken ihn in den großen Männern, jenen sonderbaren Erscheinungen, die Carlyle Helden genannt hat. Man könnte sie auch ebenso gut Dichter nennen, wenn man diesen Begriff nicht einseitig auf Personen einschränkt, die mit Tinte und Feder hantieren, sondern sich vor Augen hält, dass man mit allem dichten kann, wenn man nur genug Schöpferkraft und Fantasie besitzt, ja dass die großen Helden und Heiligen, die in ihren Taten und Leiden mit dem Leben gedichtet haben, sogar höher stehen als die Dichter des Worts. Nach Carlyles Überzeugung ist die Form, in der der große Mann erscheint, völlig gleichgültig; die Hauptsache ist, dass er da ist: »Ich muss gestehen, dass ich von keinem großen Manne weiß, der nicht alle Menschengattungen hätte verkörpern können … Ist eine große Seele gegeben, die sich dem göttlichen Sinn des Daseins geöffnet hat, so ist damit auch ein Mensch gegeben, der die Gabe besitzt, davon zu reden und zu singen, dafür zu fechten und zu streiten, groß, siegreich und dauerhaft; dann ist ein Held gegeben: – seine äußere Gestalt hängt von der Zeit und der Umgebung ab, die er gerade vorfindet.« In der Geschichte gibt es nur zwei wirkliche Weltwunder: den Zeitgeist mit seinen märchenhaften Energien und das Genie mit seinen magischen Wirkungen. Der geniale Mensch ist das große Absurdissimum. Er ist ein Absurdissimum wegen seiner Normalität. Er ist so, wie alle sein sollten: eine vollkommene Gleichung von Zweck und Mittel, Aufgabe und Leistung. Er ist so paradox, etwas zu tun, was sonst niemand tut: er erfüllt seine Bestimmung.
Zwischen Genie und Zeitalter besteht nun eine komplizierte und schwer entzifferbare Verrechnung.
Das Genie ist ein Produkt des Zeitalters
Ein Zeitalter, das nicht seinen Helden findet, ist pathologisch: Seine Seele ist unterernährt und leidet gleichsam an »chronischer Dyspnoë«. Kaum hat es diesen Menschen, der alles ausspricht, was es braucht, so strömt plötzlich neuer Sauerstoff in seinen Organismus, die Dyspnoë verschwindet, die Blutzirkulation reguliert sich, und es ist gesund. Die Genies sind die wenigen Menschen in jedem Zeitalter, die reden können. Die anderen sind stumm, oder sie stammeln. Ohne sie wüssten wir nichts von vergangenen Zeiten: wir hätten bloß fremde Hieroglyphen, die uns verwirren und enttäuschen. Wir brauchen einen Schlüssel für diese Geheimschrift. Gerhart Hauptmann hat einmal den Dichter mit einer Windesharfe verglichen, die jeder Lufthauch zum Erklingen bringt. Halten wir dieses Gleichnis fest, so könnten wir sagen: im Grund ist jeder Mensch ein solches Instrument mit empfindlichen Saiten, aber bei den meisten bringt der Stoß der Ereignisse die Saiten bloß zum Erzittern, und nur beim Dichter kommt es zum Klang, den jedermann hören und erfassen kann.
Damit ein Abschnitt der menschlichen Geistesgeschichte in einem haltbaren Bilde fortlebe: dazu scheint immer nur ein einziger Mensch nötig zu sein, aber dieser eine ist unerlässlich. So würde zum Beispiel für die griechische Aufklärung Sokrates, für die französische Aufklärung Voltaire, für die deutsche Aufklärung Lessing, für die englische Renaissance Shakespeare, für unsere Zeit Nietzsche genügen. In solchen Männern objektiviert sich das ganze Zeitalter wie in einem verdeutlichenden Querschnitt, der jedermann zugänglich ist. Der Genius ist nichts anderes als die bündige Formel, das gedrängte Kompendium, der handliche Leitfaden, in dem knapp und konzis, verständlich und übersichtlich die Wünsche und Werke aller Zeitgenossen zusammengefasst sind. Er ist der starke Extrakt, das klare Destillat, die scharfe Essenz aus ihnen; er ist aus ihnen gemacht. Nähme man sie fort, so bliebe nichts von ihm zurück, er würde sich in Luft auflösen. Der große Mann ist ganz und gar das Geschöpf seiner Zeit; und je größer er ist, desto mehr ist er das Geschöpf seiner Zeit. Dies ist unsere erste These über das Wesen des Genies.
Das Zeitalter ist ein Produkt des Genies
Aber wer sind denn diese Zeitgenossen? Wer macht sie zu Zeitgenossen, zu Angehörigen eines besonderen, deutlich abgegrenzten Geschichtsabschnittes, die ihr spezifisches Weltgefühl, ihre bestimmte Lebensluft, kurz ihren eigenen Stil haben? Niemand anders als der »Dichter«. Er prägt ihre Lebensform, er schneidet das Klischee, nach dem sie alle gedruckt werden, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Er vertausendfältigt sich auf mysteriöse Weise. Man geht, steht, sitzt, denkt, hasst, liebt nach seinen Angaben. Er verändert unsere Höflichkeitsbezeugungen, unser Naturgefühl; unsere Haartracht, unsere Religiosität; unsere Interpunktion, unsere Erotik; das Heiligste und das Trivialste: alles. Sein ganzes Zeitalter ist infiziert von ihm. Er dringt unaufhaltsam in unser Blut, spaltet unsere Moleküle, schafft tyrannisch neue Verbindungen. Wir reden seine Sprache, wir gebrauchen seine Satzstellungen, eine flüchtig hingeworfene Redensart aus seinem Munde wird zur einigenden Parole, die die Menschen sich durch die Nacht zurufen. Die Straßen und Wälder, die Kirchen und Ballsäle bevölkern sich plötzlich, niemand weiß wieso, mit zahllosen verkleinerten Kopien von Werther, Byron,1 Napoleon, Oblomow, Hjalmar. Die Wiesen werden andersfarbig, die Bäume und Wolken werden andersförmig, die Blicke, die Gesten, die Stimmen der Menschen bekommen einen neuen Akzent. Die Frauen werden zu Preziösen nach dem Rezept Molières und zu Kanaillen nach der Vision Strindbergs; breithüftig und vollbusig, weil Rubens es sich vor seiner einsamen Staffelei so ausgedacht hat, und schmal und anämisch, weil Rossetti und Burne-Jones dieses Bild von ihnen im Kopfe trugen. Es ist gar nicht richtig, dass der Künstler die Realität abschildert, ganz im Gegenteil: die Realität läuft ihm nach. »Es ist paradox«, sagt Wilde, »aber darum nicht minder wahr, dass das Leben die Kunst weit mehr nachahmt als die Kunst das Leben.«
Niemand vermag diesen Zauberern zu widerstehen. Sie beflügeln und lähmen, sie berauschen und ernüchtern. In ihrem Besitz sind alle Heilmittel und Toxine der Welt. Sie lassen Leben aufsprießen, wohin sie kommen, alles wird durch sie kräftiger, gesünder, »kommt zu sich«: ja dies ist sogar die höchste Wohltat, die sie den Menschen erweisen, indem sie bewirken, dass diese zu sich selbst kommen, sich selbst erkennen, sobald sie mit ihnen in Berührung treten. Sie schaffen aber auch Krankheit und Tod. Sie lösen in vielen die latente Narrheit aus, die sonst vielleicht immer geschlummert hätte. Auch erregen sie Kriege, Revolutionen, soziale Erdbeben. Sie köpfen Könige, beschicken Schlachtfelder, stacheln Nationen zum Zweikampf. Ein gut gelaunter älterer Herr, namens Sokrates, vertreibt sich die Zeit mit Aphorismen, ein ebenso gut gelaunter Landsmann, namens Plato, macht daraus eine Reihe amüsanter Dialoge, und Bibliotheken schichten sich auf, Bibliotheken werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, Bibliotheken werden als Makulatur verbrannt, neue Bibliotheken werden geschrieben und hunderttausend Köpfe und Mägen leben von dem Namen Plato. Ein exaltierter Journalist, namens Rousseau, schreibt ein paar bizarre Flugschriften, und sechs Jahre lang zerfleischt sich ein hochbegabtes Volk. Ein weltfremder und von aller Welt gemiedener Stubengelehrter, namens Marx, schreibt ein paar dicke und unverständliche philosophische Bände, und ein Riesenreich ändert seine gesamten Existenzbedingungen von Grund auf.
Kurz: die Zeit ist ganz und gar die Schöpfung des großen Mannes, und je mehr sie es ist, desto voller und reifer erfüllt sie ihre Bestimmung, desto größer ist sie. Dies ist unsere zweite These über das Wesen des Genies.
George Byron, engl. Schriftsteller und Freiheitskämpfer, † 1824 <<<
Genie und Zeitalter sind inkommensurabel
Aber was ist denn der Genius? Ein exotisches Monstrum, eine Fleisch gewordene Paradoxie, ein Arsenal von Extravaganzen, Grillen, Perversitäten, ein Narr wie alle anderen, ja noch mehr als alle anderen, weil er mehr Mensch ist als sie, ein pathologisches Original, dem ganzen dunkeln Lebensgewimmel da unten im tiefsten fremd, aber auch seinesgleichen fremd, ja sich selber fremd, ohne die Möglichkeit irgendeiner Brücke zu seiner Umwelt. Der große Mann ist der große Solitär: was seine Größe ausmacht, ist gerade dies, dass er ein Unikum, eine Psychose, eine völlig beziehungslose Einmaligkeit darstellt. Er hat mit seiner Zeit nichts zu schaffen und sie nichts mit ihm. Dies ist unsere dritte These über das Wesen des Genies.
Man könnte nun vielleicht finden, dass diese drei Thesen sich widersprechen. Aber wenn sie sich nicht widersprächen, so wäre es ziemlich überflüssig gewesen, diese Bände, die im wesentlichen nichts sind als eine Schilderung der einzelnen Kulturzeitalter und ihrer Helden, überhaupt zu schreiben. Und für den, der die Aufgabe des menschlichen Denkens nicht im Darstellen, sondern im Abstellen von Widersprüchen erblickt, ist es andererseits gänzlich überflüssig, diese Bände zu lesen.
Der Pedigree
Ehe wir diese Einleitung beschließen, fühlen wir uns verpflichtet, auf unsere Vorgänger, gewissermaßen auf den Pedigree unseres Darstellungsversuchs einen kurzen Blick zu werfen. Doch kann es sich hierbei nicht um eine Geschichte der Kulturgeschichte handeln, so verlockend und lohnend eine solche Aufgabe wäre, sondern lediglich um eine flüchtige und aphoristische Hervorhebung gewisser Spitzen, die wir gleichsam nur mit dem Scheinwerfer von unserem ganz persönlichen Standort aus für einen Augenblick beleuchten.
Eigentlich war schon das erste historische Werk, von dem wir Kunde haben, Herodots Erzählung der Kämpfe zwischen Hellenen und Barbaren, freilich ohne es selbst recht zu wissen, eine Art vergleichende Kulturgeschichte. Aber schon Herodots jüngerer Zeitgenosse Thukydides schrieb streng politische Geschichte, und erst Aristoteles hat wieder auf die Bedeutung hingewiesen, die die Betrachtung der Sitten, Gebräuche und Lebensgewohnheiten auch für die politische Erkenntnis besitzt. Zu mehr als Ahnungen und Andeutungen konnte es jedoch das Altertum nicht bringen, dessen Weltbild statisch war: dass der homerische Mensch ein wesentlich anders geartetes Wesen war als der perikleische und dieser wiederum ganz verschieden vom alexandrinischen, ist den Griechen niemals klar ins Bewusstsein getreten. Und noch weniger war das Mittelalter imstande, den Begriff der historischen Entwicklung zu fassen. Hier ruht alles von Ewigkeit her in Gott: die Welt ist nur ein zeidoses Symbol, ein geheimnisvoller Kriegsschauplatz des Kampfes zwischen Heiland und Satan, den Erwählten und den Verdammten. So hat es schon an der Schwelle des Mittelalters der größte Genius der christlichen Kirche, Augustinus, gesehen und in seinem Werke »De civitate Dei« ergreifend beschrieben.