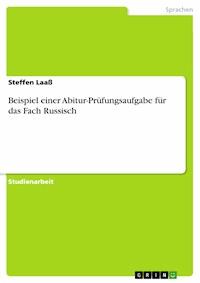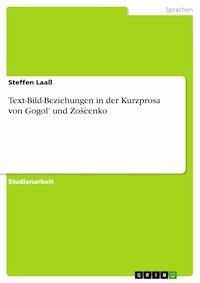36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Russistik / Slavistik, Note: 1,0, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Institut für fremdsprachliche Philologien), Sprache: Deutsch, Abstract: Zweisprachige Äquivalenzwörterbücher haben die Aufgabe, für lexikalische Einheiten einer Ausgangssprache semantische Entsprechungen in der jeweiligen Zielsprache aufzuzeigen. Im weiteren Sinne geht es um die Übertragung einzelsprachig kodierter Konzepte von einer Kultur in die andere. Besonders problematisch ist die Übersetzung von Benennungen kulturspezifischer Konzepte (u.a. Realienbezeichnungen), da sie für Angehörige eines anderen Kulturkreises entweder unbekannt oder schwer verständlich sein können. Die zweisprachige Lexikografie muss deshalb Modelle zur Erklärung und zielsprachigen Wiedergabe derartiger Benennungen entwickeln und in der Mikrostruktur des jeweiligen Wörterbuchs umsetzen. In dem Beitrag wird die Behandlung von Stichwörtern mit kulturspezifischer Semantik in zweisprachigen Wörterbüchern mit Russisch als Ausgangssprache analysiert und – auch in Abhängigkeit von Wörterbuchtyp und Nutzerkreis – kritisch gewertet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Page 3
3.4.2. Analogieverwendung
3.4.3. Paraphrase
3.5. Die Wiedergabe von Realienbezeichnungen in russisch-39
deutschen Wörterbüchern
3.5.1. Geographische Realien 40
3.5.2. Ethnographische Realien 42
3.5.2.1. Speisen und Getränke 42
3.5.2.2. Kleidung und Schmuck 46
3.5.2.3. Transportmittel 49
3.5.2.4. Architektur und Wohnen 53
3.5.2.5 Maßeinheiten und Währungen 59
3.5.2.6. Folklore und Brauchtum 59
3.5.3. Gesellschaftspolitische und soziohistorische Realien 72
3.5.3.1. Territorial-administrative Verwaltungseinheiten 72
3.5.3.2. Bildung 74
3.5.3.3. Religion und Kirche 76
3.5.3.4. Historismen zur Bezeichnung gesellschaftlicher Erscheinungen 77
3.5.3.5. Historismen zur Bezeichnung von Personen oder Amtstitel 79
3.5.3.6. Sowjetismen 80
3.6. Bewertung der angewandten lexikographischen 81
Wiedergabeverfahren
3.7. Einige Vorüberlegungen für die Erstellung eines russisch-86
deutschen Realienwörterbuches
894. Fazit
Literaturverzeichnis 90
Wörterbücher und sonstige Nachschlagewerke 92
Webliographie 93
Page 4
Einleitung
Zentraler Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die metalexikographische Unter-suchung zweisprachiger Wörterbücher für das Sprachenpaar Russisch-Deutsch im Hinblick auf mikrostrukturelle Wiedergabeverfahren von Stichwörtern mit kulturspezi-fischer Semantik. „Kulturgeladener“ Wortschatz, zu dem insbesondere Realien-bezeichnungen gehören, bringt sowohl in der zweisprachigen Lexikographie als auch in der Translationswissenschaft, der kontrastiven Linguistik und im Fremdsprachen-unterricht Probleme mit sich, die vor allem die Frage der Äquivalenzbeziehungen betreffen. Auslöser für die Auseinandersetzung mit dieser Problematik war die Feststellung, dass die in zweisprachigen Wörterbüchern dargebotenen deutschen Äquivalente für fremdsprachige kulturspezifische Stichwörter bei der Textrezeption und bei praktischen Übersetzungen oft nur von eingeschränktem Nutzen sein können. Folgenden Fragestellungen liegt dieser Arbeit zu Grunde: einerseits soll untersucht werden, auf welche Modelle zur Erklärung und zielsprachigen Wiedergabe kultur-spezifischer Konzepte Lexikographen zurückgreifen. Andererseits soll eine kritische Evaluierung dahingehend erfolgen, inwieweit die angewandten Darstellungsverfahren dem Wörterbuchbenutzer ein Bewusstsein für die Kulturspezifik bestimmter Lexik vermitteln. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse dienen somit auch einer lexikogra-phischen Bestandsaufnahme bisher erschienener russisch-deutscher Wörterbücher.
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: zwei theoretische und einen praktischen. Zunächst wird der Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur erläutert, wobei insbesondere auf die Begriffe „Kulturkreis“ und „kulturspezifisches Konzept“ aus vorwiegend ethnologischer Perspektive eingegangen werden soll. Ein weiterer Schwerpunkt bilden der Realienbegriff und die Kategorisierung von Realienbezeich-nungen. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Funktionen der zweisprachigen Lexikographie, in dem die Begriffe „Übersetzung“, „Äquivalenz“ und „lexikographische Lücke“ näher analysiert werden. Der Praxisteil stellt lexikographische Erklärungsmodelle zur Widerspiegelung von Wortschatz mit kulturspezifischer Semantik vor. Anhand von repräsentativen Beispie-len aus sechs russisch-deutschen Äquivalenzwörterbüchern soll gezeigt werden, wie die zweisprachige Lexikographie das Problem der Systemlücke zu lösen versucht.
Für diese Untersuchung kam ein eigens erarbeitetes Korpus zum Einsatz. Seine Erstellung war notwendig, da bisher noch keine umfangreicheren Sammlungen
Page 5
von kulturspezifischer Lexik für das Russische vorliegen. Das Korpus besteht aus 267 russischen Realienlexemen und basiert auf der Sichtung unterschiedlicher Quellen. Dazu gehören u.a. Texte und Vokabellisten aus Russischlehrbüchern, russisch-deutsche Grundwortschätze, annotierte Lesetexte für
Fremdsprachenlerner und aus-gewählte Wörterbuchstrecken, die nach Kulturspezifika „abgesucht“ wurden. Auch die praktische Erfahrung im täglichen Umgang im Lernen und Lehren der russischen Sprache fand Eingang in die Sammlung.
Das Korpus strebt keine Vollständigkeit an, sondern umfasst nur die geläufigsten in Wörterbüchern lemmatisierten lexikalischen Einheiten, die eine Realienbedeutung aufweisen. Dabei erfuhr die Sammlung im Verlauf der Arbeit eine ständige Revi-dierung (Ergänzungen, Streichungen) und wird auch in Zukunft einer kritischen Bewertung unterliegen.
Zur Behandlung der Realienproblematik in der Fachliteratur ist zu sagen, dass diese meist im Rahmen der Äquivalenzfrage in der Translationswissenschaft diskutiert wird. Bezüge zur zweisprachigen Lexikographie werden nur sporadisch oder gar nicht hergestellt. Autoren, die sich mit der Wiedergabe von Realienbenennungen in Wörter-büchern befasst haben, sind TOMASZCZYK (1984) und in Grundzügen PETELEZ (2001) und PETKOV (2001). Diese Arbeit legt zwar ihren Schwerpunkt auf kulturspezifische Lexik des Russischen, zu Illustrationszwecken soll jedoch eine Vielzahl von Beispielen aus anderen Sprachen herangezogen werden, vorzugsweise aus dem Englischen, Polnischen und Deutschen.
Die Wahl des Themas hängt mit meinem großen Interesse an kontrastivlinguistischen Fragestellungen zusammen. Das Hauptseminar „Kommunikationskultur und Wörter-bücher“, welches im WS 2006/07 am Institut für fremdsprachliche Philologien der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg angeboten wurde, ermöglichte eine intensi-vere Beschäftigung mit der Realienthematik. Zudem nahm ich die Gelegenheit wahr, meine (noch vorläufigen) Erkenntnisse zu der Problematik auf dem Göttingener „Norddeutschen Linguistischen Kolloquium“ im März 2007 einem interessierten Fach-publikum vorzustellen.
Meinen herzlichen Dank möchte ich Frau Prof. Dr. habil. Renate Belentschikow aussprechen, die diese Arbeit von Anfang an umfassend betreut und mit hilfreichen Anregungen begleitet hat.
1. Der Einfluss von Kultur auf Sprache
Page 6
1.1. Der Kulturbegriff
Die Tatsache, dass Sprache und Kultur eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen, ist nicht zu leugnen. Sprache als grundlegendes mensch-liches Kommunikationsmittel ist ein kulturelles Produkt, das über Jahrtausende gewachsen ist und ständiger Veränderung unterliegt. Kultur wiederum manifestiert sich im Denken der jeweiligen Sprachträger. Somit wird die Entwicklung einer Einzelsprache durch ihren kulturellen Kontext entscheidend geprägt. Doch was ist „Kultur“?
Es wäre ein abenteuerliches Unterfangen, für den Kulturbegriff einen allgemeingültigen Definitionsversuch vorzunehmen. Zu weit und vieldeutig ist der Begriffsumfang, denn jede Wissenschaftsdisziplin passt ihre Auffassungen von Kultur an ihre Bedürfnisse und Fragestellungen an. Auch im Rahmen dieser Arbeit muss der Kulturbegriff stark eingegrenzt werden.
Zunächst ist zwischen dem allgemeinen und dem spezifischen Kulturbegriff zu unterscheiden. Allgemein ist Kultur zu verstehen als die „Gesamtheit der materiellen, sozialen und ideellen Schöpfungen von Menschen“ (METZLER 2000, elektr. Pub.) und wird oft in Opposition zur Natur gestellt. Kultur ist somit eine „durch Menschen konstruierte Realität“ (HALLER 2005: 29). Diese objektive, außersprachliche Wirklich-keit, die sich aus vielfältigen Komponenten (Universalien) zusammensetzt, unterliegt allerdings räumlichen und zeitlichen Beschränkungen. Deshalb muss von einzelnen, spezifischen, sich unterscheidenden Kulturen gesprochen werden.
1.2. Die Klassifizierung von Kulturen
Die Klassifizierung von Kulturen kann u.a. nach historischen, religiösen oder geographischen Gesichtspunkten erfolgen. Historisch betrachtet unterscheidet man zwischen einer abendländischen und einer morgenländischen Kultur. Aus religiösem Blickwinkel wird zum Beispiel von einer christlichen, jüdischen und islamischen Kultur gesprochen. Unter räumlichem Aspekt kann eine Differenzierung zwischen einer europäischen, nordamerikanischen oder asiatischen Kultur erfolgen.
Eine Kategorisierung von Kulturen, die immer nur ein Konstrukt sein kann, geht stets mit der Suche nach Gemeinsamkeiten einerseits und nach Unterschieden anderer-seits einher:
Page 7
Ausgehend von der Grundkenntnis, dass es keine für die gesamte Menschheit gültige, einheitliche Kulturentwicklung gibt, fasste [die kulturhistorische Theorie der Völkerkunde] Kulturen zu Kulturkreisen zusammen, die mit ähnl[ichen] oder gleichen Einzelelementen (materieller Kulturbesitz, Wohnformen, bestimmte Sozialordnung, Religionsformen u.a.) - auch durch Diffusion - über weite Teile der Erde verbreitet sein können. (BROCKHAUS 1997)
Der von Leo Frobenius im Jahre 1898 geprägte ethnologische Begriff der Kulturkreise war der Vorläufer der sogenannten Kulturareale. Beiden Begriffen ist gemeinsam, dass sie „bestimmte Kombinationen versch[iedener] Kulturgüter, die in einem Gebiet verbreitet sind,“ betonen (HALLER 2005: 41). Kulturgüter können ideeller, sprachlicher, sozialer oder materiellen Natur sein. Letztere umfassen auch geographische Gegebenheiten. So sind die Kulturgüter „Taiga“ oder „Highlands“ nur einem bestimmten Territorium zuzuordnen (Russland bzw. Schottland). Zu den typischen Kulturelementen Osteuropas gehören z.B. das gemeinsame sprachliche (slawische) Erbe oder die politisch-ideologische Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg („Ostblockstaaten“). Die Ethnologie unterscheidet zwischen 44 räumlich abgrenzbaren, zusammenhängenden Kulturarealen (vgl. HALLER 2005: 40). Dazu zählen u.a. Nordwesteuropa, Nordafrika, die Karibik oder Südchina. Interessanterweise wird Russland dabei nicht als eigenständiges Kulturareal angesehen, sondern ist aufgrund seiner Größe und Ethnienvielfalt über fünf Kulturareale verteilt (Osteuropa, Kaukasus, Eurasische Steppe, Sibirien und Paläo-Sibirien). In einem „russischen Kulturareal“ müssten dem-nach alle Komponenten aus den fünf Gebieten gebündelt und zu einem Kulturraum zusammengefasst sein. Allerdings herrscht Uneinigkeit darüber, was als Kulturareal gilt, da die Grenzen zwischen Kulturspezifischem und Kulturuniversellem nicht eindeutig festlegbar sind. HALLER (2005: 28) führt 72 kulturelle Universalien auf, die - mehr oder weniger stark ausgeprägt - als wesentlicher Bestandteil jeder Einzelkultur gelten. Dazu zählen u.a. Bildung, dekorative Kunst, Familie, Folklore, gesellschaftliche Organisation, Kalender, Körperschmuck, Spiele und Wohnformen. Aufgrund dieser zwar allgemeingültigen, doch divergierenden kulturellen
„Versatzstücke“ sind sich nicht nur Ethnologen einig, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen in verschiedenen Welten leben.
Page 8
1.3. Das sprachliche Weltbild
Dass in einer Einzelsprache eine bestimmte Weltansicht verankert ist, konstatierte bereits Wilhelm von Humboldt in seiner Schrift „Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts“ (1835). Der amerikanische Linguist Edward Sapir und sein Schüler Benjamin Lee Whorf setzten Humboldts Gedanken fort und entwickelten die Hypothese, nach der „die einzelsprachlichen Systeme die Denkstrukturen (und auch Denkmöglichkeiten) ihrer Sprecher determinieren“ (METZLER 2000). Diese heute recht strittige und teilweise widerlegte extreme Position fasste Whorf unter dem Begriff des „linguistischen Relativitätsprinzips“ zusammen. Auch Leo Weisgerbers Lehre zur inhaltsbezogenen Grammatik bildete die Grundlage zur Erforschung einzelsprach-licher Weltbilder.
Allen drei Weltbild-Theorien ist gemein, dass Menschen ihre nicht-linguistische externe Erfahrungswelt mithilfe der Sprache unterschiedlich kategorisieren und somit eine von den Eigenarten der Sprachstruktur bedingte Weltsicht hätten, die sich insbesondere im begrifflichen Aufbau des Wortschatzes widerspiegelt. Die Wirklichkeitswahrnehmung der jeweiligen Sprachträger hängt somit weniger, wenn überhaupt, von der grammatischen Struktur einer Sprache ab, als vielmehr von der kulturellen Sphäre, in der sich die Sprache herausbildete und benutzt wird: „Der Einfluss von Kultur auf Sprache ist groß: Jede Kultur entwickelt für die für sie relevanten Bereiche ein ausdifferenziertes Vokabular; irrelevante Bereiche dagegen erfahren terminologisch nur geringe Ausdifferenzierung“ (HALLER 2005: 264). So hätten beispielsweise die von Sapir untersuchten Hopi-Indianer in ihrer Sprache nur ein Wort für alles, was fliegen kann (Insekten, Flugzeuge, Piloten u.a.). Einige arabische Regionaldialekte dagegen verfügen über eine überaus große Anzahl für die Bezeichnung des Kamels, während das Russische sehr reich ist an Benennungen emotionaler Zustände, die im Englischen nur ungenau wiedergegeben werden können. „Differenzierungen kultureller Systeme gehen einher mit Differenzierungen im Sprachsystem, zumindest im Wortschatz der jeweiligen Spr[ache]; der Umkehrschluß, daß Sprachsysteme die Wahrnehmung der Wirklichkeit spezif[isch] vorprägen und filtern, ist umstritten“ (METZLER 2000). Die objektive Realität müsste demnach von allen Menschen - egal welcher Kultur sie angehören - in ähnlicher Weise gedanklich und sprachlich erfasst und im Bewusstsein abgebildet werden können.
Page 9
Universalistische Kulturtheorien (B. Malinowski, C. Lévi-Strauss) sehen die Mensch-heit in ihrer Gesamtheit und ermöglichen basierend auf allgemeingültig existierender Kulturmuster (Universalien) die Vergleichbarkeit von Kulturen. Dagegen hebt der von M. Mead und R. Benedict entwickelte Kulturrelativismus die Einmaligkeit jeder Kultur hervor: „Der Kulturrelativismus betont nicht nur die Gleichwertigkeit und Einzigartigkeit aller Kulturen, sondern auch die Unvergleichbarkeit ihrer Weltbilder und - in ihrer extremsten Form - letztendl[ich] die Unübersetzbarkeit von Erfahrung von einer Kultur in die andere“ (HALLER 2005: 35).
Das Problem der Unübersetzbarkeit zwischen verschiedenen sprachlichen Weltbildern greift auch PALMER (1993: 46) auf:
If we do not have the ‚same picture of the universe’ as the speakers of other languages, we nevertheless have a picture that can be related to and in some degrees ‚mapped upon’ the picture that others have. That … is proved by the fact that we can investigate languages … and that we can translate. It may well be that we can never totally absorb or understand the ‘world’ of other languages, but … we can obtain a very fair understanding of them.
Die Unvergleichbarkeit und folglich die Unübersetzbarkeit von Weltbildern, also von sprachlichen Inhalten, ist jedoch in Frage zu stellen. Zweifelsohne führen kulturelle Unterschiede häufig zu nicht zu unterschätzenden
Übersetzungsproblemen, doch von einer Sprache in die andere zu übersetzen misslingt selten: „There may be no exact equivalence, but languages are never totally different“ (ibid.). Dabei treten Schwierig-keiten oft bei anscheinend ‚unübersetzbaren’ kulturgebundenen Einzelwörtern auf (z.B.dt.Schadenfreude,engl.gentleman,russ.обломовщина,poln.radioustukacz). Lexeme dieser Art fallen unter den Begriff der kulturspezifischen Konzepte.
1.4. Kulturspezifische Konzepte
1.4.1. Das Konzept - eine Begriffsbestimmung
Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnen Konzepte neben Skizzen und Entwürfen auch Vorstellungen, Denkmodelle oder Gedanken - also Begriffsinhalte. In der kognitiven Linguistik ist ein Konzept eine „mentale Informationseinheit im Langzeitge-dächtnis, in der bzw. über die Menschen ihr
Page 10
Wissen über die Welt abspeichern, organisieren und kategorisieren“ (METZLER 2000). Das Wissen kann sich auf Informationen über ganze Klassen beziehen (Kategorien- oder Typenkonzepte) oder an räumliche und zeitliche Erfahrungen eines Individuums gebunden sein (Partikular- oder Tokenkonzepte). Eine Vielzahl von Konzepten bestimmt die Vorstellungs- und Begriffswelt der jeweiligen Sprach- und Kulturträger. Konzepte stellen somit immer Abstraktionen der in der realen Welt existierenden Objekte dar und beruhen auf Erfahrungen im Umgang mit der Welt.
Zudem sind Konzepte stets mit Formativen verknüpft. Die Zuordnung der Zeichen-gestalt zu einer Bedeutung eines sprachlichen Zeichens ist arbiträr. So wird dem Konzept „Schule“ im Deutschen die sprachliche FormSchulezugeordnet, im Französischenécole,im Polnischenszkołaund im Arabischenmadrasah(َﺔَﺳ ْر َﺪ .)ﻣ
Die lexikalische Bedeutung, also die mentale Repräsentation von Wissen über das DenotatSchule,lautet im Deutschen „eine Institution, die dazu dient, ... Kindern Wissen zu vermitteln u. sie zu erziehen“ (GÖTZ et al. 1998), fürschoolim Englischen „an institution for educating or giving instruction, esp.Brit.for children under 19 years (COD 1995) und fürшколаim Russischen „Учебноезаведение, которое осущест-вляет общее образование и воспитание молодого поколения“(KUZNECOV 2003). Streng genommen bündeln
Wörterbuchdefinitionen ein mehrheitlich akzeptiertes Denotatswissen über das bezeichnete Objekt und ähneln demnach Konzepten, die „eine Menge (oder ein Set) einzelner Bedeutungselemente zu einem Ganzen
zusammenfassen“ (PÖRINGS/SCHMITZ 1999: 22).