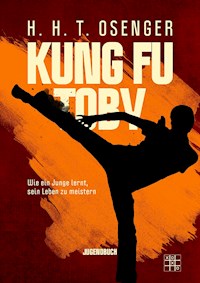
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der 14-jährige Toby hat es nicht leicht: Sein Stiefvater unterdrückt ihn, er muss fast jeden Tag vor einer Bande fliehen, die ihm auflauert, er hat keine Freunde und gilt als Außenseiter. Und dann ist da noch Bellinda, das schönste Mädchen der Schule. Toby verehrt sie schüchtern aus der Ferne, doch sie beachtet ihn nicht. Das wahre Leben beginnt für den Jungen nach Sonnenuntergang, wenn er sich in den Kämpfer Zhao verwandelt, der in einer südostasiatischen Hafenstadt lebt. In dieser Fantasiewelt ist es immer Nacht und der Vollmond scheint hell. Dort hat er Freunde und besteht mit ihnen die wildesten Abenteuer. Mehr und mehr verabschiedet sich der Junge von der Realität in seine Traumwelt, bis plötzlich ungeahnte Hilfe auftaucht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
H. H. T. OSENGER
Kung Fu Toby
Wie ein Junge lernt, sein Leben zu meistern
Jugendbuch
XOXO Verlag
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-183-2
E-Book-ISBN: 978-3-96752-683-7
Copyright (2020) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung des Bildes: Stockfoto- Nummer: 53209159
von www.shutterstock.com
Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Gewidmet allen unterdrückten Menschen
Wehrt Euch!
Tobys Realität
Toby jagte um die Straßenecke, die Schultasche an sich gepresst. Beinahe wäre sie ihm entglitten. Schweiß lief über seine Stirn, brannte in seinen Augen. Er versuchte die Tropfen wegzublinzeln. Sein Herz raste, vor Anstrengung, aber auch vor Panik. Seine Lungen pumpten wie Blasebälge im schnellsten Arbeitstakt. Nur weg hier, nur weiter! Schneller! Schneller! Sie waren wieder mal hinter ihm her!
Eben noch hatte er die Schritte seiner Verfolger auf das Pflaster des Bürgersteiges prasseln gehört, jetzt – auf der anderen Seite der Straßenecke - hörte er die Geräusche der Autos und einer Straßenbahn, die über die Fahrbahn rollten oder in den Gleisen schepperte, und den einen oder anderen Gesprächsfetzen der Passanten. Auf diesen Straßen hörte man Hochdeutsch, rheinischen Dialekt, Deutsch mit rheinischem Akzent, Deutsch mit Ostakzent, Checkerdeutsch, Türkisch, Osteuropäische Sprachen, Italienisch, Spanisch, Griechisch … Nichts davon drang in Tobys Bewusstsein, denn nur ein Gedanke hatte im Augenblick darin Platz, oder vielmehr nur eine Emotion. Es war der Selbsterhaltungstrieb.
…schneller… …entkommen… …schneller…
Er wusste genau, dass in ungefähr fünfzig Metern Entfernung ein Supermarkt war. Da er spürte, dass seine Kräfte nachließen, beschloss er, in den Markt zu flüchten. Seine Beine fühlten sich schon längst schwer wie Blei an. Die Leute auf der Straße ignorierten die Hatz, hatten weder für die Verfolger noch für das Opfer Augen oder Ohren. In dem Geschäft mochte das anders sein, hier würden sie wohl nicht wagen, ihn aufzumischen und seine Taschen zu durchwühlen. Andererseits war der Supermarkt auch eine Falle. Sie brauchten nur zu warten, bis er heraus kam. Und das musste er irgendwann tun. Da war der Eingang! Seitlich vor dem Markt, fast genau vor der Straßenbahnhaltestelle, stand ein Lieferwagen mit geöffnetem Laderaum, und der Fahrer, ein junger Mann mit blondem Stoppelhaarschnitt, fuhr mit einer Karre große Kartoffelsäcke in das Geschäft …
Die Verfolger kamen um die Ecke gerannt, gierig suchten fünf Augenpaare die beiden Seiten der Straße nach dem Jungen ab, den sie schon seit einigen Minuten hetzten. Es waren viele Menschen auf den Bürgersteigen, aber nicht der Gesuchte. Da war der Schuhmacherladen, der türkische Schnellimbiss, ein Kiosk, ein leer stehendes Ladenlokal, eine Kneipe, die noch geschlossen war, der Supermarkt. Die Straßenbahn war schon fast außer Sicht gerasselt, die konnte er nicht mehr bestiegen haben. Ein Taxi löste sich vom Straßenrand, nein, zu teuer, außerdem hatte der Fahrer das Taxenschild auf dem Dach eingeschaltet, der Wagen war also bis auf den Fahrer leer.
Der Supermarkt!
»Er muss in den Supermarkt gelaufen sein! Da hat er sich versteckt! Ihr zwei bleibt hier draußen und nehmt ihn in Empfang, wenn er `raus kommt! Ihr zwei geht mit mir `rein!«
Zwei Jungen, längst keine Kinder mehr, aber auch noch keine erwachsenen Männer, blieben vor dem Supermarkt stehen. Drei Gleichaltrige stürmten mit brutaler Begeisterung im Blick auf den Eingang zu. Dabei prallten sie mit dem Fahrer des Lieferwagens zusammen, der seine jetzt leere Sackkarre vor sich her schob.
»Macht doch eure Augen auf, ihr Blödmänner!«, legte der Fahrer erbost los.
»Mach doch selber die Augen auf …«, begann der Anführer der Gruppe genau so laut, wurde aber sehr schnell leiser. Die letzten beiden Worte schienen ihm im Hals stecken zu bleiben. Er betrachtete den Fahrer: Ärmelloses T-Shirt, das eine muskulöse Brust verpackte, daraus ragten Arme, die ganz offensichtlich kräftiges Zupacken gewohnt waren. Trotz der niedrigen Temperatur schien er nicht zu frieren. Ein hageres Gesicht mit derben Zügen! Der Fahrer packte den Wortführer mit einer Hand am Kragen seiner Jacke.
»Was war das gerade?«, fragte er leise, aber drohend. Der Griff war eisenhart, mehr Schraubstock als Faust.
»Nichts, schon gut!«, sagte der Jüngere kleinlaut. Seine Gefährten waren froh, dass sie sich nicht an seiner Stelle befanden.
Der Fahrer blickte dem Jungen noch einmal fest in die Augen. Der schien sich in seine Jacke verkriechen zu wollen wie eine Schildkröte in ihren Panzer. Da ließ der Erwachsene den Jungen los, nicht ohne ihm dabei einen Stoß zu versetzen, so dass dieser zwei kleine Schritte rückwärtstaumelte. Der Fahrer schob seine Karre auf den Lieferwagen zu und beachtete die fünf Jungen nicht mehr.
»Scheiße!«, fluchte der Anführer. »Das ist der Bubi vom Gymnasium schuld, das zahle ich dem heim. Das soll der mir büßen!« Mit diesen Worten betrat er den Supermarkt, zwei Vasallen im Gefolge, zwei andere standen draußen Wache.
Der Fahrer hob die Sackkarre in den Lieferwagen, wollte gerade die Türen schließen, da fiel sein Blick auf etwas, was sich im Halbdunkel zwischen den Säcken voller Feldfrüchte verbarg: Ein mittelgroßer, schmaler Junge mit hellbraunem Haar. Toby legte mit beschwörender Geste einen Finger an die Lippen und hauchte dann: »Bitte!«
Der Fahrer zögerte einen Moment, sah im Wagen das bleiche, verschwitze Gesicht mit den weit aufgerissenen Augen, war unentschlossen, blickte zurück auf den Bürgersteig, wo zwei ziemlich wild aussehende Jungen den Eingang und das Innere des Supermarkts beobachteten, wachsam und stets bereit, sich auf das fliehende Opfer zu stürzen. Der Mann gab sich einen Ruck und schloss die Tür. Sofort befand sich Toby im Dunkeln. Aber er atmete auf. Der tiefe Atemzug befreite ihn von der Angst, die ihn in den letzten Minuten in ihren eiskalten, unbarmherzigen Krallen gehalten hatte. Er schloss vor Erleichterung einen Moment die Augen. Toby hörte die Geräusche der Straße nun gedämpfter. Der Wagen schaukelte leicht, als sich der Fahrer ins Führerhaus hinter das Lenkrad schwang. Der Diesel wurde gezündet, Toby versuchte irgendwo in der Dunkelheit Halt zu finden. Dann ruckte das Fahrzeug an, allerdings sanfter und langsamer, als der Passagier zwischen den Kartoffeln es erwartet hätte. Konnte es sein, dass der Fahrer auf ihn Rücksicht nahm?
Schon nach wenigen Augenblicken, der Wagen konnte nur einige hundert Meter zurückgelegt haben, erstarben Bewegung und Motorengeräusch. Toby hörte den Fahrer aussteigen und die Tür des Führerhauses zuwerfen. Einige Schritte, dann Geräusche an den Türen zum Laderaum. Sie wurden aufgezogen und ließen das graue Licht eines mit Wolken verhangenen Tages herein. Toby kam es vor wie der schönste Sonnenaufgang.
»Jetzt musst du aber aussteigen«, sagte der Fahrer ohne zu lächeln, aber nicht gerade unfreundlich. Dann stahl sich doch der Anflug eines Lachens auf seine hageren Züge. »Ich nehme nicht an, dass du bis zum nächsten Supermarkt mitfahren willst, den ich beliefern muss. Der ist nämlich erst in Erkrath.«
Leicht schwankend, aber immer noch euphorisch vor Erleichterung, ging Toby über die Ladefläche seinem Retter entgegen. »Danke, dass Sie mir geholfen haben!«, sagte er. Aber noch während er die Worte aussprach, warf er einen besorgten Blick zurück Richtung Supermarkt. Der war zum Glück schon außer Sicht, und von den Verfolgern bemerkte er auch keine Spur.
Mit Verständnis im Blick reichte der Fahrer Toby die Hand, damit dieser eine Stütze beim Sprung von der Ladefläche hatte. Der Junge spürte raue und schwielige Haut und die Kraft eines erwachsenen Mannes, der körperliche Arbeit gewohnt war. Dann stand er vor seinem Retter, der ihn um gewiss einen halben Kopf überragte.
Größe! Stärke! Was würde Toby dafür geben, wenn er doch nur so groß und stark sein könnte. Kein Wunder, dass der Anführer der fünfköpfigen Bande sich von dem Fahrer des Lieferwagens hatte einschüchtern lassen. Toby hatte die Szene zwar nicht gesehen, aber gehört.
»Schon gut, Junge!«, antwortete der Fahrer, gab Toby dabei einen leichten Klaps gegen die Schulter, der den Jungen dennoch ein wenig schwanken ließ, und setzte – nun freundlich lächelnd - noch hinzu: »Glaub aber nicht, dass ich immer da bin, wenn dir diese miesen Typen ans Leder wollen.«
Damit verschloss er den Laderaum, ging zum Führerhaus seines Wagens, setzte sich ans Steuer und fuhr davon. Toby blieb einen kleinen Moment auf dem Bürgersteig stehen, inmitten des Gewühles der Großstadt, und sah ihm hinterher. Dann hielt er aber auch schon wieder nach eventuellen Verfolgern Ausschau, stellte fest, dass er im Augenblick in Sicherheit war und machte sich zu Fuß auf den Heimweg durch den Düsseldorfer Stadtteil Bilk.
Er beschleunigte sehr bald seine Schritte. Nicht nur wegen der Möglichkeit, dass er wieder mit anderen Jugendlichen Ärger bekommen könnte, sondern auch, weil der Himmel Regen verhieß. Bald verflog die Euphorie, die er seit dem Entkommen vor der Bande empfunden hatte, und seine Stimmung wurde so trüb wie das Wetter. Er passierte eilig eine graue Betonwand, die über und über mit Graffiti beschmiert war. Er ging an Häusern vorbei, die bereits über hundert Jahre auf dem Buckel hatten, und aus deren Kellerlöchern es manchmal unangenehm roch. Diese alten Buden standen einträchtig neben modernen Häusern, die erst in den letzten Jahren gebaut worden waren oder neben Mietskasernen aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. An den Zweigen der wenigen Bäume, die sich hier befanden, waren die ersten Knospen zu sehen, das zaghafte Versprechen, dass der Winter bald vorbei sein und der Frühling Licht und mildere Temperaturen bringen könnte.
Toby wohnte nicht weit von dem Gymnasium entfernt, das er besuchte. Er benötigte normalerweise nicht mehr als zehn bis zwölf Minuten für die Distanz. Heute war sie aufgrund der erzwungenen Fahrt im Lieferwagen etwas länger, aber das nahm er gerne in Kauf.
Sie hatten mal wieder vor dem Ausgang seiner Schule gelauert. Fünf Jungen, eigentlich nicht viel älter als er, aber kräftiger, sportlicher, und aggressiv! Diese Typen wussten aus Erfahrung, wie man sich schlug. Toby kannte ihre Namen nicht, aber er kannte ihre Gesichter. Der Anführer hatte brutale Gesichtszüge und weit abstehende Ohren, so dass er in Tobys Sprache, die er nur für seine eigenen Gedanken verwendete, von Anfang an den Spitznamen Segelohr trug. Zwei weitere stammten auf jeden Fall aus Familien, die einst als Gastarbeiter aus südlicheren Gefilden, vielleicht der Türkei oder einem arabischen Land, eingewandert waren. Ein weiterer sprach mit Ostakzent, der fünfte mochte wie Segelohr aus einer Ur-Düsseldorfer Familie stammen. Eins hatten sie gemeinsam: Sie mochten keine »Bubis vom Gymnasium«, wie sie stets betonten. Und so hielten sie immer wieder Ausschau nach Jungen wie Toby, die einzeln waren, schmächtiger, sich nicht wehren konnten. Und diese Jungen verprügelten sie, und wenn sie Wertvolles bei ihnen fanden, nahmen sie es ihnen ab. Toby war eigentlich eher selten ihr Opfer, da er keine trendigen Klamotten trug, kein Smartphone oder Handy besaß, selten Geld mit sich führte. Keine Reichtümer, die man stehlen konnte. Deswegen galt er auch in seiner Klasse als Außenseiter. Aber wie auch immer: Als er vor ungefähr einer Viertelstunde die Schule verlassen hatte, lag die Bande bereits vor dem Gebäude auf der Lauer. Als sie Toby bemerkten, war dieses gemeine Grinsen auf den Gesichtern aufgezogen. In dem Augenblick hatte Toby gespürt, wie sich sein Magen verkrampfte: Heute war er dennoch wieder dran!
Eines verstand Toby nicht. Allein in seiner Klasse befanden sich zwei Jungen, die bevorzugte Opfer der Bande waren. Er wusste von mehreren Schülern in den Parallelklassen und unteren Klassen, die dieses Schicksal teilten. Er hatte versucht, eine Allianz zwischen den Betroffenen zu schmieden, denn – und da war sich Toby sehr sicher – gemeinsam konnten sie den fünf Typen trotzen. Eine Gemeinschaft, die von der Kopfzahl her stärker war, würde die Bande vielleicht nicht in die Flucht schlagen können, aber von ihnen unbehelligt bleiben. Wenn sie nur zusammen hielt. Vergebens! Die anderen Schüler hatten sich abgewandt, sobald sie verstanden hatten, was Toby ihnen vorschlagen wollte.
Einmal hatte er sich Hilfe suchend an Schüler der Oberstufe gewandt, junge Männer, die kurz vor dem Abitur standen. Sie hatten ihn ignoriert, belächelt, grob abgewiesen, jedenfalls hatten sie ihm nicht geholfen. Und so war das Verlassen der Schule nach dem Unterricht für Toby immer mit der Aussicht auf Prügel und Demütigung verbunden. Eine Art niemals endender Spießrutenlauf!
Ja, die Demütigung, dachte er. Eigentlich war die noch schlimmer als die schmerzhaften Schläge und Tritte. Vor den Augen der Mitschüler zu Boden gestoßen zu werden, wehrlos, und alle sahen zu. Oder wandten sich schnell ab, heilfroh, nicht selbst das Opfer zu sein. Diese Hilflosigkeit und Schwäche! Dieses Gefühl, dass die anderen stärker und damit besser waren als er. Dass er schwächer und somit minderwertiger war als die Schläger! Diese Beschämung vor den Augen der anderen Schüler. Natürlich auch vor den Mädchen, vor denen er doch lieber groß und gut aussehen wollte. Insbesondere war da Bellinda, das Mädchen mit den langen, blonden Haaren aus der Parallelklasse. Jeder Junge schien sie zu verehren. Sie war immer wieder das Gesprächsthema Nummer Eins. Toby hätte weiß Gott was dafür gegeben, wenn sie sich einmal mit ihm verabreden würde. Oder auch nur öfters mit ihm sprechen würde, zum Beispiel in der Pause oder so. Einmal hatte er sie angesprochen; er hatte versucht, all seinen Mut zusammen zu nehmen und möglichst cool zu wirken. Tatsächlich hatten seine Knie vor Nervosität in den Hosenbeinen gezittert. Die bebenden Hände hatte er vorsichtshalber in den Hosentaschen vergraben. Er fragte sie, wie sie den neuen Mathelehrer finden würde. Nicht sehr originell, aber etwas anderes war ihm nicht eingefallen. Sie hatte nicht geantwortet, ihn nur angelächelt und leise gelacht. Und Toby, der weder einschätzen konnte, was ihr Lachen bedeuten sollte, noch eine Ahnung hatte, was er jetzt noch sagen könnte, war weg gegangen, wobei er etwas Undeutliches vor sich hin murmelte. Dabei – und auch den ganzen Rest des Tages und den nächsten Tag – hatte er sich gewünscht, er hätte sich ihr nie genähert. Er war sich wie ein Idiot vorgekommen. Von da an mied er ihre Umgebung. Und er hatte auch nie das Gefühl gehabt, dass Belinda ihn auch nur registrieren würde. Nun ja: So, wie die Dinge nun einmal waren, war er lieber froh, wenn sie ihn tatsächlich nicht sah. Vor allem dann nicht, wenn er mal wieder für die Prügel reif war.
Überhaupt: Niemand in der Schule sagte es in klaren Worten, aber Toby hatte diese Lektion schon längst begriffen. Es gab immer einige wenige Jungen, die in die Rolle des Opfers und des Außenseiters gedrängt wurden. Und dieser Gruppe gehörte er auch an. Keine trendigen Klamotten, keine teuren Smartphones, kein sonstiger technischer Firlefanz, der ihm in der Gruppe Bedeutung verlieh. Aber immer wieder Erniedrigung durch die Schläger, denen er bestenfalls durch eine Flucht Hals über Kopf entgehen konnte! Seht doch, da rennt Toby Decker mal wieder um sein Leben, diese doofe Pfeife!
Toby hasste die Bande. Er hasste auch die Mitschüler, die ihm nicht halfen. Toby hasste seine Schwäche, die ihn in diese Rolle zwang. Er hasste sein Außenseitertum. Er hasste sein Leben und sich selbst ganz besonders. Er beneidete die Starken, die die Besten im Sport waren, die Klugen, die die besten Noten schrieben, die zum Klassensprecher gewählt wurden, die von den Mädchen angehimmelt wurden, die, die stets im Mittelpunkt standen und um deren Gesellschaft sich jeder riss. Traurig, aber gefasst, öffnete er die Tür des schäbigen Mietshauses, in dem er mit seiner Mutter und seinem Stiefvater wohnte.
Er stapfte missmutig die Stufen nach oben. Von irgendwo hörte er einen zu laut eingestellten Fernseher. Es roch nicht besonders gut im Treppenhaus. Toby zog den Schlüssel zur Wohnung aus der Tasche und öffnete die Tür. Ein wohlbekannter Duft schlug ihm entgegen. Seine Mutter kochte – wie so oft – Spaghetti Bolognese. Hackfleisch war häufig im Sonderangebot, und Nudeln eines No-Name-Herstellers waren immer preiswert zu kaufen.
Toby warf die Tür leise ins Schloss und legte die Schultasche neben der Garderobe auf den Boden. Die Garderobe war eigentlich für den winzigen, fensterlosen Flur zu groß und machte den Eingangsbereich noch kleiner. Er hängte seine Jacke auf und betrat die Küche. Seine Mutter stand am Herd und sah ihm freundlich lächelnd entgegen. Dabei rührte sie abwechselnd in zwei Töpfen. Tobys Nase hatte ihn nicht betrogen.
»Hallo, Toby, wie war die Schule?«, fragte sie leise und mit Wärme in der Stimme. Sie nannte ihn stets Toby. Tobias sagte sie nur, wenn sie auf ihn böse war. Das kam zum Glück sehr selten vor.
Toby setzte sich an den kleinen Küchentisch in dem knapp bemessenen Raum. »Geht so!«, antwortete er einsilbig.
Sie trat näher und strich ihm zärtlich über den Kopf. »Du wirkst so niedergeschlagen. Hast du Ärger gehabt?«
Der Junge hätte am liebsten die Hand der Mutter weg geschoben, wusste aber, dass sie ihn dann nur noch mehr mit Fragen gelöchert hätte. Außerdem wollte er ihre Gefühle nicht verletzen. Denn das hätte seine ablehnende Reaktion auf ihre Zuneigung bewirkt, das wusste er auch. Sie hätte nie verstanden, dass ihre Zuwendung in dieser Stimmung das Letzte war, was er brauchen konnte. Seht doch, Toby Decker, das Muttersöhnchen! Ei, wie süß! Toby schüttelte als Antwort nur den Kopf.
Das Mittagessen war wenige Minuten später fertig. Mutter und Sohn saßen schweigend zusammen und aßen. Toby dachte darüber nach, dass seine Mutter der einzige Mensch auf Erden war, der etwas für ihn übrig hatte. Und deshalb war sie ihm auch lieb und teuer, wenn er auch immer – und vor allem jetzt - ein großer und erwachsener Mann sein wollte, der eigentlich keine Mutter brauchte.
Mit seinen vierzehn Jahren hatte Toby schon eine recht genaue Vorstellung davon, dass auch seiner Mutter das Leben übel mitgespielt hatte. An seinen leiblichen Vater hatte er nur eine schemenhaft Erinnerung, so früh war er gestorben. Es war seltsam, aber je mehr Energie er aufwandte, um sich das Bild dieses Mannes vor Augen zu rufen, desto mehr entzog es sich seinem Zugriff und verschwand in der Ferne der frühen Kindheit. Aber an die Tränen der Mutter über den Verlust, an ihre Verzweiflung konnte er sich gut erinnern, denn das hatte sich in seine Seele fest eingebrannt.
Er wusste noch, dass sie eine Zeit lang bei Verwandten gewohnt hatten. Damals war er noch zu sehr Kind gewesen, um zu spüren, dass sie beide dort mehr geduldet als willkommen waren. Seine Mutter hatte ihm das in späteren Tagen zur Erklärung erzählt, wenn er fragte, warum sie noch einmal geheiratet hatte. Denn unter seinem Stiefvater litt Toby; der Kerl zeigte nur zu deutlich, dass er den Sohn eines anderen Mannes ablehnte. Er hatte eben vor der Wahl gestanden, auf eine hübsche, dunkelhaarige Frau zu verzichten oder sie mit Sohn zu nehmen. Toby wünschte sich stets, er hätte sich für Ersteres entschieden.
Aber die zweite Ehe war auch für die Mutter nicht das Richtige. Sie wurde verhärmt, denn sie ärgerte sich oft über den Mann, den sie etwas überstürzt geheiratet hatte. Er hatte gut genug verdient, um ihr ein Leben versprechen zu können, das sie aus der Abhängigkeit der Verwandten befreite. Sie musste aber nur zu schnell feststellen, dass sie die eine Abhängigkeit gegen eine andere aufgab. Der neue Familienvorstand war ein egoistischer und selbstgefälliger Tyrann. Er allein bestimmte, wofür das Einkommen ausgegeben wurde. Und obwohl es vermutlich Männer gab, die weniger Geld nach Hause brachten und dennoch damit eine Familie versorgten, begann seine Mutter vormittags zu arbeiten, sobald sie verantworten konnte, dass sie vor ihrem Sohn die Wohnung verließ. Toby hatte keine Ahnung, wie genau jeden Monat das Geld ausgegeben wurde, aber für ihn fiel garantiert nicht der größte Teil ab. Er trug die billigsten Jeans und Sportschuhe. Dinge, die seine Klassenkameraden hatten und über die sie sprachen, besaß er nicht. Er hatte keinen Computer, keine Playstation, konnte sich keine Kinobesuche leisten oder CDs kaufen. Auch die Kleidung seiner Mutter war eher zweckmäßig als modisch und schick. Er konnte sich an eine Bemerkung seiner Mutter erinnern, die er allerdings nicht verstanden hatte. Oder besser gesagt, nicht hatte verstehen wollen. Sie argwöhnte, dass ihr Mann ab und zu »in gewissen Häusern« den großen Herrn spiele.
Jedenfalls war die nicht besonders große Mietwohnung sein Zuhause, in der er ein kleines Zimmer hatte. Das ganze Haus war hellhörig. Ab und zu gab es in der Wohnung über ihnen handfesten Krach. Dann konnte Toby Wort für Wort mithören, was man sich ein Stockwerk höher gegenseitig an den Kopf warf, zumindest dann, wenn am lautesten geschrieen wurde. In der Wohnung gegenüber wohnte ein junges Pärchen ohne Trauschein zusammen; das wusste er, weil sein Stiefvater darüber immer wieder abfällige Bemerkungen machte. Dennoch hatte Toby den Eindruck, dass sein Stiefvater die junge Frau besonders freundlich grüßte, wenn er ihr im Treppenhaus begegnete. Sein Gruß wurde allerdings immer nur ziemlich spröde erwidert. Ihren Freund nahm der Stiefvater nicht zur Kenntnis. Die zu laute Musik, die manchmal aus der Wohnung gegenüber zu hören war, ergrimmte ihn jedes Mal, aber darüber sagte er der Nachbarin nie auch nur ein Wort.
Nach dem Essen half Toby seiner Mutter beim Abspülen. Dabei dachte er daran, dass er einmal gesehen hatte, wie er gerne leben würde. Zu Beginn des vorigen Schuljahres hatte er einen neuen Mitschüler bekommen. Der Junge war mit seinen Eltern von Hamburg nach Düsseldorf gezogen. Er hatte einen etwas ulkigen Familiennamen, er hieß Pinnekröger. Das Gelächter war wirklich rekordverdächtig gewesen, als der Name des Jungen zum ersten Mal fiel. Daraus wurde im Nu »Pinkelkröger« und danach »Pinkelkrug« gemacht. Bereits vierundzwanzig Stunden später war der Junge umgetauft in Nachttopf und Kammerpott. Deshalb war der Junge aus Hamburg anfangs einer der Außenseiter gewesen. So hatte er sich mit Toby angefreundet, denn der lachte nicht über den neuen Jungen. Es dauerte nicht lange und der Neue lud Toby zu sich nach Hause ein.
Toby hatte damals erstaunt festgestellt, dass ein altes Haus nicht unbedingt ein schmutziges und abgewohntes Haus sein musste. Die Pinne-krögers bewohnten eine Villa aus der Gründerzeit auf dem Kaiser-Friedrich-Ring in Oberkassel. Von den vorderen Fenstern blickte man auf den Rhein und die gegenüber liegende Altstadt, nach hinten in einen gepflegten Garten. Die Räume waren groß gewesen und edel möbliert. Alle Oberflächen glänzten, eine Frau in einem schwarzen Röckchen und einer weißen Schürze darüber rannte ständig mit Putzutensilien herum und polierte. Was hatte der Mitschüler doch gelacht, als er sie Frau Pinnekröger nannte, denn er dachte, es handele sich um dessen Mutter. Toby wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass im Hause des neuen Mitschülers Bedienstete für alles sorgten, was so getan werden musste. Köchin und Haushälterin, Putzfrau, Gärtner …
Das Beste aber waren die Zimmer des Jungen gewesen! Jawohl, die Zimmer, denn er hatte nicht nur eines. Er bewohnte allein das gesamte Dachgeschoss der Villa. Sie hatten vor seinem Fernseher gesessen – er hatte einen Fernseher ganz für sich allein – und hatten Videospiele gespielt. Toby war beeindruckt gewesen, mit welcher Geschicklichkeit der Mitschüler feindliche Krieger besiegte. Mal mit dem Schwert, mal mit Schusswaffen, mal mit den Fäusten, je nach Spiel. Unfassbar, was der Junge alles besaß!
Er hatte noch etwas, was Toby nicht hatte. Aufgrund des Reichtums seiner Eltern hatte der junge Pinnekröger die Chance, alsbald in der allgemeinen Achtung zu steigen. Er lud bald auch andere Klassenkameraden ein und gab sich in finanzieller Hinsicht großzügig. Und dann sickerte so langsam durch, dass der Vater Pinnekröger in einer der größten Düsseldorfer Firmen der neue Topmanager war. Von da an dauerte es nicht mehr lange, bis der Junge aus Hamburg zu den angesagtesten Leuten in der Klasse gehörte. Genauso schnell war Toby aus dem Kreis seiner Freunde verschwunden.
Nach dem Abspülen widmete sich Toby am Küchentisch den Schulaufgaben. In seinem Zimmer befanden sich weder ein Tisch noch ein Schreibtisch. Dafür war der Raum zu klein. Eigentlich hatte er im Augenblick keine Lust, diese Pflicht zu erledigen, aber er wusste, dass ihm keine andere Wahl blieb. Schließlich war abzusehen, wann sein Stiefvater nach Hause kam. Er arbeitete in einem Lager als Verwalter und machte für gewöhnlich um vier Uhr Feierabend. Meistens war er dann um halb fünf in der Wohnung angelangt. Wenn dann Toby die Hausaufgaben noch nicht erledigt hatte, gab es als erstes einen Vortrag, dass Toby faul sei und der Schule nicht würdig, auf die ihn sein ach so großzügiger Stiefvater schickte. Zweitens gab er dann vor, Toby helfen zu wollen. Tatsache war aber, dass die Bildung des Mannes bei weitem nicht ausreichte, als dass er hätte verstehen können, was Toby in Naturwissenschaften und Mathematik lernte. Fremdsprachen beherrschte er ohnehin nicht. Also war die »Hilfe« nichts anderes als ärgerliche Zeitverschwendung, die den Aufwand für die Schularbeiten nur erhöhte.
Toby hatte die schriftlichen Arbeiten eben erledigt, da hörte er, wie die Wohnungstür geöffnet wurde. Der gnädige Herr des Hauses kehrte heim! Toby seufzte und beschloss, für Erdkunde in seinem Zimmer zu lernen. Dazu musste er nur im Lehrbuch nachlesen, was in den folgenden Seiten über Nordamerika stand.
»Ich bin zu Hause«, hörte er eine laute und etwas zu selbstbewusste Stimme rufen. Die Küchentür wurde geöffnet. Ein Mann von einem Meter neunzig Größe erschien im Türrahmen, mit deutlichem Bauchansatz und dunkelblonden, zurück gekämmten Haaren, die über der Stirn ziemlich dünn waren. Sein Stiefvater hatte irgendwo mal den Satz »Männer mit Stirnglatze sind Denker« gehört. Seitdem gab er diese Binsenweisheit immer wieder breit grinsend zum Besten.
»Mutter ist im Wohnzimmer«, brauchte Toby nur zu sagen, und der Mann drehte sich um. Da erschien jedoch seine Mutter im Flur, um ihren Mann zu begrüßen. Er küsste sie flüchtig, sie erwiderte den Kuss auf die gleiche Weise. Dann sah Toby, wie er ihr ungeniert an den Busen fasste. Seine Mutter schob die Hand weg und raunte dem Mann in ärgerlichem Ton ein paar Worte zu, die Toby nicht verstand. Er senkte rasch den Blick.
»Was gibt´s denn Gutes zum Abendessen?«, fragte Paul, der Stiefvater, lauter als notwendig.
»Von heute Mittag sind noch Nudeln und Soße übrig«, antwortete die Mutter.
»Sag mal, Nora, ist das alles, was du kochen kannst?«, fragte Paul mit einem Anflug von Verdrossenheit.
Nora Decker zog ob dieses Vorwurfs gleichfalls eine verärgerte Miene. »Ich kann nur so gut kochen, wie es die Haushaltskasse hergibt.«
Damit war das Thema beendet. Sobald es um die Finanzen ging, versuchte sein Stiefvater das Gespräch immer in eine andere Richtung zu lenken. Das kannte Toby nur zu gut. Er vermutete, dass seine Mutter Recht hatte, wenn sie glaubte, dass ihr Mann an einem falschen Ort das Geld mit vollen Händen ausgab. Er ließ sich schwer und wichtig am Küchentisch nieder. Im gleichen Moment raffte Toby seine Schulsachen zusammen und stand auf.
»Hausaufgaben fertig?«, wollte Paul wissen.
Toby nickte nur. Das schien dem Stiefvater zu knapp zu sein. Einen Moment lang überlegte er, welche Frage er nachschießen könnte. »Welche Klassenarbeiten hast du in letzter Zeit geschrieben?«, wollte er dann wissen.
»Mathe und Englisch«, antwortete Toby, der leider die Küche noch nicht hatte verlassen können.
»Welche Noten?«, bohrte Paul weiter nach.
»Mathe `ne drei«, sagte Toby, ohne den Mann anzusehen. »Englisch ist noch nicht zurück.«
Paul schüttelte den Kopf und sah dabei an die Zimmerdecke. Er schien in Stimmung für einen Vortrag zu sein. Vielleicht kam es ihm auch nur darauf an, vom Thema Haushaltsgeld und sonstige Finanzen abzulenken. »Heute hat bei uns ein Neuer im Lager angefangen. Ein Junge von achtzehn Jahren. Kein Abschlusszeugnis, nichts gelernt. Dabei ist der Kerl auch noch so doof wie Stroh. Nur stark ist er. Und eine große Klappe hat er. Der wird nicht lange bei uns bleiben, das hab ich gewusst, als ich den das erste Mal heute Morgen gesehen hab.«
Also wieder diese Tour! Toby verdrehte innerlich die Augen, traute sich aber nicht, die Küche zu verlassen, bevor sein Stiefvater fertig war.
»Überhaupt wird der es im Leben nicht weit bringen.« Paul gefiel sich offenbar in seinem Monolog. Er hörte sich immer gern reden. »Jedenfalls hat der heute schon einige dicke Fehler gemacht. Von Entschuldigung keine Spur, aber mit einem Kollegen, der schon jahrelang zuverlässig arbeitet, Krach anzufangen, das hat er geschafft.«
Toby vermutete, dass es sich bei diesem Kollegen um jemanden handelte, der vor seinem Stiefvater kroch und ab und zu mit ihm abends in die Kneipe ging.
»Eine Niete eben, dieser Kerl. Ich sehe schon kommen, dass du auch eines Tages Hilfsarbeiter wirst. So eine Niete wie der. In Mathe eine drei! Wenn du mal etwas erreichen willst, dann musst du besser werden. Erheblich besser!«
Nun schaltete sich die Mutter ein. »Eine drei in Mathematik ist gar nicht so schlecht, außerdem ist die Arbeit sowieso schlecht ausgefallen. Und wenn er mal einen Beruf erlernt, der mit Mathematik nichts zu tun hat, spielt die Note ohnehin keine Rolle.«
Aber Paul war noch nicht am Ende. »Und wie steht´s mit den Fremdsprachen?«
Toby kannte seinen Notenschnitt auswendig. »Englisch zwei plus, Französisch zwei minus.«
Achselzucken, dann ein großzügiges Abwinken. »Na ja, immerhin. Dann sieh zu, dass du später beruflich irgendetwas mit Sprachen anstellst.«
Das war´s. Toby war entlassen. Der Stiefvater kümmerte sich um sein Abendessen. Toby ging in sein Zimmer, das mit seinem Bett, einem Kleiderschrank, einem kleinen Sofa und einer Kommode fast ausgefüllt war. Alle Möbelstücke waren alt und abgenutzt. In der Mitte war noch so viel Platz, dass drei Menschen bequem hätten stehen können. Er ließ sich mit seinem Geographiebuch auf das Sofa plumpsen. Bevor er es aufschlug und zu lesen begann, war er einen Augenblick lang versucht, bereits jetzt durch die magische Tür zu treten, wie er es nannte. Aber nein, es war dafür noch zu früh. Er musste erst sicher sein, dass niemand in sein Zimmer kommen und ihn stören würde.
Der Spätnachmittag wurde zum Abend. Toby aß noch eine Schnitte Brot mit Wurst, dann gesellte er sich zu seinen Eltern ins Wohnzimmer, denn er wollte im dritten Programm den Tatort ansehen. Der war zwar eine Wiederholung, aber er mochte die Filme mit den Kommissaren Ballauf und Schenk von der Kölner Kripo. Zum Glück mochte auch Paul Kriminalfilme, sonst hätte er unter Umständen ein anderes Programm eingeschaltet. Tobys Wünsche wären dann einfach überhört worden. Wenn er seine Lieblingsfilme sehen wollte – Kung Fu-Filme mit Jackie Chan oder Bruce Lee – mussten auf den anderen Kanälen total langweilige Sachen laufen, sonst hatte er das Nachsehen.
Schließlich wurde es Zeit für die Bettruhe. Wieder in seinem kleinen Zimmer wartete Toby ungeduldig, bis in die Wohnung einigermaßen Stille eingekehrt war. Richtig still war es in diesem Haus allerdings erst spät nachts, manchmal auch nie. Aber schließlich näherte sich der rechte Zeitpunkt. Toby entspannte sich, konzentrierte sich dann, sammelte seine innere Kraft. Die Tür zu durchschreiten war nicht einfach, obwohl er es oft tat. Fast jede Nacht. Denn dann begann sein wirkliches Leben. Er schloss die Augen, öffnete dafür seinen inneren Blick.
Jetzt war es soweit!
Die Umrisse der magischen Tür schwebten plötzlich in der Dunkelheit, ihre Konturen waren aus Feuer, das auch über das Türblatt und den Rahmen leckte. Das war nun der Moment, da er jedes Mal seinen gesamten Mut zusammen nehmen musste und seine ganze Kraft. Mit dem Fuß stieß er das Türblatt auf, und als sie langsam und brennend aufschwang, sprang er durch den Rahmen der Tür in jene andere Welt, …
Zhaos Gegenwelt
… und während des Sprungs verwandelte er sich. Er war nicht länger Toby, nun war er Zhao. Zhao, der Kämpfer!
Endlich! Endlich war er zurück in seiner Welt. In der Welt, die für ihn das einzig lohnende Leben bereithielt. Er sah nicht zurück, er sah sich nur um. Es war dunkel. Es war immer dunkel in Zhaos Welt, weshalb das so war, wusste er nicht. Es spielte auch keine Rolle. Immerhin gab es genug Fackeln, Laternen, Lampions und gusseiserne Becken mit glühender Holzkohle, die das Gewirr der kleinen Straßen und Gassen beleuchteten und in ein ungewisses Zwielicht tauchten. Und dann war da ja auch noch das Lichts des Vollmondes. In Zhaos Welt war der Mond immer voll.
Dieses Gewirr aus Sträßchen, Gassen und Gässchen war bevölkert von einer unübersehbaren Menschenschar. Viele waren klein und zart gebaut, trugen dunkle Kittel und Hosen und runde Hüte aus Reisstroh. Andere waren in prächtige Gewänder aus Seide gehüllt und trugen schwarze Hüte, die aussahen wie Kästen oder Würfel. Die Armen gingen zu Fuß, die meisten Reichen ebenso, aber sie hatten eine Leibwache aus grimmig blickenden Söldnern um sich herum. Die ganz Reichen ließen sich in Sänften tragen, die von Kriegern umringt waren. Die trugen Rüstungen aus Bambus und Leder, lange und gebogene Schwerter, Lanzen und Pfeil und Bogen. Das waren die sichtbaren Waffen, aber Zhao wusste auch um die Existenz der unsichtbaren Waffen. Die waren gefährlicher. Und über diese Waffen verfügte auch er selbst.
Aber es gab auch exotischere Gestalten. Da waren die Wilden aus den Steppen des Nordens. Sie ritten auf ihren struppigen, kleinen Ponys durch die Stadt, in Kleidung aus Fell und Pelz gehüllt. Diese Leute schwitzen fast alle, denn ihre Kleidung war für diese Stadt des Südens viel zu warm. Und es gab die Seeleute, die mit ihren Schiffen den Hafen angelaufen hatten. Manche dieser Männer waren schwarz wie Ebenholz, gekleidet in buntes Tuch. Andere waren hellhäutig und blond oder rothaarig, trugen wollene Hosen und Westen aus Leder. All diese Menschen gingen durch die Gassen, auf der Suche nach Geschäftspartnern oder Partnern für die Weiterreise, auf der Suche nach Essen und Trinken, nach günstigen Einkäufen oder lohnenden Verkäufen, nach Vergnügungen.
Zhao ließ sich mit den Menschen durch die Stadt treiben. Die meisten Gebäude hatten weit überhängende Dächer, die außen leicht nach oben gebogen waren. Er ging an armseligen und elenden Hütten vorbei, an solide gebauten Geschäften, deren Inhaber ihre Waren kunstvoll auf den Veranden dekoriert hatten. Die Paläste der Reichen waren umsäumt von mächtigen Mauern, die sowohl Eindringlinge als auch die lästigen Blicke Neugieriger abhalten sollten. Restaurants lockten mit hell erleuchteten Räumen. Darin sah man Damen, die ihr schwarzes Haar kunstvoll nach oben frisiert trugen. Sie bedienten Menschen, die an niedrigen Tischen auf dem Boden saßen und köstliche Speisen verdrückten. Es gab aber auch üble Spelunken, in deren Inneres man kaum einen Blick werfen konnte. Daraus roch es nach billigem Alkohol und Rauch, der vermutlich von Opium oder anderen Drogen stammte. Zhao ging an dem einen oder anderen Bettler vorbei, für jeden hatte er eine kleine Münze.
Ein Händler sprach ihn an. »Werter Herr, habt doch die Güte und betrachtet meine Spiegel. Sie sind von erlesenster Qualität und doch nicht teuer. Aber seht selbst!« Der Mann hatte einen dünnen Schnurrbart, dessen Enden bis weit über das Kinn reichten. Er zeigte Zhao ein Grinsen voller Goldzähne. Zhao warf einen Blick auf den Spiegel aus poliertem Metall, den der Händler hoch hielt und betrachtete darin sich selbst. Er war groß, schlank und sportlich. Er hatte das markant gut geschnittene Gesicht eines jungen Kämpfers. Seine Kleidung war schlicht und tiefschwarz. Er sah gut aus. Und er war ein Held.
»Eure Spiegel sind wirklich prachtvoll«, antwortete Zhao höflich. »Aber egal, wie günstig sie sind, ich benötige keinen.« Und damit ging er weiter. Er hörte noch, dass der Händler ärgerlich vor sich hin grummelte, aber das kümmerte ihn nicht.
Es war Zeit, die anderen zu finden. Denn in dieser Welt hatte Zhao Freunde. Er traf sie jede Nacht, die er hier verbrachte, und gemeinsam erlebten sie Abenteuer. Wo mochten Weng und Lim sein?
Er bog in eine kleine Seitengasse ab, in der viele Gewürzhändler ihre Läden hatten. Die ausgefallensten Düfte wehten ihm hier um die Nase. Es roch nach Kräutern und Knoblauch, es roch sauer, süß und scharf. Er bemerkte Düfte, für die ihm keine Namen und keine Bezeichnungen einfielen. Jeder Händler rief ihm zu, er möge sein Geschäft betreten und zu ihm kommen, nur er habe die wirklichen guten Waren, die anderen böten nur billigen Schund feil. Während sich die Geschäftsleute so an Eigenlob und Schimpfkanonaden auf die Konkurrenz überboten, entdeckte Zhao seine Freunde. Der vierschrötige Weng, der ein langes, gerades Schwert am Gürtel trug, prüfte den Knoblauch eines Händlers. Der Händler hatte gerade mit einem Messerchen eine Zehe abgeschält und hielt sie Weng unterwürfig hin, dabei grinste er Beifall erheischend. Der schmale und drahtige Lim stand schmunzelnd daneben und sah zu, wie sein kompakt gebauter Freund die Knoblauchzehe entgegen nahm und hinein biss.
»Nun sagt selbst, edler Herr«, sagte der Händler, »das ist der beste und frischeste Knoblauch, den Ihr jemals gekostet habt, stimmt es nicht? Er ist zart und dabei doch so aromatisch.«
Weng kaute mit Genuss, dann fragte er: »Wie viel willst du für drei Knollen haben?«
Der Händler hob drei Finger, behielt jedoch seine unterwürfige Haltung bei. »Nur drei Dong, edler Herr!«
Weng machte ein zufriedenes Gesicht und holte einige Münzen aus einer kleinen Tasche, die an seinem Gürtel hing.
»Macht also im Ganzen neun Dong, edler Herr!«, sagte der Händler, und sein Grinsen wurde noch breiter. »Ein Preis, der wirklich günstig ist.«
Lim begann schallend zu lachen, während Weng erbost die Augenbrauen in die Höhe zog. »Was sagst du da? Ich habe nach dem Preis für drei Knollen zusammen gefragt, da sind drei Dong in Ordnung. Aber das Stück drei Dong, das ist Wucher!«
Die Händler ringsum beeilten sich, Wengs Meinung lautstark zu teilen, überschütteten den Geschäftsmann, bei dessen Laden Zhaos Freunde standen, mit Flüchen und forderten Weng auf, zu ihnen zu kommen.
»Aber, Herr!«, jammerte der Händler, »bei dieser Qualität ist der Preis wahrlich nicht zu hoch. Ich selbst habe mehr oder weniger diesen Preis an den Bauern zahlen müssen, der ihn mir lieferte. Herr, ich kann ihn Euch nicht billiger verkaufen, Ihr ruiniert einen armen Mann.«
»Wenn du deinen Knoblauch nicht günstiger verkaufen kannst, dann behalte ihn.« Entschlossen ging Weng, da er gerade Zhao entdeckt hatte, an dem Händler vorbei. Lim folgte ihm. Beide Männer zeigten ein freundliches Lächeln, als sie auf ihren Freund zugingen. Sie begrüßten sich mit einer Verbeugung, dann schlugen sie sich leicht auf die Schultern.
»Du stinkst!«, sagte Zhao breit grinsend zu Weng. Der zeigte sich durch das Kompliment des Freundes nicht im Geringsten beeindruckt.
»Ach, weißt du«, sagte Weng, »ich habe gehört, dass Knoblauch schlank macht. Wenn ich ein wenig danach rieche, ist mir das egal.«
Die drei lachten herzlich. Dann fragte Zhao: »Was machen wir heute Abend?«
Lim antwortete leise: »Mir wurde zugetragen, dass heute fünf Fremde in der Stadt sind, die nach Ärger aussehen. Ich will ja nicht behaupten, dass diese Straßen und Gassen jemals sicher waren, aber diese fünf Gestalten müssen extrem nach Wut und Zorn riechen.«
»So, schau mal einer an!«, murmelte Zhao. »Und wo sollen sich die befinden?«
»Sie wurden zuletzt im Hafenviertel gesehen«, sagte Lim.
»Dann machen wir uns doch auf den Weg dorthin«, schlug Zhao unternehmungslustig vor.
Er wusste genau, woher Lim seine Informationen bekam. In dieser Stadt gab es viele Bettler, die alle in einer Triade organisiert waren. Sie hielten nicht nur die Hand auf, sondern auch Augen und Ohren. Und ein Mann, der ihnen als spendabel bekannt war, konnte sich darauf verlassen, von diesen Bettlern alles berichtet zu bekommen, was sich in der Stadt zutrug. Die drei Freunde standen mit den Bettlern auf gutem Fuß, da sie immer etwas spendeten, aber vor allem diese Männer nicht herablassend, sondern freundlich behandelten.
Sie näherten sich einer etwas breiteren Straße, die genau so dicht bevölkert war wie die anderen. Plötzlich entstand weiter vor ihnen ein großer Trubel. Die Menschen liefen vor etwas davon oder zur Seite der Straße, suchten Schutz in Hauseingängen, Kneipen und Geschäften. Über das panische Geschrei der flüchtenden Leute hörten sie eine laute und raue Männerstimme rufen:
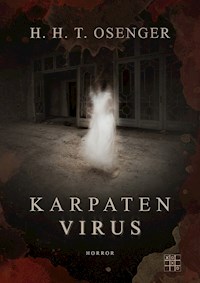













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














